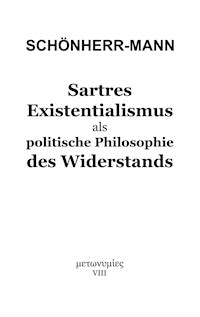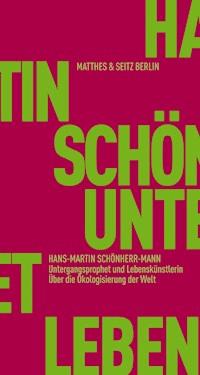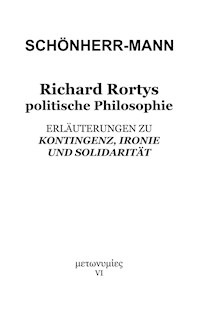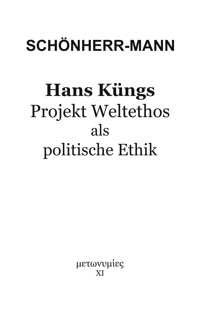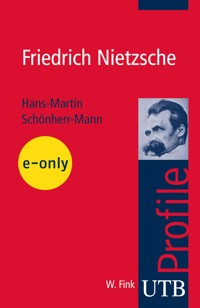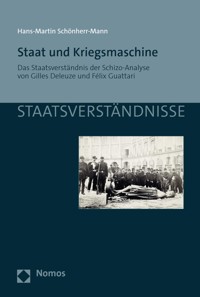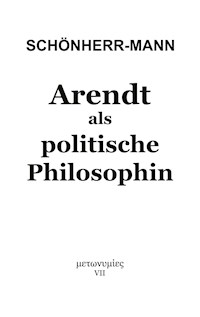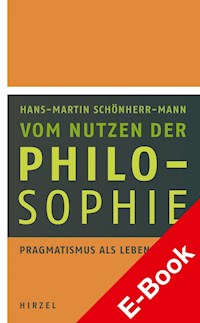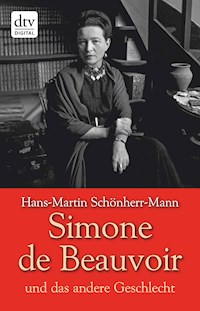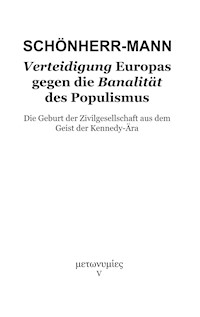
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Titel schließt an "Verteidigung der Freiheit" (1960) von Albert Camus an und an Hannah Arendts großen moralphilosophischen Essay "Eichmann in Jerusalem - Bericht von der Banalität des Bösen (1963). Der Untertitel spiel mit Nietzsches "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik". (1872)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch: Die Europäische Union verkörpert die andere Seite der Zivilgesellschaft. Denn sie entwirft sich als Friedensprojekt, das die kriegerischen Nationalstaaten dekonstruiert. Und durch rechtliche, soziale, ökologische und ökonomische Standards konstituiert sie den Lebensraum ungehorsamer Bürgerinnen, die jenseits der Nationalstaaten ihre Lebensformen individualistisch gestalten. Dabei bringen aktive Bürgerinnen ihre Vorstellungen in die Öffentlichkeit ein. Ohne sie hätte es keine Frauen-, Schwulen- und Lesben-Emanzipation gegeben, keinen Atomausstieg, keine Umweltpolitik, keine Willkommenskultur und keine EU-Rettungspolitik. Auch die Sozialpolitik wurde von mündigen Bürgerinnen herausgefordert trotz eines neoliberalen Kapitalismus, freilich in Kooperation mit der Wirtschaft.
Die Zivilgesellschaft bringt durch außerinstitutionelle politische Partizipation Bottom-up-Prozesse auf den Weg, die nachhaltiger sind als Top-down-Maßnahmen institutioneller Politik. Auf diese Weise intensiviert sich die Gewaltenteilung, was eine von Machiavelli, Hobbes, Weber, Schmitt inspirierte Politik als hierarchisch gelenkte Ordnung erschwert. Dagegen orientiert sich ein kosmopolitischer öko-sozialer Pluralismus an Camus, Arendt, Rorty, Rawls, Foucault, Rancière.
Um sich einmischen zu können, brauchen die mündigen Bürgerinnen vor allem Bildung, nein, keine Ausbildung, sondern philosophische Selbstbildung in Ontologie, Geschichte, Ästhetik der Existenz, Logik, Sozialwissenschaften, Pädagogik, Kommunikationswissenschaften, Informatik. Das ist nicht wenig, aber nötig, wirkt nachhaltig und verleiht Europa und der Zivilgesellschaft neuen Schwung. Das sind Faktizitäten und keine Utopien.
Hans-Martin Schönherr-Mann ist Prof. für Politische Philosophie an der Univ. München, seit 2004 regelmäßiger Gastprof. an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Univ. Innsbruck; Prüfungsbeauftragter an der Hochschule für Politik München; aktuelle Bücher: Michel Foucault als politischer Philosoph, Innsbruck University Press 2018; Involution oder Revolution – Vorlesungen über Medien ‚Bildung und Politik‘ an der Univ. Innsbruck, BoD 2017; Was ist politische Philosophie, Campus Studium 2012; Die Macht der Verantwortung, Karl Alber Ŕ Hinblick 2010; Der Übermensch als Lebenskünstlerin – Nietzsche, Foucault und die Ethik, Matthes & Seitz Berlin; Hannah Arendt – Wahrheit, Macht, Moral, C.H. Beck 2006
Für Irmi
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Populismus als Angriff auf Europa
Populismus als Angriff auf die Zivilgesellschaft
Nichtdiskriminierung als Ethos der Zivilgesellschaft
Involution als politische Partizipation
Involution als Eros der Zivilgesellschaft
Bildung ‚nach Auschwitz‘
Selbstbildung seit 1968 als Wegbereitung der Zivilgesellschaft
Die gebildete Europäerin und der sprachlose Untertan
Das Prinzip der Anteilhabe anstatt sozialer Gleichheit: über Rancière hinaus
Die Philosophie der Zivilgesellschaft: Arendt
Ästhetik und Eros Europas: Rorty
Das zivilgesellschaftliche Europa: Rawls‘ Pluralismus
Ausgewählte Literatur
Personenregister
„Wie viele Male haben wir es im Leben mit ‚offenherzigen’ Leuten zu tun (das heißt solchen, die sich ihrer ‚Offenheit’ rühmen): Gewöhnlich kündigt das Wort eine kleine ‚Aggression’ an: Man nimmt sich die Freiheit, taktlos zu sein (mangelndes Zartgefühl). Schlimmer ist jedoch an der Offenheit, dass sie im allgemeinen das Tor zur Dummheit aufstößt, und zwar sperrangelweit. Mir erscheint es schwierig, dem Satz ‚Ich will offen sein’ etwas andres folgen zu lassen als einen törichten Satz.“
(Roland Barthes, Das Neutrum)
VORWORT
Die Zeiten, als die Revolutionen noch den Weg in eine bessere Zukunft verhießen, sind vorbei. Heute kämpft die Menschheit entweder wieder ums Überleben oder gewisse Gruppen streiten um ein größeres Stück vom verbleibenden Kuchen, der nicht mehr so zu wachsen scheint, wie man das mal dachte. Von einer Lösung der sozialen Frage ist man weiter entfernt denn je, wiewohl in den westlichen entwickelten Ländern diese Frage an Brisanz verloren hat. Im Lager der Populisten – und hier meine ich gleichzeitig auch linke - kehrt das antike Bewusstsein wieder, auf ewig in einer bedrohten Wagenburg zu leben, die ihre Existenz nur durch Aus- und Überfälle gegenüber den Nachbarn sichern und verbessern kann – man denke nur an die deutschen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Wenn es ein politisches Verdienst der monotheistischen Religionen Christentum und Islam gibt, dann diese Mentalität bekämpft zu haben. Saint-Just programmatisch und Marx theoretisch haben den Frieden in die diesseitige Zukunft versetzt. Obwohl weder Christentum, Islam noch Marxismus diesen Frieden verwirklichen konnten, so haben sie doch mit der Idee desselben einem Denken den Weg geebnet, für das der Frieden der Ernstfall ist und nicht der Krieg, für den es sich zu engagieren lohnt. Manche Propheten, Könige und Politiker haben sich darum bemüht, was sich seit der Französischen Revolution verstärkte. Aber sie haben es noch imperial oder theologisch zumeist für ein Reich oder gar die ganze Menschheit probiert. Sie fühlten sich als Anführer, die anderen vorgaben, was sie auszuführen hätten und wurden damit von diesen abhängig, was schon Diderot erkannte.
Als in den späten Sechzigern der Traum von einer umfassende Weltveränderung für viele geplatzt erschien, machten sie sich selbst auf den Weg, die Welt um sich herum humaner zu gestalten und zwar in vielen Bereichen, die ihnen gerade wichtig erschienen. Deshalb waren die Veränderungen so nachhaltig, konnte daraus das entstehen, was man heute Zivilgesellschaft nennt und was die Rechtspopulisten durchgängig hassen. Die Zivilgesellschaft deutet eine Chance an, von jenem Traum von Paulus, Mohammed und Marx ein klein wenig zu realisieren, was schon so viel ist, dass es die etwa 10.000 Jahre alte Kriegergesellschaft gehörig durcheinanderbrachte, stellte bereits während des Vietnamkriegs ein US-General fest, man könne Kriege nicht mehr führen, weil die Familien zu wenige Kinder hätten, so dass der Verlust eines Sohnes eine Katastrophe darstelle, was in den Jahrhunderten zuvor allein schon durch die frühe Sterblichkeit an der Tagesordnung war. Demnächst werden die Populisten daher die fünf-Kind-Ehe fordern.
Wenn sie das nicht durchsetzen können und wenn eventuell die Hoffnung auf mehr Frieden erhalten bleibt, dann wird das voraussichtlich am Widerstand der Zivilgesellschaft liegen und natürlich an der Europäischen Union, die als supranationale Institution die Nationalstaaten schwächt, die für die Kriege der letzten Jahrhunderte verantwortlich zeichnen. Sie gibt dem Frieden eine Heimat und eine bessere kann man momentan in Europa schwerlich haben.
Ob das reicht, Katastrophen zu verhindern und Pasolinis Un sogno di una cosa1 weiter zu träumen, jenen „Traum von einer Sache“2, wie Marx 1843 in einem Brief an Arnold Ruge schreibt, das wird sich zeigen; denn so Hegel „die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.“3 Deswegen behält auch Richard Rorty mit seiner Einsicht recht: „Nicht irgendwelche großen, notwendigen Wahrheiten über die menschliche Natur und ihre Beziehung zu Wahrheit und Gerechtigkeit werden darüber bestimmen, welcher Art unsere zukünftigen Führer sind, sondern allein eine Menge kleiner kontingenter Tatsachen.“4 Und man darf dabei hoffen, dass die Führer weniger werden, sich die Bürgerinnen weniger bevormunden lassen und individuell selber bestimmen, wie sie leben wollen.
Deswegen nähere ich den Begriff der Zivilgesellschaft auch nicht demjenigen der kulturalistischen Linken an, besteht die Zivilgesellschaft längst nicht nur aus linken Bürgerinnen, spielen dabei vielmehr gerade auch die aufgeklärten Religionen eine wichtige Rolle wie auch viele unpolitische Beiträge. Entscheidend dabei ist der Anspruch auf Mündigkeit, der den Untertan hinter sich lässt, während dieser im Populismus wiederkehrt. Die mündige Bürgerin mischt sich in diverse öffentliche Angelegenheiten ein, weil sie das selber für richtig hält, nicht weil ihr das irgendwelche Führer und deren Ideologien eingeben. Solche selbstbewussten Zeitgenossinnen haben angefangen, die Welt nachhaltig zu verändern, und zwar durch Bottom-up-Prozesse, gerade nicht durch Top-down-Prozesse, wie man es sich zumeist von Seiten der Eliten vorstellt. Die Wegbereiter dieser aktiven Bürgerinnen, die die Zivilgesellschaft entwickeln, heißen Anton Schmid, Geschwister Scholl, Wolfgang Abendroth, Albert Camus, ihre Mitstreiter heißen Mick Jagger, Bob Dylan, Ivan Illich, Daniel Ellsberg, Robert Jungk, David McTaggart, Alice Schwarzer, Bradley Manning, Edward Snowden und viele, viele andere, die dazu beigetragen haben, dass sich immer mehr Menschen darum bemühen, die Welt in ihrem Umkreis humaner zu gestalten, ohne gleich die ganze Welt fundamental umkrempeln zu müssen. Sie ziehen den Apokalyptikern den Boden unter den Füßen weg. Wenn die Welt weiter weltet, dann verdanken wir es ihnen und erst recht, wenn sie humaner weltet. Und wenn die Nachfahren der Nazis scheitern, die EU weiter eut, dann wird das an solchen Menschen liegen, die die Zivilgesellschaft wie die EU beseelen.
1Pier Paolo Pasolini, Un sogno die una cosa (1962) Roman, Berlin 1968
2 Karl Marx, Brief an Ruge, September 1843, Deutsch-Französische Jahrbücher, Marx Engels Werke (MEW) Bd. 1, Berlin 1972, 346
3 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820), Theorie Werkausgabe Bd. 7, Frankfurt/M. 1970, Vorrede, 27
4 Richard Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidarität (1989), Frankfurt/M. 1992, 304
EINLEITUNG
Verglichen mit Nationalismus und Rechtspopulismus als ähnlich antidemokratischen Richtungen geht vom Islamismus in der westlichen Welt die erheblich geringere Gefahr aus für die Demokratie und Europa. Auch der Terrorismus wird speziell in Deutschland von Rechts viel intensiver betrieben als von Islamisten. Fast täglich finden Übergriffe und Anschläge auf Ausländer statt oder Funktionsträger werden bedroht und angegriffen – man denke an Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker –, haben 2016 ca. 700 Angriffe allein auf politische Funktionsträger und Journalisten stattgefunden – darunter auch zahlreiche gewalttätige. Nicht nur, dass rechte Straßenkrawalle wie 2018 in Chemnitz an der Tagesordnung sind verbunden mit Diskriminierungen aller Art. Dabei werden Menschen mit Migrationshintergrund und Andersdenkende tätlich angegriffen, was nicht selten in Hetzjagden ausartet, auch wenn das führende Vertreter des bundesrepublikanischen Inlandsgeheimdienstes nicht gerne hören, war dieser aber bereits bei der jahrelangen Terrorserie von in der Zwischenzeit wohlbekannten Jenenser Neonazis blind, taub, unfähig oder klammheimlich sympathisierend – man denke nur an den damaligen Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten, der in rechtsradikalen Blätter publizierte.
Dorn im Auge von Populisten ist dabei die Zivilgesellschaft, auf der das europäische Projekt der Demokratie längst ruht, damit Rot-Grün, die Willkommenskultur, die Emanzipation von Frauen, Lesben und Schwulen, in den USA besonders die Kennedy-Ära und die Emanzipation der Farbigen, in Europa die Emanzipation der Migranten als vielleicht das zentrale Feindbild. Interessanterweise ist die aus diesen Entwicklungen hervorgegangene Zivilgesellschaft auch der westliche Hauptfeind der Islamisten was sie mit ihren Attentaten auf die Redaktion von Charlie Hebdo und am 13. November 2015 in Paris insbesondere auf das Bataclan sowie auf Bars und Cafés just an einem Freitagabend bewiesen (Saturday Night Fever, USA 1977), wenn die hedonistische und sexualisierte Zivilgesellschaft feiert und dem Gebrauch der Lüste huldigt. Die Parallelgesellschaften der Populisten waren mit diesen Anschlägen nicht gemeint. Dagegen sollte der 11. September noch das Herz der westlichen Welt insgesamt treffen, was symbol-ökonomisch auch gelang, nicht aber politisch, richtete der Jet im Pentagon keinen derart medialen Schaden an, während der andere Jet das Weiße Haus gar nicht erreichte. Primär ist der Islamismus eine Gefahr für die islamische Welt, ist für die Islamisten die überwältigende Mehrheit der gemäßigten Muslime generell der Hauptfeind, d.h. der Islam ist der Hauptfeind der Islamisten – ein Islam, der ähnliche zivilgesellschaftliche Tendenzen entwickelt hat, wie die Arabellion und die diversen Proteste nicht nur in der Türkei zeigen. Die Zivilgesellschaft ist rings um das Mittelmeer nur unterschiedlich stark entwickelt.
Die postmoderne, supranational und global vernetzte Demokratie verwandelt den National- in einen Regionalstaat, macht ihn tendenziell zum Bundesland. Die multikulturelle Zivilgesellschaft verweht mit ihren vielen Minderheiten das ethnisch oder rassisch konstruierte Volk aus dem 19. Jahrhundert, das in deutschen Landen mit den Nazis unterging, wie es deren Anführer explizit wollte, wiewohl er sich das anders vorstellte, bestimmt nicht als Sprachproblem. Die mündige, so hedonistische wie ökologische Bürgerin schüttelt dagegen religiöse, traditionelle, familiäre, ständische oder völkisch-identitäre Untertänigkeit ab. Toleranz, Verantwortung und Stolz heißen ihre Tugenden, nicht Diskriminierung, Gehorsam und Demut als die Kardinaltugenden der Kriegergesellschaft.
Essentialismus und Identitarismus verblassen trotz ihrer Wiederkehr als metaphysische Obsessionen, als große Erzählungen, als unreflektierte Vokabulare und als banale Gedankenlosigkeit. Kein Wunder wenn diese Entwicklungen längst nicht nur aber vor allem Populisten, Nationalisten und Islamisten reizen. In ihren totalitären Neigungen hoffen alle drei noch auf eine völkische oder religiöse Einheit, auf dienende, verantwortungslose Untertanen, auf Frauen als Lustobjekte und unmündige Mütter, den Mann als verantwortungslosen Glaubensoder Volkskrieger, den seine Lust zum Volksvermehren zwingt – also um mit Nietzsche zu sprechen, auf Herdentiere mit Herdenmoral, ohne die die Weltkriege des letzten Jahrhunderts nicht denkbar wären. Das soll Rechtsstaat, Demokratie, Zivilgesellschaft und Mündigkeit wieder und endgültig vernichten.
Kommunisten kooperieren immerhin mit der Zivilgesellschaft, die sie erst unterdrücken, wenn sie an die Macht gekommen sind. Islamisten probierten ein ähnliches Manöver in Algerien in den 1990ern, in Ägypten und Tunesien in der Arabellion. Rechtsradikale unterscheiden sich von rechten Populisten dadurch, dass erstere die Zivilgesellschaft uneingeschränkt bekämpfen, während letztere manchmal so tun, als gehörten ihre Anhänger zur Zivilgesellschaft. Zumindest hätten sie dabei gerne denselben Status. Aber sie wollen das Volk sein, nicht die mündige Bürgerin. Doch die Zivilgesellschaft, die zumindest jeweils gewisse Teile der Bevölkerung lebendig werden lässt, ist nicht das Volk, selbst wenn Occupy jene 99% beschworen hat. Der Ruf, den die Opposition bei Protesten gegen das DDR-Regime benutzte, hatte auch damals einen rechten Beigeschmack und konnte wohl nur im Osten aufkommen, wo man keinerlei Demokratieerfahrungen hatte. Volk und Nation passen beide nicht mal zu einer repräsentativen Demokratie, geschweige denn zu einer zivilgesellschaftlich basierten, also zu einer der vielen Gewaltenteilungen, wie sie Odo Marquard entwirft.
Populisten wie Rechtsradikale, Identitäre etc. befinden sich dagegen in der schwierigen Situation, dass sie gehorsame Untertanen sein möchten, dieses aber nicht zugeben dürfen, dass sie vielmehr behaupten müssen, dass sie freiwillig gehorchen wollen. Sie tragen sogar die Verantwortung für ihren Gehorsam, was letzteren indes konterkariert, gibt es seit Sartre den Gehorsam nicht mehr, mit dem sich Eichmann in Jerusalem noch verteidigen wollte, was ja auch sein Gericht nicht akzeptierte. Bereits die Nürnberger Prozesse nahmen den Kriegsverbrechern ihre Untertänigkeit nicht mehr ab und machten diese für das verantwortlich, was sie taten. Aber die Siegerjustiz hatte damals trotzdem das Recht und die Gerechtigkeit auf ihrer Seite. Daraus ergab sich nach Hannah Arendt ihre Macht, spielte die Gewalt dabei keine Rolle, auf die sie sich stützen konnten. Selbstredend sind die meisten Zeitgenossen in der Bundesrepublik darüber froh, während man bei den Nationalisten die Erinnerungskultur ja um 180 Grad wenden möchte: Abschied von der Republik, zurück in ein Reich und Erinnerung an die Eroberungslust der Weltkriegssoldaten.
Angesichts solcher ethischer Dilemmas hören die Anhänger von Populisten umso bereitwilliger Leuten zu, die sich brüsten, offen zu sein, angebliche Wahrheiten zu sagen, die der Politik die Moral verbieten, so dass verantwortungsloser Gehorsam bzw. Eichmann vor Jerusalem wieder möglich wird, damit morallose Politik wieder Unrechte fernab jeglicher Gerechtigkeit schafft, gerade weil solche Politik Rechte vermeiden will. Nicht durch Zufall gerät die Justiz wie der Journalismus ins Fadenkreuz rechter Politik, nicht nur in Polen, in den USA, in Italien, auch in der Bundesrepublik, behindert gerade der Rechtsstaat eine so rechte- wie gesetzelose Politik.
Wie schon Hannah Arendt bemerkte, sind Tatsachenwahrheiten immer von der Lüge bedroht, muss sich die Wahrheit der Lüge schelten lassen und wenn sich der Bezichtiger der Kommunikation verweigert, dann beharrt er auf seiner Lüge als Wahrheit, was man gemeinhin als Propaganda bezeichnet, was der Propagandist natürlich niemals zugeben würde, den man denn aber nicht als Historiker anerkennt, behauptete er, dass 1914 Belgien und 1939 Polen in Deutschland eingefallen seien.
Mit den Vernunftwahrheiten ist es – so ebenfalls Arendt – nicht so einfach. Aber selbst die Logik wird in Frage gestellt. Gewisse Aprioris haben es auch nicht viel leichter. Sie werden ignoriert. Denn es ist eine Tatsache des Bewusstseins, die Sartre diagnostizierte, dass der Mensch frei und verantwortlich ist. Ungeschickt daher für Nationalisten, Islamisten und deren Anhänger, dass auch die Untertanen frei sind, dass sie für ihre Taten alleine verantwortlich zeichnen, was umso tragischer für religiöse Fundamentalisten ausläuft, die Freiheit und Notwendigkeit ineinander fallen lassen müssen, was nur noch mit dem Mantel der Absolutheit vermeintlich logisch kaschiert werden soll, sich aber gleichzeitig als Widersinn entlarvt.
Islamisten haben keine Chance, die westlichen postmodernen Gesellschaften aus den Angeln zu heben, schaffen sie das ja nicht mal in islamischen Ländern – man denke wiederum an Algerien, Ägypten und Tunesien. Nationalisten und Rechtspopulisten sind dagegen viel gefährlicher. Denn sie regieren längst nicht mehr nur an den Rändern Westeuropas: in der Türkei, in Russland, in Polen, Ungarn, sondern in den Kernländern des Westens, nämlich in Großbritannien, den USA, Italien und Österreich.
Daher geht es heute darum, die mündige Bürgerin, die Zivilgesellschaft und die Europäische Union gegen ihre Feinde zu verteidigen, stellen alle drei – auch letztere, mag es verwundern – jene Errungenschaften dar, die autoritäre Führungsstrukturen, die Vaterländer und die völkischen Bevölkerungen auflösen, und damit den Untertan – Eichmann in Jerusalem –, den Vater – das Mutterkreuz oder die ‚deutsche Familie„ – und den Terror – Eichmann vor Jerusalem – überwinden, um an deren Stelle die Mündigkeit der Bürgerin, die Freundschaft und das Gespräch zu setzen. Daraus entwickeln sich die Verantwortung für den Anderen, den Fremden, die multikulturelle Zivilgesellschaft und die pluralistischen Institutionen Europas – ein Projekt, bei dem am Ende die Friedens- und die Freiheitsperspektive doch zusammenfallen, jedenfalls für das Individuum und die Zivilgesellschaft. Und wer soll die zivilgesellschaftlich errungene Freiheit schützen, wenn nicht diese selbst und die Europäische Union – man denke an Ungarn, Polen und die Türkei – wiewohl die EU das nicht mit Gewalt erreichen kann, sondern auf einem langsamen, kommunikativen und vermittelnden Weg, der auch der Weg der Zivilgesellschaft ist, wenn die Bürgerinnen langsam von unten die Welt verändern, nicht autoritär von oben und gewaltsam, was ja erfahrungsgemäß inhuman ausläuft und notorisch scheitert.
POPULISMUS ALS ANGRIFF AUF EUROPA
Lange hat es indes gar nicht so ausgesehen, dass die Europäische Union nicht nur ein Friedensprojekt ist, das die Nationalstaaten entmachtet und zivilgesellschaftliche Spielräume für mündige Bürgerinnen entwickelt. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft besaß primär einen ökonomischen Sinn und der politische Sinn der Europäischen Union verdankte sich der Bedrohung durch die Sowjetunion während des kalten Krieges. Wiewohl der europäische Einigungsprozess auch eine versöhnende Hoffnung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik hatte – die sich glücklicherweise nicht nur etatistisch, sondern vor allem zwischen Bürgerinnen erfüllte –, bleiben vor diesem Hintergrund Erklärungen blass, diese Entwicklung habe einen originär friedensstiftenden Zweck, den man nur umso häufiger beschwört, je länger der Ost-West-Konflikt zurückliegt, in dem sich die West-Europäer schwach fühlten. Frankreich brauchte Westdeutschland als europäisches Bollwerk gegen den Kommunismus und die junge Republik brauchte dringend europäische Freunde, von denen man hoffte, diese würden ihren Bürgern deren Verbrechen verzeihen, die sie in diesen Ländern und gegen jedermann begangen hatten – und die Täter liefen in diesem Nachkriegsdeutschland frei herum, und zwar auch noch in Ehren.
Trotzdem, jetzt, erst jetzt, lange nach dem Ende des kalten Krieges gewinnt die Europäische Union ihre friedenserhaltende Funktion im Innern, just jetzt, wenn man sie nicht mehr als Bollwerk braucht, jetzt, wenn sie ihren Sinn aus sich selbst heraus entwickeln muss.
Man stelle sich nur für einen kurzen Augenblick vor, dass Populisten in der Bundesrepublik an die Macht kommen und – selbstredend abhängig von der weltpolitischen Lage, die ihre Prioritäten verschieben könnte – erst Königsberg, Danzig, Stettin, dann das ehemalige Sudentenland, Österreich und schließlich Elsass-Lothringen erobern möchten. Dergleichen kann nur eine Zivilgesellschaft verhindern, die sich dann zuallererst auf die Institutionen der Europäischen Union stützen müsste. Es ist nicht mehr der äußere Feind, der die EU nötig macht, es ist der innere Feind Europas: Populisten, Rassisten, Islamophobe, Nationalisten besonders in den Reihen der englischen Konservativen – die Unterschiede zwischen ihnen sind graduell – und am Ende auch Islamisten, aber diese höchstens en passant. Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung schildert mit einer Machtübernahme der Islamisten in Frankreich dabei das abwegigste Szenario. Die Machtübernahme von Populisten ist viel wahrscheinlicher und viel gefährlicher für die westliche zivilgesellschaftliche Lebensart – man denke nur an das Abtreibungsverbot in Polen. Irland dagegen entledigte sich gerade der Bevormundung durch einen traditionalistischen Katholizismus.
Auch die Behauptung, man könne die Globalisierung nur gesamteuropäisch bestehen, klingt als eine ähnliche Ausrede wie jene, die EU sei von vornherein ein großes innereuropäisches Friedensprojekt gewesen. Alle Länder mischen in der Globalisierung mit und den kleinen geht es häufig blendend – man denke an Singapur, die Schweiz, Norwegen oder die Emirate. Vornehmlich erscheint das Argument, man könne die Globalisierung nur europäisch bestehen, daher als ein bundesrepublikanisches Interesse, ist die Bundesrepublik zu klein für einen global player, der die internationalen Standards mitbestimmt. Im europäischen Verein könnte das klappen.
Ähnliches gilt auch für eine aktive europäische Friedenspolitik, die mit militärischen Einmischungen liebäugelt, liegen die Interessen gerade zwischen den alten und den neuen EU-Mitgliedsstaaten zu weit auseinander, sind alle momentan nicht bereit, entsprechende Souveränitätsrechte an europäische Institutionen abzutreten. Nur wenn eine europäische Außenpolitik von der Europäischen Kommission betrieben werden könnte, es einen bundesrepublikanischen Außenminister gar nicht mehr gäbe, wäre die EU international ein global player, was auch nur unter der Fahne einer globalen Machtpolitik von Vorteil wäre.
Aus der Perspektive von europäischen Zivilgesellschaften, die sich mit europäischen Populisten auseinander setzen müssen, erscheint eine aktive europäische Außenpolitik eher nachgeordnet. Der Vorteil der EU im Verhältnis zu ihren Mitgliedsstaaten könnte in einer damit verbundenen impliziten Gewaltenteilung innerhalb einer europäischen Außenpolitik liegen, die einen allzu großen Top-down-Aktionismus verhindert. Die EU und die Mitgliedsstaaten als ein globales Schwergewicht sehen sich dann eher zu einer ausgleichenden und nachhaltigen indirekten Förderung von Strukturen in der Welt gezwungen, die Kriege beruhigen oder drohenden Kriegen wie ungerechten Lebensverhältnissen präventiv entgegenwirken. Für die europäischen Zivilgesellschaften könnten sich die allseits beklagten schwerfälligen Strukturen der EU dann besonders außenpolitisch als ein friedensfördernder Vorteil erweisen. Slavoj Žižek denkt dabei wahrscheinlich noch stärker in eine postmarxistische Richtung, doch jenseits davon skizziert er die richtige Perspektive wenn er 2017 schreibt: „Europa ist nicht einfach nur ein geopolitischer Machtblock, sondern eine globale Vision, die letztlich mit Nationalstaaten unvereinbar ist.“5 Das gilt damit auch für eine nationale Ökonomie oder einen nationalen Sozialstaat, von dem so manche Linke wieder träumen, nachdem der Internationalismus ihres Vordenkers gescheitert oder in internationalen Organisationen wie der UN oder supranationalen Gemeinschaften wie der EU aufgegangen ist oder er wird von internationalen NGO’s betrieben, die von undemokratischen Regierungen – man denke an Russland, Ungarn, die Türkei und China – bekämpft werden.
Auch ein weiteres Argument gegen die EU, das gerade die Bürgerinnen zu betreffen scheint, hat einen anderen Hintergrund als jenen, der regelmäßig behauptet wird. Die mangelnde Popularität der europäischen Institutionen liegt nämlich kaum an deren realer Macht und an deren faktischem Einfluss, an der angeblich überbordenden Bürokratie und ihrer byzantinischen Unübersichtlichkeit. Das Lamento über Ämter und Beamte ist so alt wie diese selbst. Im Unterschied zur Bürokratie im eigenen Land, über die man auch notorisch lästert, hat die europäische Bürokratie nicht nur keine Verteidiger. National klagen zwar Politiker auch mal, dass die Steuer zu kompliziert sei. Letztlich aber müssen sie die eigenen nationalen Bürokratien verteidigen, deren Regeln sie selber mitgeschaffen haben und die sie auch brauchen, um ihre politischen Entscheidungen umzusetzen. Dabei handelt es sich um Politiker, die bei ihren Wählern zumindest ein gewisses Renommee haben und gelegentlich vor Ort auftauchen. So bemühen sich Politiker darum, dass Behörden bürgerfreundlicher werden, was ihr Ansehen bei den Wählern verbessern kann.
Just an solchen Verteidigern mangelt es der EU. Wer nach Europa geht, gehört zuhause zumeist nicht zu den populärsten und bekanntesten Politikern – wer kannte Martin Schulz, bevor er es im Europaparlament zu Ruhm und Ehren brachte? –, so dass eventuelle Verteidigungsreden von EU-Politikern kaum Gehör finden, und daher häufig lieber unterlassen werden. Oder die EU findet Fürsprecher bei Politikern aus anderen Ländern, die man gar nicht kennt oder die ob der mangelnden Bekanntheit einfach nur wenig Vertrauen genießen. Oder es handelt sich um Mitglieder von Parteien, die der Stammwähler daheim gar nicht mag.
Dass in Europa die Parteigrenzen eher verschwimmen, verunsichert selbst den Wechselwähler, der zuhause trotzdem weiß, was er wählt, die Töne aus Brüssel aber nur schwer einzuschätzen vermag. Wer kennt schon die EU-Institutionen genauer? Und welcher Einheimische die Institutionen des Freistaates Bayern? Das verlangt ein hohes Maß an eigener politischer Bildung, die man am häufigsten noch bei aktiven Teilnehmern der Zivilgesellschaft findet, selten bei jenen, die Populisten mit ihren außerordentlichen Wahrheiten zujubeln. Aber selbstredend bleibt auch die Liebe eher geteilt, die die diversen zivilgesellschaftlichen Gruppen der EU und ihren Institutionen entgegenbringen. Das gilt z.B. für die Ökologen und besonders die Linken, wenn letztere in der EU eine neoliberale Verschwörung wittern.
Wer also kann die Aktivitäten der EU im jeweils nationalen Rahmen verteidigen? Wer kann überzeugend vorführen, wie nötig diese Aktivitäten sind, welche Vorund Nachteile sich daraus ergeben? Warum sie trotzdem sinnvoll sein mögen? Wer hört sich solche Debatten im Europa-Parlament an? Und wer berichtet darüber? Europa mangelt es nicht nur an Verteidigern, sondern auch an Zuhörern – nicht zuletzt in der Zivilgesellschaft – sowie vermittelnden Medien, die häufig lieber über das Getue des alten Adels berichten.
Umgekehrt braucht die EU die Zivilgesellschaft; denn wenn aus ihr heraus sich nicht Gruppen für die EU einsetzen, dann wird sich der schlechte Ruf Europas schwerlich verbessern. Von der Politik ist dergleichen kaum zu erwarten, höchstens punktuell.
Wenn ein Politiker in Brüssel die EU verteidigen will, dann läuft er zudem Gefahr, von seiner Partei zuhause, die ihn ja nach Europa schickt, zurückgepfiffen zu werden. Denn seine Partei daheim profiliert sich wählerwirksam besonders gerne mit Kritik an der EU. Alle Parteien – ohne Ausnahme und bestimmt nicht nur in Deutschland – spielen begeistert die Karte, die EU und ihre Institutionen zu kritisieren, nicht nur um eigenes Versagen auf diese zu schieben. Vielmehr kann man als Politiker damit einen heute weit verbreiteten Habitus bedienen, nämlich ganz generell staatliche Institutionen zu kritisieren – ein Habitus, an dem die Zivilgesellschaft durchaus wesentlichen Anteil hat und den der sich eher untertänig fühlende Teil der Bevölkerung fleißig reproduziert und sich dabei gerade durch Populisten bestärkt fühlt. Die Zeiten, als Majestätsbeleidung noch von vielen als unerhört betrachtet wurde, als Bürokratien noch als Obrigkeit eine gewisse Verehrung, allemal Achtung genossen, diese Zeiten sind seit den sechziger Jahren mit ihren diversen Emanzipationsbewegungen zu Ende gegangen. Witziger Weise just jene, die sich nach solchen Zeiten zurücksehnen, springen auf den Dampfer der Politiker- und der Bürokratie-Beschimpfungen auf. Die Faschisten und Nazis hatten es indes noch einfacher als heutige Populisten in der westlichen Welt, waren die Demokratien damals noch längst nicht so etabliert und vor allem die Mündigkeit von Bürgerinnen noch längst nicht so weit verbreitet.
Und selbst Konservative vor allem in den USA haben diesen Habitus eines vermeintlich kritischen Bewusstseins und einer vorgeblichen Mündigkeit heute verinnerlicht. Trump profitierte davon. Die Volksvertreter in Washington D.C. müssen das ständig erleben. In Europa spielt diese Rolle die EU, auf deren Kosten sich nationale Politiker reinwaschen und auf die sie alle Aversion der Bürger gegen den Staat ablenken können. Es verwundert daher auch nicht, wenn der nationale Staat im Schatten solcher Staatskritik plötzlich freundlicher erscheint, auf den sich früher alle Kritik konzentrierte. Natürlich erhalten nationale Staaten wie bald Großbritannien durch einen EU-Austritt wieder mehr nationale Kompetenzen. Unwahrscheinlich erscheint dabei, dass sie zur nationalen Stärke des 19. Jahrhunderts zurückfinden, bleiben sie ja letztlich in die globalisierten Prozesse eingebunden, müssen sie mit den Nachbarstaaten kooperieren, denen höchstens so große Länder wie USA und China die Bedingungen der Kooperation in einem hohen Maße diktieren können. Großbritannien kann das nicht, wie schon die Brexit-Verhandlungen zeigen.
Jedenfalls liegt in diesem schlechten Ruf ihrer Institutionen auch die große Gefahr für die EU, die weder die institutionelle Stabilität noch die Macht der US-Regierung besitzt. Vielleicht zerfällt die EU irgendwann, weil man heute keine Staaten mehr gründen kann und die EU eine der letzten derartigen Versuche darstellt, obwohl es sich um keine Nationalstaatsgründung handelt. Umgekehrt werden die Briten bald ihre Kritik auf die eigene Regierung richten, wenn Britannien kein Mitglied der EU mehr ist. Allerdings verteidigen dann renommierte Politiker die britischen Institutionen bis hin zum König. Vielleicht tritt Schottland aus dem Königreich aus, um dann in den EU-Behörden einen Buhmann für Frustrationen zu behalten. Aber den haben sie schon mit London.
Je besser eine Lage erscheint, umso heftiger fällt die Kritik am Bestehenden aus, weissagt man diesem begeistert apokalyptisch den Untergang, droht man den Zeitgenossen, sie müssten ihr Leben ändern. Denn das Begehren treibt den Kritiker notorisch über das hinaus, was sich ihm anbietet, was er eigentlich genießen sollte. Die Zeitgenossen neigen dazu, das Gute nicht mehr zu schätzen, womit sich dessen Relativität demonstriert. Was zudem eine Generation errungen hat, das ist für die folgende Generation schon eine Selbstverständlichkeit und sie sucht nach neuen Ufern. Auch das Begehren als eine nicht endende Triebfeder des Menschen, wie ihn Jacques Lacan beschrieben hat, erweist sich für die EU als gefährlich, wenn dieses Begehren nicht durch Achtung aufgefangen oder durch andere Interessen abgelenkt wird.