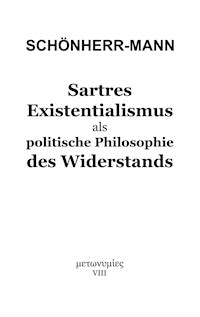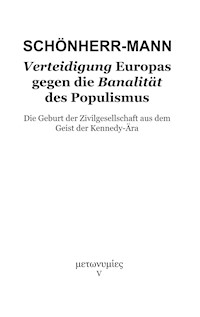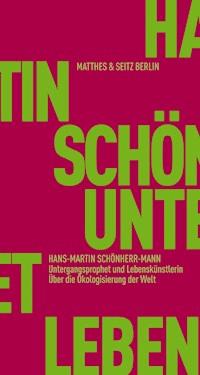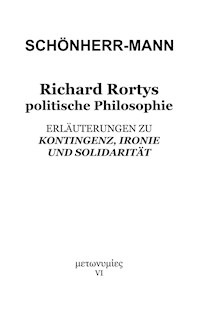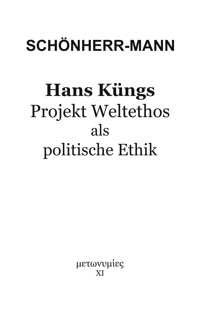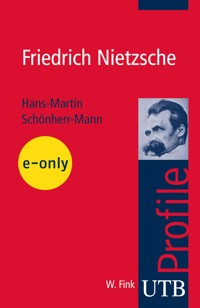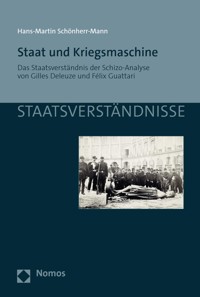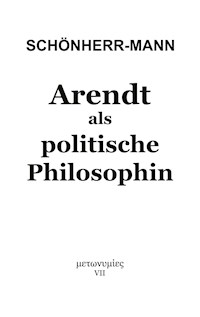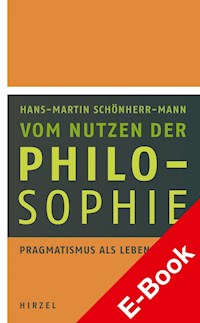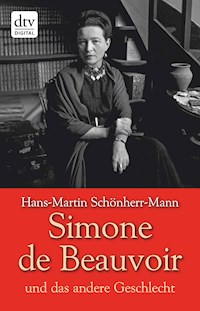Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach Michel Foucault gibt es Sexualität erst seit ca. 300 Jahren. Doch so, wie sie sich heute in der freizügigen Welt präsentiert, wird mit Sexualität primär kommuniziert - Freuds Primärprozess als reine Kommunikation. Das verdankt sich den Massenmedien. Seit dem Film und dem frühen Jazz begegnet den Leuten die Sexualität als Kommunikation, eine Lage, der alle ausgesetzt sind. Doch sie können sich solcherart Sexualität auf verschiedene Weise bedienen, dabei Symbole und Zeichen verschieben. Damit konstituieren sie das eigene Selbst, feiern Erfolge und erleben grandiose Untergänge. Sie gebrauchen Sexualität genießerisch um ihrer selbst willen, so dass sie sich diskriminierenden Ansprüchen widersetzen, die Sexualität mit Fortpflanzung verwechseln und sie gar in den Dienst eines erfundenen Volkes oder eines Staates zu stellen versuchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch: Nach Foucault gibt es Sexualität erst seit etwa 300 Jahren. Doch so, wie sie sich heute in der freizügigen Welt präsentiert, wird mit Sexualität primär kommuniziert – Freuds Primärprozess als reine Kommunikation. Das verdankt sich den Massenmedien. Seit Film und Jazz begegnet den Leuten die Sexualität als Sexyness, eine Lage, der alle ausgesetzt sind. Doch sie können sich der Sexyness kommunikativ bedienen, dabei Symbole und Zeichen verschieben. Damit konstituieren sie das eigene Selbst, feiern Erfolge wie grandiose Untergänge. Sie gebrauchen Sexyness genießerisch um ihrer selbst willen, so dass sie sich diskriminierenden Ansprüchen widersetzen, die Sexualität mit Fortpflanzung verwechseln und sie gar in den Dienst eines erfundenen Volkes oder des Staates zu stellen versuchen.
Hans-Martin Schönherr-Mann ist Prof. für Politische Philosophie am Geschwister-Scholl-Inst. der Ludwig-Maximilians-Univ. München, Lehr- und Prüfungsbeauftragter an der Hochschule für Politik München, seit 2004 regelmäßiger Gastprof. an der Fak. für Bildungswiss. der Univ. Innsbruck; Lehrtätigkeiten an der Venice International University, Univ. Regensburg, Katholischen Univ. Eichstätt, Università di Torino, Univ. Passau, Fachhochschule München, Univ. der Bundeswehr München; Bücher: Untergangsprophet und Lebenskünstlerin – Über die Ökologisierung der Welt, Matthes & Seitz, Berlin 2015; Gewalt, Macht, individueller Widerstand – Staatsverständnisse im Existentialismus, Nomos, Baden-Baden; Fröhliches Philosophieren, Edition fatal, München; Philosophie der Liebe – Ein Essay wider den Gemeinspruch ‚Die Lust ist kurz, die Reu’ ist lang’, MSB 2012; Der Übermensch als Lebenskünstlerin – Nietzsche, Foucault und die Ethik, MSB 2009.
Für Irmi
Inhalt
Einleitung
Sex im Internet-Zeitalter
Partnersuche im Internet
Sex Suche im Internet
Schattenseiten der Internet-Liebeswelt besonders für Frauen
Serieller Sex anstatt Ehe und Familie
1. Kapitel
Ehe und Sex im Absolutismus
Der Minister als Gatte der Mätresse des Fürsten
De Sades freizügige Utopie
De Sades Kritik an einer grausamen sexuellen Praxis
De Sades Kritik am familiären Tugendterror Rousseaus
Die sich der Herrschaft der Liebe entziehende Lust
Die Animation durch serielle Grausamkeiten
Durch das Spiel der Lüste andere erkennen
2. Kapitel
Ehe und Sex im 19. Jahrhundert
Moralische und ökonomische Integrität anstatt Sexyness
„‚Eine nüchterne Kindererzeugung’ innerhalb der Ehe.“
Die Pflicht zur Enthaltsamkeit als Menschenrecht
Der „lebenswierige wechselseitige Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften.“
Die „kompromisslose Domestizierung weiblichen Mutes“
3. Kapitel
Sexualität und Sex heute
Die Differenz zwischen Sex und Fortpflanzung
Triebgeschehen als Urgrund der Realität
Die Lust des Augenblicks und nicht der Ewigkeit
Die Macht der Sexualität als erregende Symbolik
Sexualität als öffentliche Kommunikation, Sex als private
4. Kapitel
Der Widerstand gegen die kulturelle Unterdrückung der Sexualität
Sexyness als Sexualität im Sinn von Gender
Sexualität zwischen Repression und Produktion
Die Erfindung der Heterosexualität als natürliche Sexualität
Die Sexualität als Wunsch und als Kompetenz
Die romantische Sexualisierung der Welt
Das nichteheliche Spiel der Lüste und das Jahr 1910
5. Kapitel
Sexyness und Schönheit
Die natürliche Schönheit
Der konstruktive Charakter von Schönheit, Erotik und Sexyness
Schönheit und der sexuelle Akt
Der Wertewandel: Glorifizierung der Unmoral
Sexyness als Kommunikation in der Öffentlichkeit
Die Verschleierte und die sexy Gestylte
Ist das Dirndl sexy?
6. Kapitel
Sexualität als Produkt der Massenmedien
Sexualisierung jenseits von Akt und Fruchtbarkeit
Niedergang der Sexualmoral durch Film und Schallplatte
Fotographie und Druckerzeugnisse als ‚Schmutz und Schund‘
Der Krieg und der Fortschritt der Sexualisierung
Der Kinsey-Report und die US-amerikanische Unkultur
Der Wunsch nach Sexyness und Pornographie
7. Kapitel
Sexyness und Ökonomie
Sexuelle Liberalisierung als der neue Faschismus des Konsums
Statt konfrontativer Verführung eine manipulative, kraftlose
Die Sexualisierung und Emotionalisierung des Kapitalismus
Religiöser oder säkularer Widerstand gegen die Sexualisierung
Die junge Jüdin und der SS-Mann
8. Kapitel
Sexualität und Emanzipation
„Je gebildeter die Frauen, desto unfruchtbarer ist eine Nation“
Die weibliche Macht der Sexualität im Zeitalter der Emanzipation
Wer sündigt nicht gerne: gerade mit westlicher Bildung!
Sexualität als Spiel, als Parodie, als Option, als Nichts
Wie verschwult ist die Welt?
9. Kapitel
Sexyness und Liebe
Wer liebt, der übertreibt
Die Liebe von Siebzehnjährigen oder jene von Sartre und de Beauvoir
Liebe als Ehe unter kommunikativer Offenheit
Liebe als Leidenschaft: eine Entschuldigung
Der sexuelle Akt als Herrschaft, die Liebe als Überbrückungsfunktion
Literatur
Einleitung1
Sex im Internet-Zeitalter
Partnersuche im Internet
Früher blickte man im Café jeder Schönen nach und irgendwann passierte es dann: Blicke kreuzten sich und sie war gefunden, obwohl man nichts über sie wusste.
Aber wer setzt sich heute noch ins Café? Da muss man viel zu lange warten. Vielleicht kommt tage- oder wochenlang niemand rein, mit der man Blicke kreuzen kann.
Heute geht das schneller. Denn heute, so die Soziologin Eva Illouz 2006, heute systematisiert das Internet die Partnersuche, was obendrein neue Möglichkeiten eröffnet.
Allerdings gilt es auch gewisse Hürden zu nehmen. Nicht nur dass man nicht mehr naiv zuerst die andere einfach anzublicken versucht, die gerade das Café betritt, obwohl man über sie gar nichts weiß und man sich selber auch nicht genau darüber klar ist, was man von ihr will. Man versucht einfach mal zu flirten.
Vielmehr muss man sich heute als erstes nämlich überhaupt klar werden, wer man selber ist, muss man diverse Fragebogen der entsprechenden Portale beantworten: wie man lebt, was man an sich selbst am attraktivsten findet, das Gesicht, die Figur oder den Bauchnabel. Die Partnersuche im Internet fördert insoweit doch die Selbstbewusstwerdung und überwindet die eigene Naivität und Bewusstlosigkeit. Erst danach muss man sich seine Wunsch- oder Idealpartnerin ausdenken. Das Internet beflügelt also auch die Fantasie, regt die Vorstellungskraft auf. Der Typ der Ideal-Frau muss sich konkretisieren, bleibt nicht mehr eine vage Vorstellung, kann man nicht mehr einfach die dunklen Südländerinnen den Blondinen vorziehen.
Aber war das vorher nicht genauso, wenn man nicht im Café warten wollte? Klingt dergleichen nicht nach traditioneller Heiratsvermittlung? Einen entsprechenden Obolus gilt es wie früher ebenfalls regelmäßig zu entrichten.
Doch dieser Eindruck täuscht, da sich dem Net-Surfer eine ungeheure Menge an Angeboten eröffnet. Da wird man nicht nur wählerisch, das muss man sein. Andere Angebote, die nicht perfekt dem Profil des Wunschpartners entsprechen, kann man gar nicht mehr wahrnehmen, braucht man schon ein Ordnersystem im PC, wo man die Daten der Idealkandidaten speichert.
Derart häufen sich denn auch die blind Dates, was verwundern sollte, wenn die Profile optimiert wurden. Wahrscheinlich weiß man weder genau, wer man selber ist, noch wen man will. Hat es doch keinen Sinn, sich über sich selbst Gedanken zu machen oder sich eine Ideal-Frau zu halluzinieren?
Zudem beginnt trotz ideal passenden Profilen die Masse der Treffen von Angesicht zu Angesicht aus noch einem weiteren Grund mit einem Fiasko, vor dem schon die Institute warnen. Nicht nur enttäuscht die potentielle Traumpartnerin häufig, wenn sie plötzlich so vor einem sitzt. Derartige Gespräche erstarren leicht in sich wiederholenden Routinen, im Abfragen von Daten oder im Erzählen derselben Witze, was konventionell auch nicht anders verläuft, nur seltener stattfindet, was vielleicht ein Vorteil war.
Wieso werden dann überhaupt gelegentlich auf diese Weise Ehen geschlossen? Eva Illouz diagnostiziert ein schier entemotionalisiertes und hoch rationalisiertes Paarungsverhalten im Zeitalter des WWW! Doch Erfolg haben auch bei der netzgestützten Partnersuche vor allem jene, die sich in der Begegnung emotional sympathisch zu repräsentieren verstehen, die über das verfügen, was Illouz eine emotionale Kompetenz nennt. So erhöht sich zwar durch das Netz die Anzahl der Angebote, die man ja auch klein halten könnte, wenn man sich dadurch drangsaliert fühlt. Die Erfolgsaussichten hängen dagegen wenig vom Netz als vielmehr vom eigenen Verhalten ab. So bemerkt Eva Illouz: „Die Interneteinbildung ist vorausblickend, bezieht sich also auf jemanden, dem man noch nicht begegnet ist; sie gründet nicht im Körper, sondern in sprachlichem Austausch und textueller Information; die Beurteilung des anderen stützt sich auf eine Ansammlung von Merkmalen, statt ganzheitlich zu sein; und in dieser speziellen Konstellation scheinen die Menschen über zu viele Informationen zu verfügen und weniger leicht in der Lage zu sein, zu idealisieren.“2
1 Danken möchte ich an dieser Stelle zunächst meiner Freundin Irmgard Wennrich, die an der Gestaltung des Buches beteiligt war. Angeregt haben es Josef Christian Aigner und Theo Hug mit ihrer Tagung „Medialisierung und Sexualisierung“ der Innsbruck Media Studies und des Instituts für psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung der Universität Innsbruck im Universitätszentrum Obergurgl im Dezember 2013 und durch den von beiden herausgegebenen Tagungsband unter demselben Titel im Verlag Springer VS Wiesbaden 2015. Zudem darf ich allen danken, die direkt oder indirekt zur Entstehung des Buches beigetragen haben: Bernhard Lienemann, der mir eine Webseite (http://www.schönherr-mann.de/) einrichtete, Reinhard Knodt, der mich zu diesem Thema auf die Philosophie-Tage des Schnackenhofs im August 2015 einlud, David Steinitz, dessen Dissertation mich dabei inspirierte, Anil Jain, der bei der Publikation geholfen hat, Franz Bernarding, der mich überhaupt auf diese Publikationsart aufmerksam machte, Michael Löhr, der einige wichtige hilfreiche Ratschläge gab, außerdem Ulrike Popp-Baier, Linda Sauer, Bernd Mayerhofer, Markus Penz, Hans-Georg Pfarrer, Michael Ruoff.
2 Eva Illouz, Warum Liebe weh tut – Eine soziologische Erklärung, Berlin 2011, 413
Sex Suche im Internet
Freilich werden im Internet längst nicht nur Ehen angebahnt. Das wäre wohl nicht mehr zeitgemäß. Denn die Sexualität erlebt mit dem Internet – so der Soziologe Jean-Claude Kaufmann 2011 – einen viel radikaleren Wandel, eröffnet zudem völlig neue Umgangsformen mit der Liebe, die vor allem von den Jüngeren intensiv genutzt werden. Man denke nur an den Werbespruch auf der Litfaßsäule: „Es muss nicht immer Liebe sein.“ Nicht nur vervielfältigt das Internet die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, und zwar explosionsartig, in der räumlichen Nähe wie in der Ferne. Das hatten wir gerade und war nicht unbedingt ein Vorteil.
Vielmehr bietet es die Möglichkeit für schnelle kurzlebige Bekanntschaften, die primär auf Sex abzielen, also auf den sexuellen Akt. Kaufmann schreibt: „Die Online-Begegnungen (. .) haben die Landschaft der Liebe beträchtlich erschüttert, nichts wird mehr so sein, wie es davor war. Unter dem Schutz der Anonymität der ‚Nebenwelt’ ist ein neuer Raum für Sex entstanden, der als eine Freizeitbeschäftigung gilt: Man plant eine heiße Nacht, wie man ins Kino oder ins Restaurant gehen würde.“3 Dabei handelt es sich nicht um Prostitution, auch nicht darum dass vornehmlich Männer – Frauen aber auch – immer schon neben ihren Ehen Liebschaften nachjagten. Denn das wird zumeist geheim gehalten, selten öffentlich als Lebensform diskutiert.
Doch den Sex um seiner selbst willen mit wenig gefühlsmäßiger Bindung und ständig wechselnden Partnern zu suchen, das lässt sich in Internetforen nicht nur unter der Hand vorbereiten, sondern darüber kann man öffentlich in Chats heiß diskutieren: ob der nächtliche Sex gut war; ob die ‚Tussi’ über Nacht bleiben wollte oder der Typ ein Arschloch war. Im Internet entwickelt sich ein halböffentlicher Diskurs über Sex, an dem potentiell jeder teilnehmen kann, während zuvor ein solcher Diskurs höchstens in der Literatur und im Feuilleton von wenigen geführt und von vielen rezipiert wurde. Dazu bemerkt Kaufmann: „Die Utopie einer freieren und offeneren Neuen Liebeswelt stellt sich heute so dar, als könnte sie das Monopol der Ehe brechen. Die konstant ansteigende Zahl von Singles überall auf der Welt beweist im Übrigen, dass die langfristige Paarbeziehung immer weniger zum Maßstab genommen wird.“4
Nun, verglichen mit ihrer Dominanz im 19. Jahrhundert hat die monogame Ehe und Familie seit Jahrzehnten und somit schon vor dem Internet dramatisch an orientierender Kraft für viele Menschen in der euroamerikanischen Welt eingebüsst. Die Scheidungszahlen steigen bereits Ende des 19. Jahrhunderts leicht an, jedenfalls in gewissen urbanen Zentren. Seit den 1970er Jahren heiraten viele Menschen nicht mehr. Sie leben auch nicht mehr unbedingt zusammen, leben in Singlehaushalten, sind aber keineswegs Single, wenn sie eine Beziehung haben.
Dass man sich via Internet die Partnerin für eine Nacht suchen kann, das betreiben nicht nur Männer, wiewohl diese doch immer noch mehr als Frauen. Aber wenn Frauen nicht mitspielten, dann könnten Männer das auch nicht tun, so dass eine solche Entwicklung an den Frauen keineswegs spurlos vorübergeht. Viele – längst nicht nur – jüngere haben sexuelle Aktivität als Freizeitbeschäftigung entdeckt – so Kaufmann –, über die sie sich im Internet genauso öffentlich austauschen. Gelegentliche Beschimpfungen als Schlampe werden zumeist solidarisch abgewehrt und der Angreifer als Schlappschwanz denunziert. „Die Frauen, die auf Männerjagd gehen, die Anhängerinnen des Sexes um des Sexes willen (. .), die ihre Lust befriedigen, befinden sich in der Minderheit. Aber sie sind eine sehr aktive und mitteilsame Minderheit, die im Netz den Ton angibt. Und eine Minderheit, die in rasantem Tempo größer wird.“5
Die Umfrage, die der Vatikan 2013/14 in Auftrag gab, ermittelte, dass eine überwältigende Mehrheit der Gläubigen – und besonders die jungen – die katholischen Sexualregulierungen nicht mehr ernst nehmen, ja dass sie erstens vor allem ohne jegliches schlechtes Gewissen gegen sie verstoßen und zweitens das auch nicht mehr geheim halten. Die katholische Sexualmoral verbietet zwar das meiste, toleriert aber Verstöße großzügig, wenn sie bereut und vor allem geheim gehalten werden – jedenfalls ist das noch die Praxis in den nichtgegenreformierten Gebieten wie Spanien und Italien, in Deutschland gehen die Gläubigen damit noch etwas strenger um.
Doch von solchen Umfrageergebnissen werden sich die theologischen Hardliner unter den katholischen Bischöfen schwerlich erschüttern lassen, wussten sie das letztlich immer schon und sehen es als ihre Aufgabe an, verirrte Gläubige – und um solche muss es sich bei diesen Jugendlichen zweifellos handeln – wieder auf den rechten Weg zurückzubringen.
Bisher durfte darüber auch nicht geredet werden. Wenn jedoch heute im Internet die Individuen öffentlich über alles kommunizieren können, auch und gerade über die von der katholischen Sexualmoral als Sünde diffamierten Lüste und Sexpraktiken völlig unabhängig von Ehe und Monogamie, wenn dergleichen vor allem nicht mehr geheim gehalten werden kann, dann droht dadurch, dass die katholische Kirche jeglichen Einfluss auf die Sexualethik vieler Gläubigen verliert.
Langfristig – momentan ist keine Umkehr dieses Trends absehbar – könnten sich die Religionen gezwungen sehen, sich überhaupt aus dieser Thematik zurückzuziehen – die sie aus säkularer Perspektive ja auch gar nichts angeht: Mündige Menschen bestimmen über ihr Sexualverhalten selbständig und lassen sich nicht bevormunden. Eine junge Katholikin erklärte in der Umfrage, dass der liebe Gott eine so schöne Sache wie den Sex schwerlich erfunden haben kann, um ihn zu verbieten.
Der freiere Umgang mit dem Sex verdankt sich einerseits einer weiter verbreiteten Bildung, was sich bereits im 19. Jahrhundert anbahnt. Andererseits entfaltet ein freierer Umgang im Sexualverhalten auch eine faszinierende Kraft auf Menschen aus bildungsferneren sozialen Kreisen, was letztlich zu diesem Wandel geführt hat. Seit die Staaten in der westlich geprägten Welt religiöse Vorschriften nicht mehr sanktionieren, können Kirchen oder religiöse Gruppen nur noch überzeugten Anhängern Sexualvorschriften machen, die diese wie auch immer freiwillig befolgen oder nicht. Niemand wird in der freizügigen Welt mehr als Hexe verbrannt, wenn sie oder er ohne jegliche Verheimlichung dem Spiel der Lüste um der Lüste willen frönen und sich über die Drei-Kind-Familie lustig machen, die eine führende Dame einer diskriminierenden Vereinigung propagiert.
3 Jean-Claude Kaufmann, Sex@mour – Wie das Internet unser Liebesleben verändert, Konstanz 2011, 125
4 Ebd.
5 Kaufmann, Sex@mour, 49
Schattenseiten der Internet-Liebeswelt besonders für Frauen
Doch das Internet führt keineswegs – so Jean-Claude Kaufmann – zu einem Frieden zwischen den Geschlechtern. Vielmehr verschärft sich der Konflikt. Auch für Eva Illouz erweisen sich die Frauen als die Verliererinnen der neuen Internet-Sex-Welt: Frauen suchen stärker das Gefühl als den bloßen sexuellen Akt. Weil dieser jedoch unkontrolliert Gefühle hervorruft, hält Kaufmann die öffentlichen Diskussionen im Internet über einen Sex mit kontrolliertem Gefühl für eine aussichtslose Utopie. Eine Chatterin „träumte von einer Art der kurzen Liebe ohne Verpflichtungen. Davon sind wir weit entfernt. Von einem Pakt des Wohlbefindens unter Gleichen. Das höllische Räderwerk vertieft ganz im Gegenteil den Abgrund, der Männer und Frauen bisweilen trennt, noch mehr.“6
Daher stellt diese neue Internet-Liebeswelt für Kaufmann auch keineswegs den Hort der Befreiung dar. Vielmehr zwingt sie zur Anpassung und bringt jene in Verlegenheit, die sich nicht auf diese Spiele einlassen wollen: „Heutzutage bleiben nicht mehr wie früher in den Tanzlokalen die Hässlichsten sitzen, sondern diejenigen, die ihre Prinzipien haben und ablehnen, dass eine Beziehung mit Sex beginnt.“7 Was aber schon seit längerem so ist.
Vorschnell könnte man außerdem einwenden, dass Prinzipien eine Frage der Wahl sind, während Hässlichkeit eine Gegebenheit ist – wenn sich nicht auch immer am Äußeren etwas so verändern ließe, um andere zu animieren, wenn es jemand gäbe, der nicht äußerlich kommunizieren könnte. Dann wäre dieser Effekt zumindest ansatzweise befreiend. Doch an Schönheit lässt sich genauso drehen wie an moralischen Prinzipien. Umgekehrt darf man darauf hinweisen, dass gerade diejenigen, die sich in Liebesangelegenheiten ungeschickt benehmen, häufig moralische Normen hochhalten, um dadurch ihre Erfolglosigkeit zu kaschieren, die sie damit indes noch verfestigen.
Warum jedoch sollten diejenigen, die Prinzipien haben, dafür nicht auch einstehen und gegebenenfalls etwas leiden? Oder könnten die Moralistinnen etwa den Anspruch erheben, dass die Welt so organisiert werden muss, damit sie die Gewinnerinnen sind? Schon Kant forderte, dass der Tugendhafte, der sich des Glückes würdig erwiesen hat, auch des Glückes teilhaftig werden sollte. Doch weil das eben normalerweise gerade nicht der Fall ist, so wünschen wir diese Glückseligkeit der Tugendhaften wenigstens im nächsten jenseitigen Leben, postuliert Kant daher die Unsterblichkeit der Seele.
Nicht nur der Katholizismus hat die Welt lange so geprägt, dass diejenigen, die sich seinen Sexualvorschriften nicht fügen, die Verliererinnen werden, weil diese die moralisch Verkommenen sein sollen, die zu Recht verlieren. Sie werden immer noch als Schlampen diffamiert, im 16. Jahrhundert wurden sie als Hexen verbrannt, während diejenigen, die Keuschheit und Treue hochhielten, manchmal sogar heute noch als Heilige verehrt werden. Doch dagegen haben sich im letzten Jahrhundert immer mehr Menschen gewehrt. Das Argument trägt also nicht allzu weit bzw. nur zurück in die traditionelle Familienmoral, der Kaufmann zuneigt. Blaise Pascals berühmte Wette, dass man einen Vorteil hat, nämlich das ewige Leben gewinnt, wenn man an Gott glaubt, trägt nur in einer Welt, in der man durch die Sitten gezwungen ist, so zu leben, wie es die Religionen vorschreiben. Wenn das nicht der Fall ist, dann befreit der Unglaube von den religiösen Vorschriften besonders den Sex betreffend.
So gründet Kaufmann auf solche Schattenseiten der Internet-Liebeswelt seinen Optimismus, dass die Ehe überhaupt nicht gefährdet ist. Erstens ändern gerade die Frauen im Laufe ihres Lebens ihren Umgang mit der Sexualität. Weil sie stärker gefühlsabhängig sind, suchen sie letztlich doch die feste Bindung. „Die Raubkatzen des Internets zum Beispiel sind nur selten ihr ganzes Leben lang Raubkatzen. In einer anderen Phase können sie nach einem netten Ehemann suchen. Das unterschiedliche Zusammenspiel von Sex und Liebe wird meistens in sehr scharf voneinander abgegrenzten Sequenzen erlebt.“8
Dabei fördert die raue Wirklichkeit, dass nicht nur Frauen stabile Beziehungen anstreben. Vor allem aber tickt bei Frauen ja die biologische Uhr: „Viele Frauen suchen, wenn sie die Dreißig überschritten haben, weniger einen Märchenprinzen als vielmehr einen künftigen Vater für die Kinder, die sie haben möchten. Keine Rede mehr davon, dies alles in einem Netzwerk aufzulösen, im Gegenteil, man muss ein leistungsstarkes Team bilden, das wie Pech und Schwefel zusammenhält: das Elternpaar.“9
Genau hier verläuft die Frontlinie zwischen traditionellen und posttraditionellen Soziologen. Erstere verweisen darauf, dass der ausschweifende Sex mit fortschreitendem Alter nachlässt, während die Zeitgenossen parallel dazu zunehmend traditionelle Werte schätzen. Von posttraditioneller Seite wäre hier wiederum einzuwenden, dass erstens statistisch die Zahl der Scheidungen in Deutschland – wenn nicht sogar in der EU und Nordamerika – steigt und die der Eheschließungen abnimmt, während die Zahl der Alleinlebenden zunimmt. Wenn die Zeitgenossen überhaupt heiraten, dann zumeist später, so dass die Jahre, die in einer zeugungsfähigen Ehe etwa zwischen 20 und 50 verbracht werden, sicherlich dramatisch weniger geworden sind, was die gesunkenen Geburtenraten ob in Polen, Spanien oder Italien bekräftigen.
Dass man Phasen der Libertinage und Phasen der Bindungssuche hat, das erscheint heute als normal. Die beiden Phasen können sich gegenseitig auch nicht widerlegen. Wer die Libertinage will, den kann man nicht mit Bindung abspeisen – auch nicht mit dem Argument, dass sie das später mal wünschen wird. Umgekehrt gilt dasselbe: wer eine feste Beziehung sucht, wird mit einer Nebenbeziehung nicht zufrieden sein, in der es primär um Sex geht. Auch Eva Illouz bestätigt, „dass Frauen sich die serielle Sexualität zu eigen gemacht haben, indem sie auf die durch dieses Mittel erlangte männliche Macht reagierten und diese nachahmten. (. .) Für Frauen hat die serielle Sexualität immer neben ihrer Ausschließlichkeitsorientierung bestanden und ist dementsprechend voller Widersprüche. Frauen neigen zu einer gemischten Sexualstrategie, die Serialität und Exklusivität kombiniert. Genauer gesagt: Für Frauen ist Serialität ein Weg, um Exklusivität zu erreichen, kein Ziel an sich.“10 Frauen werden also für Illouz von den neuen Verhaltensweisen im Internetzeitalter benachteiligt.
Einwenden lässt sich, dass die Wünsche sich im Laufe des Lebens auch ändern können. Die spätere Einstellung widerlegt aber keine früheren, könnte man die spätere früher durchaus als unvorteilhaft oder gar irrational einschätzen. Manchmal entdecken sich Frauen auch erst mit 40 als sexuelle Wesen – was auch Männer betreffen kann. Warum sollten die Zeitgenossinnen ihr Leben nicht gelegentlich ändern? Nur wer von Jugend an gemäß der traditionellen Ehe Moral lebt, betreibt dasselbe eine lange Weile. Dagegen lässt sich gar nichts einwenden, hängt das schlicht von den eigenen Vorlieben ab. Es soll auch heute noch Leute geben, die nach katholischer Vorschrift ihr Liebesleben gestalten, was auch ihr gutes Recht ist. Im Gegensatz zum 19. wie zum 17. Jahrhundert kann man jedoch heute von einer solchen Lebensform jederzeit ablassen, muss man sich ihr nicht unterwerfen – eine Lebensform unter vielen eben, die alle moralisch gleichwertig sind, soweit sie andere nicht diskriminieren.
Serieller Sex anstatt Ehe und Familie
2011 konstatiert Illouz zwar: „Die Bejahung der Freiheit im Bereich der Sexualität war eine der signifikantesten soziologischen Transformationen des 20. Jahrhunderts.“11 Doch sie schätzt diese Situation, also die Liebe in Zeiten des Internets kritischer ein als noch 2006: die Verlierer der neuen Liebesunordnung oder neuen Liebesmoral sind vor allem die Frauen. Schon durch die Aufhebung von religiösen, ethnischen, rassischen oder auch klassenbezogenen Heiratsbeschränkungen und heute zusätzlich noch durch das Internet hat sich die Auswahl möglicher Sexual- und Ehepartnerinnen eben vornehmlich für Männer vergrößert. Doch das bedeutet keineswegs, dass Ehepartner schneller zu finden sind. Denn Untersuchungen haben gezeigt, „dass eine wachsende Zahl von Optionen“, so Illouz, „die Fähigkeit, sich an ein einziges Objekt oder eine einzige Beziehung zu binden, eher blockiert als aktiviert.“12 Zudem realisieren Männer ihre Männlichkeit nicht mehr in der Ehe und durch Kinder, sondern durch eine Vielzahl von Sexualpartnerinnen. Längst ist ihnen der Beruf wichtiger als die Familie, lässt sich durch letztere kein schlechter Beruf mehr kompensieren. Entfremdet arbeiten zu gehen, um die Familie zu ernähren, war im 19. Jahrhundert die Regel und verlieh dem Leben durchaus einen nachhaltigen Sinn, den – das darf ich hier hinzufügen – damals unemanzipierte Frauen und auch heute noch jene, die gerade dringend oder auch nur generell einen Vater für ihre Kinder suchen, weiterhin fleißig einfordern.
Illouz gesteht zwar zu, dass Frauen heute dieses männliche Verfahren gelegentlich kopieren. Aber so rechte Freude mag bei den meisten über größere Erfolge – viele Bettgeschichten – nicht aufkommen, dienen diese doch für sie zumeist dazu, einen festen Partner zu finden, mit dem sie Kinder bekommen können. Genau an dieser Stelle werden Frauen zu den Verliererinnen der deregulierten Sexualität. Besonders gebildete Frauen sind dabei benachteiligt, sehen sie sich mit einem erheblich kleineren Angebot als gebildete Männer konfrontiert, ist zudem ihr Zeitraum kürzer, um Kinder zu bekommen. Männer lassen sich aber auch leichter auf Frauen ein, die weniger gebildet sind als sie selbst, Frauen umgekehrt seltener, was die Chancen der letzteren natürlich senkt. Wer den braven Anderen will, der die eigenen Wünsche erfüllt, muss sich halt mit dem braven Anderen auch zufrieden geben, auch wenn er nicht ganz standesgemäß ist. Man könnte dabei den Verdacht haben, dass Frauen häufiger standesgemäß denken als Männer, hält Simone de Beauvoir ähnliches den Frauen auch vor.
Illouz beachtet dabei auch zu wenig, dass emanzipierte Frauen vor derselben Perspektivenvielfalt stehen wie emanzipierte Männer, dass auch der biologisch unterfütterte Kinderwunsch mit anderen Interessen in Konflikt gerät und sich nicht mehr so leicht wie im 19. Jahrhundert realisieren lässt. Er hat auch keine zwangsläufige Priorität gegenüber anderen Wünschen, muss das jede für sich entscheiden. Mögen Kinder zumeist einen hohen Wert haben, doch heute konkurrieren sie mit anderen hohen Werten. Natürlich drängen nicht erfüllte Wünsche besonders stark, trauert man immer gerne dem nach, was man nicht hat und hält das, was man erreicht hat, gerne für weniger wertvoll. Auf eine solche Selbstreflexion sollte man achten, um nicht in ein Lamento über die Schlechtigkeit der Welt zu verfallen.
Doch für Illouz verschärft auch das Internet die schlechte Lage von Frauen im Zeitalter veränderter Liebesmoral. Wenn nämlich das Angebot für Männer zu groß ist, dann wird die Wahl zur Qual. Wenn die Männlichkeit sich nicht mehr in der Familie realisiert, fehlen doppelt Motive zur festen Bindung. Nur in seltenen Fällen sind Männer heute zu einer festen Bindung bereit, werden sie geradezu von Bindungsangst getrieben. Einzuwenden ist hier nur, dass weniger attraktive Männer auch schlechtere Karten haben, während für attraktive Männer wohl der Satz meiner um 1885 geborenen ostpreußischen Großmutter gilt, die der Großvater nie nackt gesehen hat, die aber noch keine Risikogesellschaft erlebte: ‚Männer über dreißig wissen nicht mehr, was sie wollen.‘ Nein, eheliche Liebe – und nicht nur die – ist immer auch ein Machtspiel: junge Frauen haben durchschnittlich mehr Angebote als junge Männer, was sich jedoch im Laufe des Lebens häufig zuungunsten von Frauen verschiebt.
Aus der Perspektive von Illouz müssen sich Frauen dagegen auf der Suche nach einem festen Partner wahrscheinlich just an diesen attraktiven Männern abarbeiten, die ob einer großen Auswahl bindungsscheu werden. Dabei wirken Frauen gerade durch ihre Bindungswilligkeit auch noch als schwach und unattraktiv: Wer mehr als der andere in einer Beziehung will, befindet sich automatisch in der schwächeren bzw. hilflosen Position – was aber für unattraktive Männer auch gilt, die keine Frau haben will. Trotzdem behält Illouz wahrscheinlich damit Recht, dass Frauen Sex eher mit Liebe – also mit festen Beziehungen – verbinden als Männer: „Viele Frauen suchen emotionale Exklusivität, während entsprechend viele Männer seriellen Sex vorziehen. Die Gefühle der Frauen und ihr Bindungswunsch sind ihrer Paarbildungsstrategie oftmals von vornherein eingeschrieben, was es wahrscheinlicher macht, dass sie widersprüchliche Wünsche verspüren, konfuse emotionale Strategien verfolgen und von Männern mit ihrer größeren Fähigkeit, sich durch serielle Sexualität einer Bindung zu entziehen, beherrscht werden.“13