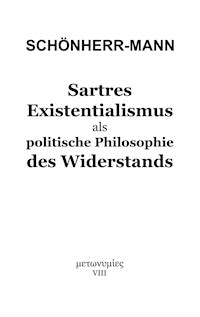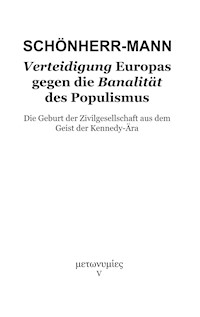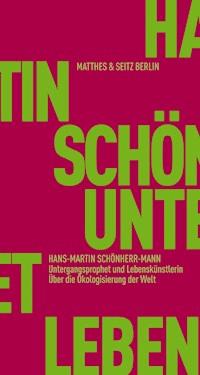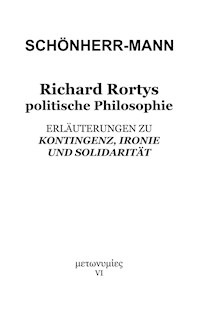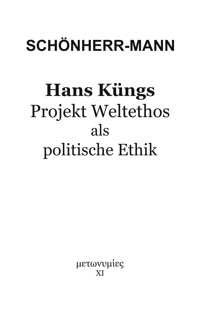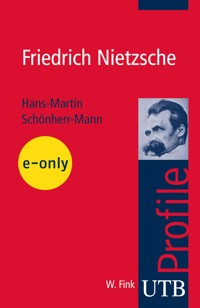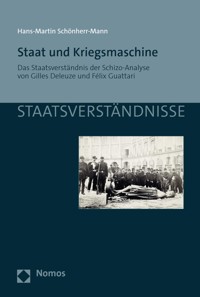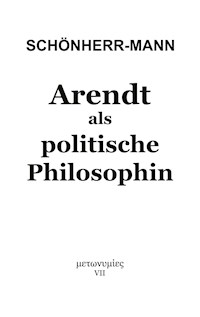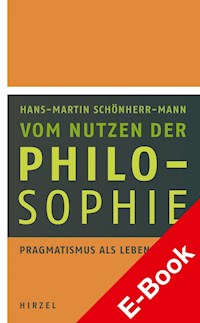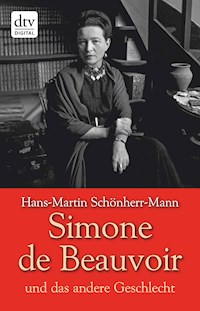
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leben und Wirken einer einflussreichen Frau Zum 100. Geburtstag von Simone de Beauvoir am 9. Januar 2008 Mit ihrer Kritik am traditionellen Frauenbild hat Simone de Beauvoir Denken und Leben zahlreicher Frauen verändert. Im Mittelpunkt dieser Einführung in Leben und Werk steht ihr berühmtestes Buch, ›Das andere Geschlecht‹, über die Lage der Frauen in der westlichen Welt. Sie kam zu dem Schluss, dass die engen Grenzen des »Typisch Weiblichen« von der Gesellschaft bestimmt sind, und fasste dies in der damals sehr provokanten These zusammen, dass man nicht zur Frau geboren, sondern zur Frau gemacht wird. Sie lehnte weder die Liebe noch die Familie ab. Was sie forderte, war: Die Menschen sollten nicht alleine aufgrund ihres Geschlechts in Zwangslagen geraten, aus denen sie sich nicht mehr befreien können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Hans-Martin Schönherr-Mann
Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2007© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40056-5 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-24648-4Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Einleitung: Emanzipation oder Weiblichkeit
1. Kapitel: Was heißt Frau sein?
Geschichte der Frau
Des Mädchens triste Zukunft
Das Drama der weiblichen Sexualität
Abtreibung als Symbol der Selbstbestimmung
Verflüchtigt sich die Frau mit dem Alter?
Die Frau als Geheimnis
Die Hilfe des Mannes
2. Kapitel: Verwirklichen sich Frauen in der Liebe?
Auf dem Weg zur entfesselten Erotik
Die Narzisstin und die Mystikerin
Sadomasochistische Fluchten
Wohin treibt die Schönheit?
Lesbische Liebe als emanzipatorischer Ausweg
3. Kapitel: Verwirklichen sich Frauen in der Ehe?
Bürgerliche Ehe und romantische Liebe
Die Ehe als Geschäft
Die Ehe als entindividualisierte Sexualität
Die Rückkehr zur traditionellen Ehe
Die Scheidung als Ausweg
Flucht in die Prostitution
4. Kapitel: Verwirklichen sich Frauen in der Familie?
Liebe als Elternliebe
Die Unmöglichkeit, sich in Kindern zu verwirklichen
Kinderlosigkeit als eine Voraussetzung der Selbstverwirklichung
Selbstverwirklichung jenseits der Mutterschaft
Mutterschaft als Wesen der Frau
Die Rückkehr zur Familie als Einkehr in das weibliche Wesen
Die Familie zwischen Notwendigkeit und Option
Das Wesen der Frau
5. Kapitel: Verwirklicht sich die Frau im Mann?
Die Lage von Frauen im Patriarchat
Das verdrehte Bewusstsein von Frauen
Weibliche Emotionalität oder männliche Rationalität
Selbstverwirklichung oder Sinn des Lebens
Die Unvermeidbarkeit der Gewalt
6. Kapitel: Verwirklichen sich Frauen in der Emanzipation?
Zur Geschichte der Emanzipation
Zur Entwicklung der Frauenbewegung
Emanzipation als Prozess der Individualisierung
Auf der Suche nach der authentischen Liebe
Emanzipation oder Selbstverwirklichung
7. Kapitel: Was heißt Selbstverwirklichung?
Die Geworfenheit als Erfahrung von Frauen
Freiheit und Selbstverwirklichung
Der Feminismus als Existentialismus
Andersheit und Einheit der Geschlechter
Freiheit und Verantwortung
Abkürzungen
Anmerkungen
Literatur
Personenregister
Für Irmi
EINLEITUNG1* EMANZIPATION ODER WEIBLICHKEIT
Es sieht so aus, als sei das Spiel gewonnen. Die Zukunft kann nur zu einer immer tiefgreifenderen Integration der Frau in die einst männliche Gesellschaft führen.«1 (AG 179) Simone de Beauvoir erscheint mit diesen Zeilen, die sie 1949 in ihrem monumentalen Hauptwerk Das andere Geschlecht schrieb, heute mehr als bestätigt, wiewohl sie sich damals darin irrte.
Genau deshalb insistieren Traditionalisten jedweder Couleur darauf, die Frauen wieder unter die Kontrolle der Religion oder der Familie zu bringen: unter den Schleier oder das Kopftuch, jungfräulich in die Ehe, hinter den Küchenherd, in die aufopferungsvolle Hingabe an Kinder und Ehemann; allemal weg von der Idee, ein eigenes Leben selbst und jenseits der Traditionen gestalten zu dürfen, um eben nicht nur altruistische Zuträgerin für Familie, Volk und Vaterland zu sein.
Viele Aspekte des modernen Lebens, die Technologien, die Ökonomie, ja selbst politische Vorstellungen der Republik oder der Demokratie lassen sich leichter mit überlieferten Lebensformen verbinden als die Emanzipation der Frau. Diese unterwandert die innere Hierarchie traditioneller Gemeinschaften, basieren diese doch praktisch überall auf der Unterordnung der Frauen unter die Männer. Selbst wer die Vorzüge der aufgeklärten, liberalen, demokratischen und pluralistischen Lebensform schätzt, der spürt als Mann genau hier, dass die euro-amerikanische Welt seine soziale Position ins Wanken bringt, ihm die Kontrolle über seine Familie, besonders über das Leben seiner Frau und seiner Kinder entzieht. Dagegen weltweit die Menschen aufzustacheln, fällt den traditionellen, vor allem den religiösen Eliten leicht, denn hier prallen die Interessen unmittelbar und hart aufeinander.
Daher erstaunt es, dass de Beauvoir schon um die Mitte des 20.Jahrhunderts das Spiel der Emanzipation für gewonnen erachtet, das um so mehr, als Das andere Geschlecht die Lage der Frauen in den etwa hundert Jahren zuvor, also unter dem Patriarchat dokumentiert. Das Werk präsentiert sich als Bestandsaufnahme in einer Zeit, in der Frauen noch längst nicht die Anerkennung als eigenständige Personen mit einem Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben erfuhren, wie es sich am Anfang des 21.Jahrhunderts zumindest in der westlichen Welt deutlich herauskristallisiert.
Damals dominierten die Männer praktisch alle öffentlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereiche, während Frauen weitgehend ein Leben im Verborgenen des privaten Hauses führen, um dessen monotone, ständig wiederkehrende Beschäftigungen kaum ein Mann mit ihnen konkurrieren möchte. Nicht zuletzt daher wirkt auf de Beauvoir das Leben von Frauen weitgehend als unwesentlich, es hinterlässt keine persönlichen Spuren. Deshalb formuliert sie ihre Leitfrage, an der auch ich mich im vorliegenden Buch orientiere: »Wie kann ein Mensch sich im Frau-Sein verwirklichen?« (AG 26) Eine keineswegs nur ironische Frage, deren Sinn die heutigen Traditionalisten erneut fleißig bestreiten. Insoweit weist Das andere Geschlecht weit über die eigene Epoche hinaus.
Nicht nur dass der Prozess der Emanzipation vor allem global noch längst nicht abgeschlossen ist. Vielmehr – das möchte das vorliegende Buch vorführen – entwickelt de Beauvoir eine Perspektive, die in der heutigen Diskussion um die Familie und die Emanzipation der Frau wiederkehrt. Ihr Buch schildert einerseits die Lage der Frau in jener Welt, an deren Werten sich Traditionalisten orientieren. Andererseits bringt sie eine Perspektive auf den Begriff, die sich heute in der westlichen Welt weitgehend durchsetzt und in der sich daher die gegenwärtigen Unterschiede zwischen Traditionalismus und Feminismus konturieren: Was heißt Emanzipation und Selbstverwirklichung? Was bedeutet Wesen der Frau? Was heißt Sinn des Lebens? Insoweit wird sich de Beauvoirs Buch und ihr Denken als hochaktuell erweisen, auch wenn man ihm ablehnend gegenübersteht: das existentielle Denken der vierziger Jahre, dem es sich verdankt, erfasst die Problematik von Frauen am Anfang des 21.Jahrhunderts nach wie vor.
»Wie kann ein Mensch sich im Frau-Sein verwirklichen?« Mit dieser Frage zieht de Beauvoir alle traditionellen Rollenverständnisse der Frau in Zweifel, die sich auf einen naturgegebenen Charakter der Frau berufen, der durch ihre Gebärfähigkeit begründet scheint. Die Frau bekomme die Kinder und nicht der Mann: Also müsse sie sich auch um sie kümmern. Ja mehr noch, das zu tun, entspreche ihrer fürsorglichen und liebevollen Natur, so dass auch ihr monotones Leben im Haus, im Schatten der Öffentlichkeit, die natürliche Form des richtigen und guten Lebens der Frau darstellt. Nur um den Preis der Entfremdung vermag sie sich daher dieser naturgegebenen Weiblichkeit – also ihrer Gebärfähigkeit, Mütterlichkeit, Häuslichkeit, Fürsorglichkeit und Opferbereitschaft – zu entziehen. Traditionelles Denken beruft sich fast immer auf eine vorhandene Natur oder auf eine gottgegebene Ordnung, sei es wenn Aristoteles die Sklaverei legitimiert oder Thomas von Aquin die feudale Fürstenherrschaft. Der US-amerikanische politische Philosoph Leo Strauss, Lehrer zahlreicher konservativer Politiker wie Paul Wolfowitz, schreibt 1952: »Es ist für Aristoteles wie für Moses offensichtlich, dass Mord, Diebstahl, Ehebruch etc. unbedingt schlecht sind. Griechische Philosophie und die Bibel stimmen insoweit überein, dass der richtige Rahmen der Moral die patriarchalische Familie ist, die monogam ist oder dazu tendiert und die die Zelle der Gesellschaft formt, in der die freien erwachsenen Männer, und besonders die alten, vorherrschen. Was immer die Bibel und die Philosophie uns über die Vornehmheit gewisser Frauen erzählen mag, im Prinzip beruht beides auf der Dominanz des männlichen Geschlechts.«2 Die patriarchalische, monogame Familie verbannt damit die Frau ins Haus – eine damals weit verbreitete konservative Position, wie sie heute vor allem in Teilen der katholischen Kirche wiederkehrt.
Gegenüber der biblisch instruierten patriarchalischen Familie gelangt die Emanzipation der Frau in rechtlicher wie in familiärer Hinsicht während der Aufklärung im 18.Jahrhundert mit der Idee der Gleichheit auf die soziale und politische Agenda. Aber erst im 20.Jahrhundert, vor allem in dessen zweiter Hälfte, beschleunigt sich der Emanzipationsprozess. Um 1950 stehen Frauen vor großen Schwierigkeiten, wollen sie aus ihren eingeübten Rollenmustern aussteigen. Aber nicht nur de Beauvoir selbst, die eine tief katholische Erziehung in einem bürgerlichen Pariser Elternhaus genoss, beschloss irgendwann, nicht mehr an den lieben Gott zu glauben und ihren Lebensweg nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Im ersten Band ihrer Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, der 1958 erscheint, berichtet sie: »Ich hatte eine Stunde damit zugebracht, die verbotenen Äpfel zu verspeisen und in einem ebenfalls verbotenen Balzac-Band von dem seltsamen Liebesidyll eines Mannes mit einer Pantherkatze zu lesen; vor dem Einschlafen gedachte ich mir selbst noch sonderbare Geschichten zu erzählen, die mich in sonderbare Zustände versetzen würden. ›Das ist Sünde‹, sagte ich mir. Es war mir unmöglich, mich länger selbst zu betrügen (…) Ich hatte immer gedacht, dass im Vergleich zur Ewigkeit diese Welt nicht zählte; sie zählte jedoch, denn ich liebte sie ja; stattdessen wog auf einmal Gott nicht mehr schwer genug.«3 (MT 126f.)
Viele Frauen ihrer Generation und auch schon davor testeten neue emanzipierte Lebensformen. So zitiert de Beauvoir bereits 1949 entsetzte Rufe emanzipationsgeschädigter Männer: »›Wo sind die Frauen?‹ (…) Und (…) die Weiblichkeit sei ›in Gefahr‹, man ermahnt uns: ›Seid Frauen, bleibt Frauen, werdet Frauen.‹« (AG 9) Zunehmend wird die patriarchalische Familie als natürlich göttliche Ordnung abgelehnt. Frauen – so Simone de Beauvoir – entsprechen ihrer traditionellen sozialen Rolle nur, weil sie ihnen antrainiert wurde. Daher kann die Sachlage ganz anders aussehen: »Nicht die Natur definiert die Frau: sie definiert sich selbst, (…).« (AG 62) Solche Sozialisierungen lassen sich anders als natürlich erscheinende Vorgaben und Zwänge auch überwinden: Frauen können sich auch andere Lebenswege öffnen. Sie müssen nicht unbedingt einer traditionell propagierten Weiblichkeit folgen.
Doch heute, wo das Spiel gewonnen scheint und die Emanzipation sich durchsetzt, verlieren die damit verbundenen Errungenschaften an Attraktivität, und es konturieren sich deren Schattenseiten. Frauen haben die Chance, ihr Leben beruflich wie zwischenmenschlich nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Zu arbeiten erweist sich längst als unumgänglich. Der Verzicht auf die Institution Familie befreit von deren Zwängen und Idiosynkrasien. Doch verlieren Frauen wie Männer damit auch deren Schutz und Halt. Die Familie büßt ihre stabilisierende Kraft ein, was viele Menschen verunsichert. Jetzt hängen zwischenmenschliche Beziehungen weitgehend von ihnen selber ab: eine schwierige Aufgabe, an der doch kein Weg mehr vorbeiführt. Haben Aufklärung, Sozialbewegung des 19.Jahrhunderts und zuletzt noch der Feminismus mit ihren jeweiligen Emanzipationsbestrebungen übertriebene Hoffnungen geweckt? Ernüchtert müssen viele feststellen, dass weder die Aufklärung, noch der Sozialismus, noch die Frauenbewegung schlicht aus sich heraus das Leben der Menschen nachhaltig humaner oder gar glücklicher zu formen vermochten. Das Glück muss doch jeder für sich schaffen, es fehlt hier wie überall ein Stein des Weisen. Wenn zudem etwas den Menschen kennzeichnet, dann seine notorische Unzufriedenheit mit dem Erreichten, das sehr schnell an Attraktivität einbüßt. Das Begehren, so der Psychoanalytiker Jacques Lacan, treibt die Menschen ständig über die gerade erreichten Ziele hinaus.4
Es verwundert daher nicht, dass parallel zu den politisch wie religiös fundamentalistischen Strömungen, die die aufgeklärte moderne Welt ablehnen, traditionalistische oder konservative Kreise ihre Stimme erheben, die vor allem den Liberalisierungstendenzen misstrauen. Besonderes Aufsehen erregten damit zuletzt die Fernsehjournalistin Eva Herman, der FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher und der konservative Gesellschaftskritiker Norbert Bolz. Sinkende Geburtenraten liefern den dramatischen Aufhänger für ihre Warnungen vor dem mit der Emanzipation der Frau verbundenen Zerfall der traditionellen Familie: ein Kassandraruf, in den manche katholischen Bischöfe einstimmen. Sie können sich dabei in eine ungebrochene Linie der Kritik an den modernen Lebensverhältnissen einreihen, zur der neben Leo Strauss unter vielen anderen der katholische Existentialist Gabriel Marcel oder der fundamentalistische Moralphilosoph Alasdair MacIntyre zählen.
Schirrmacher nimmt dabei eine relativ moderate Position ein: Man wird die Frauen schwerlich in die Rolle zurückdrängen können, die sie um 1900 herum noch an die Familie fesselte. Wenn sich allerdings die Frauen aus der Familie in die Arbeitswelt verdrücken, dann gibt es zwar genug zu essen, aber der »Vorrat an verwandtschaftlichen Beziehungen« schwindet. Um die Tragödie des Nachwuchsmangels zu verhindern, müssen Frauen heute daher wieder einiges von dem freiwillig leisten, was sie vor ihrer Emanzipation zu tun gezwungen waren: nämlich liebevoll aufopfernde Hingabe. Wenn zu wenig Kinder auf die Welt kommen und sich die sozialstaatlichen Bande lockern, die die zerfallenen Familienstrukturen nicht mehr ersetzen, dann stellen sich folgende Fragen: »Wer rettet dann wen, wenn es ernst wird, wer versorgt wen, wenn es Not tut, wer vertraut wem, wenn es schlimm wird, wer setzt wen als Erben ein, wenn es zu Ende geht? Und vor allem: Wer arbeitet für wen, auch wenn kein Geld da ist?«5 (SM 21) Wie also bewegt man Frauen zu nicht bezahltem, wiewohl unabdingbarem Dienst am Nächsten bzw. zumindest ein Stück weit zum Verzicht auf eigene berufliche oder weitere Interessen? Nur der Altruismus von Frauen halte die Gesellschaft »im Innersten« zusammen. Das gelinge nicht dem Markt und nicht dem Staat. Dazu brauchte es elterliche Fürsorge, für die man weder Orden erhält noch irgendeine pekuniäre Entlohnung. Frauen müssten in diesem Sinn wieder Weiblichkeit entwickeln.
Eva Herman greift den Feminismus frontal an und stellt die Errungenschaften der Emanzipation generell in Frage: Sind emanzipierte Frauen überhaupt noch Frauen? Die Emanzipation verlange einen viel zu hohen Preis. Die Logik, die dagegen heute vonnöten erscheint, laute, Selbstverwirklichungsansprüche aufzugeben, um Weiblichkeit zurückzugewinnen, also genau auf das zu verzichten, was Simone de Beauvoir fordert. Die Journalistin versteht die Weiblichkeit nicht als individuelle Wahl. Die Frau soll ihr Leben nicht nach Karrierevorstellungen führen, sondern nach den überlieferten Ideen einer Weiblichkeit, die sich in der Familie erfüllt. Dementsprechend skizziert sie ein so benanntes Eva-Prinzip. Es »drückt Hoffnung aus, Lebensfreude, einen Sinn für Werte. Es verbindet uns Menschen ohne die Frage nach einem bestimmten Entgelt. Es schenkt Liebe und Sicherheit, Treue und Zuverlässigkeit. Verabschieden wir uns vom Ich. Wir Frauen haben alle Gaben, die wir dafür brauchen.«6 (HE 59) Die neue Eva, die nicht mehr um ihr eigenes Selbst, sondern um ihre Kinder kreist, kehrt dann selbstverständlich zu den traditionellen Tugenden zurück, die Liebe nicht mit Sexualität, Erotik, dionysischer Leidenschaft verknüpfen, sondern mit Berechenbarkeit, der sich allein die Stabilität von Familien verdankt. Ähnlich wie bei Frank Schirrmacher geht es also um unbezahlte Familienarbeit, da diese weder der Staat noch die meisten Ehemänner abgelten können.
Scheitert die Emanzipation? Begreift man heute wieder die weibliche Natur der Frau, die sich in der Kindererziehung und der Fürsorge um die Verwandten verwirklicht? Stellt die Emanzipation gar eine Entfremdung genau von dieser Natur dar? Schließlich führt sie die Frauen in die Arbeitswelt anstatt ins Ehebett, kommen auf diese Weise immer weniger Kinder auf die Welt, verschiebt sich die Alterspyramide. Nähert sich das Abendland seinem Ende, wenn Frauen sich von der Mütterlichkeit und der Familie abwenden und andere Lebenswege im Beruf wie in den zwischenmenschlichen Beziehungen verfolgen? Müssen sich Frauen stattdessen in Liebe und Ehe verwirklichen? Sollte die moderne Gesellschaft ins Patriarchat zurückkehren? Das liegt angesichts des terroristisch aufgeladenen Konflikts der Kulturen gar nicht so fern, schreibt doch jüngst der politische Philosoph Otfried Höffe: »So gut wie alle Kulturen schätzen Gegenseitigkeit (Reziprozität) verbunden mit Großzügigkeit hoch ein. Sie kennen ein Inzestverbot (…) und sie lehnen sexuellen Libertinismus ab.«7 (HL 30) In der westlichen Welt haben sich aber im Zuge der Emanzipation gerade gewisse Formen desselben, nämlich freiere Liebe, im Anschluss an de Beauvoir und Sartre, und öffentliche Homosexualität verbreitet. Daran, vor allem an der Emanzipation der Frau, nehmen auch Vertreter des Islam Anstoß.
Oder hat Simone de Beauvoir mit ihrem Buch Das andere Geschlecht den Frauen den Weg gewiesen: nicht nur in die Freiheit von patriarchalischer Bevormundung, sondern vor allem in die Verwirklichung ihres eigenen Lebens, für dessen Scheitern sie dann auch selbst die Verantwortung tragen? Ist der Feminismus im Grunde ein Existentialismus, wie ihn Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre in den vierziger Jahren entwarfen? Kann der Feminismus eine solche Perspektive der aktuellen Feminismuskritik in Zeiten von Geburtenrückgang sowie einer alternden Gesellschaft entgegenstellen?
1.KAPITEL
WAS HEISST FRAU SEIN?
»Wie kann ein Mensch sich im Frau-Sein verwirklichen?« Die Alternative, die heutige Kritiker der Emanzipation der Frau oder dem Feminismus anbieten, unterscheidet sich nicht grundsätzlich von jener, vor der Simone de Beauvoir Mitte des letzten Jahrhunderts stand. Nur, dass die heutige Fragestellung vom Faktum einer bereits fortgeschrittenen Emanzipation ausgeht und sich eventuell vor der Wahl sieht, von dieser einfach wieder ab- und in die Vergangenheit zurückzukehren – und sei es mit Gewalt wie im Iran und im Afghanistan der Taliban–, oder an den Stand der Dinge anzuknüpfen und die Emanzipation eher nur abzuwandeln. Jedenfalls lautet die Alternative: Verwirklicht sich die Frau, indem sie in die traditionellen Frauenrollen schlüpft, indem sie deren Weiblichkeit auslebt? Oder verwirklicht sie sich, indem sie davon unabhängig ihren eigenen Lebensweg wählt und sich dabei nicht mehr am überlieferten Frauenbild der Gattin und Mutter orientiert?
Damit drängt sich für Simone de Beauvoir zunächst die Frage auf: Was heißt es überhaupt, eine Frau zu sein? Was hat es auf sich mit dem naturgegebenen Wesen der Weiblichkeit? Da gilt es genauer hinzuschauen. Das andere Geschlecht stellt im ersten Teil auf einer allgemeinen Ebene die Geschichte und den Mythos der Frau sowie Antworten aus der Biologie, der Psychoanalyse und dem historischen Materialismus dar. Der zweite Teil widmet sich den konkreten Erfahrungen von Frauen mit ihrem Geschlecht, in der Familie, in der Liebe und entwickelt am Ende Perspektiven der Emanzipation. Es stützt sich auf viele Beobachtungen und Gespräche de Beauvoirs, auf historisches und literarisches Material.
Geschichte der Frau
Was heißt eine Frau sein? Hat die Frau eine Geschichte? Wenn es ein natürliches Wesen der Frau gibt, dann erscheint das unveränderlich, schließt also eine Geschichte aus. Allerdings haben die modernen Naturwissenschaften längst gezeigt, dass die Natur selbst sich wandelt, dass sich also auch in der Natur kaum unveränderliche Kerne der Dinge diagnostizieren lassen. Selbst das Gen ist kein harter Kern, sondern ein sich selbst reproduzierender, sich kopierender Mechanismus und ständig in Veränderung begriffen.8 Wenn man Weiblichkeit folglich als ein Produkt historischer Umstände versteht – und sei es auch nur in ihren oberflächlichen Erscheinungsweisen–, dann kann man Wandlungen als Geschichte darstellen.
Für de Beauvoir besaßen die Männer gegenüber den Frauen seit Entstehung der Menschheit einen biologischen Vorteil. Sie sind größer und stärker und nicht mit der Schwangerschaft belastet. Die Männer verbannten daher die Frauen in die schwächere und unsichere Rolle der Anderen, also des permanent anderen Geschlechts, das sich nur durch ihr eigenes, das erste Geschlecht definiert. Der französische Titel von Das andere Geschlecht lautet denn auch Le Deuxième Sexe, ›das zweite Geschlecht‹, also implizit etwas Zweitrangiges.
Simone de Beauvoir dementiert mythische Vorstellungen von einem matriarchalischen Reich, einer Art goldenem Zeitalter der Frau. Es gab nie nachhaltige Wechselbeziehungen zwischen den Geschlechtern. Man stellte die Frau außerhalb des Menschenreichs als Erde, als Göttin, als Mutter Gottes, als Mutter schlechthin, die sich ihre Anerkennung durch die Beschränkung auf diese Aufgabe erkauft. Ihr eignet nicht die gleiche menschliche Würde wie dem Mann. Simone de Beauvoir konstatiert: »Sie ist dazu bestimmt, unterworfen, besessen, ausgebeutet zu werden wie die Natur, deren magische Fruchtbarkeit sie verkörpert.« (AG 99) Noch 1699 erklärte ein Gelehrter, dass sich das Spermatozoon im Laufe seiner Entwicklung gewissermaßen nur häute. In ihm liege der kleine Mensch schon vollständig vor. Die Frau trage dazu gar nichts bei: sie brüte nur. Dass Ei und Samenzelle miteinander verschmelzen, dass die Frau einen biologischen Beitrag zum werdenden Menschen leistet, das wurde erst gegen Ende des 19.Jahrhunderts genauer untersucht.
Die Situation der Frauen hing natürlich wesentlich von der jeweiligen sozialen Schicht ab. Die römische Ehefrau übernahm zwar die Position der Herrin im Haus – lateinisch domina–, aber ihr wurde eine sehr strenge Ehe- und Sexualmoral auferlegt. Auch die wohlhabende Bäuerin genoss im Mittelalter hohes Ansehen und besaß die Autorität im Haus. Intellektuelle Frauen spielen dagegen regelmäßig eine Außenseiterrolle, was sich erst nach dem Tod Beauvoirs nachhaltig zu ändern beginnt. In praktisch allen Kulturen lebten die Frauen in der Funktion des Lasttieres, wenn sie zu unteren Schichten und Klassen gehörten. Gerade auf dem Land sahen sie sich zu allen Zeiten härtester Fron ausgesetzt. Mit der industriellen Revolution änderte sich die Lage zunächst wenig. Man benötigte Heere an Arbeitskräften, für die man auch Frauen rekrutierte. Doch anstatt dass die bezahlte Arbeit ihre Stellung gehoben hätte, steigerten sich nur ihre Belastungen. Man zog sie zu den einfachsten und monotonsten Arbeiten heran, und selbst dort, wo sie dieselbe Arbeit wie Männer verrichteten, erhielten sie nie den gleichen Lohn – eine Tendenz, die bis heute anhält, wo Deutschland in dieser Hinsicht im europäischen Vergleich noch 2007 negative Schlagzeilen produziert.
Man warf de Beauvoir vor, die sozialen Unterschiede zwischen Frauen zu wenig zu beachten. In der Tat bleibt ihre Perspektive allgemein und existentialistisch, schuldet sich also primär ihrer eigenen Situation. Doch die weibliche Anthropologie oder die Menschheitsgeschichte aus der Perspektive der Frau spiegelt sich in jeder individuellen Existenz. Selbst den Mann beängstigt die Freiheit, sein Leben selber organisieren, führen und bewältigen zu müssen. Doch dieser Zwang, an dem er durchaus scheitern kann, eröffnet ihm seine Lebensperspektiven. Die Frauen werden dagegen so erzogen, dass sie solche Herausforderungen meiden, gar nicht nach dem eigenen Lebensentwurf streben: »Von Kindheit an und ihr ganzes Leben lang wird sie verwöhnt und verzogen, indem man ihr als ihre Berufung jene Selbstaufgabe vor Augen hält, die für jedes von seiner Freiheit beängstigtes Existierendes eine Versuchung ist.« (AG 887) Es muss nicht verwundern, wenn Frauen dann dazu neigen, sich lieber durch ihre jeweiligen Ehemänner oder Lebenspartner zu bestimmen, als sich anzustrengen, ihr Leben bewusst selbst zu formen. De Beauvoir zitiert den schottischen Ethnologen James George Frazer mit dem Satz: »Die Männer machen die Götter, die Frauen beten sie an.« (zit. AG 103)
Um 1950 hapert es noch in fast allen Ländern mit der rechtlichen Gleichstellung, erleiden Frauen vielmehr immer noch massive Benachteiligungen – eine Sachlage, die sich in der westlichen Welt seither sicherlich verbessert hat, aber selbst hier keineswegs als überall vollendet erscheint, geschweige denn wenn man über die Grenzen Europas hinaus zu den Nachbarn schaut. Selbst wenn sich diese Gleichheit heute fast 60Jahre nach dem Erscheinen von Das andere Geschlecht erheblich weiter entwickelt hat – wozu de Beauvoir mit ihrem Buch als Vordenkerin der Emanzipation und des Feminismus wesentlich beitrug–, besetzen die Männer immer noch die gehobeneren sozialen Positionen, schöpfen sie in einem viel größeren Maße die Welt als die Frauen. So gilt der Satz de Beauvoirs immer noch – weltweit allemal, aber auch im Abendland: »Zwischen den Geschlechtern besteht heute keine wirkliche Gleichheit.« (AG 185) Der Weg dorthin deutet sich für de Beauvoir indes schon an: »Erst seit die Frauen angefangen haben, sich auf dieser Erde heimisch zu fühlen, konnte es eine Rosa Luxemburg, eine Madame Curie geben. Sie beweisen brillant, dass nicht die Unterlegenheit der Frauen ihre historische Bedeutungslosigkeit bedingt hat, sondern dass es ihre historische Bedeutungslosigkeit war, die sie zur Unterlegenheit verurteilt hat.« (AG 182)
Des Mädchens triste Zukunft
Was heißt eine Frau sein? Die Geschichte der Frau zeigt die Ungleichheit der Geschlechter auf. Was folgt daraus: das Festhalten an der Ungleichheit, weil diese der Natur und der Geschichte entspricht, oder die Emanzipation, um die unterdrückende Ungleichheit zu beenden?
Lässt sich ein Wesen der Frau aus ihrer Lebensgeschichte heraus bestimmen? Die Geschichte der Unterlegenheit der Frau beginnt für de Beauvoir schon in der Kindheit. Die Geschlechterdifferenz nämlich erlebt das kleine Mädchen als Nachteil. Will es urinieren – so de Beauvoir 1949–, so muss es sich hinhocken. Daher muss es sich entblößen, ergo sich verstecken, was es nicht nur als einen unbequemen, sondern einen erniedrigenden, letztlich beschämenden Vorgang erlebt. Andererseits glaubt das Mädchen, dass der Knabe seinen Penis als Spielzeug benutzen kann, schließlich lässt er sich in die Hand nehmen. Dagegen tabuisieren die Eltern und Erzieher die Geschlechtsorgane des Mädchens und verstärken damit diese Erfahrung überhaupt erst so, dass sie die Unterwürfigkeit der Frau vorbereiten. Daher hätte das Mädchen gerne einen Penis, spricht Sigmund Freud gar vom Penisneid.
Der Horizont des Mädchens verengt sich vor allem dadurch, dass man in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts seinen Umgang weitgehend auf andere weibliche Wesen beschränkt. Man vermittelt ihm Freundinnen, lässt es von Lehrerinnen erziehen oder es lebt unter den Matronen der Familie. Die Erziehung stützt sich dabei auf Bücher und Spiele, die den Weg in das weibliche Schicksal ebnen, vermeintliche weibliche Weisheit eintrichtern, in weibliche Tugenden einüben und weibliche Fertigkeiten züchten wie Kochen, Nähen, Haushaltsführung, Körperpflege, Anmut und natürlich vor allem Anstand. De Beauvoir beruft sich auf einen bekannten französischen Historiker aus dem 19.Jahrhundert: »Ein Fluch, der auf der Frau lastet – genau das hat auch Michelet hervorgehoben–, besteht darin, dass sie in ihrer Kindheit Frauenhänden überlassen bleibt.« (AG 349)
Daher werden Mädchen auch nicht früher als Jungen erwachsen, wie es die gängige Meinung suggeriert. Die Mentalität der erwachsenen Frau insgesamt gelangt vielmehr über eine gewisse Kindlichkeit nicht hinaus. Natürlich fühlt sich die ältere Tochter geschmeichelt, wenn sie gegenüber ihren Geschwistern das Mütterchen spielen, Befehle erteilen und vernünftig daherreden darf. Zunächst möchte das Mädchen auch in die Rolle der Mutter und der älteren weiblichen Verwandten und Bekannten der Familie schlüpfen, also letztlich selbst zur Matrone avancieren; denn es glaubt, dass die Matronen die Welt beherrschen, jedenfalls solange, bis es einsieht, dass die wahren Herren nicht die Matronen, sondern die Männer sind: nach de Beauvoir eine viel dramatischere Einsicht als die Entdeckung des Penis.
Mädchen lernen daher von frühester Jugend die Verehrung der Männer. Um sie drehen sich Mythen, Legenden und Lieder, die das kleine Mädchen faszinieren. Sie berichten davon, dass Männer Griechenland, das Römische Weltreich oder Frankreich – überhaupt alles auf der Welt schufen. Ob als Großväter, Brüder, Onkel oder Väter, ob als Lehrer, Ärzte oder Pfarrer– Männer ziehen das Mädchen in ihren Bann, so dass die erwachsene Frau dem Mann eine rührende Achtung entgegenbringen wird. Die Liebe solcher Männer möchte das Mädchen einmal gewinnen.
Doch sie kann dazu nichts beitragen, außer zu warten wie Dornröschen, Aschenputtel oder Schneewittchen. Denn sie gestaltet ihr eigenes Leben nicht selbst. Wenn sich ihre Existenz als Frau abzuzeichnen beginnt, spürt sie entsetzt das ihr bevorstehende Schicksal. Für den Mann umschreibt die Ehe nur einen Teil seines Lebens. »Für das Mädchen dagegen«, so Simone de Beauvoir, »steht bei der Ehe, der Mutterschaft das ganze Schicksal auf dem Spiel, und sobald es auch nur eine Ahnung von den damit verbundenen Geheimnissen bekommt, erscheint sein Körper ihm in hassenswerter Weise bedroht. Mit dem Zauber der Mutterschaft ist es vorbei: Ob es früher oder später, bruchstückhaft oder zusammenhängend darüber aufgeklärt worden ist, es weiß, dass ein Kind nicht von ungefähr in den Mutterleib gelangt und dass es nicht mit dem Zauberstab herauskommt. Voller Angst stellt es sich Fragen: Oft ist ihm die Vorstellung, dass in seinem Körper ein kleiner Parasit gedeihen soll, nicht mehr wunderbar, sondern abscheulich. Der Gedanke an den monströsen dicken Bauch erfüllt es mit Entsetzen.« (AG 369) In der Pubertät beginnt sich die Welt den Knaben zu öffnen, den Mädchen verschließt sie sich langsam und endgültig. Es dürfe nicht verwundern, wenn in diesem Lebensalter bei Frauen daher häufig Psychosen ausbrechen.
Im Grunde hatten Frauen um 1900 herum kaum eine Chance, diesem Schicksal zu entgehen, es sei denn als alte Jungfer, über die sich alle Welt lustig machte. Simone de Beauvoir bewunderte die noch wenigen älteren Frauen, die wie Männer ihr eigenes Geld verdienen und wie diese im Leben stehen, beispielsweise Lehrerinnen oder Erzieherinnen. Sie symbolisieren eine Chance der Unabhängigkeit, ihrem vermeintlichen Schicksal doch zu entrinnen, wiewohl sie dann auf Weiblichkeit und Mutterschaft im traditionellen Sinn weitgehend verzichten müssen – was ihnen natürlich auch nicht leicht fällt. Man sollte das mit dem priesterlichen und mönchischen Zölibat vergleichen, wenn man dessen Motive nicht allein in Vermeidung von Sünden sucht, sondern vielmehr darin, eine mühselige Existenz als Vater und Ehemann zu umgehen, um sich interessanteren Angelegenheiten widmen zu können.
Früh haderte de Beauvoir mit ihrer streng katholischen Mutter, für die die Mutterrolle die zentrale Aufgabe der Frau darstellte. Dagegen verkörperte der geistig rege Vater, wiewohl nur ein kleiner Beamter, die andere attraktive Welt, nach der zu streben de Beauvoir frühzeitig beschloss: »Kinder zu haben, die ihrerseits wieder Kinder bekämen, hieß nur das ewige alte Lied wiederholen; der Gelehrte, der Künstler, der Schriftsteller, der Denker schufen eine andere leuchtende, frohe Welt, in der alles seine Daseinsberechtigung erhielt. In ihr wollte ich meine Tage verbringen; ich war fest entschlossen, mir darin einen Platz zu verschaffen!« (MT 130) Da die Familie in Wirtschaftskrisen ihr Vermögen weitgehend verloren hatte, musste sie in eine kleinere Wohnung umziehen. Die Mutter musste auf die Haushaltshilfe verzichten, Simone bekam nur noch Bücher zur Lektüre als billiges Vergnügen. Der Vater offenbarte seinen beiden Töchtern, dass sie mangels Mitgift kaum die Chance auf eine gute Heirat hätten. Als de Beauvoir später nach dem Studium dann wirklich Lehrerin wurde und gar nicht daran dachte zu heiraten, verletzte das den Vater trotzdem. Auf diese Weise gelangte de Beauvoir jedenfalls in eine vergleichsweise komfortable Position. Sie verfasst schließlich Das andere Geschlecht, ohne Kenntnis der feministischen Literatur. Vielleicht verdankt sich sein Erfolg gerade diesem nüchternen Blick, der sich die Geste der Betroffenheit spart.
Für ihre Ablehnung bürgerlicher Lebensformen, besonders der Mutterrolle, war Elizabeth Mabille, Spitzname Zaza, die engste Freundin de Beauvoirs, mitverantwortlich, die sie ob ihrer geistigen Lebendigkeit und Unabhängigkeit tief bewunderte. Als de Beauvoir sich dem Ende ihres Studiums näherte, isolierte deren Familie Zaza von ihr und organisierte für sie eine bürgerliche Vernunftehe, auf die sie sich zuvor nie einlassen wollte. Sie starb daraufhin unter merkwürdigen Umständen. Immer versuchte de Beauvoir über sie zu schreiben. In ihrem ersten Band der Memoiren einer Tochter aus gutem Hause glückte es ihr, Zaza eine Art Denkmal zu setzen: »Zusammen haben wir beide gegen das zähflüssige Schicksal gekämpft, das uns zu verschlingen drohte, und lange Zeit habe ich gedacht, ich hätte am Ende meine Freiheit mit ihrem Tode bezahlt.« (MT 341)
Das Drama der weiblichen Sexualität
Was heißt Frau sein? Die Entwicklung des Mädchens führt nach traditionellem Muster in die Existenz als Hausfrau und Mutter, auf die sie hin erzogen wird. Lässt sich das Wesen der Frau aus dem bestimmen, was sie üblicherweise zur Frau macht, nämlich aus der Sexualität? »Langsam entwickelt sich« – so de Beauvoir – »die Empfindsamkeit der erogenen Zonen, und diese sind bei der Frau so zahlreich, dass man ihren ganzen Körper als erogen betrachten kann: Die Heranwachsende merkt es an ihrer Reaktion auf vertraute Zärtlichkeiten im Familienkreis, auf harmlose Küsse, auf zufällige Berührungen durch die Schneiderin, den Arzt, den Friseur, auf die freundschaftliche Hand, die sich ihr auf das Haar oder auf die Schulter legt. Sie lernt eine tiefere Verwirrung kennen, die sie beim Spielen und Balgen mit Jungen oder Mädchen absichtlich herzustellen sucht.« (AG 392)
Natürlich gestehen die Sitten Mädchen im Jahr 1949 (man darf fragen, ob sich das bis heute wirklich egalisierte) nicht dieselben Freiräume zu wie Jungen. Zudem droht ihnen beim ersten Sex eine Verletzung, die sie durch die Inbesitznahme durch Männer erleiden werden. »Aber mehr noch als die Verletzung und den damit einhergehenden Schmerz«, schreibt de Beauvoir, »lehnt [das Mädchen] die Tatsache ab, dass sie ihm zugefügt werden. ›Es ist eine furchtbare Vorstellung, von einem Mann durchbohrt zu werden‹, sagte mir eine Jugendliche. Der Abscheu vor dem Mann wird nicht durch die Angst vor dem männlichen Glied erzeugt, die vielmehr Bestätigung und Symbol eines bestehenden Abscheus ist. Die Vorstellung der Penetration erhält ihren obszönen und erniedrigenden Sinn innerhalb einer allgemeineren Form, der sie selbst als ein wesentliches Element angehört.« (AG 395)
Männer übernehmen beim Sex überhaupt die aktive Rolle, bleiben Subjekte, während sie Frauen zum Objekt degradieren. Auch Simone de Beauvoir selbst leidet noch unter dieser Perspektive, wie man zumindest aufgrund ihrer Romane vermuten darf, die sie selbst als den bedeutendsten Teil ihres Werks betrachtete. In ihrem wohl wichtigsten Roman Die Mandarins von Paris, für den sie den höchsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt erhielt, legt sie 1954 ihrer Protagonistin Anne, die autobiographische Züge trägt, die Worte in den Mund: »Seine Hände rissen mein Hemd weg, sie streichelten meinen Schoß, und ich gab mich der schwarzen Sturzwelle des Verlangens hin: empor getragen, gewiegt, wieder untergetaucht, gehoben, in die Tiefe geschleudert: Sekunden gab es, in denen ich vom Gipfel herab ins Leere stürzte, ich sollte im Vergessen, in der Nacht ertrinken – welche Reise! Seine Stimme warf mich aufs Bett zurück: ›Muss ich aufpassen?‹ – ›Wenn das möglich ist.‹ – ›Bist du nicht abgeriegelt?‹«9 (MP 70)
Lange Zeit wurden Frauen als Wesen betrachtet, denen kein eigenes sexuelles Begehren eigne. Wenn doch, so hielt man sie schnell als vom Teufel besessen und zerrte sie vor das Hexengericht und auf den Scheiterhaufen. Sicherlich räumt spätestens Freud mit dieser Mär auf. Doch derjenige, der als erster die Dynamik der Sexualität erkannte und generalisierte, das war Marquis de Sade. Seine zentrale These, die vor allem auch die Frauen betrifft, formuliert de Beauvoir 1955 in ihrem Essay Soll man de Sade verbrennen: »Die Libido ist allgegenwärtig, und sie ist stets viel mehr, als sie ist: Diese große Wahrheit hat Sade zweifellos zumindest geahnt.«10 (SV 48) Einen gängigen Vorwurf weist de Beauvoir jedoch im dritten Band ihrer Memoiren Der Lauf der Dinge von sich: »Ich hätte sexuelle Zügellosigkeit gepredigt: Ich habe aber nie einem Menschen geraten, mit wem auch immer und wann auch immer ins Bett zu gehen. Ich bin nur der Meinung, dass auf diesem Gebiet die Wahl, die Zustimmung und die Weigerung nicht den gesellschaftlichen Einrichtungen, den Konventionen und den Interessen unterworfen sein dürften.«11 (LD 188)
Gerade aus ihrer libidinösen Fixierung, die sie in den Dienst des egoistischen Lustgewinns stellt, soll die Sexualität von den Kritikern der Emanzipation gerissen werden. »Der Vatikan«, so konstatiert Judith Butler, »fürchtet sich vor einer Abtrennung der Sexualität vom biologischen Geschlecht, denn das würde die Vorstellung einer sexuellen Praxis einführen, die nicht durch vermeintlich natürliche Fortpflanzungsziele im Zaum gehalten wird.«12 Wenn sie bloß auf sich selbst und nicht auf die Institutionen und ethischen Normen höre, realisiere sich die Frau gerade nicht als Frau, sondern entfremde sich von ihrer Natur, ihrer Weiblichkeit. So heißt es auch bei Eva Herman: »Lassen wir wieder Weiblichkeit zu, Schamgefühl und Intimität, und natürlich Kinderwünsche; geben wir uns nicht länger zufrieden mit der Vereinnahmung der Sexualität durch Theoretiker, die uns jeden natürlichen Zugang zum tiefsten Geheimnis der Natur verwehren wollen. Bekennen wir uns zum Frausein, zum Eva-Prinzip. Und wir sollten auch nicht länger Beziehungen akzeptieren, in denen Männer der puren Bequemlichkeit und Verantwortungslosigkeit wegen unseren Kinderwunsch unterdrücken.« (HE 190)
In der Tat, wenn gerade Männer den Kinderwunsch heute hinterfragen und die Kontrazeptiva ihn ausmanövrieren, dann liegt die Antwort auf der Hand. Der Kinderwunsch darf nicht angetastet werden, man muss ihn vielmehr als nicht weiter hinterfragbares Geheimnis akzeptieren, der »von Scham und Intimität umhüllt« die Frau der Verfügungsgewalt der Männer wie von Frauen entzieht – von solchen Frauen nämlich, die sich nicht in der Weiblichkeit realisieren, sondern die ein selbstbestimmtes, genauer: männliches Leben führen wollen. Doch auf diese Weise bestimmt sich nicht die Natur der Frau, sie bleibt vielmehr in ein mystisches Dunkel gehüllt, in das sich die Frau, ohne nachzudenken, schicken muss: als Entscheidung Mutter zu werden.
Deshalb erfahren sich Frauen stärker als der Mann den Interessen der Gattung ausgeliefert – wie es die Traditionalisten ja auch sehen, wenn sie die sinkenden Geburtenraten als Folge der Emanzipation beklagen. Derart generiert sich die Befruchtung der Frau für de Beauvoir immer als eine Form der Vergewaltigung. Alte Riten bei Hochzeiten – die Entführung der Braut – erzählen noch von diesem Konflikt, wenn man die Frau, die sich nun den Gattungsinteressen beugen muss, gewaltsam in den Stand der Ehefrau versetzt. De Beauvoir bemerkt: »Andererseits ist die Befruchtung für sie bei weitem keine Vollendung des sexuellen Erlebens. Im Gegenteil: Mit der Befruchtung beginnt der Dienst, den die Spezies von ihr fordert und der sich, langwierig und schmerzlich, in der Schwangerschaft, der Niederkunft und im Stillen des Kindes realisiert.« (AG 455)
Wird Frauen ihre weibliche Natur gewaltsam beigebracht? Oder unterstützen diese Unterschiede nicht doch die traditionelle These vom natürlich gegebenen weiblichen Wesen? Norbert Bolz interpretiert eine solche sexuelle Disziplinierung gar als kulturelle Antwort darauf, dass natürliche Sexualität keine dauerhaften Beziehungen zu stiften vermag. Sie erscheint ihm nötig, da sich auf eine ausgelebte Sexualität keine Familie aufbaut. In Die Helden der Familie heißt es: »Es ist das größte Ärgernis für die menschliche Gemeinschaft, dass man die Beziehung von Männern und Frauen nicht dauerhaft auf Liebe basieren kann. Die Welt wäre in Ordnung – d.h. ihre Ordnung wäre, (…) ›repressionsfrei‹–, wenn die Sexualtriebe durch ihre eigene Dynamik imstande wären, stabile Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen zu stiften. Das funktioniert aber nicht, (…)«13