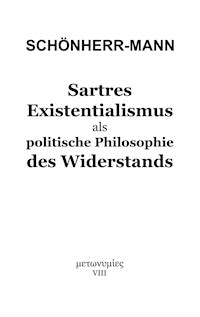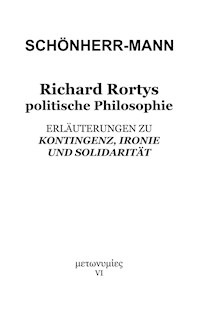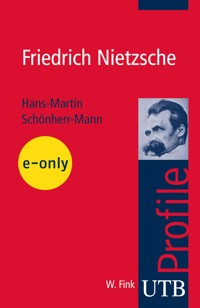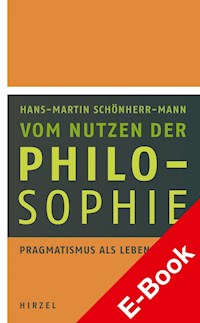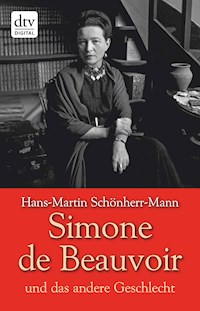Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Campus »Studium«
- Sprache: Deutsch
Die politische Philosophie spielt eine zusehends wichtigere Rolle vor allem in Bezug auf die Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitspolitik. Ihre Grundfragen sind die Gerechtigkeit und Legitimität der politischen Ordnung, der Konflikt zwischen Individuum und Gemeinschaft, Freiheit und Gleichheit oder auch die humane Gestaltung der Biopolitik. Neben dem klassisch traditionellen Modell von Platon bis Leo Strauss erläutert Hans-Martin Schönherr-Mann die Grundmodelle der modernen politischen Philosophie: das performative Modell (Machiavelli, Carl Schmitt und andere), das rationalistische (Kant, Marx, Rawls), das sprachphilosophisch ausgerichtete (Cassirer, Derrida) sowie eines, das die Beziehung zwischen Medien und Politik in den Vordergrund rückt (McLuhan, Baudrillard). Dabei geht es immer auch um die Frage, wie die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger bewahrt und gestärkt werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Martin Schönherr-Mann
Was ist politische Philosophie?
Über das Buch
Die politische Philosophie spielt eine zusehends wichtige Rolle vor allem in Bezug auf die Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitspolitik. Ihre Grundfragen sind die Gerechtigkeit und Legitimität der politischen Ordnung, der Konflikt zwischen Individuum und Gemeinschaft, Freiheit und Gleichheit oder auch die humane Gestaltung der Biopolitik.
Neben dem klassisch traditionellen Modell von Platon bis Leo Strauss erläutert Hans-Martin Schönherr-Mann die Grundmodelle der modernen politischen Philosophie: das performative Modell (Machiavelli, Carl Schmitt und andere), das rationalistische (Kant, Marx, Rawls), das sprachphilosophisch ausgerichtete (Cassirer, Derrida) sowie eines, das die Beziehung zwischen Medien und Politik in den Vordergrund rückt (McLuhan, Baudrillard). Dabei geht es immer auch um die Frage, wie die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger bewahrt und gestärkt werden kann.
Über den Autor
Hans-Martin Schönherr-Mann ist Essayist und Professor für Politische Philosophie an der LMU München.
Für Irmi
Einleitung
Was ist politische Philosophie? Eine sehr allgemeine Antwort darauf lautet: Nachdenken über die Formen, Perspektiven und Zusammenhänge des staatlich geregelten Zusammenlebens der Menschen.
Eine etwas differenziertere Antwort auf diese Frage gibt Leo Strauss, einer der einflussreichsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er unterscheidet in seiner programmatischen Schrift aus dem Jahr 1959 What is Political Philosophy? eine klassische von einer modernen Antwort auf diese Frage. Die klassische politische Philosophie wird vornehmlich von Platon und Aristoteles und anderen antiken Denkern entwickelt. An sie schließen Augustin, Thomas von Aquin und konservative moderne Theoretiker wie Leo Strauss selbst an.
Überblick
Im Zentrum der klassischen Antwort steht die Frage nach dem guten Leben, für das der Staat zu sorgen hat. Das gute Leben bringt alle Fähigkeiten des Menschen zu ihrer Blüte und realisiert folglich das Gute, also primär ethische Vorstellungen, die dadurch der Politik zugrunde liegen. Dementsprechend diskutiert die politische Philosophie die großen politischen Fragen: Was ist das Wesen der Freiheit? Wie legitimiert sich politische Herrschaft? Ein Gegensatz zwischen den BürgerInnen und dem Staat besteht für den klassischen Ansatz nicht – die Menschen sind auf den Staat ausgerichtet.
Heutige Vertreter der klassischen politischen Philosophie gehen davon aus, dass kompetente Eliten die Mehrheit lenken müssen, da Menschen gefährliche wie gefährdete Wesen sind.
Die meisten sind zudem unfähig, sich selbst zu regieren, sie müssen diese Aufgabe also anderen überlassen. So stellt Leo Strauss fest, dass es »eine fundamentale und gleichzeitig spezifische Übereinkunft unter allen klassischen politischen Philosophen gab: das Ziel des politischen Lebens ist die Tugend, und die dazu dienlichste Ordnung ist die aristokratische Republik, oder anders formuliert das gemischte Regime.« (1959: 40; eigene Übersetzung)
Die Republik wird von einer Elite regiert. Doch die Bürger dürfen daran partizipieren und wie im antiken Athen in der Volksversammlung mit abstimmen. Aber nicht alle Menschen sind Bürger. In der Antike trugen die politisch verantwortlichen Eliten ihre Staaten. Einen Gegensatz zwischen sich und ihrem Staat sahen sie gemeinhin nicht. Die große Mehrheit der Menschen war dagegen politisch unmündig. Im Mittelalter fanden sich alle Menschen immerhin in einer göttlichen Ordnung aufgehoben. Aber auch in diesen Epochen trug ohnehin nur ein kleiner Teil von ihnen politische Verantwortung.
Die moderne Antwort auf die Frage nach der politischen Philosophie verkürzt Leo Strauss darauf, dass diese sich nur in der Ablehnung dieser klassischen Antwort einig sei. Doch das ist eine etwas knappe Charakterisierung, die man sogar als solche in Frage stellen darf. Es gibt nicht nur politische Philosophen, die sich entweder – ähnlich wie Strauss – möglichst eng an die Antike anlehnen oder diese ablehnen. Manche bleiben ihr auch in starkem Maße treu, obwohl sie sich wie Jean-Jacques Rousseau auf modernen Wegen befinden. Hegel und Hannah Arendt vertreten originell und pointiert die moderne politische Philosophie, lehnen die Antike aber nicht ab, sondern greifen auf sie in starkem Maße zurück.
Das vorliegende Buch skizziert diese klassische Position im ersten Kapitel, wendet sich dann aber intensiv dem zu, was Leo Strauss in seiner Schrift eher stiefmütterlich behandelt, nämlich die unterschiedlichen modernen Antworten auf die Frage: Was ist politische Philosophie?
Gemeinsam ist den modernen politischen Philosophen, zu deren Vorläufern Niccolò Machiavelli und Thomas Hobbes zählen, dass sie von einem Gegensatz zwischen den BürgerInnen und dem Staat ausgehen.
Im 18. Jahrhundert erheben bürgerliche Kreise Ansprüche auf politische Teilhabe. Sie sehen sich durch den von Adel und Klerus beherrschten Staat nicht vertreten. Im 19. Jahrhundert erhebt die Arbeiterklasse Ansprüche auf Mündigkeit. Bis heute emanzipieren sich diverse Bevölkerungsgruppen: Juden, Frauen, Farbige, Ausländer und Homosexuelle. Solche unterschiedlichen Interessen vermag der Staat kaum mehr zu integrieren, so dass er in Gegensatz zu vielen BürgerInnen und ganzen sozialen Gruppen gerät.
Seit der Renaissance entfaltet sich die Aporie zwischen Individuum und Staat als der große, neuzeitliche wie moderne Konflikt, der von der modernen politischen Philosophie unterschiedlich interpretiert wird. Die liberal orientierten Positionen betonen die Mündigkeit und Autonomie der BürgerInnen, so dass sich dieser Konflikt nicht aufheben, sondern höchstens moderieren lässt, bzw. der Staat muss den Interessen der BürgerInnen dienen. Doch diese sind so unterschiedlich, dass ihm dies kaum gelingt. Die gemeinschaftsorientierten Positionen, zu denen natürlich auch traditionalistisch konservative wie jene von Leo Strauss gehören, ordnen die Individuen dem Staat oder dem Gemeinwohl unter. Die Entstehung dieses Konfliktes schreiben sie zumeist der modernen Kulturentwicklung zu und betrachten diese Prozesse entweder als Niedergang (wie Rousseau) oder (wie Marx) als dialektischen Motor des Fortschritts.
Eine moderne, primär technische, somit performative Antwort entsteht wie alle anderen modernen Positionen seit dem 16. Jahrhundert. Sie wendet sich weit vom antik klassischen Konzept ab. Es geht ihr weder primär um das Gerechte noch um das Gute, sondern um Machterhalt, Sicherheit und um eine effiziente Politik. Deren Wirkung steht im Vordergrund – daher performativ: to perform bedeutet, etwas durchzuführen. So orientiert sie sich ethisch nicht an Normen oder Werten, sondern an den Wirkungen des Handelns, für die die Politik die Verantwortung übernehmen soll. Als ethischer Grundzug der Moderne tritt die Verantwortungethik an die Stelle der Normenethik.
Die performative politische Theorie lässt sich dabei durch zwei grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven beschreiben, nämlich primär mit der Formel Politik als eine Technik der Herrschaft, wie sie bereits von Machiavelli in seinem Buch Il Principe propagiert wird. Solcherart Politik orientiert sich nicht an Moral oder Ethik, also nicht mehr an der Frage nach dem guten Leben und damit am Guten schlechthin. Schließlich gibt es entweder keine derartigen Gemeinsamkeiten mehr oder die Menschen ordnen sich nun mal nicht mehr freiwillig dem Staat unter. Daraus entwickelt sich ein modernes Verständnis von Politik, das nach dem Funktionieren des Staates fragt und dabei dessen Legitimitätsgründe ebenfalls nur diagnostisch bzw. deskriptiv untersuchen will.
Daher geht es in der Politik primär darum, möglichst effizient oder geschickt einerseits für stabile politische Verhältnisse zu sorgen und andererseits mit diesen Verhältnissen einem bestimmten Teil der BürgerInnen Vorteile zu verschaffen. Denn Politik wird nicht die Interessen aller BürgerInnen gleichmäßig verwirklichen und mit dem immer wieder propagierten Gemeinwohl doch nur bestimmten Gruppen dienen. Der Konflikt zwischen Staat und Individuum wird in der Regel zu Lasten einer Mehrheit und zu Gunsten einer Minderheit ausgetragen. Doch selbst wenn es umgekehrt wäre, dürften die Interessen der Minderheit nicht vernachlässigt werden.
Die meisten Positionen gehen dabei vom Faktum eines hierarchischen Staates aus, halten dieses denn auch normativ für geboten oder für unveränderlich. Andere Positionen unterstellen, dass sich diese Struktur durchaus verändern lässt und halten dergleichen für normativ geboten bzw. zielen darauf ab, die Strukturen dementsprechend wirklich zu verändern. Dabei wollen sozialistische und anarchistische Modelle die staatliche Herrschaft von Menschen über Menschen durch einen sachlichen Verwaltungsstaat ersetzen. Daher vertreten auch manche performativen Positionen emanzipatorische Absichten. In diesem Sinne analysiert eine zweite Grundkonzeption Politik als ein Geflecht von Machtbeziehungen, das bei Michel Foucault in politische, soziale und individuelle Techniken des Umgangs mit Macht ausläuft. Dabei wird das Individuum weder normativ noch machttechnisch dem Staat unterworfen. Vielmehr werden die individuellen Möglichkeiten analysiert, unter solchen Bedingungen eigene Vorstellungen und Interessen zu realisieren.
Eine weitere Position orientiert sich rationalistisch normativ. Auf die Frage »Was ist politische Philosophie?« antwortet sie mit einer möglichst allgemein akzeptablen Begründung des Rechts und der politischen Institutionen, die ersteres setzen, kontrollieren und ausgestalten, um damit eine gerechte politische Ordnung zu etablieren. Daher handelt es sich nicht um eine primär performative Antwort auf die politischen Herausforderungen, sondern um eine ethische Antwort. Die Frage »Was ist politische Philosophie?« lässt sich durch die Frage ersetzen: Was ist Gerechtigkeit? Genauer, wann sind politische Verhältnisse gerecht?
Darauf geben die vielen Vertreter dieses Ansatzes natürlich sehr unterschiedliche Antworten wie beispielsweise John Locke: wenn sie das Eigentum schützen! Oder John Stuart Mill: wenn sie die Freiheitsrechte der BürgerInnen sichern! Allen diesen Antworten ist gemeinsam, dass sie die Gerechtigkeit einer politischen Ordnung auf ein Legitimitätskriterium stützen, von dem sie jeweils unterstellen, dass alle BürgerInnen diesem Kriterium zustimmen können, also nach dem Muster: Wenn der Staat für soziale Gerechtigkeit sorgt, dann schafft er gerechte Verhältnisse, somit eine sittliche Ordnung, der alle BürgerInnen nicht nur zustimmen können, sondern zustimmen müssen.
Einerseits betrachtet man unter bestimmten anthropologischen Prämissen analytisch die Strukturen des Staates und des Politischen. Andererseits kritisiert man diese realen Strukturen von normativen Geltungsansprüchen aus oder von utopischen Modellen als ethischen Idealen aus. Oder man entwirft normative Begründungsszenarien zur Legitimation von Grundprinzipien für die Grundstruktur von Staat und Gesellschaft. In der Aufklärung bedient man sich dabei vornehmlich naturrechtlicher und ethischer Ansätze. Im 19. Jahrhundert konzentriert man sich auf Staat und Rechtssystem. Im 20. Jahrhundert werden neben pragmatischen Konzepten vornehmlich normative Modelle entwickelt, die das aufklärerische Programm der Moderne vollenden sollen.
Das normativ rationale Modell unterscheidet sich vom technischen Modell durch ein klares Primat der Gerechtigkeit gegenüber dem Prinzip des Machterhalts und der Sicherheit.
Die vierte Antwort überschreitet sowohl den klassischen, den technischen wie den rational normativen Ansatz in einer Perspektive, die Leo Strauss nicht hinlänglich wahrnimmt, die ihm vielleicht gar nicht so stark bewusst werden konnte. Sie schließt an den linguistic turn an, somit an die Sprachphilosophie, die originäre und avancierteste Philosophie des 20. Jahrhunderts. Die Sprachphilosophie bemerkt, dass die Voraussetzung für das Weltverständnis, damit auch für jedes politische und soziale Denken nicht in hehren Vorstellungen vom ethisch Guten gründet, auch nicht in bestimmten materiellen oder sozialen Interessen, auch nicht in einer blanken Machttechnik, sondern in der Sprache selbst, in deren Funktionen und Strukturen.
Aus sprachphilosophischer Perspektive sind dementsprechend nicht politische Inhalte von erster Bedeutung, sondern politische Symboliken und deren Wirkungen.
Staat und Politik werden nicht mehr unter performativen Bedingungen des Handlungszwangs bestimmt, der Konsens verlangt, sondern sprachphilosophisch als Ort sozialer Konflikte, die ausgetragen und ausgehalten werden müssen, so dass an die Stelle des Konsenses der Dissens tritt. Damit situiert sich dieses Modell ausschließlich auf demokratischem Boden.
Es gibt hierbei allerdings auch verschiedene Bemühungen, das soziale Band unter Bedingungen des sprachphilosophisch unhintergehbaren Dissenses zu restabilisieren. Entweder versucht man den mit dem linguistic turn verbundenen Nominalismus materiell und pragmatisch rückzubinden oder man begreift die Sprache selbst als einigendes Band. Obwohl sich die Idee der Gerechtigkeit nicht mehr universell normativ aufladen lässt, bleibt sie als formaler Anspruch an die Sprache bestehen, die den Dingen doch gerecht werden sollte.
Das linguistische Modell ist posttraditionell und emanzipatorisch orientiert. Was ist politische Philosophie? Das linguistische Modell stellt die Frage der Gerechtigkeit jetzt als Konflikt verschiedener Sprachen oder Diskurse, die sich nur schwierig ineinander übersetzen lassen bzw. die sich gegenseitig schlicht kaum verstehen können. Mit dieser sprachlichen Orientierung spiegelt dieses Modell die Vielfalt der Lebensformen wider und erhebt somit emanzipatorische Ansprüche. Das Individuum ist zwar in die Sprache als Lebensform eingebunden. Doch es formuliert nun eigene Forderungen gegenüber dem Staat, denen er gerecht werden muss.
Die fünfte Antwort schließt an das Problem der Sprache an, wendet sich allerdings einer neuen technologischen Entwicklung zu, die es in dieser Form zuvor nicht gab, nämlich den Massenmedien, die die Politik heute in starkem Maße prägen. Zwar bemerkt Hannah Arendt, dass bereits im Mythos politische Ereignisse nur durch den Beobachter bzw. den Dichter als solche erfasst und überliefert werden. Ohne Homer wüssten wir nichts vom Trojanischen Krieg und von Odysseus.
Doch die modernen Massenmedien, die sich technologischen Entwicklungen verdanken, sind mehr als bloße Beobachter und Berichterstatter. Sie interagieren mit der Politik. Ohne sie als Vermittler könnte die zeitgenössische Politik nicht funktionieren. Daher lassen sich die Medien kaum noch als vierte Gewalt im Staat bezeichnen, wie man sie im 20. Jahrhundert gerne auffasste, während andere in ihnen totalitäre Bedrohungen diagnostizieren. Entweder behindert das reine Zusammenspiel von Politik und Medien die Eliten beim Regieren oder es schränkt die demokratischen Rechte der BürgerInnen ein. Dadurch kann es auch die Bemühungen um Emanzipation diverser Minderheiten beeinträchtigen.
In dieser Perspektive geht die medial orientierte politische Philosophie einerseits von einem Primat des Staates gegenüber dem Individuum aus: der große Bruder. Eine andere Tendenz sieht jedoch in den modernen Massenmedien sich eröffnende Chancen der Demokratisierung und der Emanzipation. Denn während die alten Medien – Zeitungen, Radio und Fernsehen – im 20. Jahrhundert noch weitgehend als Mittel zur Verstärkung politischer Macht verstanden wurden, haben die neuen Medien der mobilen und netzgestützten Kommunikation in den letzten Jahrzehnten Chancen der Demokratisierung und der Emanzipation eröffnet. Sie ermöglichen Kommunikation zwischen sehr vielen Menschen, die sich auf diese Weise politisch organisieren können. Sie bieten eine Ebene der Öffentlichkeit, auf der jeder seine Kritiken und Meinungen sehr vielen anderen mitteilen und zugleich mit anderen darüber diskutieren kann.
Daher kann man in der politischen Philosophie davon sprechen, dass sich mit der Internetgesellschaft neue Perspektiven des Politischen eröffnet haben – das Internet avanciert zu einem neuen zentralen Gegenstand der politischen Philosophie.
So wie auch die Globalisierung verstärken die neuen Medien den sozialen Pluralismus. Sie greifen auf das linguistische Modell zurück, indem sie an die Stelle von klassischen Vorstellungen vom Guten eine Vielzahl medialer Bilder mit hoher psychologischer Symbolkraft setzen.
Doch dadurch ergeben sich Veränderungen in den sozialen und politischen Institutionen. Das Internet ermöglicht Menschen, die von ihren Peergroups oder sozialen Gruppen weit entfernt und isoliert leben, permanent miteinander zu kommunizieren. Dadurch mildert sich der Integrationsdruck auf Einwanderer, die den Kontakt zu ihrer Herkunft in einem hohen Maße aufrechterhalten können. Eine Integration oder Assimilation erscheint ob der neuen Medien schwieriger. Die Verflechtung wird zunehmen, ohne dass sich die Differenzen abschleifen. Toleranz wird umso nötiger sein, ja, verlangt ist Achtung vor dem Anderen in seiner Andersheit.
Grundkonzeptionen
Philosophie, politische Philosophie, politische Theorie, Politikwissenschaft
Was ist politische Philosophie? Man kann die antiken griechischen Mythen, insbesondere den des Ödipus und die daran anschließenden Mythen von Kreon und Antigone als den Anfang der politischen Philosophie begreifen, der der Philosophie selbst noch vorausgeht. Denn die Fragen nach Göttern, nach der Natur, nach der Familie, nach dem Schicksal ergeben sich aus der entstehenden Polis heraus.
Wenn sich die Vorsokratiker zunächst mit dem Urgrund der Welt beschäftigen, so fragen sie nach der Herkunft der Polis. Daraus avanciert die Grundfrage der Philosophie nach der Gerechtigkeit bzw. der richtigen Ordnung der Polis zum Grundmotiv der Philosophie. Allerdings haben sich heute Spezialbereiche der Philosophie gebildet, die sich für Politik nicht interessieren und gemeinhin keine Bezüge zu ihr herstellen. Während in Platons Politeia alle Dimensionen des menschlichen Lebens unter der Perspektive des Politischen entworfen werden – die Ethik, die Erkenntnis, die Kunst, die Erziehung, die Psychologie – treten eine Generation später bei Aristoteles diese Disziplinen bereits auseinander, auch wenn sie jetzt unter dem Dach der Philosophie, doch nicht mehr der politischen Philosophie, zusammengefasst werden.
Zwar besitzt die Nikomachische Ethik deutlich politische Züge, die politische Wissenschaft wird gar als höchste und die in der Polis leitende begriffen. Die Politik des Aristoteles stellt nicht mehr als eine erweiterte Verfassungslehre dar. Die Philosophie differenziert sich seither in verschiedene Bereiche aus. Die politische Philosophie vereint dagegen alle wissenschaftlichen und philosophischen Teilbereiche unter der Perspektive des Politischen. Literatur beispielsweise kritisiert, analysiert und interpretiert die politische Welt, wie die Politik die Literatur ihrerseits zu beeinflussen versucht. Ergo beschäftigt sich die politische Philosophie auch mit Ästhetik und im Weiteren mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, den technologischen Entwicklungen, der Pädagogik, der Psychologie, sowieso mit der Gesellschaft.
Das unterscheidet denn auch die politische Philosophie von der politischen Theorie, die sich auf die inneren Zusammenhänge des Politischen konzentriert, also Fragen der Institutionen, der Legitimität, Macht und Gewalt. Damit beschäftigt sich die politische Philosophie zwar auch, aber in einem darüber hinaus greifenden Zusammenhang.
Angesichts der Differenzierung der Philosophie in bestimmte voneinander getrennte Bereiche bleibt der politischen Philosophie vielleicht als letztem Bereich die vornehme Aufgabe, Zusammenhänge, Strukturen, Netzwerke zwischen den diversen Lebensformen und Subsystemen herzustellen.
Einen Blick auf das Ganze vermag auch sie nicht mehr zu werfen: Das Ganze lässt sich nicht vorstellen. Was bleibt, sind gewisse Formen des Überblicks und Zusammenhänge, vor allem dort, wo sie gemeinhin nicht hergestellt werden.
Just darum kümmern sich weder politische Theorie – jedenfalls in einer engen Bedeutung – noch Politikwissenschaft. Während Erstere sich mit den theoretischen Grundlagen der Politik beschäftigt, analysiert Letztere das politische Geschehen und versucht es so zu deuten, dass sie mit ihren Ergebnissen die Politik beraten kann.
Politische Philosophie steht dagegen der Ideengeschichte nahe, die sich ja nicht auf politische Ideen beschränkt, sondern diese im Zusammenhang mit anderen Formen der Geistesgeschichte betrachtet. Die heute zumeist abgeschafften politikwissenschaftlichen Lehrstühle führten häufig den Titel »Politische Theorie und Ideengeschichte«, eher selten »Politische Theorie und Philosophie«. Die politische Philosophie eruiert somit die Grenzen des Politischen und stellt Zusammenhänge zu den anderen Dimensionen der Politik her, um das Geschehen zu durchleuchten. Schwerlich wird sie sich auf die Seite bestimmter Akteure schlagen. Wenn ihr an Objektivität gelegen ist, dann muss sie sich neutral verhalten. Das entspricht nicht nur einem wissenschaftlichen Ethos, sondern auch der politischen Weisheit, dass es innerhalb der Verwicklungen der politischen Geschehnisse keine richtige oder falsche, keine objektive Position gibt. Diese gibt es nur außerhalb derselben als eine Form der Unparteilichkeit.
Niedergang der Anthropologie als Begründung des Politischen
Die meisten politischen Philosophien stützen sich entweder explizit oder implizit auf eine Anthropologie. Was ist politische Philosophie? Politische Philosophie fragt gemeinhin nach der richtigen und gerechten politischen Ordnung. Für wen aber soll sie gerecht sein, genauer für welchen Menschen? Was für ein Wesen hat dieser Mensch, so dass ihm eine politische Ordnung gerecht wird bzw. gerecht erscheint? Das sind die Grundfragen der politischen Philosophie – das ist politische Philosophie. Wenn ich die Natur des Menschen kenne, seine Fähigkeiten, seine Neigungen, seine Interessen, kann ich daraus ableiten, wie die gerechte politische Ordnung auszusehen hat.
Nach Platon, der die politische Philosophie begründet und sie als umfassend begreift, besitzt der Mensch drei Seelenkräfte, nämlich die Begierde, den Willen und die Vernunft (1958 b: 246 a). Jede dieser drei Kräfte entwickelt einen perfekten Zustand, der sie ausfüllt, nämlich die Besonnenheit, den Mut und die Weisheit, drei von vier Kardinaltugenden. Die vierte, die Gerechtigkeit realisiert sich, wenn der Staat eine diesen Kräften entsprechende Struktur hat und zwar aus dem Stand der Handwerker und Bauern, der Wächter und der Philosophen besteht. Letztere sollen ob ihrer Weisheit den Staat lenken. So heißt es in der Politeia, »dass jeder nur eines betreiben müsse von dem, was zum Staate gehört, wozu nämlich seine Natur sich am geschicktesten eignet. […] Dieses also […] scheint die Gerechtigkeit zu sein, dass jeder das Seinige verrichtet.« (1958 a: 433 a) Überhaupt spielt die Anthropologie in der antiken Philosophie eine den Staat fundierende Rolle.
Mit dem Christentum verliert sie an Bedeutung; denn es liefert eine umfassende Erklärung der Schöpfung und der Geschichte der Erde, der Natur und der Menschheit. Damit werden auch die Rollen des Menschen auf Gottes Erdboden bestimmt, die die Menschen auszuüben haben. Der Mensch wird als von Gott geschaffen verstanden. So garantiert Gott nicht nur dadurch, dass er dem Menschen die Vernunft verliehen hat, dass dieser die Welt richtig erkennt (schließlich handelt es sich ja auch um Gottes Schöpfung). Vielmehr hat der Mensch daher auch ein Gott gefälliges Leben zu führen. An die Stelle der Anthropologie tritt die religiöse Begründung des Politischen: der Fürst soll die göttlich vorgeschriebene Ordnung aufrecht erhalten und die Bürger sollen sich dem unterordnen (Augustin 1955: 134).
Mit dem Verblassen der politischen Strahlkraft des Christentums seit der Renaissance kehrt die Anthropologie als Legitimation und Grundlage der politischen Ordnung zurück, die dem Wesen des Menschen entsprechen muss. Besitzt der Mensch wie bei Hobbes einen gefährlichen Charakter, dann soll der Staat diesen unter Kontrolle bringen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Hat der Bürger ein von Natur aus gegebenes Recht auf Eigentum, so hat der Staat nach John Locke die Aufgabe, dieses Eigentum zu schützen. In der Aufklärung und noch im 19. Jahrhundert geht es darum, gute Gründe für eine neue anzustrebende gerechte Ordnung vorzubringen: Wenn sich der Mensch, wie bei Marx, in der Arbeit verwirklicht, so müssen ihm nicht nur die Früchte seiner Arbeit zustehen. Vielmehr hat er ein Recht auf entsprechende Arbeitsbedingungen, die ihm Erfüllung bieten. Diese sicherzustellen ist Aufgabe der politischen Ordnung.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts indes verliert die Anthropologie in der politischen Philosophie an Bedeutung. Denn keine Wesensbestimmung des Menschen lässt sich empirisch begründen. Letztlich verschiebt man mit solchen Anthropologien nur das Problem der Begründung einer politischen Ordnung. Beim Menschen kann man höchstens noch gewisse allgemeine Strukturen diagnostizieren, die keine inhaltliche oder essentielle Bedeutung ergeben.
Beispielsweise prädestiniert ihn nach Sartre eine bestimmte Struktur des Bewusstseins zur Freiheit. Oder er ist nach Ernst Cassirer ein sprachbegabtes Wesen. Daraus lassen sich jedoch kaum noch eindeutige politische Konsequenzen ableiten. So hat sich die Debatte denn auch weitgehend verlagert. Zumeist glänzen heute die Neurowissenschaften mit anthropologischen Thesen, die bevorzugt die Willensfreiheit bezweifeln. So haben die Libet-Experimente nachgewiesen, dass die Bewegung des Armes dem Befehl dazu im Kopf vorausgeht.
Nun lässt sich schon nach Kant der freie Wille im Grunde in der Erfahrungswelt nicht nachweisen. Alles Handeln fügt sich in Zusammenhänge, die dafür genügend zureichende Gründe liefern. Solche naturwissenschaftlichen Bemühungen, die Willensfreiheit zu widerlegen, reihen sich daher wohl eher in politische Bemühungen ein, die demokratischen Partizipationsrechte der einzelnen BürgerIn zu untergraben.
Gerechtigkeit zwischen Idee und Wirklichkeit, Verteilungs-, Institutionen- und Verfahrensgerechtigkeit
Das Grundthema der politischen Philosophie ist die Frage der Gerechtigkeit. Sie klingt schon im Mythos an, wenn Antigone ihren getöteten Bruder Polineikes begräbt, obwohl Kreon das verboten hat, da sich Polineikes gegen ihn auflehnte. Ist eine politische Ordnung gerecht, die der Schwester verbietet, den Bruder zu begraben? Oder darf die politische Ordnung den Aufrührer abschreckend bestrafen? Zunächst erscheint das nur eine Frage zu sein, mit der sich die Herrscher beschäftigen. Als die Bürger Thebens ihren König Ödipus um Hilfe gegen die Pest bitten, stellt er fest, dass sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben, er aber das Wohl der ganzen Stadt (Sophokles 1977: 63).
Während der Mythos die Frage der Gerechtigkeit primär negativ bzw. kritisch formuliert, also Ungerechtigkeiten aufzeigt, beginnt die politische Philosophie, positive Gedanken über die Gerechtigkeit zu entwickeln. Gerechtigkeit spielt schon zwischen den Menschen, im Umgang miteinander eine wichtige Rolle. Doch auf dieser Ebene lässt sich – so Platon – die Frage der Gerechtigkeit nicht definitiv klären. Es kommt auf die politischen Verhältnisse an, was zwischen den Menschen als gegenseitiger gerechter Umgang erscheint (1958 a: 369 a).
Dabei treten die zwei Pole zutage, wie man auf unterschiedliche Weise die gerechte Ordnung bzw. die Gerechtigkeit bestimmen kann. Platon entwickelt eine abstrakte, jedenfalls ideale gerechte Ordnung, die die Gerechtigkeit als Prinzip so realisiert, dass jeder das ihm Zustehende erhält. Da sich dieses jedem Einzelnen Zustehende aber nicht durch Befragung der Betroffenen bestimmen lässt, sondern nur allgemein und theoretisch durch philosophische Einsicht, verdankt es sich einer idealen Konstruktion. Doch ideale Gerechtigkeitsvorstellungen verlangen nach Umsetzung in einer wenig idealen Wirklichkeit und scheitern zumeist daran.
Die andere Beantwortung der Frage der Gerechtigkeit hat ihren Ursprung gleichfalls in der Antike, und zwar bei Aristoteles. Auch hier stellt Gerechtigkeit eine zentrale Tugend dar, die sich sowohl auf der Ebene der Bürger als auch auf der institutionellen verwirklichen lassen muss. Aber anstatt sie aus großen idealen Ideen abzuleiten, beruft sich Aristoteles auf das zurückliegende Zeitalter des Perikles und auf die in dieser Zeit blühende Demokratie, also auf bereits realisierte, somit traditionelle Verhältnisse, mit denen man schon diverse Erfahrungen gemacht hatte.
Es orientiert sich die Idee der Gerechtigkeit nicht an idealen Vorstellungen, sondern an der Erfahrungswelt (Aristoteles 1976: 1260b 29–36).
Die christliche Ordnung des Mittelalters lebte von der Anerkennung der herrschenden Ordnung als einer göttlich gebotenen und seit Jahrhunderten bestehenden. Noch das Wort Re-volution, also Zurück-drehen, schließt an die Idee eines früheren goldenen Zeitalters an, in dem Gerechtigkeit herrschte. Die französischen Revolutionäre wollten eigentlich jenen spätmittelalterlichen Zustand wiederherstellen, als die Stände ökonomisch nicht so stark bevormundet wurden, wie in der merkantilistischen, also staatlich gelenkten Wirtschaftsweise des Absolutismus.
Doch daraus entstand eine in die Zukunft blickende Frage der Gerechtigkeit. Man stellt sich seit dem 19. Jahrhundert einen Zustand vor, den man aufgrund der technischen Entwicklung glaubt herstellen zu können und erhebt ihn damit nicht nur zum anzustrebenden Zustand, sondern beurteilt daran auch die realen Zustände. Marx wollte genau das vermeiden, indem er versuchte, die zukünftigen ökonomischen Entwicklungen und die sich daraus ergebenden sozialen und politischen Veränderungen möglichst genau zu bestimmen (Engels 1972: 209).
Doch damit geriet er trotzdem in die Falle des Idealismus. Während die Utopisten der frühen Neuzeit wie Thomas Morus und Tommaso Campanella ihre utopischen Modelle gar nicht umsetzen wollten, sondern als reinen Maßstab zur Beurteilung ihrer jeweiligen sozialen und politischen Verhältnisse verwendeten, geht es Marx um die revolutionäre Veränderung, die sich zwar nicht mehr allein auf Ideale und Ideen stützt, sondern auf eine möglichst wissenschaftliche Prognostik. Um die Ideen des Sozialismus umzusetzen, sehen sich spätere Sozialrevolutionäre immer stärker genötigt, auf nackte Gewalt zurückzugreifen.
Im Vordergrund dieser Bemühungen um Gerechtigkeit steht seit dem 19. Jahrhundert bis heute auch nicht durch Zufall die Verteilungsgerechtigkeit. Zwar wird seit den Erfahrungen des Totalitarismus die institutionelle Gerechtigkeit auch wieder betont, also der Zugang zu politischen und bürokratischen Ämtern. In allerjüngster Zeit tritt auch die Verfahrensgerechtigkeit in den Fokus des öffentlichen Interesses, die Frage also, ob die Gesetze und die Strafen gerecht sind, heute vor allem ob sie diskriminierend sind.
Trotzdem bleibt die Verteilungsgerechtigkeit am heftigsten umstritten. Sozialisten fordern die Überwindung des Kapitalismus und damit massive Eingriffe in das Eigentumsrecht, somit eine Umverteilung von Vermögen; Neoliberale halten dagegen jede Form einer progressiven Einkommenssteuer für Diebstahl, für sie gibt es schlicht keine soziale Gerechtigkeit (Nozick 1974: 249). Diese stellt per se eine Ungerechtigkeit dar.
Vor diesem Hintergrund wird im 20. und im 21. Jahrhundert die Frage der Gerechtigkeit zunehmend konstruktivistisch gestellt. Inhaltlich kann man Gerechtigkeit nicht mehr für alle BürgerInnen bestimmen. Daher bleibt gar nichts anderes, als nach formalen Kriterien zu suchen, auf die sich die VertreterInnen der BürgerInnen hypothetisch einigen könnten, um daraus eine Verfassungsordnung zu entwickeln.
Wollte Platon die Menschen in eine ausgedachte ideale Ordnung einfügen, so muss der moderne Staat zunehmend die individuellen Ansprüche seiner BürgerInnen anerkennen, will er ihnen gerecht werden. Gibt es in der Antike noch keinen Gegensatz zwischen den Einzelnen und ihrer Polis, so verschärft dieser sich im 21. Jahrhundert umso mehr. Ständig vergrößern sich die Rechte der BürgerInnen, laufend entstehen neue individuelle Ansprüche, die Staat und Politik berücksichtigen müssen, um die Frage der Gerechtigkeit positiv und erfolgreich zu beantworten.
Das ethisch Gute als Grundlage des Politischen oder als private Orientierung
Aus der klassischen Tradition heraus, aber auch in vielen modernen Theorien, spielt die Frage nach der Ethik bzw. nach dem Guten schon deswegen eine wichtige Rolle, weil sie eng mit dem Thema Gerechtigkeit verknüpft ist. Denn wenn man Gerechtigkeit nicht formal bestimmen will, muss man sie auf ethische Normen stützen, die gerne aus der Natur bzw. der Anthropologie abgeleitet werden. Sie entfaltet auch eine Eigendynamik, die sich zumeist, aber nicht immer der Tradition verdankt.
Was ist politische Philosophie? Die Frage nach einem ethischen Grund des Politischen stellen! Für Platon ist das Gute die höchste Idee, die allen Dingen erst ihr wahres Wesen verleiht. Umgekehrt ohne Frage nach dem Guten kann man die Dinge in der Welt nicht in ihrer vollen Wahrheit erkennen: Man muss wissen, wozu sie gut sind, was sie ethisch, aber auch technisch bewirken (1958 a: 508 c). Ein Atomkraftwerk beurteilt man nur dann richtig, wenn man dessen ethische Konsequenzen beachtet, beispielsweise die Sicherheitssysteme, die nötig werden.
Die Moderne hat dagegen ethische Fragen lange strukturell aus den Wissenschaften ausgeblendet. Wissenschaftliche Erkenntnisse galten als ethisch neutral. Erst langsam begreift man, dass die modernen Technologien viele ethische Probleme nach sich ziehen. Insofern spielt die Ethik bzw. die Frage nach dem Guten in der politischen Philosophie seit ihren Anfängen bis heute eine herausragende Rolle, so dass man von der politischen Ethik spricht.
Platon geht es um die Einsicht in das, was das Gute für den Menschen ist, und d. h. wie er seine Naturanlagen entfaltet, somit wie er ein Leben führt, das ihm selbst und der ihn umgebenden Natur entspricht. Das zu ermöglichen ist die Aufgabe der politischen Ordnung, die nur dann eine gute und gerechte ist (1958 a: 433 a). Damit ist der Mensch in seinen Staat integriert, muss er die Aufgaben erfüllen, die der Staat an ihn stellt. Dem entspricht bis heute eine gemeinschaftsorientierte Ethik, die die Mehrzahl aller Ethiken stellt.
Auch Aristoteles betrachtet die Bürger als Teil der Polis, ihrer eigenen Polis. Politik zu machen, bedeutet daher, etwas für die Polis zu tun. Der Bürger, der nur seinen Lüsten frönt, entzieht sich dieser Pflicht. Wer dagegen tugendhaft oder tüchtig für die Polis handelt, wird dadurch auch glücklich (1975: 1099 a 31-b 1). Rousseau betrachtet den Staat ebenfalls als einen organischen Körper, dessen Glieder die Bürger sind, die sich daher vollständig dem Staat hingeben, um dann ihre Rechte und Freiheiten vom Staat zurück zu erhalten (1977 a: 19). Rechte müssen einerseits staatlich gesichert sein. Andererseits müssen die BürgerInnen dafür dem Staat militärisch dienen, ihm auch ihr Leben hingeben. In diesem Sinne hatte die Ethik eigentlich immer politischen Charakter. Sie sollte die BürgerInnen ihren jeweiligen Gemeinschaften unterordnen.
Umgekehrt muss es daher nicht verwundern, wenn sich die BürgerInnen in den letzten Jahrhunderten zunehmend dagegen wehrten und auf ihren eigenen Rechten insistierten bzw. Widerstand gegen staatliche Autoritäten und Bevormundung leisteten. Dabei können sie sich in der Tat auf die Menschenrechte berufen, die heute als individuelle Rechte hochpolitischen Charakter besitzen. Als sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Nordamerika und in Frankreich erklärt wurden, hatten sie diesen individuellen Charakter allerdings noch nicht, sondern sollten die Bürger, also nicht den Adel, gegen Übergriffe des Absolutismus wie auch anderer Staaten schützen. Dabei zielten sie auf die Sicherung des Eigentums vor staatlicher Willkür und ökonomische Freiheiten, die die Staaten damals zumeist stark einschränkten. Daraus ergab sich die Idee der Nation, die diese Rechte sichert und der umgekehrt das Individuum zu dienen hat. Die Emanzipation der Bürger im 18. Jahrhundert und der Arbeiter im 19. zielten auf die Schaffung nationaler oder gar globaler Gemeinschaften, denen sich das Individuum unterzuordnen habe.
Schon die Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert überschritt diese Perspektive. Doch erst seit der Menschenrechtserklärung der UN 1948 nach der Epoche des Faschismus entwickeln sich die Menschenrechte zu echten Individualrechten, die das Individuum vor dem Zugriff seines Staates schützen sollen, auf die es sich im Angesicht eines solchen Zugriffs berufen kann. Die Emanzipation der Farbigen, der Frauen, der Homosexuellen, der Behinderten, der Zuwanderer, der Alten etc. berufen sich auf Antidiskriminierungsprinzipien, hinter denen die Menschenrechte stehen, die keinen Sinn mehr durch die soziale Gruppe erhalten, sondern nur noch einen Eigensinn. Seither zielt die Emanzipation diverser Gruppen nicht mehr auf ein allgemeines staatliches oder gar überstaatliches Ziel, sondern auf ein individuelles.
Auf diese Weise avanciert die politische Ethik zur Grundlage für demokratisch partizipatorische Politik, die anders als die traditionelle Ethik keine hierarchischen Ordnungen mehr legitimiert, sondern Mündigkeit und Verantwortung der BürgerInnen einfordert. Der Sinn der Demokratie ist nicht mehr die Legitimation einer Elitenherrschaft, sondern die Beteiligung der BürgerInnen.
Die hierarchische politische Ordnung zwischen Selbstzweck und Dienst am Bürger
Oberflächlich betrachtet gilt das nicht für das Thema der politischen Herrschaft und zwar als unvermeidliche hierarchische politische Ordnung. Denn noch existiert kein Gemeinwesen, das auf eine hierarchische politische Ordnung verzichtet hätte. Immer hat der Staat ein Gewaltmonopol. Wo er es nicht durchzusetzen vermag, droht in der Tat zumeist das Chaos – man denke an Somalia. Trotz dieser weitgehenden Übereinstimmung innerhalb der politischen Philosophie über den konkretesten ihrer Gegenstände – man kann solche Herrschaft schließlich überall sehen und beschreiben, während sich alle anderen Begriffe erheblich abstrakter präsentieren – bleiben genügend unterschiedliche Herangehensweisen.
Zwar ist der Ruf nach der Diktatur in der westlichen Welt im Laufe des 20. Jahrhunderts erheblich leiser geworden. Die Welt ist viel zu komplex, als dass sie sich aus einem einzelnen Think-Tank heraus erfolgreich und angemessen verwalten ließe. Doch welche politische Richtung soll es bitteschön sein? Natürlich die eigene, die man selber vertritt. Wer über seinen eigenen Horizont hinaus zu denken vermag, der wird die Unsinnigkeit dieser Vorstellung schnell einsehen.
Trotzdem reden immer noch bestimmte politische Konzeptionen implizit der Diktatur das Wort, zumindest einer gelenkten Demokratie oder einer demokratischen Elitenherrschaft. Sie widersprechen dem aufklärerischen Anspruch auf Mündigkeit aller BürgerInnen. Entweder seien viele dazu nicht klug und gebildet genug oder sitzen ihren Ideologien auf (Strauss 1977: 192; Voegelin 1996: 33). Daher plädiert man dafür, dass die hierarchische politische Ordnung keineswegs gemildert wird. Im Rahmen dieser Positionen macht der Marxismus mit der Elitenherrschaft der Kommunistischen Partei nur insoweit eine Ausnahme, wie er zumindest darauf hofft, in ferner Zukunft diese Herrschaft abbauen zu können.
Trotzdem hat sich in den letzten hundert Jahren der Anspruch auf demokratische Partizipation der BürgerInnen intensiviert. Mit ihm geht eine Bemühung einher, die politischen Hierarchien abzuflachen, sie bürgernäher zu orientieren und sie demokratisch stärker zu kontrollieren. Dass die Demokratie jedoch eine Volksherrschaft sei, diese Illusion ist längst verblasst. Demokratie heißt somit höchstens noch die Konkurrenz verschiedener Eliten, die sich zumeist in Parteien organisieren. Das soll die hierarchische politische Ordnung mildern und zwar ähnlich wie es sich die Lehre von der Gewaltenteilung vorstellt: Verschiedene staatliche Gewalten konkurrieren miteinander, so dass die BürgerInnen dadurch größere Spielräume erhalten (Montesquieu 1965: 212 ff). Intensivere Partizipation der BürgerInnen wirkt der Übermacht der hierarchischen politischen Ordnung entgegen. Das hat sich in der Bundesrepublik z. B. bei der Kernenergie gezeigt, die politisch gewollt war und entsprechend gefördert wurde, die aber in der Bevölkerung auf zunehmende Ablehnung stößt (Mayer-Tasch 1985: 13).
Derart konkurrieren denn auch unterschiedliche Vorstellungen miteinander, welchen Zweck, die hierarchische politische Ordnung oder auch der Staat hat. Ist er primär Selbstzweck, dem die BürgerInnen zu dienen haben und die froh sein dürfen, wenn der Staat ihnen gewisse Freiheiten ermöglicht und in einem bestimmten Rahmen das Leben sichert?
Oder muss die hierarchische politische Ordnung den BürgerInnen dienen? Dann ist der Staat kein Selbstzweck mehr, sondern muss sich durch Leistungen legitimieren (Hobbes 1984: 134). Wenn sich die BürgerInnen nicht mehr so stark ihren sozialen und politischen Verbänden zugehörig fühlen – der Familie, dem Stand, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Klassen oder Völkern –, wenn sie eher individualistische Lebensformen wählen, dann sieht sich der Staat zunehmend herausgefordert. Dann stellen sich ihm neuen Aufgaben: Wirtschafts- und Sozialpolitik wird wichtiger als Verteidigungs- oder Außenpolitik.
Dadurch verändern sich die Grundlagen der politischen Ordnung. Sie verliert ihr festes Fundament in der göttlichen Schöpfung, das ihr zwar noch einen Selbstzweckcharakter verliehen hatte. Wenn die BürgerInnen mündig und frei sind, wenn ihr Wohlsein der Zweck der politischen Ordnung ist, dann ist die Grundlage der politischen Ordnung kein Fundament mehr, sondern die Leistung, die sie für die BürgerInnen erbringt. Die Grundlage avanciert zum perspektivischen Konstrukt, das es immer wieder neu zu schaffen gilt.
Legitimitätsgründe der politischen Ordnung: Tradition, Recht, Medien, Gewehrläufe
Was ist politische Philosophie? Sie diskutiert die Legitimitätsgründe der politischen Ordnung, die sich in den letzten Jahrhunderten verschoben haben. Außer in Theokratien gründet eine politische Ordnung nicht mehr auf der Heiligkeit des Herrschers oder einer göttlichen Ordnung. Ein Gottesbezug in der Verfassung erinnert höchstens an frühere derartige Legitimitäten. Die Worte der US-amerikanischen Verfassung, »dass alle Menschen gleich geschaffen, von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt sind«, nehmen nur noch besonders fromme Menschen wörtlich. Alle anderen denken Menschenrechte als unveräußerliche Rechte der BürgerInnen, weil sie Menschen sind, nicht weil sie Geschöpfe Gottes sind.
So würde man aus moderner Perspektive religiöse Legitimitätsgründe unter traditionelle subsumieren. Dazu zählt auch eine Monarchie, selbst wenn diese sich konstitutionell fundiert. BürgerInnen erkennen eine politische Ordnung an, weil diese auf eine Tradition zurückblicken kann, weil die BürgerInnen sie als solche seit langem gewöhnt sind und schätzen. Oder aber BürgerInnen erkennen eine politische Ordnung an, weil sich ihre Institutionen dem Recht verdanken und sich an dieses gemeinhin auch halten, so dass deren Tätigkeiten dadurch eine Legitimität bekommen.
Max Weber ordnet diesen beiden Legitimitätstypen »legaler Herrschaft« noch eine dritte hinzu, nämlich die charismatische, die auf der außeralltäglichen Gnadengabe eines politischen Führers beruht, den seine Gefolgschaft wie auch die BürgerInnen insgesamt daher als legitim anerkennen (1980: 140). Im 20. Jahrhundert mag es den einen oder anderen charismatischen Führer gegeben haben. Trotzdem erfolgte daraus höchstens der Gewinn einer demokratischen Wahl, nicht die Legitimation der Herrschaft.
Daher erscheint es sinnvoll, zu traditionellen und bürokratischen einen anderen Legitimitätsgrund hinzuzufügen, nämlich den demokratisch-medialen. Die demokratisch gewählte Regierung erhält ihre Legitimität durch die Wahl, ihre Anerkennung aber durch die mediale Öffentlichkeit, zu der die Präsentation der Regierung durch die Medien und in diesem Rahmen vor allem Umfragewerte gehören. Es handelt sich um eine demokratische Herrschaft, deren Legitimität durch die von Medien vermittelte Popularität entsteht. Wenn eine Regierung sehr niedrige Umfragewerte erzielt, dann mag ihre Mehrheit noch auf Jahre gesichert sein, sie gerät trotzdem häufig unter Druck und nicht selten ins Wanken. Eine Regierung wird nicht nach der letzten gewonnenen Wahl beurteilt, sondern nach ihren zukünftigen Wahlchancen.
Jenseits der Medien braucht eine Demokratie die Zustimmung eines großen Teils der BürgerInnen, die gelegentlich miteinander über Politik reden. Dann ruht die Legitimität der Demokratie auf der Kommunikation der BürgerInnen, die sich demokratisch verhalten und durch fehlenden Widerstand ihre Anerkennung kundtun. Gelegentlich entzieht ein Teil der BürgerInnen durch öffentliche Demonstration der Demokratie oder der demokratischen Regierung ihre Zustimmung, schwindet somit beider Legitimität.
Auf diese Weise unterscheidet Hannah Arendt denn auch Macht und Gewalt. Macht kann sich auf die BürgerInnen stützen, die durch ihre Zustimmung und dadurch, dass sie Gesetze freiwillig befolgen, der Regierung oder der Verwaltung Macht verleihen. Macht kommt dann gerade nicht aus den Gewehrläufen. Wenn ein Diktator nur dadurch an der sogenannten Macht bleibt, weil die Armee die Bevölkerung einschüchtert, dann gründet er nur eine Herrschaft, der es an Anerkennung und somit an Legitimität fehlt. Macht entfaltet er nicht (2003b: 45). Es sei denn man versteht unter Macht, dass sich diese gerade durch die Drohung und Anwendung von Gewalt Respekt verschafft. In der Tat erkennen manche Leute Macht gerade dann an, wenn sie sich gewaltsam durchsetzt. Allerdings fehlt einer solchen Macht die Zustimmung der BürgerInnen. Zumeist wird eine Zustimmung nachträglich beispielsweise durch diverse Wahlmanipulationen oder die Zensur von Medien konstruiert, was wohl am stärksten gegen einen solchen Machtbegriff spricht, der sich auf Gewalt stützen will und trotzdem die Zustimmung braucht.
Von der Souveränität zur Gouvernementalität: äußere und innere Machtentfaltung
Was ist politische Philosophie? Die traditionelle politische Philosophie fragt nach dem Grund der Souveränität. Zwar entsteht begrifflich eine Lehre der Souveränität erst in der Renaissance, als sich Fürsten von der Oberhoheit von Kaiser und Papst unabhängig machen wollten und dabei die territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit betonten (Bodin 1981: 240). Doch die Idee einer Art souveränen oder obersten Herrschaft findet sich bereits im alten Orient, bei den Persern und Ägyptern und im Judentum, das zunächst Gott als König betrachtete, der durch einen Propheten vertreten wurde. Die Idee des Königs oder des Kaisers als auch eines religiös höchsten Wesens, das die Geschicke der Welt lenkt, durchzieht die römische wie die christliche Geschichte.
Die Römer gingen realistischerweise davon aus, dass sich diese Lenkung nicht leicht nachvollziehen lässt und sprachen daher von einem fortunatischen Walten. Das drehte bereits Augustin in die göttliche Vorsehung um, die gubernatio divinae providentiae. Der Begründer des ökonomischen Liberalismus Adam Smith geht davon aus, dass eine unsichtbare Hand dafür sorgt, dass das öffentliche Wohl entsteht, wenn die Einzelnen nur ihren eigenen Interessen folgen.
Allein darauf will sich Carl Schmitt indes nicht stützen. Zwar erhält bei ihm der Souverän höhere Weihen durch eine Übertragung der katholisch kirchlichen Repräsentation der universellen Einheit von Welt, Mensch und Gott auf den Staat. Doch entscheidend ist für ihn etwas anderes, wenn er 1922 schreibt: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.« (1979: 11) Auch hier hallt noch etwas von jener höheren Autorität nach, die ihren Ursprung im pharaonischen Gottkaisertum besitzt.
Doch selbst wenn der Notstand ausgerufen wird, dann verfügen einige staatlichen Institutionen gemeinhin über größere Befugnisse gegenüber den BürgerInnen. Wenn ein Einzelner auch eine Art höchste Instanz darstellt, bleibt viel entscheidender, wie der Notstand umgesetzt wird. Daher verschiebt sich die Idee der Souveränität hin zur Idee einer Regierungstätigkeit, die im Grunde ein Ausführungsorgan darstellt. Letztlich geht es dabei um eine Verwaltungstätigkeit: die Regierung besteht dort, wo sie konkret agiert, sie besteht aus Regierungsbeamten und deren Untergebenen.
So hat sich in der politischen Theorie das Wort Gouvernementalität verbreitet. Nach Michel Foucault besteht Politik primär aus Verwaltungstätigkeit, die sich durchaus seit der Antike auf das wirtschaftliche Leben eines Staates konzentriert. Diese Tätigkeit verändert sich seit der frühen Neuzeit. In einem stärkeren Maße als zuvor geht es einer verwaltenden Politik, also einer ausführenden Regierung, seither um die Kontrolle, die Lenkung und auch die Förderung der eigenen Bevölkerung, also aller Menschen, die auf dem Territorium eines Staates leben.
Daher hat sich die Regierungstätigkeit seither massiv erweitert und dringt in praktisch alle Lebensbereiche ein, obwohl im Zuge der ökonomischen Liberalisierung die BürgerInnen bei ihren Wirtschaftstätigkeiten über einen erheblich größeren individuellen Spielraum als früher verfügen. Längst heißt Regierungshandeln nicht mehr nur für äußere und innere Sicherheit und für die ökonomischen Rahmenbedingungen zu sorgen. Inzwischen werden alle Lebensbereiche staatlich geregelt, organisiert, gefördert und kontrolliert.
Mit der Gesundheits-, der Sozial- und der Bildungspolitik gestaltet der Staat das Leben der meisten Menschen von der Wiege bis zur Bahre, um nur drei wichtige Beispiele zu nennen. Natürlich versucht die Politik diese Verwaltungstätigkeiten so zu repräsentieren, als diene sie damit der Bevölkerung bzw. allen Einzelnen. In einem weitaus stärkeren Maße als noch im Mittelalter hat die Regierung seither für die innere Sicherheit zu sorgen. Der Lebensschutz gehört wie die Gesundheit zu den Grundrechten der Bürger. War im Mittelalter – so der US-Philosoph Michael Walzer – vor allem das Seelenheil für den Einzelnen wichtig, für das die Kirche flächendeckend sorgte, so tritt an die Stelle des Seelenheils zunehmend das Körperheil, die Sicherheit des Lebens, implizit somit auch schon dessen Verlängerung (1992: 138).