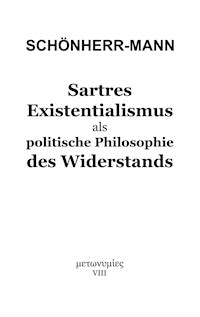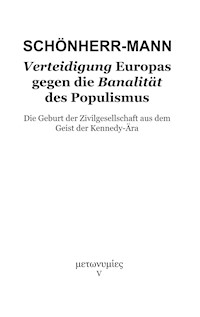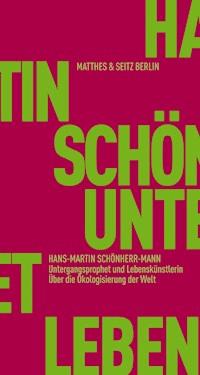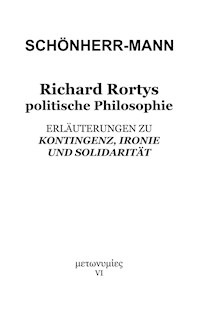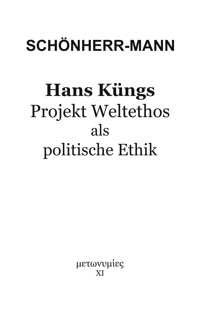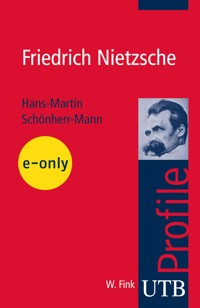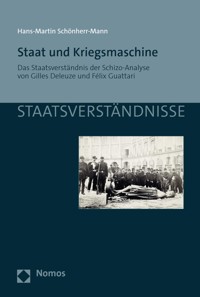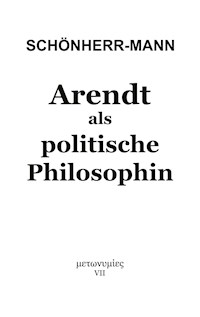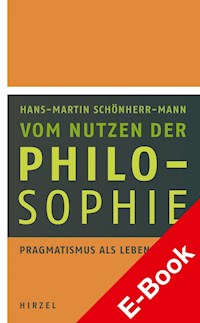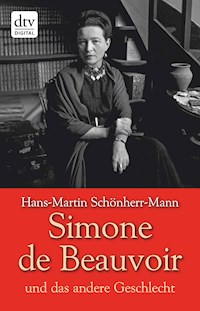Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der untergehende Nietzsche will den Kaiser in der Hand haben, das Christentum zerstören, an die Stelle des Gekreuzigten treten, eine neue Zeitrechnung einführen: das Programm des Übergangs bereits beim frühen Nietzsche wiewohl moderater, in harter Form das Programm der französischen Revolution. Ähnliches beseelt Teile des politischen und sozialen Denkens - auch affirmativ. So wirr Nietzsche letzte Äußerungen klingen, der Wahn enthüllt, was Ideologie wie Begehren verschweigen, wovon Intellektuelle politisch träumen, wie das Unbewusste die Politik antreibt, wie sich die Bürgerinnen an die sozialen Systeme so begeistert wie unterwürfig anschließen. Derart transformiert sich Wahn in Aufklärung und entlarvt die Vernunft jener Experten, die die Welt retten wollen, was weder der übergehende noch der untergehende Nietzsche intendiert hätten. Im Rückgriff auf die französische Philosophie nimmt das Buch Nietzsches allerletzte wirre Äußerungen ernst, interpretiert in ihrem Licht sein Denken seit dessen Anfängen als durchgängig politisch, wiewohl weltfremd, aber just dadurch die politisch soziale Welt erhellend, in der sich zwischen der Sprache des Wahns und der der Vernunft schon lange nicht mehr hinlänglich unterscheiden lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Ich liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn
als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden.“
Im Wahn äußert Nietzsche unverblümt, was sein politisches Denken seit den Anfängen in Basel umtreibt:
3.1.1889: „Die Welt ist verklärt, denn Gott ist auf der Erde. Sehen Sie nicht, wie alle Himmel sich freuen. Ich habe eben Besitz ergriffen von meinem Reich, werfe den Papst ins Gefängnis und lasse Wilhelm, Bismarck und Stöcker erschießen. Der Gekreuzigte“
Ein erleuchteter Genius muss den Staat lenken, nicht eine Bürokratie und dabei eine harte Scheidung zwischen einer neuen Elite der Genien und den Untertanen durchsetzen.
Bossuet: ‚Ketzer ist der, der eigene Gedanken hat‘
Leibniz ‚Ein Befehl, ein Federstrich würde genügen . . .‘
Dadurch realisiert sich das Leben, nicht durch Rationalisierung: das motiviert Nietzsches Kritik an Aufklärung und Positivismus.
Schiller: „Ein Federzug von dieser Hand, und neu/ Erschaffen wird die Erde.“
Die Sprache des Untergangs entbirgt im entfesselten Spiel der Signifikanten die Sprache des Willens zur Macht, zum Übergang nicht nur im Denken Nietzsches als die Gewalt der Sprachreglementierung, um soziale Herrschaft zu stabilisieren.
Saint-Just: „Patriot ist, wer die Republik als Ganzes unterstützt, wer sie in Einzelheiten bekämpft, ist ein Verräter.“
Doch das Unbewusste kommt nicht nur Nietzsche in die Quere, sondern dem politischen Denken insgesamt.
Carl Schmitt: „Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt.“
Im Rückgriff besonders auf Foucault, Lacan und den Anti-Ödipus nimmt das Buch Nietzsches allerletzte wirre Äußerungen ernst, interpretiert in ihrem Licht sein Denken seit der Geburt der Tragödie als durchgängig politisch, wiewohl weltfremd, aber just dadurch die politisch soziale Welt erhellend, in der sich zwischen der Sprache des Wahns und der der Vernunft schon lange nicht mehr hinlänglich unterscheiden lässt:
„Ein Gespenst geht um in Europa das Gespenst des Kommunismus.“
Hans-Martin Schönherr-Mann Prof. für Politische Philosophie, Univ. München, Gastprof. Innsbruck, Eichstädt, Regensburg, Venice International Univ.
Für Irmi
INHALT
Vorwort
1. Vom künstlerischen zum politischen Genius
2. Verantwortlichkeit als Scheidung zwischen Obertan und Untertan
3. Die Wiederkunftslehre als gefährliches und gefährdetes Denken
4. Der Übergang des letzten Menschen zum Übermenschen
5. Adlige Aussteigerinnen, Tänzerinnen,
Juliette
, Raskolnikow
6. Philosophische Wiederkunft der bösen heiligen drei Könige
7. Das Ordnungsbundbegehren als das Ende des Zeitungslesers
8. Der Wille zur Wahrheit als metonymisierendes Begehren
9. Die Wiederkehr des Bösen als Überwindung des letzten Menschen
Nachwort:
Der Untergang
Literaturverzeichnis
Personenverzeichnis
„Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrunde. Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Aufdem-Wege, (. . .) was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Ich liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden.“
(Also sprach Zarathustra)
VORWORT
„Der Mythos des Gott ist tot“– so Jacques Lacan – „ist möglicherweise nur ein Schutz vor der Drohung der Kastration.“1Lou von Salomé nennt Nietzsche einen Gottsucher. Für Martin Heidegger ist Nietzsche gar der letzte Gott suchende deutsche Denker. Versteckt sich hinter dem Gottesleugner also ein Gottsucher oder die ödipale Angst vor der Kastration? Ist Nietzsches Philosophie just auf letztere eine Antwort? Und der wüste Untergang die anti-ödipale Konsequenz des Schizos? Entstanden aus einer begehrenden Philosophie des Übergangs? Eines mit dem Gekreuzigten und dem Kaiser konkurrierenden Genius? Enthüllt sich dadurch aber das Begehren der politischen Philosophie, just das, was für Leo Strauss nicht geäußert werden darf, für den „Lessing, (. . .) überzeugt war, dass es Wahrheiten gibt, die nicht ausgedrückt werden sollten oder dürften, (. . .).“2 Gerade politische Philosophie – so Strauss‘ Folgerung – „wendet sich nicht an alle Leser, sondern nur an vertrauenswürdige und intelligente Leser.“3
Zur Religionskritik hatte die Aufklärung alles gesagt. Nur von einem Tod Gottes spricht sie nicht. Nietzsche bereichert diese Debatte um eine originelle Erzählung. Wie heißt es in der Fröhlichen Wissenschaft: „Hören wir noch Nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch Nichts von der göttlichen Verwesung? – auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!“4 Psychoanalytisch verbirgt sich darin der Vatermord, weil der Vater dem Sohn den Gebrauch der Lüste verweigert, wobei Ödipus in diesem Sinn kein Vatermörder sein kann.
Ist Nietzsche der erste Philosoph, der sich gegen solche Bevormundung zur Wehr setzt? Nein, das hat die französische Aufklärung längst erledigt. Sie kämpft um die Mündigkeit der Menschen, wie es Kant formuliert: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. (. . .) Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“5 Hier eröffnet sich Nietzsches Kastrationsproblem. Er bedient sich dieses Wahlspruchs nach allen Regeln der Kunst selbst, wehrt sich gegen Entmündigung. Doch das überträgt er nicht auf seine Zeitgenossinnen. Er allein verkörpert den Genius, der sich nicht auf die Vernunft stützt. Dazu sucht er Anhänger, die seine Lehren, nicht etwa eigene, verbreiten sollen. So benimmt er sich als Guru mit gemischten Ideen, die in politischer Perspektive wenig aufklärerisch klingen – untergehend esoterisch verstanden doch und womöglich nicht mal wider Nietzsches Willen, wenn letzteren das Unbewusste treibt.
Arthur C. Danto unterscheidet der Einfachheit halber zwei Nietzsche: der eine schreibt kluge und wegweisende Ideen auf. Der andere kritzelt übles Zeug aufs Papier: er verachtet seine Mitmenschen, lobt die ‚blonde Bestie‘, den nordischen Aristokraten und preist einen gewalttätigen hierarchischen Staat. Häufig, so Danto „ist die gellende, keifende, zuweilen fast hysterische Stimme des Pamphletisten und chronisch Unzufriedenen zu hören.“6
Danto empfiehlt daher, Nietzsche diese bösen Zähne kurzerhand zu ziehen, also nur die andere Seite ernst zu nehmen, nämlich die des Kritikers von Religion, Moral, Technik und Wissenschaft. Das brachte Danto den Spitznahmen ‚Arthur Dentist‘ ein. Wenn es darum geht, über Nietzsche konstruktiv hinaus zu denken, dann ist das zweifellos eine sinnvolle Methode, die ich auch schon angewendet habe.7
Die Frage stellt sich aber, was man vom bösen Nietzsche lernen kann, besonders wenn man ihn bis zuletzt, also bis in seine Wirrnis hinein ernst nimmt. Ergeben sich noch enthüllendere Genealogien, weil im Wahn der Wunsch, das Unbewusste, die Katrationsangst sprechen? Dass das sinnvoll ist, will der folgende Text zeigen. Der ‚wahre‘ Nietzsche ist das nicht, weil es diesen gar nicht gibt: denn Texte haben nie nur einen einzigen Sinn. Aber die einen oder anderen Diskurszusammenhänge seiner Philosophie könnten dadurch erhellt werden, die politischer ist, was häufig verdrängt wird, die überhaupt eine politische Philosophie ist, wie ich es im Folgenden zeigen möchte und zwar bis in seine letzten wüsten Bemerkungen: Auch seine ästhetischen, religiösen, ethischen, wissenschaftskritischen Ansätze fügen sich in ein politisches Denken, das, wie es Danto bemerkt, hochproblematisch ist, aber sich dadurch als erhellend auch bezüglich anderer Ansätze in der politischen Philosophie erweist, so dass Wahn in Aufklärung übergeht.
In Britannien wurde Nietzsche für den ersten Weltkrieg verantwortlich erklärt. „In Piccadilly“ – so der Herausgeber der englischen Nietzsche-Edition Oscar Levy – stellte „ein Buchhändler die 18 Bände unserer Ausgabe ins Schaufester und darüber stand in großen Lettern geschrieben: ‚The Euro-Nietzschean War. ‚Read the Devil, in order to fight him the better‘“8 Bis in die neunzehnhundertsechziger Jahre galt Nietzsche vielen als Vordenker der Nazis. Dazu hat Elisabeth Förster-Nietzsche beigetragen, die unter dem Titel Der Wille zur Macht 1906 eine Sammlung von Texten aus dem bis dahin unveröffentlichten Nachlass herausgab, die sie so manipulativ zusammenstellte, dass Nietzsche damit Intentionen untergeschoben wurden, die den Nazis gelegen kamen.
Dass Nietzsche als Nazi-Philosoph gelesen wird, dagegen wehrte sich zur historischen Stunde Georges Bataille. Zum 100. Geburtstag Nietzsches am 15. Oktober 1944, als Paris längst befreit war, besangen ihn die Nazis untergehend in einer skurrilen Feierstunde in Weimar im alliierten Bombenhagel – Mussolini steuerte dazu eine antike Dionysos-Statue bei. Da schreibt Bataille ein Buch Nietzsche und der Wille zur Chance, das 1945 erscheint. Nietzsches Gedanken des Willens zur Macht, der als Triebfeder alles Lebendigen jede Grausamkeit legitimiert, versteht Bataille als spielerische Kreativität, die angesichts eingefahrener sozialer Verhältnisse neue Lebenschancen eröffnet. „Der Wille zur Macht ist der Löwe, aber ist das Kind nicht ein Wille zur Chance?“9
Als Giorgio Colli und Mazzino Montinari ab 1964 im Nietzsche-Archiv in Weimar den Nachlass akribisch rekonstruierten und eine umfassende Gesamtausgabe herauszugaben, verblasste das Bild Nietzsches als dichtender Nazi-Vordenker langsam und zunehmend wurde Nietzsche als Philosoph – nicht mehr nur als Dichter – wahrgenommen.
Trotzdem lässt sich der böse Dichter vom guten Philosophen nicht einfach trennen. Denn durch Wegsehen kann man die böse Seite nicht aus der Welt schaffen. So ist Anacleto Verrecchia im Hinblick auf die Nazis der Ansicht, dass „sich im Werk Nietzsches nicht nur einige, sondern Hunderte Seiten finden, die dieser Ideologie genau entsprechen.“10 Aber liegt Nietzsches Bosheit allein darin? Könnte seine Bosheit die politische Philosophie – nicht nur die seine – erhellen?
Nach Nietzsches Genealogie lassen sich Gut und Böse nicht mehr voneinander scheiden – eine Lebenserfahrung, die man in einer säkularen Welt machen muss, in der Religionen nicht mehr über Gut und Böse herrschen. Daher ist für Gianni Vattimo Nietzsches Philosophie hilfreich: „Die hier beschriebene Lage ist keineswegs verzweifelt, allerdings nur, wenn wir fähig sind, ihr gegenüber das zu zeigen, was Nietzsche einen ‚guten Charakter‘ nannte, nämlich das Vermögen, eine schwingende Existenz und die Sterblichkeit zu ertragen.“11
Aber in welcher Weise hilft der Blick auf Nietzsches Bosheiten und auf seinen Wahn? Nun, philosophisch könnte man das fast a priori beantworten: Sie muss Einblicke eröffnen, die es ohne solche Perspektiven nicht gibt. Dazu muss man Nietzsche nicht unbedingt gegenintentional lesen. Seine Bosheiten wie seine wirren Thesen passen gut in sein Leben, wie ich es in meiner Nietzsche-Biographie zeige.12 Aber der Übergang Nietzsches in seinen wüsten Untergang enthüllt darüber hinaus nicht nur sein Begehren, was er sagte und doch verbarg, seine Wunschproduktion, sondern umso mehr wie im politischen und sozialen Verständnis Wahn als Vernunft maskiert wird: die „schwindelerregende Unvernunft der Welt und unbedeutende Lächerlichkeit der Menschen“13, so Michel Foucault.
Danken möchte ich besonders Markus Penz, Linda Sauer, Paul Stephan, Andrea Umhauer und Irmgard Wennrich.
1 Jacques Lacan, Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (1964), 33
2 Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, 1952, 28
3 Ebd. 25
4 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft (1881-82), KSA Bd. 3, Nr. 125, 481
5Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung (1884), 35
6 Arthur C. Danto, Nietzsche als Philosoph (1965), 31
7 Vgl. Schönherr-Mann, Friedrich Nietzsche, UTB Profile 2008
8 Oscar Levy, Nietzsche im Krieg (1919), 42
9 Georges Bataille, Nietzsche und der Wille zur Chance – Atheologische Summe III (1945), 200
10 Anacleto Verrechia, Zarathustras Ende, 1986, 12
11 Gianni Vattimo, Jenseits vom Subjekt (1980), 35
12 Vgl. Schönherr-Mann, Friedrich Nietzsche – Leben und Denken, Römerweg 2020
13 Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft (1961), 31
1. VOM KÜNSTLERISCHEN ZUM POLITISCHEN GENIUS
Im Nachlass findet sich eine Bemerkung von Ende 1870, dass die Menschen von Illusionen beherrscht werden, die sich netzartig ausbreiten. „Die meisten Menschen spüren gelegentlich, dass sie in einem Netz von Illusionen hinleben. Wenige aber erkennen, wie weit diese Illusionen reichen.“14 Die Bilder, die sie sich von der Welt machen, entstehen nicht in der Auseinandersetzung mit der Welt. Vielmehr erzeugen und verstärken sich diese Bilder gegenseitig, ergeben Weltbilder, die mit der Welt gerade nichts gemein haben. Sonst könnte es ja nicht so viele gegensätzliche Weltbilder geben. Die Zeitgenossen sind sich dessen teilweise sogar bewusst, ahnen aber nicht im Geringsten, wie weit diese Illusionen reichen.
Bereits in seiner wichtigsten frühen Schrift Die Geburt der Tragödie, die in den ersten Jahren während seiner Baseler Professur zwischen 1869 und 1871 entsteht, kritisiert er in diesem Sinne den Moralismus des Christentums, der sich die Welt gemäß seiner Moralvorstellungen halluziniert: wer moralisch ist, der kommt in den Himmel, ist die Welt so eingerichtet. Dass das eine Konstruktion ist, das klingt heute banal, war aber im so frommen wie prüden 19. Jahrhundert äußerst provokant. Neu war der Gedanke allerdings nicht. Eine ähnliche Kritik wird bereits im 18. Jahrhundert von aufgeklärten Denkern entwickelt.
Dem christlichen Moralismus stellt Nietzsche in Die Geburt der Tragödie eine ästhetische Existenz gegenüber. Sie gründet auf einem Zusammenspiel dessen, was er als das Dionysische und das was er als das Apollinische bezeichnet. Das Apollinische verkörpert das Prinzip der Klarheit, der Vernunft, das dem Menschen ein Selbstbewusstsein verleiht, mit dem er seine Triebe wie seine Bedürfnisse zu steuern in die Lage versetzt wird. Das macht ihn zum individuellen Menschen, der seine Lebendigkeit unter Kontrolle hat. Damit beschreibt Nietzsche eher seine eigenen Zeitgenossen als die antiken Griechen. Der sich militarisierende Machtstaat des 19. Jahrhundert, den der junge Nietzsche in seiner Heimat Preußen zunächst bewundert, erzieht mit seinen Disziplinierungsmethoden dieses Individuum so, dass es dem Staat dient, freilich für Nietzsche nicht intensiv genug.
Der ihm nicht völlig ferne aber doch ganz andere Denker, der noch verrufenere Max Stirner schreibt 1844, also im Geburtsjahr Nietzsches: „Man soll das Gesetz, die Satzung in sich tragen, und wer am gesetzlichsten gesinnt ist, der ist der Sittlichste. (. . .) Hier endlich erst vollendet sich die Gesetzesherrschaft. Nicht ‚Ich lebe, sondern das Gesetz lebt in Mir‘. (. . .) ‚Jeder Preuße trägt seinen Gendarmen in der Brust‘ – sagt ein hoher preußischer Offizier.“15 Hier deutet sich schon ein Gedanke an, wie ihn Nietzsche und die anschließende Lebensphilosophie vertreten werden. Gesetz, Recht, Moral, Vernunft unterdrücken das Leben, indem sie es organisieren. Sie erzeugen einen Menschen, wie ihn sich das Christentum seit den Kirchenvätern wünschte, so dass dadurch die Lebendigkeit des antiken Menschen ausgetrieben wurde – eine Entwicklung die nach Max Weber in der protestantischen Ethik gipfelt, die Weber folgendermaßen charakterisiert: „Der ‚innerweltliche Asket‘ ist Rationalist sowohl in dem Sinn rationaler Systematisierung seiner eigenen persönlichen Lebensführung, wie in dem Sinn der Ablehnung alles ethisch Irrationalen, sei es Künstlerischen, sei es persönlich Gefühlsmäßigen, innerhalb der Welt und ihrer Ordnungen. Stets aber bleibt das spezifische Ziel vor allem: ‚wache‘ methodische Beherrschung der eigenen Lebensführung.“16
Als Gegenmodell entdeckt Nietzsche in der antiken Tragödie den dionysischen Chor, der gleichermaßen das Leben wie das Schicksal symbolisiert. Denn Dionysos verkörpert den Rausch, die rauschhafte Gemeinschaft, nicht das isolierte Individuum und insofern eben das Leben bzw. das Lebendige, nicht das Vernünftige, nicht die geistige Klarheit, die sich über das Leben zu erheben versucht. „Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen; auch die entfremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Menschen.“17
Dionysos entsteht durch einen Ehebruch des Zeus. Es gibt verschiedene Varianten der Geschichte. Gemäß einer gängigen brach Zeus die Ehe mit Semele, der Tochter von Kadmos, dem König von Theben, und schwängerte sie. Zeus‘ betrogene Gattin Hera animierte incognito Semele, sie solle Zeus dazu bringen, sich in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Doch als Blitz verbrannte er Semele. Zeus entnahm ihr daraufhin die Leibesfrucht und nähte sie sich in seinen Oberschenkel. Später setzte er diesen aus, so dass Dionysos auch als der Zweimalgeborene bezeichnet wird.
So stieß Nietzsche auf eine Parallele zu Jesus. Doch während Dionysos für Nietzsche die unwiderstehbare Macht des Lebens verkörpert, stellt Jesus für ihn die Ablehnung des Lebens dar, jedenfalls das, was Paulus aus den Lehren Christi fabrizierte. Das Leben muss für Nietzsche denn auch gar nicht erlöst oder versöhnt werden. Es entgeht dem Leiden nicht, aber damit hat man sich mit Dionysos einzurichten. Das Leiden gehört zum Leben. Ohne Leiden denn auch keine Lust, schon gar keine Höhepunkte. Daher täuscht sich Nietzsche in einem seiner Gedichte im Zarathustra: „Doch alle Lust will Ewigkeit –, / – ‚will tiefe, tiefe Ewigkeit!’“18 Dabei handelt es sich nicht um Lust, sondern um Begehren, das nach Jacques Lacan als menschlicher Grundantrieb unstillbar ist, weil es kein Objekt hat. Lacan schreibt: „Das Begehren ist eine Beziehung des Seins zum Mangel. Dieser Mangel ist Mangel an Sein / Seinsmangel / manque d’être im eigentlichen Sinne. Es ist nicht der Mangel an diesem oder jenem, sondern Mangel an Sein, wodurch das Sein existiert. Dieser Mangel ist jenseits all dessen, was ihn vergegenwärtigen kann.“19 Just ein Mangel an Sein aber treibt Nietzsches Gedankenwelt um.
Der damit verbundene, von Schopenhauer stammende Pessimismus behält trotzdem einen optimistischen Unterton. Denn Nietzsche geht von einem Zusammenspiel zwischen der Lebenslust und dem Pessimismus aus, die die antike griechische Tragödie inspirieren. Diese arbeitet sich am Verhängnis ab, das im Mythos eine tragische Rolle spielt, wenn der Schrecken, das Böse, das Rätsel wie zerstörerische Kräfte ihre fatale Gewalt entfalten. Der sich daraus ergebende Pessimismus verdankt sich indes dem Gegenteil zu diesem Prozess, nämlich der Lebenslust. Die Tragik entfaltet ihre Stärke nicht aus sich selbst, sondern aus dem ihr anderen, nämlich der überschwänglichen Lust am Leben, die sich ihrerseits auf Gesundheit und ein intensives Leben stützt, sich aber bedroht sieht – oder mit einem Mangel an Sein konfrontiert.
Damit argumentiert Nietzsche bereits in dieser frühen Schrift genealogisch, d.h. er entwickelt eine Sache nicht aus der ihr entsprechenden Tradition, sondern aus ihrem Gegenteil, aus dem ihr anderen. In Zur Genealogie der Moral, wo er das genealogische Verfahren exemplarisch vorführt, leitet er das Gute nicht aus der Tradition des Denkens über das Gute ab, sondern aus seinem Gegenteil, nämlich dem Bösen: „Sprechen wir sie aus, diese neue Forderung: wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig, der Wert dieser Werte ist selbst erst einmal in Frage zu stellen – und dazu tut eine Kenntnis der Bedingungen und Umstände not, aus denen sie gewachsen, unter denen sie sich entwickelt und verschoben haben (Moral als Folge, als Symptom, als Maske, als Tartüfferie, als Krankheit, als Missverständnis; aber auch Moral als Ursache, als Heilmittel, als Stimulans, als Hemmung, als Gift), wie eine solche Kenntnis weder bis jetzt da war, noch auch nur begehrt worden ist. Man nahm den Wert, dieser ‚Werte‘ als gegeben, als tatsächlich, als jenseits aller In-Frage-Stellung.“20
Daher ist der Pessimismus keine Grundhaltung, die immer schon vorliegt, sondern er verdankt sich der Unterdrückung der Lebenslust. Dabei entstand ein Wahnsinn, das Dionysische. Für Nietzsche handelt es sich wiederum um einen Umschlag. In der Tragödie wie in der Komödie entsteht etwas Rauschhaftes, Wahnsinniges, wenn die Protagonisten untergehen, ob Ödipus, der sich blendet oder Antigone, die in den Tod geht. Just das steht im Gegensatz zu den Umständen, die Nietzsche als dekadent bezeichnet, wenn sich beispielsweise Athen auf dem Höhepunkt seiner Blüte dadurch im Niedergang befindet, weil mit Sokrates der Rationalismus einzieht. „Was ist dionysisch? (. . .) woher müsste (. . .) das entgegengesetzte Verlangen, das der Zeit nach früher hervortrat, stammen, das Verlangen nach dem Hässlichen, der gute strenge Wille des älteren Hellenen zum Pessimismus, zum tragischen Mythus, zum Bilde alles Furchtbaren, Bösen, Rätselhaften, Vernichtenden, Verhängnisvollen auf dem Grunde des Daseins, – woher müsse dann die Tragödie stammen? Vielleicht aus der Lust, aus der Kraft, aus überströmender Gesundheit, aus übergroßer Fülle? Und welche Bedeutung hat dann, physiologisch gefragt, jener Wahnsinn, aus dem die tragische wie die komische Kunst erwuchs, der dionysische Wahnsinn? Wie? Ist Wahnsinn vielleicht nicht notwendig das Symptom der Entartung, des Niedergangs, der überspäten Kultur? Gibt es vielleicht – eine Frage für Irrenärzte – Neurosen der Gesundheit? Der Volks-Jugend und Jugendlichkeit?“21 Für Nietzsche erlaubt der Wahnsinn Einsichten, was die Psychoanalyse auf den Begriff bringt und was sich in seinem wüsten ‚Untergang‘ präsentieren wird.
So taucht in dieser Kunst im Angesicht des Schreckens, dass selbst die blühendste Existenz irgendwann vor einem fürchterlichen Ende steht, der Wahn und der Rausch auf als Nachhall jener Blüte. Das hat einen versöhnenden Charakter, nämlich das Individuum geht dadurch im Leben auf. Zugleich ist das ein Trost für das Individuum, das sich rauschhaft im Leben verliert, was ihm am Ende gar gelingt – völlig berauscht. Trotz allen Schreckens besteht das Leben für Nietzsche aus einer ewigen Lust, die über die individuelle Existenz hinausweist, diese mit dem Leben bzw. der Natur verbindet. Nur dass es sich nicht um Lust, sondern um Begehren handelt.
Die Kraft des Dionysischen ist nicht das Prinzip des Individuellen, sondern des Lebens im Allgemeinen. Es verbindet die Menschen miteinander, wenn sie sich beispielsweise gemeinsam der Musik Wagners hingeben. Dann gehören sie zusammen, werden sie in einem gemeinsamen Rausch aufgehoben: der Wallküren-Marsch bei den Auftritten des langjährigen Nazi-Kanzlers in den Filmen Leni Riefenstahls – beispielsweise in Triumph des Willens (Deutschland 1935). Und zugleich verbindet dieses Dionysische die Menschen mit der Natur. Umgekehrt versöhnt sich dabei die Natur als das Leben mit dem Menschen, der sich durch die Kultur von ihr entfernt hat: der Reiz der Drogen.
Dem Prinzip des Dionysischen stellt Nietzsche das des Apollinischen entgegen. Apoll ist der Gott der bildnerischen Künste, die etwas zeigen bzw. sehen lassen, das man begreifen kann. Es geht folglich um die Wahrheit. Apollinisch gewinnt der Mensch Einsicht in die Welt, wodurch er sich aus ihr heraushebt, die Einheit zwischen Mensch und Natur zerbricht. Dadurch vereinzelt der Mensch, während ihn das Apollinische an der Kunst mit diesem Bruch gewissermaßen versöhnt. Denn er erlebt dadurch die Welt in Form eines Traumes, den er weiterträumen muss. „Apollo aber tritt uns wiederum als die Vergöttlichung des principii individuationis entgegen, in dem allein das ewig erreichte Ziel des Ur-Einen, seine Erlösung durch den Schein, sich vollzieht: er zeigt uns, mit erhabenen Gebärden, wie die ganze Welt der Qual nötig ist, damit durch sie der Einzelne zur Erzeugung der erlösenden Vision gedrängt werde und dann, ins Anschauen derselben versunken, ruhig auf seinem schwankenden Kahne, inmitten des Meeres sitze.“22 Nur dadurch kann sich das Individuum mit einer Welt voller Leiden arrangieren.
Apoll dagegen verkörpert das Principium individuationis, macht Apoll den Menschen zum Individuum. Aber auch wenn Nietzsche damit indirekt die Aufklärung kritisiert, die das Lebendige zu wenig beachte, so wird der Mensch doch als Individuum gestärkt, das dem Leiden gegenüber in der Kunst einen Ruhepol entwickelt, mit der es der Welt gelassen gegenübertreten kann. „Der titanische Künstler fand in sich den trotzigen Glauben, Menschen schaffen und olympische Götter wenigstens vernichten zu können: und dies durch seine höhere Weisheit, die er freilich durch ewiges Leiden zu büßen gezwungen war. Das herrliche ‚Können‘ des großen Genius, das selbst mit ewigem Leiden zu gering bezahlt ist, der herbe Stolz des Künstlers – das ist Inhalt und Seele der aeschyleischen Dichtung, während Sophokles in seinem Ödipus das Siegeslied des Heiligen präludierend anstimmt.“23 Die Frage aber, woher der Genius kommt, was das Genie zum Genius macht, muss offen bleiben, wäre das eine Rationalisierung. So verkörpert der Genius einen Mangel an Sein, das unstillbare Begehren, das durch keine Einsicht domestiziert ist.
Just eine derartige künstlerische Existenz macht Nietzsche früh in zeitgenössischen Künstlerkreisen populär, die Kunst als Fluchtpunkt gegenüber einer disziplinierenden Realität begreifen, die Nietzsche freilich keineswegs ablehnt – es gibt halt solche und solche Künstler. Davon hallt bis heute einiges nach – wird sich dieser Gedanke im 20. Jahrhundert noch intensivieren.
Für den Niedergang des Mythos, der Tragödie, des Dionysischen macht Nietzsche Sokrates verantwortlich, der seinen Zeitgenossen nicht nur die Moral, sondern die dialektische Reflexion und eine kritische Einsicht in die Welt wie ins eigene Leben lehrte. Aber just das versteht Nietzsche als ein Zeichen des Niedergangs einer ursprünglichen Lebendigkeit. Das Leben kann nicht mehr einfach gelebt werden, dessen Moral versteht sich nicht mehr von selbst, sondern alles muss reflektiert werden und verliert dadurch seine ursprüngliche Spontaneität. Das führte damals in den Niedergang, mit dem Nietzsche die zeitgenössische Gesellschaft konfrontiert sieht: „Wie? könnte vielleicht, allen ‚modernen Ideen‘ und Vorurteilen des demokratischen Geschmacks zum Trotz, der Sieg des Optimismus, die vorherrschend gewordene Vernünftigkeit, der praktische und theoretische Utilitarismus, gleich der Demokratie selbst, mit der er gleichzeitig ist, – ein Symptom der absinkenden Kraft, des nahenden Alters, der physiologischen Ermüdung sein? Und gerade nicht – der Pessimismus?“24
Die moderne Wissenschaft soll der Tragik der Welt widerstreiten, indem sie die Welt umwertet, nämlich zum Lebendigen auf Distanz geht, es aus der Ferne des Theoretischen betrachtet. Dann wird die Wahrheit der Wissenschaft zu einer theoretischen Betrachtung der Welt, die das Lebendige in der Welt, das Sein, verdrängt. Das gilt Nietzsche als das Geheimnis des Sokrates. Eine ähnliche Kritik wird in konservativ religiösen Kreisen noch jahrzehntelang wiederholt werden, wiewohl man sich dort um 1900 nur ansatzweise und mit distanzierendem Unterton auf Nietzsche bezieht. Max Scheler schreibt: „Klugheit, rasche Anpassungsfähigkeit, kalkulierender Verstand, Sinn für ‚Sicherheit‘ des Lebens und allseitigen ungehemmten Verkehr, resp. Eigenschaften, die diese Bedingungen herzustellen imstande sind, Sinn für ‚Berechenbarkeit‘ aller Verhältnisse, für Stetigkeit in der Arbeit und Fleiß, Sparsamkeit und Genauigkeit in der Einhaltung und Schließung der Verträge: das werden jetzt die Kardinaltugenden, denen Mut, Tapferkeit, Opferfähigkeit, Freude am Wagnis, Edelsinn, Lebenskraft, Eroberungssinn, gleichgültige Behandlung der wirtschaftlichen Güter, Heimatliebe und Familien-, Stammes-, Fürstentreue, Kraft zu herrschen und zu regieren, Demut usw. untergeordnet werden.“25 Das klingt fast nach Nietzsche. Freilich ordnet Scheler das Leben dem Heiligen unter und in eine Ordnung der Liebe ein, während er gegenüber Nietzsche den Spieß umdreht und diesem Ressentiment gegenüber dem Christentum vorwirft.
Nietzsche kritisiert das moderne Fachmenschentum genauso wie die wissenschaftlich orientierten Bildungsstätten seiner Zeit. Stattdessen sucht er nach anderen Orientierungen in der griechischen Antike, die die wissenschaftliche Distanz durch Lebendigkeit ersetzen, die ihm selbst freilich abgeht: ein Seinsmangel. Zudem hofft er, dass sie ihn mit anderen Menschen wie der Natur in Einklang bringen. Das heißt aber nichts anderes, als dass seine Zeitgenossen Ähnliches wie Nietzsche denken, was sie natürlich nicht tun. Arthur Danto schreibt: „Nietzsche Kategorienpaar < apollinisch – dionysisch> mit Rationalität und Irrationalität gleichzusetzen wäre allzu vordergründig. Letztlich handelt es sich beim Träumen um nichts Rationaleres als beim Tanzen, und die Musik – die von den Griechen selbst in einem Atemzug mit der Mathematik genannt wurde – ist auch nicht weniger rational als die Dichtung. Wenn es weniger wahnsinnige Logiker als wahnsinnige Dichter gegeben haben sollte, so liegt das daran, dass es mehr Dichter als Logiker gegeben hat.“26 Damit deutet sich ein Weg an, der vom Dionysischen zum Principium individuationis führt, der das Individuum mit dem Rausch versöhnt, was Nietzsche selbst sowohl philosophisch als auch im weiteren Leben misslingen wird, misslingen musste, aber in diesem Misslingen dem Begehren Ausdruck verleiht.
Denn bereits in Die Geburt der Tragödie deutet sich die Verschärfung dieser Widersprüche an. Nietzsche verbindet nicht nur die Lust mit der Grausamkeit, also mit der Gewalt, sondern auch die Familie, die allerdings auf ehrenhaften Regeln beruht, während die rauschhafte Lust, die Nietzsche als dionysisch bezeichnet, diese Regeln sprengt. In allen Kulturen diagnostiziert er ein solches Zusammenspiel von Lust und Grausamkeit: „Aus allen Enden der alten Welt (. . .) können wir die Existenz dionysischer Feste nachweisen (. . .). Fast überall lag das Zentrum dieser Feste in einer überschwänglichen geschlechtlichen Zuchtlosigkeit, deren Wellen über jedes Familientum und dessen ehrwürdige Satzungen hinweg fluteten; gerade die wildesten Bestien der Natur wurden hier entfesselt, bis zu jener abscheulichen Mischung von Wollust und Grausamkeit, die mir immer als der eigentliche ‚Hexentrank‘ erschienen ist.“27 Der verrufene Marquis de Sade hat einen ähnlichen Gedanken einem seiner adligen Folterer in den 120 Tagen von Sodom in den Mund gelegt: „Das Verbrechen ist ein Modus der Natur, eine Methode, den Menschen anzutreiben. Warum soll ich mich nicht genauso durch das Verbrechen bewegen lassen wie durch die Tugend? Die Natur braucht das eine wie das andere.“28 Doch der Marquis meinte das kritisch, was man bis zur Biographie von Volker Reinhardt kaum glauben wollte.
Die Geburt der Tragödie transformiert sich indes in die Geburt der Tragödie Nietzsches. Der Anfang seiner intellektuellen Existenz war ein auf Latein geschriebener großer Schulaufsatz über den griechischen Dichter Theognis von Megara, der etwa um 500 v. Chr. lebte. Dieser Aufsatz wird die entscheidende Weiche in seinem Leben stellen. Denn dieses Thema und das damit verbundene Interesse an der Altphilologie nimmt er mit an die Universitäten von Bonn und Leipzig, wo er beim renommierten Altphilologen Friedrich Wilhelm Ritschl studiert, der ihm zur Publikation seines überarbeiteten Schulaufsatzes verhilft. Für einen seiner quellenkritischen Vorträge über die Verzeichnisse der Schriften des Aristoteles bekommt er einen Preis seiner Universität. Der Text wird daraufhin wie andere von ihm im 1827 gegründeten Rheinischen Museum für Philologie abgedruckt, der ältesten Fachzeitschrift der Altertumswissenschaften, an der Ritschl damals als Mitherausgeber beteiligt ist – hatte er also nachhaltige Protektion.
Durch diese Publikationen machte er sich einen Ruf als kompetenter Altphilologie. Noch bevor er einen Studienabschluss vorweisen kann, wird er 1869 auf eine außerordentliche Professur für klassische Philologie in Basel berufen, was gleichfalls Ritschl in die Wege geleitet hatte. Der kometenhafte Aufstieg kam also nicht von selbst und man könnte fragen, ob Ritschl ihn wegloben wollte. Andererseits entsteht er nicht aus der Entwicklung neuer Interessen oder Einsichten, sondern aus jenem alten Schulaufsatz, der sich fortschreibt. Bereits ein Jahr später wird er Ordinarius. Also im zarten Alter von 25 Jahren erreicht er den akademischen Zenit.
Zwei Jahre später folgt indes der abrupte Abstieg, den er nicht zu verwinden vermag, ein erster Untergang, der sich in einen Übergang verwandeln wird. Denn Die Geburt der Tragödie loben nur seine Freunde, unter anderen Jakob Burckhardt und Franz Overbeck. In den altphilologischen Kollegenkreisen wird das Buch wenig begeistert aufgenommen. Sein Lehrer Ritschl schweigt. In seinem Tagebuch findet sich der Eintrag: ‚geistreiche Schwiemelei‘.
Der junge Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, der ein bedeutender Philologe werden sollte, schreibt eine lange vernichtende Kritik, in der er auch Nietzsches fachliche Kompetenzen in Zweifel zieht. War das vielleicht nicht mal nur Kollegen-Bosheit? Wie konnte der blutjunge Aufsteiger erwarten, dass man ihn obendrein ob äußerst gewagter Thesen feiert, noch dazu da diese einen Hang in die antike Philosophie aufweisen und sich gar nicht so sehr um die Probleme der Altphilologie kümmern? Und Nietzsche war zu dem Zeitpunkt kein guter Kenner der antiken Philosophie, was er auch nie wurde. Und er weiß sehr genau, dass die Vorwürfe stimmen. Was hat er wissenschaftlich vorzuweisen: einen überarbeiteten Schulaufsatz, ein paar Vorträge publiziert unter der Ägide seines Mentors. Aber er ist doch das Genie!
Jedenfalls wird sich Nietzsches fachlicher Ruf als Altphilologe von dieser Kritik nicht mehr erholen, wiewohl er von befreundeten Kollegen verteidigt wird. Aber das sind eben Liebesdienste, wie Wilamowitz-Moellendorff kontern kann. Auch die Studenten meiden ihn und kehren nur langsam wieder in seine Veranstaltungen zurück. In einem Semester hat er nur zwei Studenten aus anderen Disziplinen. Das muss den arrogant elitären Möchtegern-Aristokraten zutiefst gekränkt haben. Nietzsche wollte noch weiter aufsteigen, zum neuen Stern am Altphilologenhimmel. Er fühlt sich als Star und sieht sich plötzlich abgelehnt.
Mit diesem Scheitern der Geburt der Tragödie bei den meisten Fachkollegen, sieht er sich wissenschaftlich isoliert. So wendet er sich beleidigt von der Philologie ab. Daher ist es zudem nicht verwunderlich, dass er sich zum Kulturkritiker entwickelt, eben einer Kultur, die ihn als Star nicht anerkennt. Intellektuell bleibt ihm nur die Philosophie, von der er bloß Schopenhauer kennt, mit dem er sich während seines Studiums beschäftigte. Schopenhauer erscheint ihm als eine angemessene Reaktion auf die Situation der Zeit.
Schon in einem Schulaufsatz – wieder die Schule – hatte er Kritik an den deutschen Zuständen geübt. Das verschärft und fokussiert sich in seinen Bildungsvorträgen, die er um das Erscheinen von Die Geburt der Tragödie halten wird. Hatte er Preußen zunächst verehrt, so wandelt sich nun sein Blick nach der deutschen Einigung auf die preußisch-deutschen Verhältnisse, die er kritisiert, weil sie sich nicht hierarchisch genug entwickeln – eine Kritik, die ähnlich von jenen formuliert wird, die gedanklich den Weg in die tyrannische Diktatur ebnen, eben in den späteren Totalitarismus, der jeden Widerstand brutal brechen wird: Gewalt als Antwort auf die Liberalisierung.
Die Verherrlichung einer ästhetischen Existenz wird in den frühen siebziger Jahren zudem unter dem Einfluss von Jacob Burckhardt durch die geniale historische Existenz ersetzt, zumindest erweitert. Damit tritt der Aspekt der Macht in den Vordergrund, die nicht moralisch beurteilt werden soll, jedenfalls nicht aus der Moral des Christentums heraus. Nietzsche kritisiert Bismarck, den genialen Staatsmann, der dergleichen Attribute bescheiden ablehnt, versteht hier Nietzsche offenbar nicht, wie Politik funktioniert, dass sich ein Politiker selbst in Diktaturen geschickter Weise nicht selber lobt, bis bei den Nazis in dieser Hinsicht alle Dämme brechen werden, die sich selber loben mussten mangels des Lobes jener, die sie nicht unter Kontrolle hatten.
Im Winter 1872 hält Nietzsche in Basel fünf Vorträge Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Eingeladen dazu hatte ihn die ‚Academische Gesellschaft‘, als sein Ruf als Philologe noch nicht demoliert war. Nietzsche kritisiert das deutsche Gymnasium und die deutsche Universität, die ein verwissenschaftlichter Geist beherrsche, der zu einer immer weiteren Spezialisierung führt und nicht nur das, sondern auch noch zum Selber-Denken: „Hier wird jeder ohne Weiteres als ein literaturfähiges Wesen betrachtet, das über die ernstesten Dinge und Personen eigne Meinungen haben dürfte, während eine rechte Erziehung gerade nur darauf hin mit allem Eifer streben wird, den lächerlichen Anspruch auf Selbständigkeit des Urteils zu unterdrücken und den jungen Menschen an einen strengen Gehorsam unter dem Zepter des Genius zu gewöhnen.“29 Damit klinkt sich Nietzsche in das antiaufklärerische reaktionäre Denken des 19. Jahrhunderts ein. So schreibt Albert Camus: „Wenn Maístre den starken Gedanken Bossuets wiederaufnimmt: ‚Ketzer ist der, der eigene Gedanken hat‘, d.h. Ideen, die sich auf keine soziale und religiöse Tradition stützen, so spricht er damit die zugleich älteste und jüngste Formel des Konformismus aus.“30 Für den damaligen Katholizismus wie das reaktionäre Denken, wie auch für Nietzsche sind die Menschen nicht mündig.
Lehnt Nietzsche in der zuvor geschriebenen Geburt der Tragödie den rationalen Geist des Sokratismus und der Aufklärung ab, so nimmt er nun den positivistischen Geist des 19. Jahrhunderts aufs Korn, dem auch Schopenhauer und Wagner zu widerstreiten suchen. Gegen Hegel lehnt er den allzu starken Einfluss des Staates auf die Bildung ab, was zu Nietzsches aristokratischen Neigungen passt. In den Aristokratien der vorhergehenden Jahrhunderte gab es kaum ein öffentliches Bildungswesen, war Bildung die Sache des Adels und der reichen Bürger mit ihren Hauslehrern. Hier verkennt Nietzsche den Zug der Zeit einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft, die auf einer verbreiteten Bildung beruht. Aber Nietzsche ist offenbar nicht allein mit seiner Abneigung gegenüber der staatlichen Bildung, die zwar zumeist längst gesetzlich verordnet war, was aber erst zu Beginn des 20. Jahrhundert wirklich realisiert werden konnte. Viele gerade aus niederen Schichten, oder auch die Bauern lehnten eine Schulpflicht ab, weil sie ihre Kinder aufs Feld schicken wollten. Überhaupt behindert für Nietzsche der zeitgenössische Staat mit seiner Schulstruktur, dass sich das Genie entfalten kann. Dazu trägt vor allem die Massenbildung bei, weil sie die dumme Masse und nicht das Genie fördert. Nietzsche fragt: „Wozu diese auf die Breite gegründete Volksbildung und Volksaufklärung? Weil (. . .) man die aristokratische Natur der wahren Bildung fürchtet, weil man die großen Einzelnen dadurch zur Selbstverbannung treiben will, dass man bei den Vielen die Bildungsprätension pflanzt und nährt, weil man der strengen und harten Zucht der großen Führer damit zu entlaufen sucht, dass man der Masse einredet, sie werde schon selbst den Weg finden – unter dem Leitstern des Staates!“31 Letzteres ist sicher richtig, orientiert sich die Bildung darauf, die Menschen zu nützlichen Untertanen zu machen. Individualismus beschränkt sich auf sehr kleine politisch einflusslose Kreise.
An den Universitäten verhindert nach Nietzsche die wissenschaftliche Spezialisierung, die auch einem weniger erleuchteten Geist – seinen bösen Kollegen – eine Hochschultätigkeit erlaubt, dass sich dort allein die wahren Genies tummeln, die doch als einzige an die Universität gehören – eine Klage die bis heute zumeist von jenen erhoben wird, die es an der Universität nicht weit gebracht haben. Denn die Universität hat für Nietzsche folgenden Sinn: „Diese Einzelnen sollen ihr Werk vollenden, das ist der Sinn ihrer gemeinschaftlichen Institution – und zwar ein Werk, das gleichsam von den Spuren des Subjekts gereinigt und über das Wechselspiel der Zeiten hinausgetragen sein soll, als lautere Wiederspiegelung des ewigen und unveränderlichen Wesens der Dinge.“32 Immerhin versucht er anzugeben, woraus sich das Genie speist, das sich vom wissenschaftlichen Geist abkehrt. Es handelt sich um das Ewige, was indes nicht für Klarheit, sondern Dunkelheit sorgt. Aber das Ewige taucht bei Nietzsche immer wieder auf bzw. das Begehren nach dem, was nicht ist: manque d’être.
Parallel dazu kritisiert er den damals um sich greifenden Journalismus, der sich in den Trend der Erweiterung der Bildung durch die zunehmende wissenschaftliche Spezialisierung und die damit einhergehende Verflachung der Bildung einklinkt und diese Verflachung weiter befeuert: „Im Journal kulminiert die eigentümliche Bildungsabsicht der Gegenwart: wie ebenso der Journalist, der Diener des Augenblicks, an die Stelle des großen Genius, des Führers für alle Zeiten, des Erlösers vom Augenblick, getreten ist.“33 Oberflächlicher zeitbezogener Journalismus ersetzt das Genie eines politischen Führers, das sich zuvor von solcher Oberflächlichkeit wie Aktualitätssucht dadurch befreit, dass es als ‚Führer‘ die Epoche wie ihre Momente einordnet, d.h. der Genius dekretiert aus eigener Herrlichkeit den Sinn der Ereignisse, schreibt Geschichte, wozu er keine Beobachter braucht, schon gar keine journalistischen – eine Illusion, die Hannah Arendt entlarven wird: Geschichte schreiben nämlich nicht die genialen politischen Führer, sondern die Dichter, die Historiker, später die Journalisten: Ohne die Journaille kein Genius – für Nietzsche ein unerträglicher Gedanke!
Die Vision des politischen Genius bedeutet dabei, dass die Geführten quasi von selbst einsehen, dass sie diesem zu folgen und zu gehorchen haben. „Es ist als ob dieses Genie in blitzartiger Seelenwanderung in alle diese halben Tierleiber gefahren sei und als ob jetzt aus ihnen allen wiederum nur das eine dämonische Auge herausschaue.“34