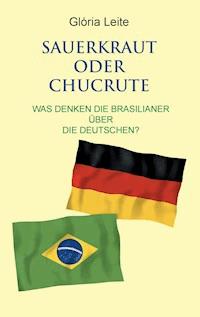
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit Hilfe zahlreicher Interviews skizziert Glória Leite die Erfahrungen von Brasilianern, die in Deutschland leben oder lebten. Die Autorin berichtet auch von Vorstellungen der Deutschen über Brasilien sowie über Stereotypen, die Deutsche und Brasilianer voneinander haben. Es werden außerdem historische Informationen über die ersten Kontakte zwischen beiden Völkern gegeben, mit Hinweisen auf die deutsche Auswanderung und Verpflanzung deutscher Kultur, die Brasilien beeinflusst hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von der Autorin bereits erschienen:
Welch ein Wurm!? Politische Satire (2006)
Wir spielen und kiffen, was sonst? Politische Satire (2010)
Mein lieber Herr Mann! – Eine Brasilianerin in Deutschland erzählt (2011)
Autorin
Glória Leite wurde in Brasilien geboren, studierte Geschichte an der Universität des Bundesstaats Rio de Janeiro und verbrachte anschließend zwei Jahre in den USA. Seit 1992 lebt sie in Deutschland.
Für Linda
Inhalt
Vorwort
Was bedeutet es, deutsch zu sein?
Sind die Deutschen anders als die Brasilianer?
Márcia Haydée – Primaballerina des Stuttgarter Balletts
Miriam Etz trug den ersten Bikini in Brasilien
Beziehung zwischen den Ländern
Typisches brasilianisches Essen
Kurze Memoiren
Kurze Geschichten
Julia da Silva Bruhns
Silvia Sommerlath
Erfahrungen von Deutschen in Brasilien
Olga Benario-Prestes
Antônio Manuel Lima Dias – Maler
Erfahrungen von Brasilianern in Deutschland
Lieben die Brasilianer Deutschland?
Vorwort
Seit 2003 sind die Brasilianer besonders stolz auf ihr Land, darauf, was sie in so kurzer Zeit primär im sozialen und wirtschaftlichen Bereich erreicht haben.
Aber es ist nicht immer so gewesen.
Früher bekamen sie ständig zu hören, dass Brasilien kein Geld für grundlegende Ausgaben habe. Geschweige denn für so etwas wie Bildung oder die Armutsbekämpfung. Die damaligen Präsidenten und Politiker haben ihnen eingeredet, dass das, was sie hatten, genug wäre, um zurechtzukommen.
Glücklicherweise haben nicht alle an diese Märchen geglaubt. Nach drei gescheiterten Versuchen gewann 2002 der Kandidat der Arbeitspartei (PT – Partido dos Trabalhadores) Luiz Inácio Lula da Silva die Präsidentenwahl, nach zwei Amtsperioden wurde Dilma Rousseff zu seiner Nachfolgerin.
Innerhalb von zehn Jahren entwickelte sich Brasilien von der elft- zur sechstgrößten Wirtschaft der Welt – und brachte nicht nur das Bruttoinlandsprodukt nach oben. Mit der neuen Sozialpolitik stiegen vierzig Millionen Menschen zur Mittelklasse auf, und weitere fünfundzwanzig Millionen überwanden die Armut. Und das alles in einem Universum von bald zweihundert Millionen Menschen. Die brasilianischen Einkommen steigen seitdem weiter an, während die soziale Ungleichheit sinkt. Die wirtschaftliche Stabilität und die geringe Inflation sind fast als Wunder zu betrachten. Alle fragen sich, wie Lula da Silva dieses ›Mirakel‹ geschaffen hat. Der damalige Präsident antwortet darauf, das brasilianische Volk und eine gute Regierungsmannschaft hätten das geschafft.
Den ersten Gipfel erreichte das südamerikanische Land mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, einen noch höheren wird es mit der Olympiade 2016 erreichen.
Selbstverständlich gibt es immer noch viel zu tun. Die Brasilianer wissen das. Allerdings wissen sie auch, welche Richtung sie jetzt einschlagen sollten, um ihren harten und dennoch herzlichen – ja, die Brasilianer sind herzlich – Weg weiterzugehen.
Die Welt beobachtet mit großen Augen, was dort passiert. Die traditionellen starken Partner USA und Europäische Union haben noch nicht verinnerlicht, dass ihnen nicht mehr das Hauptinteresse Brasiliens gilt, sondern dass sie nur noch wichtige Handelspartner wie alle anderen sind. Das trifft insbesondere auf Deutschland zu, das lange Zeit geschäftlicher Freund war – man sagt allerdings, Länder haben keine echten Freunde, aber Interessen.
Ein Exempel für die gute geschäftliche Beziehung zwischen Brasilien und Deutschland sind die enormen deutschen industriellen Investitionen in São Paulo. Ein anderes ist die ehemalige deutsche Emigration nach Brasilien mit inzwischen Millionen von deutschstämmigen Nachkommen im Süden des Landes.
Diese guten Beziehungen bedeuten jedoch nicht, dass sie für alle anderen Bereiche als Modell dienen. In der politischen Sphäre der ehemaligen CDU/CSU/FDP-Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel nahm Deutschland Brasilien nicht als strategischen Partner wahr.
Ist das schlecht für Brasilien?
Angeblich nicht.
Brasilien ist nicht mehr das Land, das der deutschsprachige Schriftsteller Stephan Zweig mit einem seiner Buchtitel ›Ein Land der Zukunft‹ genannt hat. Brasilien und sein Volk wollen nicht mehr auf die ferne Zukunft warten, sondern hier und jetzt von seinem Reichtum profitieren. Das brasilianische kämpferische Volk will im Land der Gegenwart atmen.
Ist das schlecht für Deutschland?
Nicht unbedingt.
Seit Langem ist Deutschland für seine hochqualifiziert ausgebildeten Bürger bekannt. Viele Erfinder des zwanzigsten Jahrhunderts sind Deutsche. Die moderne Philosophie hat in deutschem Boden ihre Wurzeln. Die Deutschen haben einen hohen Lebensstandard erreicht. Und mit ihrer Hauptaktivität, dem Exporthandel, sind sie an der Weltspitze. Aber reicht das aus für ein Land, um sich an der Spitze zu halten? Bis zum letzten Jahrhundert hat das ausgereicht, heutzutage genügt es nicht mehr. Deutschland hat keine Rohstoffe. Alles muss importiert werden. Und ohne wertvolles und mit der Zeit rares Naturmaterial geht es nirgendwo. Das macht Deutschland von anderen Ländern abhängig. Und die Länder – hauptsächlich die BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) –, die über die Rohstoffe verfügen, wissen schon, dass sie die Bildungsqualifikation ihrer Bürger verbessern müssen, um mit Deutschland konkurrieren zu können. Deren Weg ist, ihre Rohstoffe selbst zu verarbeiten, um sie mit Wertschöpfung zu verkaufen. Und sie machen das schon bereits. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die BRICS-Staaten Deutschland überholen. Brasilien ist dabei.
Die deutsche Auswanderungsbewegung Richtung Brasilien ist bekannt, auch wenn in Deutschland wenige davon gehört haben. Noch weniger ist die umgekehrte Richtung bekannt, ich meine die Brasilianer, die nach Deutschland gekommen sind. Und das ist, was ich mit diesem Buch vor allem zu beleuchten versuche. Betrachten Sie es nicht als wissenschaftliche Arbeit, sondern als eine informative und zugleich unterhaltsame Lektüre.
Ich möchte die Erfahrungen und Fantasien von Brasilianern, die in Deutschland leben oder einmal gelebt haben, erzählen, dazu ebenso das Denken der Deutschen über Brasilien zusammenfassen. Und auch über die Stereotypen, die sie voneinander haben, berichten. Die verschiedenen Meinungen als auch Antworten, entsprechend ihrem eigenen Erleben, auf Fragen wie: Was ist deine Meinung über Deutschland/Brasilien? Hast du dich schon wegen deiner Hautfarbe oder Herkunft diskriminiert gefühlt? Welches Bild kommt, wenn du über Brasilien/Deutschland denkst? Was hat dich nach Deutschland gebracht? Es wird auch historische Informationen über die ersten Kontakte zwischen beiden Völkern geben, mit Hinweisen über die deutsche Auswanderung und Verpflanzung deutscher Kultur, die Brasilien beeinflusst hat.
Außerdem wird dargestellt, was für beide Gesellschaften als generell typisch und nicht als Ausnahme empfunden wird.
Die Gespräche mit Unternehmern, Poeten und Musikern, Hausfrauen, Illegalen, Beamten, Rechtsanwälten, Studenten und Akademikern wurden informell zu Hause mit Tee und Biskuit, persönlich in Lokalen, unter Einfluss von ein paar Bieren, an Arbeitsplätzen bei einer Tasse Kaffee, locker, zwischen Büchern, manchmal chaotisch und sogar mittels Skype durchgeführt.
Weil einige ihre Identität nicht freigeben möchten und sogar Illegale mir ihre persönlichen Erfahrungen mitgeteilt haben, entschied ich mich dafür, nur die Initialen ihrer Namen zu verwenden.
Bei allen möchte ich mich herzlich bedanken.
Was bedeutet es, deutsch zu sein?
Wenn man sich vorstellt mit »Ich bin Deutscher« oder »Ich komme aus Deutschland«, denkt der Gesprächspartner unwillkürlich an eine oder mehrere Sorten von Qualitäten: »Dieser Mensch ist fleißig, arbeitet hart, ist intelligent, diszipliniert, seriös, sparsam, ehrlich und vor allen Dingen: Auf den kann ich mich verlassen.«
Keine Zauberei. Die Produkte ›Made in Germany‹ sind seit dem 19. Jahrhundert in der ganzen Welt begehrt und Synonym für Zuverlässigkeit. Der Perfektionismus der Ingenieure und Handwerker war beispiellos, verbunden mit dem ›Deutsche Waren haben ein ewiges Leben‹-Image, der preußischen Mentalität, mit Armee und Rüstungsindustrie und den überall verkauften Kanonen unschlagbar. Damals waren die Deutschen ständig in Kriege verwickelt und bis zu 90 Prozent der Reichsausgaben mit der Rüstungsindustrie verflochten. Alles drehte sich um Kriege, die anspruchsvolle Technologien mit sich brachten. In den letzten 50 Jahren sind die Deutschen mit Autos, Druckmaschinen, Lokomotiven und Pharmaindustrie bekanntgeworden. Und seit zwanzig Jahren sind sie auch für Dienstleistungen, insbesondere große Events wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, anerkannt.
Die Deutschen, die nach Brasilien für einen kurzen Aufenthalt auswanderten – wie Abenteurer – oder für immer – wie Bauern, aber auch Gelehrte und gut Ausgebildete –, haben bei den Einheimischen, den Portugiesen und später bei den Brasilianern, einen gemischten Eindruck hinterlassen. Wenn ich hier Deutsche erwähne, meine ich hiermit alle Europäer, die Deutsch als Muttersprache sprachen. Die dama ligen ›Deutschen‹ waren also auch die Schweizer und Österreicher.
Hans Staden zum Beispiel, ein Abenteurer, veröffentlichte 1557, kurz nachdem die Portugiesen in Brasilien einfielen und es besetzten, das Buch ›Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newen welt America gelegene‹, wo er über seine zwei Reisen nach Brasilien berichtete. Er erzählte, dass die Indios ihn fast gefressen hätten. Es scheint, dass der erste Kontakt zwischen beiden Zivilisationen nicht ideal gewesen ist. Zumindest unter unserer heutigen Perspektive.
Die Tausenden deutschen Bauern-Auswanderer, die im 19. Jahrhundert vor dem Hunger flohen und alle ihre Habe verkauften, um die Tickets für die Schiffe zu bezahlen, waren in Brasilien willkommen. Maria Leopoldine von Österreich, die Kaiserin Brasiliens, hat die Türen des Landes für sie geöffnet und aus ihnen Grundbesitzer gemacht. Sie wollte gleichsprachige Landsmänner für ihr Königreich.
Das erste nationale Bier wurde bei Joaquim Salles in Partnerschaft mit Louis Bücher in São Paulo gebraut. Das berühmte Antarctica wurde im Jahr 1888 hergestellt, dem Jahr der Lei Àurea – des Goldenen Gesetzes, mit dem die Sklaverei abgeschafft wurde.
Und außer den VWs, die heutzutage überall auf den Straßen Brasiliens fahren, gibt es etwas, was für die Mehrheit des Volks unbekannt bleibt, obwohl es ihren Alltag beeinflusst: Das deutsche Grundgesetz hatte starken Einfluss auf die letzte brasilianische Verfassung von 1988. Dieser Einfluss war indirekt über die von den Deutschen inspirierte portugiesische Charta gekommen. Und auch direkt durch die vielen brasilianischen Richter, die in Deutschland ihren Doktor in Jura gemacht haben.
Für die Brasilianer heißt ›deutsch‹ zu sein auch dem Gesetz zu gehorchen. Im Straßenverkehr zum Beispiel. Die Brasilianer in Deutschland bewundern die Deutschen, die immer vor roten Fußgängerampeln stehen bleiben. Frau A., Architektin, aus São Paulo, die 1992 nach Deutschland kam und im Nahrungsimport aus Brasilien arbeitet, sagt: »Ich verstehe, dass man vor einer roten Fußgängerampel stoppt und wartet, wenn Verkehr herrscht und vorrangig, wenn Kinder in der Nähe sind. Aber frühmorgens, wenn kein Auto kommt und die Straße leer ist!? Nein, das ist mir zu viel.« Und sie fügt hinzu: »Regeln werden festgelegt, um Menschen zu orientieren, nicht um sie zu versklaven!« Die Deutschen denken anderes. Herr G., Deutscher aus Frankfurt, ein kleiner deutscher Weinexporteur nach Brasilien, siebzig Jahre alt, argumentiert, dass man keine Ausnahme machen darf. »Wenn man einen Sonderfall erlaubt, dann kommt immer noch einer mit eigenem Wunsch, um seine eigenen Interessen zu wahren und um sein Modell auszuhecken. Wenn jeder eine Ausnahme erfindet, wird Deutschland eine Anarchie werden.« Und Herr G. B., 63 Jahre alt, deutscher Techniker ergänzt. »Diese Woche habe ich gesehen, wie ein Fahrradfahrer eine rote Ampel überfahren hat. Ich bin schnell mit meinem Fahrrad neben ihn gerollt und habe ihm laut gesagt, dass ich es sehr schlecht finde, was er gerade gemacht hat. Wenn andere das sehen, werden wir Fahrradfahrer in ein schlechtes Licht kommen.«
Ob die Deutschen selbstbewusst oder arrogant sind, ist für Brasilianer schwer zu unterscheiden. Die Deutschen behaupten, sie sind nicht blasiert, sie wissen eben einfach alles besser als andere. Was man machen sollte, bevor man etwas über sie klatscht, wäre, sie zuerst genauer kennenzulernen.
»Die Deutschen sind anders als die Amerikaner, die sehr freundlich und offen sind. Sie sind anders als die Italiener, die romantisch sind, und auch anders als die Brasilianer, die fröhlich sind. Sie sind einfach für uns zu trocken. Jedoch ist das ihre direkte Art, objektiv zu sein, obwohl sie uns manchmal schockieren.« Das sagt Frau L., Brasilianerin aus Minas Gerais, ehemals Professorin in Deutschland und heute bei einer amerikanischen Universität tätig. Herr G. entgegnet, dass die Amerikaner nicht ehrlich sind. »Wir sind vertrauenswürdig, wir heucheln nicht.« Und Frau L.: »Kann man vielleicht ein bisschen diplomatisch sein und dabei ehrlich bleiben? Weißt du, ich bereise die ganze Welt, wenn ich jedoch nach Deutschland komme, sage ich meinem deutschen Mann schon am Flughafen: ›Zurück ins Land der Ehrlichkeit. ‹ Er weiß sofort, worüber ich rede. Und lacht und nickt.« Und Frau L. erzählt weiter, nachdem sie einen kräftigen Zug aus der Zigarette genommen hat: »Warum ich immer wieder nach Deutschland zurückkehre? Weil ich mich hier wohlfühle. Die Kinder und Enkelkinder meines Mannes leben hier. Ich habe Freunde aus damaliger Zeit. Und sie kommen uns in den Vereinigten Staaten besuchen. Ob ich die Deutschen mag? Ich würde antworten mit einem deutlichen ›Ja‹. Ja, ich mag sie. Ich habe gelernt, sie zu mögen.«
Sind die Deutschen anders als die Brasilianer?
Das Alltagsleben der Deutschen wird von Ehrensache und Tradition beherrscht, die entweder geschriebene oder ungeschriebene Gesetze sind, wie zum Beispiel die Gartenpflicht. Die Gartenpflicht ist dazu da, um die Nachbarn durch den perfekten Garten zu beeindrucken. Die Brasilianer dagegen orientieren ihren Alltag meistens durch den Jeitinho Brasileiro, eine Form von ›Ich gehe diesen Seitenweg, um schnell und leicht mein Ziel zu erreichen, egal ob der Pfad legal ist oder nicht‹.
Der perfekte Garten. Das perfekte Haus
Die Brasilianer bewundern die deutschen Gärten, wobei nicht nur die öffentlichen makellos sind. Die privaten auch. Egal ob groß oder klein, ob im Hinterhof oder vor einem Haus mit mehreren Wohnungen. Hauptsache, sie sind perfekt gestaltet.
Und wann finden die Deutschen Zeit, ihre Gärten perfekt einzurichten?
Frau L.: »Meistens nach der Arbeit verbringen sie die Freizeit mit ihren Gartenträumen. Und ich sage noch etwas dazu. Sie machen das nicht, weil sie Spaß haben. Nur. Sie fühlen sich verpflichtet. Und um ihren Drang zu erfüllen, gibt es keine Ausrede. Sie beobachten auch die Gärten der Nachbarn. Und jede will ihren schöner machen als die der anderen. Es ist wie ein ständiger unbewusster Machtkampf – den Nachbar unter Druck zu setzen: ›Du musst etwas in deinem Garten tun‹ – und Wettbewerb: ›Ich werde meinen makelloser schaffen als du deinem. Wer kein Interesse am eigenen Garten zeigt, wird subtil verachtet. Ich und mein Mann wohnten in einem Einzelhaus, aber nebenan gab es mehrere Wohnungsgebäude. Ein damaliger deutscher Nachbar von uns, der in einer dieser Wohnungen wohnte, sagte mir eines Tages, er kümmere sich um den Hinterhof, solange er Spaß hätte. Sein kleiner Garten war halb wild, halb gepflegt. Und das geschmückte Teil hatte zwei Tannenbäume, die er fällen musste, weil ein Nachbar vom ersten Stock ihn oft schimpfte, wegen der Bäume würde sein weiter Blick gestört. Mit seiner bewussten Entscheidung, sich zu kümmern, solange er Spaß hat, war er eine Ausnahme. Er erlaubte sich, sich von seinen Nachbarn nicht unter Druck setzen zu lassen. Eine andere Bewohnerin des Wohnungshauses übernahm den vorderen Garten, der allen ›gehörte‹. Die anderen Bewohner kamen vorbei und lobten sie oft für ihr Engagement. Und kritisieren sie subtil, wenn sie keine Zeit oder Lust hatte.« Und Frau L. fährt fort mit ihrer besonderen Art zu sprechen, mit vielen kleinen Details. »Bei uns in Brasilien ist es anders. Wenn die Männer von der Arbeit nach Hause kommen, wollen sie nichts tun. Außer vielleicht ein Bier oder einen Whiskey trinken. Eine Handwerksarbeit kommt nicht infrage. (Vergessen Sie nicht, dass es Ausnahmen gibt.) Wir Frauen dagegen müssen, wenn wir nach Hause kommen, noch viel Hausarbeit machen. Davon gibt es kaum Ausnahmen. Ein anderer Unterschied zwischen uns und den Deutschen findet man im Stellenwert des Außen und Innen der Behausungen. Die Deutschen kümmern sich sorgfältig um das Innere des Hauses und das Außen, weil sie sich Sorgen machen, was die anderen über sie denken und urteilen werden. Die Brasilianer kümmern sich besonders um das Innen. Sie machen ihre Häuser innen so schön wie möglich. Und beschäftigen sich mit dem Außen so gut wie gar nicht, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, was die Nachbarn über sie klatschen. Es wäre nicht schlecht, wenn die Deutschen ein bisschen von uns und wir ein bisschen von ihnen lernten. Nicht zu viel hier, nicht zu wenig da. Ich gehe davon aus, dass die neue Generation Brasiliens sich verändert. Das alte Modell, nach dem die Menschen kaum Handwerksarbeit zu Hause machen, ist dabei zu verschwinden. Und wenn ich Handwerksarbeit erwähne, will ich damit auch Gartenarbeit sagen. Und die neue deutsche Generation hat sich noch nicht für die Perfekte-Gärten-unter-nachbarlichem-Druck-Gestaltung entschieden. Wir müssen abwarten. Wenn sie es irgendwann für sich selber machen, werden sie echten Spaß haben und sich dabei gutgelaunt entspannen. Ohne Druck.«
Illegal Arbeit versus Jeitinho Brasileiro I
Ein Deutscher würde nicht jemand zu sich für eine Hausreparatur bestellen, der nicht ausgebildet ist. Oder? Doch! Für bestimmte Sachen. Ein Brasilianer macht es auch. Und wie! Und für alles.
In Deutschland macht man selbst alle möglichen handwerklichen Hausarbeiten. Zum Beispiel: tapezieren, Möbel zusammenbauen, Teppiche und Fußböden verlegen, Wände streichen und so weiter. Und dafür haben die Deutschen eine Menge Werkzeug in den Kellern ihrer Häuser. Fast jedes Haus hat eine Miniwerkstatt, weil Handwerksarbeit zu teuer ist. Um den hohen Preisen zu entgehen, bestellt man im Fall des Falles einen Schwarzarbeiter, einen Deutschen oder Ausländer – auch Illegale –, um die Kosten zu senken. Wen die Deutschen offiziell und mit Rechnung bestellen, ist zum Beispiel einen Elektriker oder einen Gasinstallateur, weil die Verantwortung zu groß wäre, falls etwas schief ginge.





























