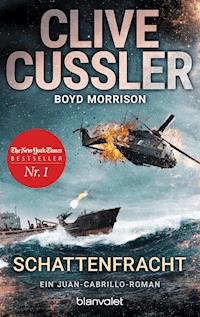
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Juan-Cabrillo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
»Eine großartige Verschmelzung von Action-Abenteuer und Geschichte!« Associated Press
Ein brutaler Bankraub lässt Juan Cabrillo und die Crew der Oregon nahezu pleite zurück. Plötzlich sind sie unerwartet verwundbar. Und doch hat der Vorfall etwas Gutes, denn nur deshalb werden sie auf den Rachefeldzug eines geheimnisvollen Hackers aufmerksam. Der Banküberfall war nur der Anfang eines Plans, der Millionen den Tod und die Weltwirtschaft zum Erliegen bringen wird. Cabrillo und seine Gefährten setzen alles daran, ihren Gegner aufzuspüren. Doch der ist ihnen – zum ersten Mal bei all ihren Einsätzen – technisch weit überlegen!
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Juan Cabrillo nicht entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Autoren
Clive Cussler konnte bereits dreißig aufeinanderfolgende »New-York-Times«-Bestseller landen, seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, und ist auch auf der deutschen Spiegel-Bestsellerliste ein Dauergast. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Boyd Morrison arbeitete als Ingenieur für die NASA und Microsoft, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Außerdem ist er professioneller Schauspieler und Jeopardy!-Meister. Er lebt mit seiner Frau in Seattle.
Die Juan-Cabrillo-Romane von Clive Cussler:
1. Der goldene Buddha
2. Der Todesschrein
3. Todesfracht
4. Schlangenjagd
5. Seuchenschiff
6. Kaperfahrt
7. Teuflischer Sog
8. Killerwelle
9. Tarnfahrt
10. Piranha
11. Schattenfracht
Weitere Bände in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Clive Cussler
& Boyd Morrison
Schattenfracht
Ein Juan-Cabrillo-Roman
Deutsch vonMichael Kubiak
PROLOG
ST. HELENA
28. April 1821
Lieutenant Pierre Delacroix verfluchte sich wegen seines übertriebenen Selbstvertrauens selbst. Er war ein großes Risiko eingegangen, als er sich bereits im trügerischen Licht der Vorboten des Morgengrauens in der Hoffnung aufs Meer hinausgewagt hatte, sich noch vor Sonnenaufgang einige Kilometer näher an die Felsklippen auf der Nordseite von St. Helena heranschleichen zu können. Eine englische Fregatte – eine von insgesamt elf, die die abgelegene Insel bewachten – erschien nicht weit von der Küste entfernt und nahm Kurs in ihre Richtung. Würde sein Unterseeboot am helllichten Tag auf dem Wasser gesichtet werden, wäre die Mission, Napoleon Bonaparte aus seiner Verbannung zu befreien, beendet, ehe sie richtig begonnen hatte.
Delacroix ließ sein Fernrohr sinken und rief durch die Luke nach unten: »Tauchmanöver vorbereiten!«
Im böigen Wind falteten drei Männer das Segel zusammen. Mit der strahlenden Sonne im Rücken warf Delacroix einen letzten Blick auf die näher kommende Fregatte, ehe er sich durch den Einstieg schlängelte und die kupferne Luke über seinem Kopf schloss. Seine Nasenflügel blähten sich bei dem ranzigen Körpergeruch von fünfzehn Männern, die in diesem engen Gefängnis eingepfercht waren.
»Haben sie uns gesehen?«, fragte Yves Beaumont mit sorgenvoll gefurchter Stirn. Zwar bemühte er sich um einen ruhigen, festen Tonfall, aber sein Blick sprang immer wieder zu der geschlossenen Luke und verriet seine Unruhe. Als erfahrener Bergsteiger hatte er schon lässig auf handbreiten Felsrippen gestanden – vor Abgründen, bei deren Anblick gewöhnlichen Menschen das Herz stehen geblieben wäre. Aber die Vorstellung, in einer solchen Hülse aus Metall und Holz in die Tiefe zu tauchen, erzeugte ein Gefühl von nackter Angst in ihm.
Delacroix waren solche Empfindungen fremd. Die Beengtheit seiner vorübergehenden Wirkungsstätte machte ihm nichts aus, weshalb er genau die richtige Wahl war, um die Mission des ersten funktionsfähigen Unterseeboots der Welt anzuführen.
»Wir werden noch früh genug erfahren, ob sie uns gesehen haben, Monsieur Beaumont.«
Außerdem würden sie bald feststellen können, ob das Unterseeboot einen Tauchgang auf dem offenen Meer überstand. Es war nach Entwürfen gebaut worden, mit denen der amerikanische Ingenieur Robert Fulton den Marinefachleuten Napoleons sein Konzept unterseeischer Kriegsführung in Gestalt des sechseinhalb Meter langen Tauchboots Nautilus vorgestellt hatte. Delacroix hatte seine auf siebzehn Meter Länge vergrößerte Version auf den Namen Dasyatis getauft.
Seit es von dem Schoner abgelegt hatte, der das technisch modernisierte Schiff bis etwa einhundert Kilometer vor die Küste von St. Helena geschleppt hatte, war die Dasyatis im Schutz der Dunkelheit unterwegs gewesen. Bisher war die Reise ohne Zwischenfälle verlaufen, und der mit Kupfer verkleidete hölzerne Rumpf hatte sich als wasserdicht erwiesen.
Nun kam der Zeitpunkt, um herauszufinden, ob der erste Einsatz der Dasyatis auf offener See genauso erfolgreich verlaufen würde wie die Tauchversuche im Hafen, die sie mit fliegenden Fahnen absolviert hatte.
»Alle Luken sind verriegelt, Lieutenant«, sagte Fähnrich Villeneuve, Delacroix’ stellvertretender Kommandant. »Der Schnorchel ist geschlossen und dicht.«
»Ballastpumpen sind bereit.«
Die beiden Techniker des Unterseebootes nahmen ihre Positionen an den Handpumpen ein, die Wasser in die leeren Tanks drückten. Der Rest der zwölfköpfigen Besatzung hielt sich bereit, um die Kurbelwelle zu bedienen, die den Propeller am Heck antrieb, während Delacroix die Pinne ergriff, die das Ruder bewegte. Beaumont und ihr zweiter Passagier, der ständig eine schwarze Maske trug, um seine Identität geheim zu halten, pressten sich gegen die Innenwand des Rumpfs, um nicht im Weg zu sein.
Mit einem tiefen Atemzug – als beabsichtige er, sich selbst in den Ozean zu stürzen – sagte Delacroix: »Tauchfahrt einleiten!«
Die Techniker bedienten die Pumpenschwengel, und wenige Minuten später schwappte Seewasser gegen die beiden Sichtfenster in dem turmartigen Aufbau der Dasyatis. Der hölzerne Rumpf des Bootes knarrte und ächzte, als der Wasserdruck auf allen Seiten stetig zunahm.
»Es ist vollkommen gegen die Natur, mit einem Schiff unterzutauchen«, hörte er einen der Matrosen murmeln, aber ein drohender Blick aus Delacroix’ Augen ließ ihn sofort verstummen.
Er wartete, bis die an einer Schwimmboje befestigte Leine außerhalb des Bootes anzeigte, dass sie sich etwa sieben Meter unter der Wasseroberfläche befanden, dann sagte er: »In dieser Tiefe bleiben.«
Die Techniker hörten auf zu pumpen. Die Dasyatis verharrte in ihrer Position, und das Knarren ließ nach.
Nun hatten sie nichts anderes zu tun, als zu warten. Bis auf ein gelegentliches Husten oder Räuspern von Seiten der Mannschaftsmitglieder herrschte im Innern der Dasyatis eine gespenstische Stille. Sogar das beruhigende Plätschern der Wellen gegen den Bootsrumpf war verstummt.
Mittlerweile war die Sonne vollständig aufgegangen, und genügend Licht drang durch die zwei Zentimeter dicken Scheiben des untergetauchten Beobachtungsturms, sodass keine Laterne mehr nötig war, um das Innere des Unterseeboots zu erhellen. Sie sollten nun sechs Stunden unter Wasser ausharren können, ehe sie die Schnorchelrohre ausfahren oder auftauchen müssten, um frische Luft aufzunehmen.
Nach etwa zwei Stunden Wartezeit glitt ein dunkler Schatten über sie hinweg. Delacroix, der ihre Umgebung durch die Fenster beobachtete, konnte in kaum dreißig Metern Entfernung den Rumpf der Fregatte erkennen, deren Segel die Sonne abschirmten. Sämtliche Tätigkeiten innerhalb des Unterseeboots kamen zum Stillstand, während die Männer auf einen Angriff warteten und nach oben blickten, als könnten sie genau beobachten, was sich über ihren Köpfen tat.
Delacroix’ Augen klebten an der Fregatte und suchten nach einem Hinweis darauf, dass sie direkt auf sie zusteuerte. Sie behielt ihren Kurs jedoch beharrlich bei. Nach wenigen Minuten geriet sie außer Sicht. Um jedes Risiko, entdeckt zu werden, auszuschließen, wartete Delacroix weitere drei Stunden, bevor er Befehl gab, den Schnorchel auszufahren.
Auf diese Weise mit frischer Atemluft versorgt, blieben sie bis zum Einbruch der Dunkelheit unter Wasser. Als die Dasyatis schließlich auftauchte, wurde die Nacht vom fahlen Schein eines Halbmondes erhellt. Erleichtert stellte Delacroix fest, dass weit und breit keine andere Lichtquelle zu sehen war.
Er blickte zu den Klippen von Black Point hinüber. Nicht allzu weit entfernt ragte die Felswand des nördlichen Küstenabschnitts der Insel etwa einhundertsiebzig Meter in den nächtlichen Himmel. Monatelang hatte er mit dem Bergsteiger Beaumont trainiert, aber als er die abweisende Felsbastion dann mit eigenen Augen erblickte, begann er zum ersten Mal am Erfolg der Mission zu zweifeln.
Beaumont drängte sich vor dem Sichtfenster neben ihn und nickte, als er die steile Klippe betrachtete.
»Schaffen wir es dort hinauf?«, fragte Delacroix.
»Oui«, erwiderte Beaumont. »Schließlich ist es nicht das Matterhorn. Und der Aufstieg wird einfacher sein als auf den Mont Blanc, auf dessen Gipfel ich schon drei Mal gestanden habe.«
Anstatt sich heimlich auf die Insel zu schleichen, wäre Delacroix eine offene Invasion wesentlich lieber gewesen, aber dazu hätten ihm drei Dutzend Kriegsschiffe und zehntausend Männer zur Verfügung stehen müssen, um eine reelle Chance zu bieten, dieses Unternehmen erfolgreich durchzuführen. Eine Garnison von zweitausendachthundert Soldaten und fünfhundert Kanonen, die einen einzigen Gefangenen eintausendachthundert Kilometer vom nächsten Festland entfernt beschützten, machte Napoleon Bonaparte zur bestbewachten Persönlichkeit der gesamten Weltgeschichte. Den König von England zu entführen wäre wahrscheinlich einfacher gewesen.
Die Mannschaft kletterte an Deck, froh, endlich wieder frische Luft atmen zu können. An Stricken ließen die Männer mehrere Korkbälle hinab, die am Rumpf der Dasyatis als Fender dienen sollten, damit die empfindliche Außenhaut nicht mit den scharfkantigen Felsen kollidierte, und warfen den Anker.
Delacroix schlang sich eine kräftige Angelschnur über die Schulter, und Beaumont folgte seinem Beispiel. Anschließend knoteten sie sich an ein Sicherungsseil, das sie miteinander verband. Mehr als dreihundert Meter aufgeschossenes Seil sowie eine Vorrichtung, die wie eine Kinderschaukel aussah, lagen auf dem Schiffsdeck bereit.
Mit einem Kopfnicken machte Beaumont einen entschlossenen großen Schritt, trat vom Schiff auf einen Vorsprung hinüber, der aus der Felswand herausragte, und kletterte los. Als er gut drei Meter zurückgelegt hatte, wartete er, während Delacroix ihm folgte, den er sogleich sicherte. In diesem Rhythmus kletterten sie die Felswand hinauf, wobei sie gelegentlich zur einen oder anderen Seite ausweichen mussten, um einen besonders steilen Abschnitt zu umgehen. Beaumont, der sich leichtfüßig und ohne sichtbare Mühe in dem steilen Gelände bewegte, hielt mehrmals an, damit sich Delacroix ausruhen konnte. Nur ein einziges Mal rutschte Delacroix ab, doch das Sicherungsseil zwischen den Männern verhinderte, dass er in die Tiefe stürzte.
Normalerweise brauchte Beaumont höchstens vierzig Minuten für eine Kletterstrecke von einhundertsiebzig Metern, aber da Delacroix trotz ausgiebigen Trainings nur mühsam vorankam, dauerte der Aufstieg länger als eine Stunde.
Als sie schließlich die obere Kante der Klippe erreichten, hämmerte Beaumont einen eisernen Bohrhaken mit einem Ring am Ende in einen Felsspalt. An diesem Ring befestigte er eine Umlenkrolle, knotete beide Enden der Angelschnur zusammen und legte die Schnur um die Rolle, ehe er die Leine mit einem Eisengewicht beschwerte, das mit hellgelber Farbe gestrichen war. Dieses schleuderte er so weit hinaus, dass es, ohne die Felswand zu berühren, dicht neben dem Unterseeboot ins Meer eintauchte. Als Delacroix nach wie vor kein Schiff am Horizont erkennen konnte, gab er den Mitgliedern der Bootsmannschaft mit einer kleinen Fahne ein Zeichen, das Seil an der Angelschnur zu befestigen.
Als sie oben auf der Klippe ihrerseits ein Signal empfingen, dass Seil und Angelschnur miteinander verbunden waren, zogen er und Beaumont die Schnur über die Rolle nach oben. Das schwere Seil schlängelte sich die Felswand empor. Als das Seilende über die Felskante rutschte, gaben sie den Männern auf dem Unterseeboot erneut ein Zeichen mit der Fahne.
Mit zweihundert Pfund zusätzlichem Gewicht in Gestalt des maskierten Mannes beschwert, erfolgte das Einholen des Seils quälend langsam. Nach zehn Minuten schweißtreibender Arbeit fixierte Beaumont alleine das Seil, während Delacroix den maskierten Mann über die Felskante hievte und ihm half, aus der hölzernen Schaukelvorrichtung – einem sogenannten Bootsmannsstuhl – auszusteigen. Ein zusätzliches Brett war hinter der Rückenlehne festgezurrt, auf dem Delacroix stehen konnte, wenn der Stuhl am Abend wieder zum Boot hinuntergelassen würde.
»Kann er nicht reden?«, fragte Beaumont und deutete mit einem Daumen auf den maskierten Mann.
»Er wird dafür bezahlt, dass er es nicht tut«, sagte Delacroix. »Genauso wie Sie dafür bezahlt wurden, mich hier heraufzubringen. Jetzt ist Ihre Arbeit beendet, und ich danke Ihnen.«
»Und wer ist er?«
»Das werden Sie nie erfahren«, sagte Delacroix und stieß ein Stilett ins Beaumonts Hals. Der Bergsteiger erstarrte, ein Ausdruck der Verwirrung und des Unglaubens erschien in seinen Augen. Dann sank er langsam zu Boden.
Delacroix stopfte gut zwanzig Pfund Steine in Beaumonts Rucksack. Mit einem Fuß schob er den Leichnam des Bergsteigers ein Stück zur Seite und über die Felskante, um zu vermeiden, dass er auf dem Unterseeboot aufschlug. Die Mannschaftsmitglieder würden den abstürzenden Körper ins Meer eintauchen sehen, und Delacroix würde ihnen erklären, dass Beaumont ausgerutscht sei. Damit gab es einen Zeugen weniger, dessentwegen er sich Sorgen machen musste.
»Kommen Sie«, sagte Delacroix zu dem maskierten Mann, während sie zu dem beschwerlichen fünf Kilometer langen Fußmarsch landeinwärts aufbrachen. Delacroix’ Begleiter folgte ihm gehorsam und nach wie vor stumm. Nackter felsiger Untergrund ging allmählich in eine Grasnarbe und schließlich in dichten Wald über.
Gegen Mitternacht erreichten sie den Rand des Landgutes, auf dem das Longwood House stand, in dem Napoleon gefangen gehalten wurde. Es hielt sich im trostlosesten Teil der Insel auf, kilometerweit von Jamestown entfernt, wo sich der einzige Hafen befand. Die Abgelegenheit sollte Teil der Strafe für den besiegten Kaiser sein, erwies sich jedoch auch als vorteilhaft für Delacroix’ Plan. Da die Gegend nur schwer zugänglich war, unterlag die Bewachung keinem strengen Ritual, und Napoleon konnte sich frei und ungehindert bewegen, solange er nicht den Weg zur Stadt einschlug.
Die einzige Straße nach Jamestown verlief auf der anderen Seite des Anwesens, wo sich auch die Hauptwachstation und die Baracken befanden. Die Wachen hielten es nicht einmal für nötig, auf dem Gelände, einer sorgfältig gepflegten Gartenanlage mit einheimischen Gummibäumen und englischen Harthölzern, regelmäßige Patrouillengänge durchzuführen.
Die Bäume als Deckung benutzend, gelangten Delacroix und der maskierte Mann zum Haus, ohne einen Alarm auszulösen. Delacroix hatte sich den Grundriss des Hauses eingeprägt und fand auf Anhieb den Eingang.
Um diese späte Uhrzeit war das Haus still und dunkel. Delacroix führte sie lautlos durch die Korridore, bis sie das Schlafzimmer fanden, dem ihr nächtlicher Besuch eigentlich galt. Behutsam drückte Delacroix die Tür auf und schlüpfte durch den Spalt, gefolgt von dem maskierten Mann. Diesem bedeutete er mit einer Geste, jetzt die Maske abzunehmen, und dann riss er ein Streichholz an, um die Lampe auf dem Nachttisch anzuzünden.
Der Schläfer im Bett wurde durch das plötzlich aufflackernde Licht geweckt.
»Wir sind wegen Ihnen hier, Euer Majestät«, sagte Delacroix.
Ruckartig richtete sich Napoleon Bonaparte im Bett auf. Er machte Anstalten, um Hilfe zu rufen, als er Delacroix’ Begleiter erblickte.
Dieser hätte Napoleons Zwillingsbruder sein können. Der gleiche halb kahle Kopf, die gleiche beinahe zwergenhafte Körpergröße und die gleiche römische Nase. Obgleich Delacroix innerlich auf diesen Augenblick vorbereitet war, verschlug es ihm beim Anblick der beiden Männer, die da nebeneinander standen, fast den Atem.
Blinzelnd musterte Napoleon seinen Doppelgänger und fragte: »Robeaud?«
»Ich bin es, Euer Majestät«, erwiderte das Double in dem absolut gleichen Tonfall des Kaisers.
François Robeaud hatte viele Jahre als Napoleons Double gedient und war bei Anlässen aufgetreten, bei denen der Kaiser nicht hatte erscheinen wollen, sodass Napoleon sich immer dann nicht hatte in Gefahr begeben müssen, wenn er einen Attentatsversuch befürchten musste. Seine Existenz war nur wenigen ausgewählten Personen bekannt, und Delacroix hatte Jahre gebraucht, um ihn im Schuldgefängnis aufzustöbern, wo Robeaud eingekerkert worden war, nachdem sein Wohltäter von den Engländern gefangen genommen wurde.
»Wer sind Sie?«, fragte Napoleon und wandte sich zu Delacroix um, der zackig salutierte. Er verspürte heftiges Herzklopfen, als ihm bewusst wurde, dass hier jenes militärische Genie, das einst den gesamten Kontinent beherrscht hatte, in Fleisch und Blut vor ihm saß.
»Leutnant Pierre Delacroix, Euer Majestät. Ich habe während der Schlacht von Trafalgar unter Kommodore Maistral auf der Neptune gedient.« Die Neptune war eines der wenigen Schiffe, die während der entscheidenden Seeschlacht, die den Heldenstatus Lord Nelsons bei den Briten begründete, nicht versenkt worden waren.
Napoleon kniff bei der Erwähnung einer der schlimmsten Niederlagen seiner Nation die Augen zusammen. »Was hat dieser nächtliche Besuch zu bedeuten?«
»Ich habe die Absicht, Sie von dieser Insel herunterzuholen, Euer Majestät. In Frankreich liegt eine Flotte von achtzig Kriegsschiffen unter meinem Kommando bereit und wartet auf Ihre Befehle.«
»Warum haben Sie die Insel dann nicht angegriffen, um mich zu befreien?«
»Weil die Offiziere ausschließlich Ihre persönlichen Befehle ausführen. Sie wollen nicht riskieren, die Royal Navy anzugreifen, solange sie nicht wissen, dass Sie tatsächlich befreit wurden.«
Der ehemalige Kaiser starrte sein Double an. »Und Monsieur Robeaud? Weshalb haben Sie ihn auf diese gottverlassene Insel mitgebracht?«
Delacroix nickte Pierre Robeaud zu, der eine kleine Flasche aus einer Tasche seiner Jacke nahm. Er schraubte die Kappe auf, betrachtete einige Sekunden lang die Öffnung der Flasche, dann setzte er sie an die Lippen und leerte sie.
Delacroix nahm ihm die Flasche aus der Hand und verstaute sie in seiner eigenen Jacke. »Robeaud hat sich nicht nur freiwillig dazu gemeldet, Ihren Platz einzunehmen, sondern er ist auch bereit gewesen, gegen die Zahlung einer Geldsumme, mit der die Schulden seiner Familie beglichen werden, das Arsen in diesem Fläschchen zu trinken. Er wird in einigen Tagen sterben, dafür wird seine Familie in Zukunft aber ein sorgenfreies Leben führen können. Die Ärzte, die die Engländer vor kurzem hierhergeschickt haben, um Ihren Leibarzt abzulösen, kennen Sie noch nicht gut genug, um einen Doppelgänger zu entlarven.«
Napoleon würdigte Delacroix’ taktischen Scharfsinn mit einem anerkennenden langsamen Kopfnicken. »Sehr gut, Leutnant. Ich sehe, dass Sie viel von mir gelernt haben. Würden die Engländer bemerken, dass ich geflohen bin, dürfte uns das Schiffsgeschwader, das St. Helena bewacht, einholen, ehe wir uns auch nur dreißig Seemeilen von der Insel entfernt haben.«
»Genau, Euer Majestät. Wir müssen jetzt gehen.«
»Aber wohin? Wie sollen wir von hier fliehen?«
»Vor Black Point wartet ein Unterseeboot.«
Napoleons Augen weiteten sich. »Sie meinen, Fultons seltsames Schiff funktioniert tatsächlich?«
»Kommen Sie mit, und ich zeige es Ihnen.«
Robeaud zog das Nachthemd an und legte sich ins Bett, während Napoleon in eine der militärischen Uniformen schlüpfte, die zu behalten ihm die Engländer gestattet hatten.
»Ich bestehe darauf, diesen Ort als aufrechter Soldat zu verlassen«, sagte er. Napoleon nahm ein Buch vom Nachttisch. Er riss mehrere Seiten heraus, verstaute sie in seinem Uniformrock und legte das Buch zurück. Auf dem Deckel war in Gold der Titel L’Odysseé in römischen Buchstaben und darunter in griechischer Schrift eingeprägt. Offensichtlich handelte es sich um Homers Odyssee.
Als Delacroix ihn ein wenig verwirrt ansah, erklärte Napoleon: »Die Seiten haben für mich eine sentimentale Bedeutung.«
Sie verließen das Landgut auf demselben Weg, auf dem Delacroix und Robeaud es betreten hatten. Napoleon befand sich in einer körperlich schlechteren Verfassung als seine Ablösung, daher dauerte der Rückmarsch zur Küste erheblich länger. Sie erreichten den Rand der Klippe nur zwei Stunden vor Tagesanbruch.
Delacroix warf ein Seilende über die Felskante, sodass die U-Boot-Mannschaft es auffangen konnte, dann bereitete er den Bootsmannsstuhl vor. Als Napoleon sah, auf welche Weise er den Weg bis zum Wasser zurücklegen sollte, weigerte er sich anfangs. Delacroix machte ihn jedoch darauf aufmerksam, dass der Bootsmannsstuhl die traditionelle Methode war, Offiziere auf ein Schiff zu holen, während sie sich auf See befanden. Daraufhin verstummten die Einwände des Kaisers.
Er nahm auf dem Stuhl Platz, während Delacroix hinter ihm auf das Trittbrett stieg und sich am Seil festhielt, damit sie nicht zu heftig hin und her schaukelten. Als Delacroix drei Mal kurz am Seil zog, ließen die Männer auf dem U-Boot das Seil auslaufen, das um die Rolle an der Felskante geschlungen war. Napoleon hielt sich kerzengerade und bemühte sich, in einer derart unbehaglichen Position so viel Würde wie möglich zu bewahren.
Nur eine Stunde vor dem Morgengrauen landeten Napoleon und Delacroix auf dem Deck des Unterseebootes. Die Matrosen holten das restliche Seil ein, während sie mit vor Staunen geöffneten Mündern den legendären Feldherrn und Kaiser anstarrten. Als das Seil vollständig geborgen war, blieb als einziger Hinweis auf ihr nächtliches Unternehmen der unverdächtige Felshaken mit Eisenring am Klippenrand zurück.
Sie stießen sich von der Felswand ab und zogen die Korkfender hoch. Noch vor Tagesanbruch würden sie sich so weit wie möglich von der Küste entfernen und erst dann wieder auf Tauchstation gehen.
»Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Erfolg, Leutnant«, sagte Napoleon. »Sie werden für diese tollkühne Tat die höchsten Auszeichnungen erhalten. Also, zuerst treffen wir mit unserer Fregatte zusammen, danach sollten wir sofort Kurs auf unsere Flotte nehmen, um …«
Delacroix schüttelte den Kopf. »Es gibt keine Flotte.«
Die Reaktion auf diese Feststellung war ein ungläubiger Blick. »Keine Flotte? Aber Sie sagten doch, Ihnen stünden achtzig Schiffe zur Verfügung.«
»Das sagte ich nur, damit Sie bereitwillig mitkommen. Dies ist eine Geheimmission. Niemand darf jemals erfahren, dass Sie geflohen sind.«
»Erwarten Sie etwa, dass ich mich davonschleiche wie ein Dieb in der Nacht und zulasse, dass ein Hochstapler meinen Platz einnimmt? Nein! Wie soll ich dann in meine rechtmäßige Position als Kaiser zurückkehren können? Ich muss meine Rückkehr an die Macht öffentlich bekannt machen. Ich weigere mich, wie ein gemeiner Krimineller aus meinem Gefängnis auszubrechen.«
»Sie haben in dieser Angelegenheit keine Wahl.«
Napoleon schlug mit der Faust gegen den Kommandoturm des Unterseebootes. »Leutnant Delacroix, ich verlange, augenblicklich von Ihnen zu erfahren, welche Pläne Sie mit meiner Befreiung verfolgen!«
»Sie unterliegen einem Missverständnis, Euer Majestät«, sagte Delacroix und deutete mit einem Kopfnicken auf einen Matrosen, der ein Paar eiserne Handfesseln bereithielt. »Wir haben diesen abgelegenen Ort nicht aufgesucht, um Sie zu befreien. Wir sind gekommen, um Sie zu entführen.«
EINS
ALGERIEN
GEGENWART
Mächtige Dünen und schroffe Felsklippen, durchglüht von der grellen Mittagssonne, erstreckten sich, so weit das Auge reichte. Die Frachtmaschine IL-76, seit dem Start in Kairo mittlerweile drei Stunden in der Luft, war gemäß entsprechender Fluganweisungen einem Zickzack-Kurs über der Sahara gefolgt.
Tiny Gunderson wandte sich in seinem Pilotensessel um und blinzelte verwirrt, als er Juan Cabrillo hinter sich stehen sah.
Normalerweise hatte Juan kurz geschnittenes blondes Haar, blaue Augen und als gebürtiger Kalifornier eine von der Pazifiksonne golden gebräunte Haut. Doch in diesem Augenblick war er als Araber verkleidet mit schwarz gefärbtem Haar, braunen Kontaktlinsen, dunkel geschminkter Haut und einer künstlichen Nase, die sein Aussehen vollkommen veränderte.
»Für einen Moment habe ich Sie glatt für einen unserer anderen Passagiere gehalten«, sagte Tiny.
»Sie sind im Frachtraum damit beschäftigt, ihre Ausrüstung zu überprüfen«, erwiderte Juan. »Sie wirken ein wenig nervös. Einige von ihnen sind noch nie mit einem Fallschirm abgesprungen.«
»Na, da haben sie sich den idealen Ort zum Lernen ausgesucht. Ich habe seit einer halben Stunde nichts mehr gesehen, was man als Straße bezeichnen könnte.«
»Sie wollen sichergehen, dass niemand vor uns ihren Zielort erreicht.«
»Damit dürfte kaum zu rechnen sein. Wir nähern uns dem letzten Kontrollpunkt. Ich brauche die nächsten Koordinaten.«
»Dann ist mein Timing absolut makellos«, sagte Juan. »Unser Klient hat sie mir soeben genannt. Er meinte, es sei die Absprungposition.« Er reichte Tiny einen Notizzettel mit einem Satz GPS-Koordinaten. Tiny tippte die neuen Zahlen in den Autopiloten-Computer des russischen Jets ein, und das vierstrahlige Flugzeug beschrieb eine weite Kurve in dieser Richtung.
»Wir müssten in zehn Minuten an Ort und Stelle sein«, sagte er. »Ich öffne die Hecktür zwei Minuten vor dem Absprung.«
Juan nickte. »Wie sieht unser Treibstoffvorrat aus?«
»Kein Problem. Uns stehen weitere acht Stunden Flugzeit zur Verfügung.«
»Denken Sie daran«, sagte Juan, »die Leute verlassen die Landezone erst dann, wenn Sie außer Sicht sind, also verschwinden Sie, sobald wir draußen sind.«
»Als ob mir der leibhaftige Teufel im Nacken säße, Chairman. Ich wünsche einen guten Sprung.«
Juan grinste. »Wir bleiben in Verbindung.« Er verließ das Cockpit und stieg die schmale Treppe in den riesigen Frachtraum hinab.
Vier Paletten besetzten den mittleren Bereich des Frachtabteils. Drei Strandbuggys waren hintereinander aufgereiht, ihre Fallschirme über den Sitzen locker zusammengefaltet und die Reißleinen an einer Führungsstange im Flugzeug verankert, sodass sie automatisch betätigt wurden, sobald die Fahrzeuge die Maschine verließen.
Die Strandbuggys waren Scorpion-Wüstenfahrzeuge aus den Beständen der saudischen Armee. Natürlich war ihre Bewaffnung entfernt worden. Ein Tag war nötig gewesen, um sie jeweils erneut mit einem M2-Browning-Kaliber-.50-Maschinengewehr und einem 40mm-MK-19-Granatwerfer auszurüsten, der normalerweise auf dem Chassis montiert war. Nun konnten sie es mit jedem Gegner bis fast zum Kaliber eines Panzers aufnehmen, und wie ihre Kunden hatten durchblicken lassen, würden die Waffen nicht nur Demonstrationszwecken dienen.
Die vierte Palette, genauso groß wie die Strandbuggys, war mit einer Plane bedeckt und stand im vorderen Teil des Frachtraums. Sie würde bei dieser Gelegenheit nicht abgeworfen werden.
Juan ging zu den sechs Männern hinüber, die sich in der Nähe der Hecktür versammelt hatten. Sie alle waren Elitesoldaten des Saharan Islamic Caliphate, einer Terroristenvereinigung, die hoffte, einen fundamentalistischen Staat zu errichten, der sich über ganz Nordafrika erstrecken sollte.
Der Anführer dieser besonderen Gruppierung, ein für seine brutalen Methoden berüchtigter Ägypter namens Mahmoud Nazari, dem mehrere Attentate auf Reisegruppen zugeschrieben wurden, hatte verlauten lassen, dass er versuche, Massenvernichtungswaffen in seinen Besitz zu bringen, um damit die Vormachtstellung seines Kalifats zu sichern. Die NSA hatte eine Unterhaltung zwischen ihm und seinen Unterstützern in Saudi-Arabien aufgefangen, aus der hervorging, dass er umfangreiche Geldmittel benötige, um in Algerien einzudringen, wo er die gewünschten Waffen erwerben könne.
Obgleich dem abgehörten Gespräch nicht zu entnehmen war, um welche Art von Waffen es sich handelte, wurde die Bedrohung doch ernst genommen, und die Corporation hatte den Auftrag erhalten, in Erfahrung zu bringen, was Nazari zu finden hoffte.
Juan blieb vor den Männern stehen. Nazari, eine hagere Erscheinung mit Vollbart und toten Augen, zeigte keinerlei Gefühlsregung. Er fragte auf Arabisch: »Wie lange noch bis zum Absprung?«
»Weniger als zehn Minuten«, antwortete Juan im reinsten saudi-arabischen Tonfall. Er sprach außerdem noch Russisch und Spanisch fließend, aber er beherrschte keinen anderen arabischen Dialekt, daher machte ihn seine Legende zu einem Dschihadisten aus Riad.
Angesichts der Grausamkeiten, die Nazari begangen haben sollte, hatte Juan jedes Mal, wenn er mit dem Terroristen kommunizieren musste, einen üblen Geschmack im Mund. Als sich Nazari einmal damit gebrüstet hatte, bei einem seiner Überfälle einem westlichen Touristen die Hände abgehackt zu haben, hätte Juan ihn beinahe ohne Fallschirm aus dem Flugzeug geworfen. Aber die Mission, die Massenvernichtungswaffen zu finden und aus dem Verkehr zu ziehen, war einfach zu wichtig, um diesem Drang nachzugeben.
»Wie weit müssen wir fahren, nachdem wir gelandet sind?«, fuhr Juan fort.
»Das werden Sie wissen, wenn ich es Ihnen sage. Und jetzt schließen Sie Ihre Vorbereitungen ab.« Juan hatte zwar keine Antwort erwartet, aber er hätte sich verdächtig gemacht, wenn er keine Fragen zu der Mission gestellt hätte.
»Ja, Sir«, sagte Juan und zwang sich zu einem Tonfall vorgetäuschten Respekts. Er deutete auf die Warnlampe über ihren Köpfen. »Dort blinkt es rot, wenn die Hecktür geöffnet wird. Bleiben Sie hinter der gelben Linie auf dem Boden, wenn Sie nicht aus der Maschine hinausgesogen werden wollen. Eine Minute vor dem Absprung schaltet die Lampe auf Gelb um, danach leuchtet sie grün, wenn der Absprung erfolgen muss. Die Paletten zuerst, dann wir. Verstanden?«
»Das sind wir doch schon vor dem Start durchgegangen«, sagte Nazarin ungehalten. »Wir sind schließlich keine Dummköpfe.« Seine Männer, die ihr Gurtzeug und die Fallschirmleinen überprüften, hatten offenbar keinerlei Einwände gegen diese Gedächtnisstütze.
»Natürlich«, sagte Juan. »Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wir sehen uns unten.«
Juan überließ sie ihren Vorbereitungen und ging zum vorderen Teil des Frachtdecks. Dass sie und die Fahrzeuge heil und intakt auf dem Erdboden landeten, war ihm nur deshalb wichtig, weil sie ihn dann zum Ziel ihres Unternehmens führen könnten. Es war nicht leicht gewesen, ihr Vertrauen in diesem Maß zu gewinnen, wie es ihnen offenbar gelungen war. Deshalb führten bei dieser Operation auch nicht die U.S. Special Forces Regie. So gut sie in anderen Bereichen sein mochten, Infiltration gehörte nicht gerade zu ihren Stärken, und die CIA war in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt.
Juan hatte die Corporation geschaffen, um Aktionen durchzuführen, bei denen jeder Hinweis darauf, dass die amerikanische Regierung daran beteiligt war oder dahinterstand, vermieden werden musste. Die Regel war, dass die USA als handelnder Partner bei derartigen Unternehmungen niemals in Erscheinung traten. Während seiner vorübergehenden Tätigkeit im Dienst der CIA hatte er die Erfahrung gemacht, dass zahlreiche solcher Operationen durch eine Organisation wie die Corporation durchgeführt werden mussten. Juan war von Anfang an bereit gewesen, die Risiken solcher Operationen gemeinsam mit seiner Firma zu tragen, für die er und seine Mitstreiter stets großzügig entlohnt wurden. Nebenjobs besserten ihr Einkommen auf, wenn die Aufträge von Seiten der CIA spärlicher waren, aber Juan nahm niemals einen Auftrag an, bei dem er das Gefühl hatte, dass damit nicht auch die Interessen Amerikas verfolgt wurden.
Diese Mission entsprach seinen Anforderungen in vollem Umfang.
Es hatte vieler Wochen und zahlreicher geheimer Treffen bedurft, um Nazaris Vertrauen hinreichend zu erwerben, sodass er gewillt war, sie für diese Mission zu engagieren. Er wünschte ein unbemerktes Vordringen in die algerische Wüste, achtzig Kilometer unwegsamen Geländes von der nächsten menschlichen Ansiedlung oder Oase entfernt. Die Benzintanks der Strandbuggys fassten gerade genug Treibstoff, um vom Absprungpunkt bis zum Ziel und wieder zurück in die Zivilisation zu gelangen, was einer der Gründe dafür war, dass die Infiltration auf dem Luftweg stattfinden musste. Der andere Grund war, dass sie sich nicht auf algerischem Terrain aufhalten durften. Die Oregon ankerte bereits im Hafen von Algier, um sie auf kürzestem Weg außer Landes zu schmuggeln. Tiny Gunderson, der Starrflüglerpilot der Corporation, würde die gecharterte IL-76 nach Abschluss der Mission zu ihren Eigentümern zurückbringen. Ursprünglich hätte die Operation drei Tage später stattfinden sollen, aber Nazari hatte die Zeitachse aus unbekannten Gründen plötzlich verkürzt.
Juan traf Eddie Seng dabei an, wie er sich vergewisserte, dass die Buggys auf den Paletten unverrückbar festgezurrt waren. Schlank und muskulös wie ein Kunstturner, war Eddie ein weiterer CIA-Veteran im Dienst der Corporation und deren Chef für landgestützte Operationen. Auch wenn er Mandarin fließend beherrschte, verfügte er über keinerlei Arabischkenntnisse und hatte daher kaum direkten Kontakt mit Nazari und seiner Truppe gehabt. Juan hatte ihnen erklärt, dass Eddie ein Freiheitskämpfer aus Indonesien sei, der volkreichsten muslimischen Nation der Erde. Glücklicherweise hatten sie bislang nicht erkannt, dass Eddie eigentlich chinesischer Abstammung war.
»Wie machen sich unsere Freunde?«, fragte Eddie und grinste, als er beobachtete, wie sich einer von ihnen in der Leine verhedderte, die automatisch die Reißleine ziehen würde. »Einige sind ziemlich grün um die Nasenspitzen.«
»Ich hoffe nur, dass sie sich bis zum Absprung zusammenreißen«, sagte Juan und schlängelte sich in sein Fallschirmgeschirr. »Tiny bekommt einen Tobsuchtsanfall, wenn sie sich von ihrer letzten Mahlzeit verabschieden und er die Sauerei beseitigen muss, ehe er das Flugzeug zurückgibt. Sind wir bereit?«
»Alles ist okay. Wir können jederzeit starten.«
»Wo ist Linc?«
»Ist ein letztes Mal zur Toilette gegangen«, antwortete eine tiefe Bassstimme hinter Juan. Er wandte sich um und sah Franklin Lincoln, der in einer Hand seinen Fallschirm und in der anderen zwei AK-47-Sturmgewehre trug, als ob es Kinderspielzeuge seien. Der riesige Afroamerikaner mit einem Kopf, so glatt und glänzend wie eine Billardkugel, reichte Juan ein AK-47, eine der Waffen, die er hasste. Widerstrebend ergriff er sie.
»Machen Sie mir keinen Vorwurf, Chairman«, sagte Linc. Als ehemaligem Navy-SEAL wäre ihm ebenfalls eine modernere Waffe lieber gewesen. »Bedenken Sie, dass wir mit den Wölfen heulen müssen, um nicht aufzufliegen.« Lincs Tarnidentität war die eines Nigerianers, der sich dem Kampf gegen die westlichen Ungläubigen angeschlossen hatte.
Laut der aktuellen Geheimdienstinformationen war es unwahrscheinlich, dass Nazari und seine Männer Englisch sprachen. Juan hatte Nazari erklärt, dass er, Eddie und Linc sich auf Englisch untereinander verständigten, weil sie aus Saudi-Arabien, Indonesien und Nigeria kämen. Trotzdem redete Juan stets so leise wie möglich, nur für den Fall, dass die CIA-Informationen nicht zutrafen.
»Das heißt noch lange nicht, dass es mir gefallen muss«, sagte Juan und befestigte das Gewehr an seinem Gurtgeschirr.
»Kennen wir mittlerweile unser Ziel?«, fragte Eddie.
»Nada. Nazari gehört nicht gerade zur mitteilsamen Sorte. Ich bin mir nicht mal sicher, dass seine Männer es kennen.« Juan tippte auf seine Uhr, und Stimmen erklangen plötzlich in seinem Ohrhörer. Er konnte Nazari so deutlich hören, als stünde er direkt neben dem Terroristen. Bisher hatte der winzige Mikrofon-Transmitter, den Juan im Polster seines Gurtgeschirrs versteckt hatte, keine verwertbaren Informationen geliefert.
»Aber sie haben alles getan, was wir verlangt haben«, konnte Juan einen von Nazaris Soldaten sagen hören.
»Das ist mir egal«, erwiderte Nazari. »Wir dürfen dieses Risiko nicht eingehen. Sobald sie dahinterkommen, was wir ausgegraben haben, könnten sie es sich vielleicht anders überlegen und …«
In diesem Moment sank die hintere Tür herab und ließ einen Luftschwall herein, dessen Fauchen und Pfeifen alle anderen Laute so überdeckte, dass Juan nur noch Bruchstücke der weiteren Unterhaltung aufschnappen konnte.
Juan, Eddie und Linc vergeudeten keine Zeit und beendeten die Vorbereitungen für den Absprung. Alles befand sich in der vorgeschriebenen Position, als das gelbe Licht aufleuchtete.
Eine Minute bis zum Absprung.
»Wir müssen absolut auf Zack sein und sofort einkassieren, was immer es ist, worauf sie so scharf sind«, sagte Juan mit einem Blick zu Nazari am anderen Ende des Frachtraums. »Ich glaube, gerade gehört zu haben, dass unser Kunde uns in diesem Moment umbringen will.«
Linc grinste. »Reizend.«
Dann wechselte die Signallampe zu Grün, die Paletten mit den Standbuggys glitten nacheinander aus der Hecköffnung, und Juan stürzte sich als Erster hinaus ins Leere, wo fünfzehnhundert Meter unter ihnen die Wüste wartete.
ZWEI
MONACO
Henri Munier hätte niemals offen zugegeben, dass er Motorsport verabscheute, zumal er Direktor einer Bank war – in einem Land, in dem alljährlich das berühmteste Autorennen der Welt stattfand. Viele seiner wichtigsten Kunden waren Formel-Eins-Fahrer, die in Monaco lebten, um die Vorzüge seines Rufs als Steueroase auszukosten. Sie wären zutiefst beleidigt gewesen zu erfahren, dass er ihren Sport als abstoßend und langweilig empfand.
Er saß in seinem neuen nach seinen Wünschen angefertigten elektrischen Tesla SUV, schüttelte den Kopf und hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, als er in die Nähe der als Le Rascasse bekannten Kurve der Grand-Prix-Strecke gelangte. Das Vormittagsrennen der Formel-3.5-Wagen näherte sich seinem Ende, und das schrille Heulen der hochtourigen Motoren, während sie durch die enge Kurve schlichen und gleich wieder auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigten, war deutlich zu hören. Die Fenster des SUV schafften es nicht, das durchdringende Kreischen abzuschirmen.
Und es würde noch schlimmer werden. Das große Formel-Eins-Ereignis, bei dem die technisch höchstentwickelten Rennwagen der Welt zum Einsatz kämen, würde am Nachmittag starten. Es war eins der wenigen Grand-Prix-Rennen, das auf städtischen Straßen ausgetragen wurde, und Munier hasste die Störung des Straßenverkehrs von Monte Carlo während der sechs Wochen vor und der drei Wochen nach dem Rennen, in denen der Kurs aufgebaut und wieder abgebaut wurde.
Er hatte nicht die Absicht, dem Rennen beizuwohnen und zwei Stunden lang Interesse an seinem Verlauf vorzutäuschen. Wie jedes Jahr nutzte er die Gelegenheit, um eine Einladung zu einer der rauschenden Partys anzunehmen, die auf den zahlreichen dicht gedrängt nebeneinanderliegenden Luxusjachten im Hafen stattfanden, alle mit perfekter Sicht auf das Rennen. Er hatte seine Frau und seine beiden Töchter zum Sonnenbaden nach Antibes geschickt, sodass er während des Wochenendes von familiären Verpflichtungen befreit war.
Dieses Jahr hatte er die begehrteste Einladung der Stadt erbeutet. Eine der größten Jachten der Welt, die Achilles, hatte am längsten Pier des Hafens festgemacht, und die dekadenten Feiern, die auf ihren Decks für alle sichtbar stattgefunden hatten, bildeten seit einer Woche das Hauptgesprächsthema in der Stadt. Der Eigner, Maxim Antonowitsch, hatte Munier eine mit Blattgold geränderte Einladung überbringen lassen, und der Bankier vermutete, dass der öffentlichkeitsscheue Milliardär darüber verhandeln wollte, einen wesentlichen Teil der Geldgeschäfte seiner Holdings der Bank Crédit Condamine anzuvertrauen. Vielleicht zog er sogar seine Einbürgerung in Monaco in Erwägung.
Munier hatte nichts dagegen einzuwenden, Angenehmes mit Nützlichem zu verbinden.
Er hielt am Ende des Piers nahe der Achilles an und betrachtete das imposante Schiff. Obgleich er an den Anblick der schwimmenden Attribute des Reichtums gewöhnt war, musste er zugeben, dass keine Jacht im Hafen mit dieser einen zu vergleichen war.
Mit einhundertfünfunddreißig Metern vom Bug bis zum Heck war sie zwar nicht so lang wie die größten Mega-Jachten, aber was ihre Breite betraf, so suchte sie ihresgleichen. Die Hauptmasse ihrer Aufbauten ruhte auf zwei riesigen Zwillingsrümpfen, die dem Schiff auch bei schwerster See beeindruckende Stabilität verliehen. Der Innenraum war sicherlich zwei Mal so groß wie der gleich langer Jachten, und zwei große Schwimmbecken und ein Whirlpool auf dem Oberdeck waren das Zentrum zahlreicher Partys. Das Achterdeck bot nicht nur ausreichend Raum für einen Helikopter-Landeteller, sondern auch für einen Hangar, in dem die Maschine mit zusammengefalteten Rotorflügeln Platz fand.
Die elfenbeinweiße Jacht war unter strenger Geheimhaltung gebaut worden, daher waren lediglich Gerüchte über zahlreiche ihrer technischen Einrichtungen im Umlauf. So wurde angenommen, dass die Jacht über ein Unterseeboot und ein Verteidigungssystem zur Abwehr mit Raketen bewaffneter Piraten verfügte. Munier wäre nicht überrascht gewesen, wenn es tatsächlich der Fall gewesen wäre. Seit die Luxusjacht Tiara im Jahr 2008 vor Korsika nachts geentert und um einhundertvierzigtausend Euro erleichtert wurde – Kreditkarten, Mobiltelefone und Schmuck hatten die Piraten zurückgelassen –, hatten die Jachtbesitzer beträchtlich aufgerüstet und keine Kosten gescheut, um ihre Schiffe zu schützen.
Als er aus dem Wagen stieg, fächelte eine leichte Brise über Muniers Pima-Baumwollhemd und seine Sommerhose aus indischer Rohseide, während er auf die Gangway der Achilles zusteuerte, an deren Ende er von einer bildschönen jungen blonden Frau begrüßt wurde. Hinter ihr standen zwei athletische Männer in dunklen Anzügen bereit, um unerwünschte Besucher fernzuhalten. Züchtig bekleidet mit einem maßgeschneiderten Hosenanzug mit Weste, der ihre schlanken Konturen dezent zur Geltung brachte, warf sie einen kurzen Blick auf das Tablet, das sie in einer Hand hielt, ehe sie den Bankier in akzentfreiem Englisch ansprach.
»Mr. Munier«, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln, »ich bin Ivana Semova, Mr. Antonowitschs Privatsekretärin. Willkommen auf der Achilles.«
Er ergriff ihre Hand, schüttelte sie und erwiderte: »Ich fühle mich durch die Einladung geehrt. Sein Ruf als großzügiger Gastgeber ist legendär. Habe ich Gelegenheit, ihn kennenzulernen, während ich an Bord bin, damit ich mich bei ihm persönlich bedanken kann?«
»Mr. Antonowitsch bittet Sie sogar, in den vorderen Salon zu kommen. Wenn Sie mir folgen würden …«
Sie ging über die Gangway voraus und stieg danach einige Stufen zum offenen Hauptdeck hinauf. Dutzende von badenden Schönheiten in knappen Bikinis umschwärmten Männer jeden Alters und Aussehens, einige im Swimmingpool, einige auf breiten gepolsterten Sonnenliegen. Rhythmisch stampfende Diskomusik, nur wenig erträglicher als der Lärm der Rennwagen, drang aus unsichtbaren Lautsprechern, die auf dem Deck verteilt waren.
Als sie das Schiffsinnere betraten und sich die massiven Flügel der Doppeltür hinter ihnen schlossen, wurde die Musik augenblicklich zu einem kaum mehr hörbaren Summen reduziert. Als sie über persische Teppiche schritten, wurde das Klicken von Ivanas Louboutin Pumps sekundenlang verschluckt.
»Da wären wir«, sagte sie, als sie einen weiteren elegant eingerichteten Raum betraten, an dessen Ende ein breiter Mahagonischreibtisch stand. Der hochlehnige Sessel dahinter wandte dem Raum seine Rückseite zu, sodass Munier seinen Gastgeber nicht sehen konnte.
Er nahm an, dass dies Antonowitschs besondere Art war, seinen Auftritt zu inszenieren. Bisher kannte er nur einige grobkörnige Fotos des als einsiedlerisch geltenden Milliardärs, der Mitte sechzig und korpulent war, grau meliertes lockiges Haar hatte und dessen linke Wange ein dunkelrotes Muttermal in der Form eines Krummsäbels zierte. Antonowitsch hatte sein Vermögen auf altmodische Art erworben, indem er zahlreiche der ergiebigsten Erzvorkommen im Kaukasus aufkaufte, als die Bergewerke privatisiert wurden. Seitdem unterstützte er angeblich politische kremlfeindliche Gruppierungen, was seinen von Paranoia geprägten Lebensstil erklärte.
Munier wartete darauf, dass der Milliardär seine Anwesenheit offenbarte.
Doch nichts geschah.
Ivana tippte auf das Display ihres Smartphones, ohne dem zunehmend peinlichen Schweigen Beachtung zu schenken.
Munier räusperte sich. »Wird Mr. Antonowitsch bald erscheinen?«
»Nur einen Moment«, erwiderte die Frau, aber Munier wusste nicht, ob sie meinte, dass sein Gastgeber in einem Moment eintreten würde oder dass sie noch einen Moment brauchte, um sich uneingeschränkt um den Besucher kümmern zu können. In der Bank war Munier derjenige, der Leute warten ließ, aber hier hielt er sich trotz seines wachsenden Unmuts über diese offensichtliche Missachtung seiner Person zurück. Wenn sich seine geschäftlichen Erwartungen nicht erfüllten, wollte er sich wenigstens so bald wie möglich in den Partytrubel stürzen.
Eine Tür am hinteren Ende schwang auf, und ein kleiner, muskulöser Mann kam herein. Seine Begleiter, ein Inder und ein auffällig blasser Mann mit rotbraunem Haar, waren ebenfalls von athletischer Statur. Der neben ihnen fast kleinwüchsig erscheinende Anführer hatte kurz geschorenes schwarzes Haar mit unregelmäßigen kahlen Flecken. Seine Nase sah aus, als wäre sie bei einigen Schlägereien gebrochen worden, seine schmalen Lippen waren zu einem geringschätzigen Grinsen verzogen, und eine längliche Brandnarbe begann unterhalb seiner linken Ohrmuschel und verschwand in seinem Hemdkragen. Trotz seines von Brutalität geprägten Aussehens füllte er den Raum mit einer charismatischen Ausstrahlung.
Er blieb vor Munier stehen und betrachtete ihn wortlos.
Munier entschied, dass er als Erster das Wort ergreifen sollte, um das Eis zu brechen. »Mr. Antonowitsch, es ist mir eine große Freude, Sie …«
Ein bellendes Lachen drang aus dem Mund des Mannes und brach abrupt ab.
»Ich bin nicht Antonowitsch. Mein Name ist Sergej Golow. Ich bin der Kapitän dieses Schiffes.« Sein Akzent war nicht sehr stark, aber eindeutig slawisch. »Nehmen Sie Platz, Munier. Es gibt einiges, worüber wir reden müssen.«
Obgleich ihn diese Ankündigung verwirrte, befolgte Munier die Aufforderung. Er erwartete, dass ihm ein Cocktail angeboten wurde, aber nichts dergleichen geschah.
Er warf einen Blick zu dem noch immer umgedrehten Schreibtischsessel und sah dann zu Ivana hinüber, deren Lächeln sich verflüchtigt hatte. »Ich bin davon ausgegangen, dass Mr. Antonowitsch zugegen sein würde.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Antonowitsch kommt nicht«, sagte Golow. »Ich habe Sie hierhergebeten.«
Munier zwang sich zu einem Lächeln. »Dann muss ich mich bei Ihnen für die Einladung zu der Party bedanken. Kann ich etwas für Sie tun?«
Golow lachte verhalten, ließ sich gegenüber Munier in einen Sessel sinken und stützte die Ellbogen auf die Knie. Der Inder und der rothaarige Mann bauten sich mit unbeweglichen Mienen hinter ihm auf.
»Zu der Party … richtig«, sagte Golow. »Ja, ich habe Sie zu einer Party eingeladen, aber sie verläuft ein wenig anders, als Sie vielleicht erwartet haben.«
Munier rutschte hin und her und suchte sich eine andere Sitzposition. Plötzlich verspürte er ein zunehmendes Unbehagen. »Was meinen Sie?«
»Meine Party ist eher ein Kommandounternehmen.«
»Ich verstehe nicht.«
»Sie werden mir helfen, Ihre Bank auszurauben. Heute.«
Munier blinzelte mehrmals, während er versuchte, sich auf das, was er soeben gehört hatte, einen Reim zu machen. Dann spielte ein Lächeln in seinen Mundwinkeln. »Sie machen einen Scherz, nicht wahr? Hat Georges Petrie Sie dazu überredet?« Petrie, der stellvertretende Direktor der Bank Credit Condamine, war für seine gelegentlichen sorgfältig inszenierten Lausbubenstreiche geradezu berüchtigt.
»Kein Scherz, Munier«, sagte Golow, aus dessen Miene jegliches Lachen verschwunden war. »Sehen wir in Ihren Augen aus wie jemand, der Späße liebt?«
Muniers Herz hämmerte gegen sein Brustbein. »Eigentlich nicht.«
»Sehen Sie, die biometrischen Schlösser in Ihrer Bank können nur von Ihnen geöffnet werden.«
Petries Fingerabdrücke und Retinamuster erfüllten dieselben Voraussetzungen, aber Munier klärte ihn nicht darüber auf.
»Und die funktionieren natürlich nur«, fuhr Golow fort, »wenn Sie am Leben sind und atmen. Abgehackte Finger und herausgeschälte Augäpfel, so was funktioniert nur im Kino. Wir wissen, dass die neuesten Sicherheitssysteme sogar auf die Bewegung des Blutkreislaufs reagieren.«
»Weshalb sollte ich Ihnen helfen?«
»Weil ich Sie auf der Stelle töte, wenn Sie es nicht tun.« Um seinem Argument Nachdruck zu verleihen, zogen die Männer hinter seinem Sessel Pistolen aus ihren Jacketts und hielten sie lässig in den Händen.
Munier wollte schlucken, aber sein Mund war vollkommen ausgetrocknet. »Also, ich helfe Ihnen, und dann lassen Sie mich gehen?«
»Sie sind nicht dumm, Munier. Sie haben unsere Gesichter gesehen. Das war wegen der Dinge, die wir planen, nicht zu vermeiden. Wir können keine Zeugen zurücklassen, daher dürfte Ihnen, wie ich denke, klar sein, dass Sie aus dieser Geschichte nicht lebend herauskommen.«
»Warum … aus welchem Grund sollte ich dann tun, was Sie von mir verlangen?«
Golow gab Ivana mit einem Kopfnicken ein Zeichen, und sie kam mit dem Tablet zu ihm herüber. Sie tippte mehrmals auf das Display, dann drehte sie es in Muniers Richtung.
Was er erblickte, ließ seinen Atem stocken.
Da waren seine Frau und seine beiden Kinder am Strand und bauten gerade eine Sandburg.
»Zeigen Sie es ihm«, sagte Ivana in ihr Telefon.
Der Bildausschnitt verschob sich, sodass Munier die Pistole sehen konnte, die der Kameramann in der Hand hielt.
Munier wollte seiner Familie eine Warnung zurufen, aber Ivana zog das Tablet zurück, ehe er einen Laut über die Lippen brachte.
»Sie sind ein Monster«, stieß Munier hervor und starrte Golow an. Sein Blick wanderte weiter zu der Frau. »Sie beide sind Monster.«
»Glauben Sie mir«, sagte Golow. »Wir wollen nicht, dass es so weit kommt. Aber ich habe schon Schlimmeres getan.«
Ein verzweifelter Gedanke schoss Munier durch den Kopf. »Georges Petrie! Sie können doch Petrie nehmen! Er kann Sie reinlassen. Tun Sie meiner Familie nichts an.« Ein ersticktes Schluchzen drang aus seiner Kehle. »Ich schwöre, dass ich niemandem etwas verraten werde.«
»Nein. Sie sind unsere einzige Option.«
»Aber Petrie …«
»Unglücklicherweise haben wir es bereits bei ihm versucht«, sagte Golow. Er nickte dem Inder zu, der zum Schreibtischsessel ging und ihn herumdrehte.
Bis zu diesem Augenblick hatte sich Munier an die Hoffnung geklammert, dass es für ihn einen Ausweg aus dieser Situation gab und er eine Lösung fand. Nun hingegen wusste er, dass er keine andere Wahl hatte, als das zu tun, was sie von ihm verlangten.
Nicht Maxim Antonowitsch hatte in dem Sessel gesessen, wie er angenommen hatte. Sondern es war George Petrie, der ihn mit blicklosen Augen anstarrte, die sonnengebräunte Stirn durch ein Einschussloch verunstaltet.
DREI
ALGERIEN
Während er dem Erdboden entgegensank, konnte Juan die zerklüfteten Felsformationen deutlicher erkennen, die in unregelmäßigen Abständen aus den Sandmassen der riesigen Dünen herausragten, und er hoffte, dass keiner der Strandbuggys auf ihnen gelandet war. Da sie zu neunt waren und jeder Buggy nur über drei Sitze verfügte, hätte ein verzogenes Chassis oder eine gebrochene Achse zur Folge gehabt, dass mindestens drei von ihnen in einer der lebensfeindlichsten Regionen der Erde gestrandet wären.
Juan wusste genau, wer den Kürzeren zöge, wenn es dazu käme. Nazari würde nicht zögern, sie zurückzulassen, vor allem da er offenbar eigene Vorbereitungen getroffen hatte, Algerien zu verlassen, für den Fall, dass er beabsichtigte, Juan, Eddie und Linc zu töten.
Juan hielt sich während des Sinkflugs in der Nähe seines Teams auf, aber die ungeübten Ägypter waren über ein weites Gebiet verstreut gelandet.
Nachdem er sich von seinem Fallschirm befreit hatte, erklomm Juan die nächste Düne, um das Gelände in Augenschein zu nehmen. Die Sonne brannte vom Himmel. Sein Kopftuch milderte die Hitze kaum, und er war froh, dass anstatt der Kevlarschicht, die Soldaten gewöhnlich mit sich herumschleppten, die modernste leichtgewichtige schusssichere Membran in seine Kleidung eingenäht war.
»Dort sind die Scorpions«, sagte er und deutete auf die Wüstenfahrzeuge, die in einer Linie in der nebenan liegenden Dünensenke gelandet waren. »Holt unseren Wagen von der Palette herunter und entfernt die Fallschirme.«
»Was ist mit Ihnen, Boss?«, fragte Eddie Seng.
Juan sah, dass Nazari zu zwei Ägyptern links von ihnen hinüberging. Einer der Männer lag im Sand und krümmte sich vor Schmerzen.
»Ich sehe mal nach, was ihm zugestoßen ist. Holt mich ab, wenn der Scorpion fahrbereit ist.«
Juan stapfte vorsichtig den Abhang hinunter, um keine Lawine auszulösen. Der lose, feinkörnige Sand erlaubte nur ein langsames Vorwärtskommen, und sich mit einem Fahrzeug darauf zu bewegen wäre eine heikle Angelegenheit.
Er erreichte den verletzten Mann gleichzeitig mit Nazari. Er war einer der unerfahrenen Fallschirmspringer. Sein Gesicht war vor Qual verzerrt.
Der Mann, der neben ihm kniete, um ihm zu helfen, wandte sich zu Nazari um und sagte: »Sein Unterschenkel ist gebrochen. Er ist auf diesem Stein dort gelandet, und sein Bein ist umgeknickt.« Er deutete auf einen Felsenturm neben ihnen, obgleich das grotesk abgewinkelte Schienbein des Mannes eine Erklärung unnötig machte.
Juan verspürte ein vertrautes Zucken, als er die grässliche Verletzung betrachtete. Sein eigenes Bein hatte unterhalb des Knies nach einer Schießerei mit einem chinesischen Kanonenboot amputiert werden müssen. Er hatte sich so sehr an die Prothese, die er trug, gewöhnt, dass Nazari in ihm niemals einen Mann mit nur einem gesunden Bein vermutet hätte, aber der Phantomschmerz der fehlenden Gliedmaße machte sich auch nach Jahren immer noch bemerkbar.
Juan bückte sich, um das verwundete Bein zu untersuchen. Dann blickte er zu Nazari hoch. »Schien- und Wadenbein sind gebrochen. Wir müssen beides gerade richten und eine Schiene anlegen. Laufen kann er damit nicht, daher müssen wir ihn entweder tragen oder Krücken für ihn basteln.«
»Sind Sie sicher?«, fragte Nazari.
»Ich bin kein Arzt, aber solche Verletzungen habe ich schon des Öfteren gesehen.«
Nazari nickte. Ohne ein weiteres Wort zog er seine Pistole und schoss dem Mann zwei Mal in den Kopf.
Juan sprang auf und starrte Nazari und die 9mm-SIG-Sauer in seiner Hand an.
»Für all das haben wir keine Zeit«, sagte Nazari seelenruhig. »Er hätte uns nur behindert.«
Der andere Mann sprang ebenfalls auf, und es schien, als wollte er einen großen Fehler machen und Nazari angreifen.
»Er ist jetzt ein Märtyrer«, erklärte Nazari seinem Soldaten. »Wie wir alle am Ende Märtyrer sein werden. Wir konnten ihn nicht mitnehmen, und ihn hier liegen und verdursten zu lassen, wäre grausam gewesen. Mach unseren Scorpion startbereit. Wie ich schon sagte, wir haben nicht viel Zeit.«
Der Soldat wich zurück, warf einen letzten Blick auf seinen Kameraden und eilte so schnell er konnte zu den Buggys hinüber.
»Er versteht die Situation nicht so wie Sie und ich«, sagte Nazari zu Juan. »Ich erkenne es in Ihnen. Wir beide sind uns gleich.«
Juan hätte sich bei dieser Vorstellung beinahe vor Abscheu geschüttelt. »Wie meinen Sie das?«
»Wir beide sind bereit, alles zu tun, um diese Mission erfolgreich abzuschließen.«
Ehe Juan auf diese Beleidigung, die Nazari allerdings als Kompliment gemeint hatte, reagieren konnte, näherte sich Scorpion 1 mit Eddie am Steuer und Linc hinter dem Kaliber-.50-Maschinengewehr im Wagenheck. Der 200 PS starke Motor grollte heiser, als der Wagen neben ihm anhielt. Das Einzige, was ihn von den anderen Wüstenjeeps unterschied, war die kleine »1« auf der Seitenwand.
Eddie betrachtete den Toten und fragte: »Was ist passiert?«
»Unser Kunde hat mir soeben seine Entschlossenheit demonstriert«, antwortete Juan. Nichts in Nazaris Augen verriet, dass er die Worte verstanden hatte, aber sie fixierten ihn argwöhnisch.
Juan schwang sich auf den Beifahrersitz hinter den 40mm-Granatwerfer und setzte den Helm auf, den Eddie ihm reichte.
Scorpion 2 erschien wenige Sekunden später, und Nazari kletterte hinein.
Als auch der dritte Wüstenbuggy startbereit war, übernahm Nazari die Spitze und verwendete ein GPS-Gerät als Navigationshilfe, während sie sich hohe Dünen hinauf und hinunter wühlten und um größere Felsformationen herumkurvten.
Nazari hatte darauf geachtet, dass sie von ihrem Landepunkt weit entfernt waren, als sie ihr Ziel erreichten. Nach einer halben Stunde Fahrt nahm Juan das Blinken von Sonnenstrahlen auf Metall als ein Flimmern in der vor Hitze wabernden Luft in der Ferne wahr.
»Ist das eine Fata Morgana?«, fragte er. Er war durch das im Helm integrierte Kommunikationssystem nur mit Eddie und Linc verbunden.
Linc, der auf seinem Sitz im Wagenheck eine höhere Position einnahm, erwiderte: »Ich glaube nicht, aber ich kann nicht genau erkennen, was es ist.«
Nazari musste es ebenfalls bemerkt haben, denn sein Scorpion änderte die Fahrtrichtung und steigerte das Tempo.
»Das muss unser Ziel sein«, sagte Juan.
Eddie gab Gas, um den Anschluss nicht zu verlieren. Als sie sich dem Objekt bis auf etwa vierhundert Meter genähert hatten, waren seine Umrisse zu erkennen.
Es war das hell glänzende Aluminiumheck eines Flugzeugs. Obgleich die Witterung darauf deutliche Spuren hinterlassen hatte, befand es sich in einem weitgehend unversehrten Zustand. Juan vermutete, dass es im Sand vergraben gewesen und erst vor kurzem durch einen Sturm freigelegt worden war. Herumziehende Nomaden, die Nazaris Aktivitäten unterstützten, mussten ihn darüber informiert haben.
»Es sieht so aus, als würde es hier schon seit längerer Zeit liegen«, sagte Juan.
Die Abmessungen des Heckabschnitts ließen auf ein Passagierflugzeug mittlerer Größe schließen, aber Juan konnte schon bald ein weiteres Detail erkennen.
Der hintere Teil des Rumpfs war nicht nur fensterlos, sondern trug auch das vertraute runde Stars-and-Stripes-Symbol der United States Air Force.
»Das ist entweder ein Transportjet oder ein Bomber«, sagte Juan. Er inspizierte mit zusammengekniffenen Augen das Heckleitwerk. Die schwarzen Ziffern, die sich darauf befanden, waren verblichen, aber immer noch lesbar.
52-534
»Linc?«
»Bin schon dabei«, erwiderte Linc. Er rief von ihren Kunden unbemerkt eine Datenbank über die Anzahl und Stationierung vom Massenvernichtungswaffen auf, die er auf seinem Tablet heruntergeladen hatte, und gab die Zahl ein, um in Erfahrung zu bringen, ob sie zu einem verschollenen Flugzeug gehörte.
Keine zehn Sekunden später sagte Linc: »Ich hab’s. Seriennummer 52-534 ist ein strategischer B-47-Bomber, der 1956 während eines Nonstopflugs nach Marokko verloren ging. Er gehörte zu einer Vierer-Formation, die zu einem Rendezvous mit einem Tankflugzeug unterwegs war. Als sie aus einem dichten Wolkenfeld herauskamen, war diese Maschine verschwunden.«
»Anscheinend hatten sie einen technischen Defekt und sind vom Kurs abgekommen«, sagte Eddie.
Juan vermutete zwar, den Grund zu kennen, weshalb Nazari sie engagiert hatte, um ihn mit seinen Leuten an diesen entlegenen Ort zu bringen, aber er ließ sich die Mission noch einmal durch den Kopf gehen. Die B-47 hatte zehntausend Pfund für die Waffenherstellung benötigtes nukleares Material über die Sowjetunion transportieren sollen. Aber wenn das Flugzeug einige hundert Meilen vom Kurs abgekommen war, jedoch einigermaßen kontrolliert hatte gelandet werden können und dabei weitgehend intakt geblieben war, musste der Pilot diese Ladung abgeworfen haben, ehe er seinen Landeversuch eingeleitet hatte. Doch selbst wenn er diesen Schritt nicht ausgeführt hatte, verfügte die Expedition nicht über die technische Ausrüstung, um eine so große Ladung zu bergen, und unter Nazaris Leuten gab es niemanden, der fähig gewesen wäre, eine Atombombe zu demontieren. Das konnte es also nicht sein, worauf sie es abgesehen hatten.
»Wurde der Vorgang als Broken Arrow eingestuft?«, fragte Juan und verwendete das offizielle Codewort für den unfallbedingten Verlust eines nuklearen Sprengkopfs.
»Ja«, sagte Linc, während sie neben dem Flugzeugheck anhielten. Er verstaute das Tablet in seinem Rucksack. »Wochenlang haben sie danach gesucht und sogar die englische Marine und die französische Fremdenlegion um Hilfe gebeten.«
»Was hatte die Maschine denn geladen?«, fragte Juan, als er beobachtete, wie Nazari aus dem Scorpion 2 ausstieg und zum ersten Mal ein heimtückisches Grinsen über seine bislang ausdruckslose Miene glitt. »Etwas Tragbares, nicht wahr?«
Er wandte sich zu Linc um, der sein Helmvisier hochklappte und grimmig nickte. »Das Flugzeug brachte Kernwaffenkomponenten zu einer Flugbasis in Europa. Weniger als zwanzig Meter von uns entfernt sind im Sand zwei Plutoniumkerne vergraben.«
VIER
MONACO
Da sich die meisten der fünfunddreißigtausend Einwohner der Stadt um die Grand-Prix-Strecke drängten, war der Boulevard de Belgique, nur ein paar Straßen weit entfernt, nahezu menschenleer. An einem gewöhnlichen Sonntag wimmelte es in diesem Viertel von Monte Carlo, wo die Zentrale der Bank Credit Condamine residierte, von Touristen, doch die meisten von ihnen hielten sich gerade beim Automobilrennen auf. Sergej Golow stellte zufrieden fest, dass sie, wie er geplant hatte, mit nicht allzu vielen Zeugen rechnen mussten.
Henri Muniers Tesla SUV stoppte vor dem Tor zur Tiefgarage, und Golow schob Muniers Ausweiskarte in das Lesegerät. Das Tor, ein massives Gitter aus gehärtetem Stahl, fuhr hoch, und Golow lenkte den Wagen auf den persönlichen Parkplatz des Bankdirektors.
Er schaltete den Motor des SUV aus und nickte Ivana Semowa auf dem Beifahrersitz zu. Sie schloss ihren Laptop an den Datenport des Wagens an und begann auf der Tastatur zu tippen. Sie hatte sich Munier zwar als Antonowitschs Assistentin vorgestellt, tatsächlich aber war sie die Computerexpertin des Milliardärs. Die in Kiew geborene Frau hatte ihre Hacker-Aktivitäten – das Eindringen in amerikanische private Datenbanken und das Programmieren von Viren, die sich in gesicherte Finanzsysteme hineinschleichen konnten – aufgegeben, um Antonowitsch behilflich zu sein, seine Firmen vor solchen Leuten wie ihr zu schützen. Ihre Arbeit war derart herausragend gewesen, dass er ihr die Leitung des Teams übertragen hatte, das die Architektur der Digitalsteuerung der Jacht entwickelte. Er entlohnte sie fürstlich für ihre Dienste, und sie war jeden Penny wert.
Nach einer Minute meldete sie: »Neuprogrammierung abgeschlossen.«
»Braves Mädchen«, sagte Golow und wandte sich in seinem Sitz zu Munier um, der auf dem Rücksitz von O’Connor und Sirkal flankiert wurde, Antonowitschs zuverlässigsten Sicherheitsexperten und Leibwächtern.
Rahul Sirkal hatte beim indischen Militär während des Kaschmir-Konflikts an Kampfeinsätzen teilgenommen, ehe er in den Geheimdienst eintrat. Diesen hatte er fünf Jahre zuvor wieder verlassen, um eine eigene Sicherheitsfirma aufzubauen. Obwohl Antonowitsch Russe war, hatte er ausgiebig die Welt bereist, daher beschränkte er sich nicht darauf, ausschließlich Landsleute einzustellen. Sirkal hatte er durch Zufall während ausgesprochen schwieriger Verhandlungen mit seiner Tochterfirma in Bangalore kennengelernt und war derart beeindruckt von ihm, dass er ihn sofort als Chef seiner eigenen Sicherheitsmannschaft eingestellt hatte.
Seamus O’Connor, als Veteran der Irish Republican Army ein Ire mit auffällig bleichem Teint und rotem Haar, arbeitete als Sirkals Waffenexperte, dem es nichts ausmachte, sich die Hände schmutzig zu machen, wenn sich dies als notwendig erwies. Er war der stets gewaltbereite Praktiker, der Sirkal mit seiner rein technischen Herangehensweise perfekt ergänzte.
Von den beiden Männern eingerahmt, machte Munier einen zutiefst sorgenvollen Eindruck.
»Ich sollte Sie daran erinnern, dass wir zu jedem Zeitpunkt zusehen und zuhören«, sagte Golow zu Munier.
Ivana drehte den Bildschirm des Laptops zu ihm herum, auf dem sie und Golow, aufgezeichnet durch die Weitwinkeloptik der Minikamera an Muniers Sakkorevers, zu erkennen waren.
Munier nickte. »Ich verstehe.«
»Wenn die Übertragung für länger als drei Sekunden unterbrochen wird oder wir Ihre Hände für eine gleichlange Zeitspanne nicht im Blick haben, gehen wir davon aus, dass Sie den Versuch machen, unsere Beteiligung zu enthüllen. Daraufhin werden wir nicht nur die Sprengladung in der Kamera zünden, sondern Ihre Familie wird große Qualen erleiden, bevor sie stirbt.«
»Ich sagte doch, dass ich verstehe.« Munier schaute sich in der Tiefgarage um. »Und die Wachen im Gebäude? Was werden Sie mit ihnen tun, sobald Sie drin sind?«
»Was denken Sie?«
»Ich … ich kann nicht …«
»Sie können, wenn Sie wollen, dass Ihre Frau und Ihre Kinder am Leben bleiben.«
Munier sammelte sich, so gut er konnte, und nickte abermals.
»Sie haben fünf Minuten«, sagte Golow.
Munier stieg aus und ging zum Fahrstuhl.
Ivana balancierte den federleichten Laptop auf den Knien. Das Bild, das die Reverskamera lieferte, war klar und plastisch, außerdem konnten sie Muniers rasselnden Atem deutlich hören.
»Hecheln Sie nicht so«, sagte Golow in sein Mikrofon. »Sie sollen natürlich erscheinen. Verlassen Sie den Lift nicht, bevor Sie sich beruhigt haben.«
»In Ordnung«, erwiderte Munier, und sein Atem verlangsamte sich so weit, dass er nicht mehr klang, als würde er jeden Moment vor Nervosität ohnmächtig werden.
Das Fahrstuhlsignal erklang, und Munier betrat die Lobby der Bank. Er wurde von einem uniformierten Wachmann begrüßt, der gerade aus dem Sicherheitsbüro heraustrat.
Der Wachmann sprach Französisch mit ihm. Ivana, die vier Sprachen fließend beherrschte, übersetzte für Golow.
»Munier nannte ihn André. Er ist überrascht, Munier dort anzutreffen.«
»Er scheint darüber auch nicht sehr erfreut zu sein«, sagte Golow.
»Er wollte sich wahrscheinlich das Rennen ansehen, und jetzt ist es ihm peinlich, dass er von der Ankunft von Muniers Wagen in der Garage nichts mitbekommen hat. Offensichtlich ist er nicht misstrauisch.«
Munier redete wieder. Der Wachmann nickte und kehrte ins Sicherheitsbüro neben der Lobby zurück.
»Er holt einen anderen Wachmann namens François. Munier hat ihm erklärt, sein Fahrer habe ein Problem mit dem Wagen und brauche ihre Hilfe.«
Golow lächelte. »Er hält sich Wort für Wort ans Drehbuch.«
Das Geschehen verlief tatsächlich genau so, wie er es geplant hatte. Bevor Antonowitsch ihn als Kapitän der Achilles engagierte, hatte Golow das Kommando auf einer ukrainischen Fregatte namens Poltawa innegehabt. Er war noch vor der Auflösung der UdSSR in der sowjetischen Marine ausgebildet worden und wurde danach zur neu geschaffenen Marine der Ukraine, seines Geburtslandes, versetzt. Er entwickelte sich zu einem der herausragenden Marinestrategen und sollte für seine Leistungen mit dem Admiralsstern belohnt werden. Dann jedoch war es zur Krimkrise gekommen. Russland annektierte die gesamte Halbinsel und übernahm die ukrainische Marinebasis Sewastopol. Viele der besten Schiffe der Ukraine wurden beschlagnahmt, darunter auch die Poltawa.
Golow wurde getadelt, weil er zugelassen hatte, dass sein Schiff konfisziert wurde, anstatt den Hafen zu verlassen, bevor die Russen es übernehmen konnten. Damit war seine Karriere beendet.
Der Exilrusse Antonowitsch fand in Golow einen Bruder im Geiste. Beide hassten die augenblickliche politische Führung in Moskau. Und Antonowitsch brauchte jemanden mit Golows Kenntnissen und Fähigkeiten, um eine Jacht mit den einzigartigen technischen Möglichkeiten der Achilles zu führen. Aus diesem Grund entwickelte sich daraus eine ideale Partnerschaft.
Nun konnte Golow seine planerischen Fähigkeiten für weitaus interessantere Projekte einsetzen.





























