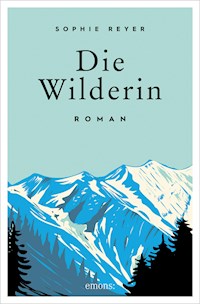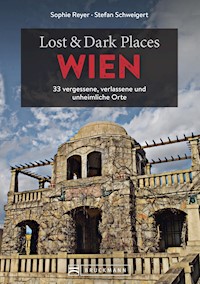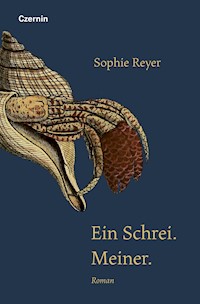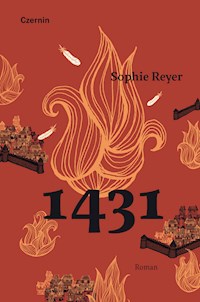14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Flora entdeckt eine Falte in ihrem Gesicht, verliert ihren Job, hat Rückenschmerzen und in ihre Wohnung wird eingebrochen. Wie praktisch es wäre, sich in einen Panzer zurückziehen zu können! Flora wird älter und es ist, als ob sie nun endlich die Schildkröte würde, die sie als Kind immer hatte haben wollen. Von Ärzten und Therapeuten fühlt sie sich missverstanden.� Doch dann wird aus der Midlifecrisis eine Midlifecrisis-Liebesgeschichte. Denn Halt bietet Semir, der Hausmeister, der nebenan eingezogen ist. Mit Charme und Freundlichkeit macht er sich in Floras Leben breit. Seine positive Energie steckt an und lässt sie neuen Mut schöpfen. Einfach ist es aber auch mit ihm nicht. Wie Flora schon bald feststellen muss, hat Semir mehr als ein Geheimnis. Charmant und mit leichter Hand erzählt Sophie Reyer vom Älterwerden, der Liebe und den Lügen, von Sinnkrisen und den Panzern zwischen uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sophie Reyer
SCHILDKRÖTENTAGE
Roman
Sophie Reyer
SCHILDKRÖTENTAGE
Roman
Produziert mit Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien
Reyer, Sophie: Schildkrötentage / Sophie Reyer Wien: Czernin Verlag 2017 ISBN: 978-3-7076-0616-4
© 2017 Czernin Verlags GmbH, Wien Lektorat: Evelyn Bubich Cover: Mirjam Riepl unter Verwendung eines Bildes aus »Brehms Tierleben« Autorinnenfoto: Konstantin Reyer Satz: Burghard List Produktion: www.nakadake.at ISBN E-Book: 978-3-7076-0616-4 ISBN Print: 978-3-7076-0615-7
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Schildkrötentage
TEIL 1
1. Die Falte
Das erste Mal fällt es mir auf, als ich dusche: Eine Falte hat sich in meinem Gesicht gebildet. Hart verläuft sie meinen linken Mundwinkel hinab. Ich fixiere mein eigenes Spiegelbild, versuche zu lächeln, spitze die Lippen. Die Falte aber verschwindet nicht. Es fühlt sich an, als hätte sie jemand in mich hineingemeißelt, wie in eine Skulptur, einfach so über Nacht.
Seltsam, denke ich, dass ich mein Gesicht auf einmal nicht wiedererkenne.
»Das ist eine eigentümliche Anomalie«, erkläre ich der Hausärztin, als ich am nächsten Tag in ihrer Praxis sitze. Ich versuche es so zu formulieren, weil ich nicht zugeben möchte, dass ich Probleme mit dem Alterungsprozess habe. Sie aber hat mich durchschaut und blitzt mich aus großen grünen Augen an.
»Sie werden alt«, erklärt sie, nicht ohne Genugtuung.
Ich nicke und blicke sie an, während ich merke, wie mir die Zunge schwer im Mund wird.
»Verstehe. Und was schlagen Sie vor?«
»Nun, das ist der natürliche Prozess, der sich fortsetzen wird bis zur Verwesung«, bekomme ich zur Antwort.
Die Frau kann einem Mut machen.
»Aha«, sage ich laut.
»Immerhin leiden Sie an keinem Gendefekt«, versucht sie mich aufzumuntern.
»Aber ich schmiere mir doch jeden Tag eine Creme ins Gesicht!«, bemühe ich mich, meine Haut zu verteidigen. »Außerdem gehe ich doch erst auf die vierzig zu!«
Die Ärztin nickt und wirkt nicht im Mindesten betreten.
»Also, was schlagen Sie vor?«
Erwartungsvoll sehe ich sie an und fixiere ihren Lidschlag.
Sie tippt mit ihrer linken Hand, deren Nägel grellgelb lackiert sind, auf ihren Rechner, der auf ihrem Schreibtisch steht, und gibt etwas ein.
»Nun, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.«
Ich nicke. Die Frau macht es spannend.
»Ich gebe Ihnen«, fährt sie fort, während sie nach einem Zettel greift, »die Nummer von einem befreundeten Chirurgen.«
Mit Grauen muss ich an die verzerrten Schlitzaugen gelifteter Schauspielerinnen aus den Achtzigern denken und winke ab.
»Nein, nein. Es geht wirklich nur um diese eine Falte. Wissen Sie. Keine große Sache.«
Die Ärztin seufzt.
»Ich verstehe Sie, das haben wir doch alle durch«, meint sie, ohne mich anzusehen.
»In dem Fall wäre vielleicht auch eine Psychotherapie nicht schlecht? Sie wissen schon, man kann innen oder außen arbeiten.«
Das war ein Schlag ins Gesicht.
»Verstehe. Vielen Dank«, sage ich, obwohl ich in keinster Weise befriedigt bin.
»Sehen Sie, auch die Haut ist nur eine organische Einheit«, klopft die Ärztin mir aufmunternd auf die Schultern, während sie mich zur Tür geleitet.
Organische Einheit, denke ich, als ich nach Hause gehe. Das klingt im Grunde ganz gut. Dennoch empfinde ich eine gewisse Fremdheit meiner Haut und besonders der Falte gegenüber. Vor allem, weil die Frauen um mich herum immer jünger aussehen. Vor zwei Jahren hat die Firma SkinInc eine neue Creme auf den Markt gebracht, die angeblich Abnützungserscheinungen und Faltenbildung im Gesicht stoppt und für eine glatte, geschmeidige Haut garantiert und ich wende sie regelmäßig an. Sie sollte doch helfen, oder? Ob ich alt werde? Ob es wohl bergab mit mir geht? Habe ich mit diesem Zug der Verbitterung im Gesicht überhaupt noch eine Chance auf eine Karriere, denke ich. Ich seufze.
Im Badezimmer zupfe und zerre ich an meinen Lippen. Dann stelle ich mir vor, dass ich die Züge in meinem Gesicht neu male, mir meinen alten Mund mit den Fingerkuppen zurückmale. Doch es funktioniert nicht so ganz. Eigentlich fand ich den ganzen Jugendwahn immer anstrengend, aber nun merke ich, dass ich alt werde, und würde doch gerne jung bleiben.
Ich verlasse das Bad und habe Lust, mich zu verkriechen. Eine Schildkröte zu sein, wäre wunderbar, überlege ich. Auch sie hat einen gerillten Körper und einen überaus faltigen Hals, der an eine Ziehharmonika erinnert. Aber wenn sie sich irgendwo nicht wohlfühlt, zieht sie einfach den Kopf ein. Dann kann niemand sie sehen.
Schildkröten, denke ich, und auf einmal fällt es mir wieder ein: Meine Großmutter hatte eine Schildkröte. Sie hieß Pipimaus. Ich erinnere mich: Sie war so groß wie ich damals. Ich konnte nur kriechen. Sie konnte nur kriechen. Ich hielt sie in die Höhe, selbst auf dem Rücken liegend. Sie streckte den Kopf nach mir aus. Dann zog sie alle Glieder ein. Ihr Blick war tief und stumm. Kaum war ich vier geworden, lief sie fort. Danach bin ich nie wieder jemandem begegnet, der so ein tiefes stummes Zwiegespräch führen konnte.
Als ich am nächsten Morgen aufwache, merke ich, dass ich Mühe habe, mich vom Rücken auf den Bauch zu drehen. Ich versuche, aufzustehen. Rolle, wackle. Strauchle. Hantle mich schließlich mit den Fingern nach vorne bis zu meinem Sessel, an dem ich mich in die Höhe ziehe. Meine Wirbelsäule fühlt sich steif an, als wäre sie taub. Kaum habe ich den Spiegel im Badezimmer aufgeklappt, wird mir auch schon wieder komisch zumute. Diese Falte, links, sie irritiert mich, ich kann das Bild, das ich von mir habe, nicht mehr korrigieren.
Ein Panzer, denke ich. Ein Panzer wäre nicht schlecht.
Bei dem Wort kommen alte Erinnerungen hoch:
»Ich will eine Schildkröte haben, Mama«, beharrte ich, als ich acht Jahre alt war.
»Da hast du eine, mit der geh ins Bad.«
Mein Vater hielt mir damals eine grellgrüne Plastikminiatur vor die Nase, die nach Gummi stank und die man mit Batterien füttern konnte, sodass sie sich bewegte. In diesen Zeiten waren die Imitationen im Gegensatz zu den Roboter-Spielzeugtieren von heute, die dem Original schon recht nahe kommen, billiger Fake gewesen. Und ich war nicht dumm.
»Aber eine echte«, schrie ich also.
»Die macht mir alles an!«, sagte meine Mutter.
»So spricht man nicht«, sagte mein Vater.
Ich begann zu brüllen.
»Schildkröten werden ganz entsetzlich gequält, über die Grenze geschmuggelt, damit sie hier gekauft werden«, erklärte meine Mutter ein wenig sanfter und schob mir eine Tasse Kakao unter die Nase.
»Ich will eine Schildkröte haben«, schrie ich.
Schließlich wurde ich heiser, ging mit verheulten Augen ins Bad und spielte mit meiner Gummischildkröte, die mir überaus lächerlich vorkam. Sie war giftgrün, knallig, fluoreszierend. Ihr Aussehen erinnerte auf unangenehme Art und Weise an einen aufgeblähten Luftballon. Sie konnte Wasser schlucken und wieder ausspeien, das war das einzig Spannende an ihr.
»Und, geht es dir besser?«, fragte mein Vater.
Ich spritzte ihm ins Auge. Er stieß einen gellenden Schrei aus, der einen erstaunten Unterton hatte. Meine Mutter kam wieder herein. Sie war wütend. Sie schrie.
»Weißt du, was mit Schildkröten gemacht wird? Sie werden über die Grenze geschmuggelt.«
»Das hast du schon gesagt.«
»Dabei werden ihnen die Beine abgeschnitten, amputiert und später wieder angenäht. Willst du das? Willst du schuld daran sein, dass eine Schildkröte wegen dir verstümmelt wird?«
Ich betrachtete meine Füße. Das Wasser schwappte aus der Wanne. Mir war ganz komisch. Ich spürte auf einmal, dass ich eine Zunge im Mund hatte. Ein bedrängendes Gefühl. Der Atem wollte nicht mehr so ganz aus mir herauskommen, und die Worte auch nicht.
Erst Jahre später fand ich heraus, dass meine Mutter mich belogen hatte.
Seltsam, denke ich, während ich so vor mich hin träume. Wie viel wir Menschen doch erleben, und an wie wenig wir uns erinnern, wenn wir nicht in Situationen kommen, die alte Bilder in uns wachrufen. Was soll ich machen? Ich beschließe, fürs Erste einmal fernzusehen.
Das hilft meistens. Irgendwann habe ich einmal irgendwo gelesen, dass der Mensch in keiner anderen Situation weniger denkt, als wenn er fernsieht. Das kann ich mir gut vorstellen. Im Übrigen denken die Leute, die unsere Fernsehprogramme gestalten, wahrscheinlich auch nicht mehr als wir alle, wenn wir fernsehen. Das ist beruhigend.
Ich stiere in das Flackern des Bildschirms, dessen Szenenwechsel mir ein seltsames Gefühl von Sicherheit und Rhythmus vermittelt. Immer noch tut mir der Rücken weh. Gut, dass heute Sonntag ist, denke ich. Die Welt bräuchte mehr Sonntage.
Da ertönt ein Geräusch von der Straße her. Ich stehe auf, um das Fenster zu schließen, und werfe einen kurzen Blick hinaus. Sieht so aus, als würde jemand hier einziehen. Ein kleines Auto, das so abgefuckt ist, dass es an eine Thunfischdose erinnert, steht auf dem Parkplatz vor der Tür. Ein Mann, auch klein und in diesem Sinne zu dem Auto passend, steigt aus. Er hat lockiges, dunkles Haar, das in alle Richtungen steht.
Inder vielleicht, denke ich. Oder Jude.
Dann schließe ich das Fenster und streife zurück auf meine Couch, den Ort der Seligkeit.
2. Recherche
Da mir die Ärztin auch nicht helfen kann, begebe ich mich selbst auf Recherche. Das Internet. Ärzten habe ich ohnehin nie getraut, die werden doch alle von der Pharmaindustrie eingekauft, denke ich, und starte meinen Laptop, Marke Äpfelchen. Ich durchblättere ein paar Links zum Thema Hautcremen. Hauptsächlich Seiten von Marken, die ich ohnehin kenne, nein, das ist nichts, ich will auch nicht »Toddlers & Tiaras« sehen, eine Sendung, in der Dreijährige den Tanzstil der neuen Popstars imitieren und Preise gewinnen können, auch das lähmt mich im Moment.
Auf Youtube entdecke ich, nachdem ich es erfolgreich geschafft habe, alle Werbeseiten zu schließen, eine Dokumentation über Männer und Frauen, die zu Bäumen werden. »Treeman« nennt sich das, was mich aus einem borkenartigen, mit Warzen übersäten Körper mit traurigen Augen ansieht. Das sei eine Hautkrankheit. Ich spüre meine Zunge nicht mehr, als ich die Dokumentation über »Treeman« weiterverfolge.
»I become a tree«, sagt der Herr mit den schlitzartigen Augen.
Der Baummensch aus Indonesien sieht verstört aus. Sein Rückgrat ist geknickt, weil seine Rindenhände und Rindenbeine so schwer sind. Ich bin paralysiert und starre auf den Bildschirm. Die Ärzte versuchen offenbar, ihn mit Vitamin A, das ihm über eine bestimmte Creme direkt auf die Haut übertragen wird, zu heilen. Lächerlich, denke ich. Der Schmerz in seinen Augen klappt nach innen. Ich habe diese Augen schon an Tieren gesehen, wenn sie eingesperrt in Käfigen saßen. Sie hatten ihren Blick in einen inneren Raum zurückgezogen, der sie beschützte. Mit einem Mal kann ich nicht mehr atmen. Ein Moment der Bestürzung.
Schließlich hört die Schlucksperre auf. Ich google nach einigen der Bilder, drucke sie aus und stopfe sie in meine Tasche.
Als ich mich anziehe, erinnere ich mich wieder: Die anderen Kinder wollten keine Schildkröten. Eher Gameboys oder Barbies. Aber ich war ein komisches Kind, denke ich. Ich bohrte mit meinem Kopf Höhlen in die Bettdecke, um mich zu verstecken. Mir war immer kalt und meine Handteller wurden leicht feucht. Oft träumte ich von kuscheligen, winzigen Zimmern, in die ich mittels einer Rutsche gelangte. Auch sie waren etwas Ähnliches wie Höhlen. So wie eine Schildkröte aus Hölzern Zelte aufschichtet, schichtete ich hinter dem Haus meiner Eltern Brennholz auf, bis kleine Häuschen entstanden. In denen ließ ich mich und meine Reptilienroboter wohnen. Das waren Triceratopse mit harten Schädeln, Godzillas aus Plastik mit zwei Köpfen, haarige Monster aller Art und komische Drachen, deren Köpfe innen hohl waren, und die man leicht eindrücken konnte. Ich strickte ihnen Gewänder, ließ sie mit mir mitessen. Abends schliefen die Dinosaurier in meinem Bett. Der Geruch nach Plastik und Kunststoff erwärmte mein Herz. Es war mein Geruch nach Heimat, nach Erde, nach Glücklichsein geworden. Manchmal wünschte ich mir den Hals eines Brontosaurus, auf dem ich hinabrutschen konnte, wieder und wieder. Oder ich stellte mir vor, an Hörner geklammert auf einem Triceratops zu reiten. Ich sammelte die Monster, Dinosaurier und Drachen in einer Schublade, die mir bald heilig wurde. Nach der Schule baute ich Türme oder Straßen aus ihnen, ich ließ sie die Haare der batteriebetriebenen Ponys und Barbies fressen, mit denen meine Schwester spielte und die auf Knopfdruck singen, tanzen oder urinieren konnten. Es war eine gute Zeit, denke ich heute. Auch ohne Schildkröte. Das lag an den Höhlen. Mühevoll reiße ich mich aus meinen Gedanken. Es wird Zeit, dass ich etwas unternehme, denke ich.
Mit den Bildern des Baummenschen im Kopf gehe ich also zu meiner Ärztin. Ich versuche, sie vorsichtig darauf hinzuweisen, dass ich nun auch Rückenschmerzen habe. Sie zeigt sich nicht besonders beeindruckt. Sie tastet meinen Rücken ab. Dann fällt ihr Blick auf meinen Bauchnabel, der ihr irgendwie zu gefallen scheint, denn ihre Augen beginnen plötzlich zu leuchten.
»Wie wäre es für den Anfang mal mit einem Antibiotikum?«, schlägt sie vor.
Was soll das denn, frage ich mich und merke wieder, dass ich eine Zunge im Mund habe.
Kurze Stille. Ein Moment der Peinlichkeit.
»Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein wenig fehl am Platz?«, frage ich unsicher.
»Wissen Sie, im Grunde sollten Sie sich einfach so lieben, wie Sie sind«, fährt sie fort.
Ihre Hände sehen zierlich aus und sind mit roten Sommersprossen übersät.
»Aha«, sage ich ratlos.
Da nähern sich mir ihre Finger. Sie legen sich um meinen Hals. Die Ärztin zieht meinen Kopf ein wenig an ihre Lippen heran, atmet in meinen Nacken hinein.
»Was sind Ihre Lieblingstiere?«, fragt sie.
»Warum?«
»Nun, vielleicht wäre es schön, wenn Sie das Tierische in Ihnen ein wenig mehr leben würden?«
»Ja …«
»Also, was sind denn Ihre Lieblingstiere?«
»Sch … Schildkröten«, stottere ich.
»Ich hab mal Schildkröten beobachtet«, fährt sie fort, »die recken den Kopf so raus und ziehen ihn dann wieder ein.«
Sie beginnt, meinen Rücken zart zu berühren, irritiert vollführe ich eine rasche Bewegung, knirsch, zack. Ein Schrei. Verdammt. Jetzt habe ich ihr in der Hast einen Kinnhaken verpasst. Habe ich ihr den Kiefer gebrochen? Ich drehe mich langsam um und sehe sie an. Die Ärztin schützt ihre linke Backe mit der Schale ihrer Hand. Meine Finger zittern, stammeln, suchen nach dem weiten Pullover, in den ich mich gekleidet habe, weil mein Panzer gut in ihm Platz hat.
»Entschuldigung«, flüstere ich.
Schweigen.
»Ich muss los dann «, sage ich.
Auf dem Heimweg sinniere ich über mein Leben. Seit frühester Kindheit also: diese uneingeschränkte Vorliebe für das Monströse. Ich lief mit einem Dinosaurier im Arm umher, nannte ihn Marian, fütterte ihn bei jeder Gelegenheit. Ich erinnere mich, sein harter nackter Schädel war aus Gummi. Manchmal zog ich ihn an seinem langen Schwanz hinter mir drein. Marians speckige Babyschenkel waren mir das Liebste auf der Welt. Ich krümmte mich, spielte Ei für den Dinosaurier. Sammelte die winzigen, glitschigen Wesen mit Reptilienhaut, die mir meine Tanten und Onkeln geschenkt hatten, in Kisten ein und baute hinter dem Haus kleine Höhlen aus Holzscheiten für sie. Marian hatte mehrere Knöpfe am Bauch, einen für »kuscheln«, einen für »schlafen«, einen für »essen«. Wenn ich an der Schnur zog, die aus seinem Hinterkopf hing, konnte er sogar singen. Das war ganz gut. Trotzdem wollte ich eine Schildkröte haben. Eine echte. Manchmal zischte eine Sternschnuppe über den Himmel. »Ich will eine Schildkröte«, dachte ich mir dann, Augen fest zu, Lider gegeneinander gepresst, heimlich, still. Der Wunsch schoss nach innen. Schoss ins Herz zurück, oszillierte zwischen Bauch und Gehirn, immer wieder. Die Wünsche, die man einer Sternschnuppe schickt, darf man keinem erzählen, hatte der Vater gesagt. Meine Wünsche blieben also sorgfältig aufbewahrt in meinem Kopf. Ich betrachtete den Sternenhimmel. Er war endlos, das Licht erreichte uns zu spät, wusste ich, da waren viele Sterne bereits tot. Die Kuppel des Himmels schützte meinen Kopf, ein dunkler Himmel, dunkel und ruhig, ein Gefühl von Güte, wenn es so etwas geben sollte. Ich sperre die Wohnungstür auf und seufze.
Vielleicht, denke ich, als ich meine Kaffeemaschine auf den Herd stelle, ist meine Verwandlung die Erfüllung dieses alten Wunsches? Ich bin nicht abergläubisch. Und außerdem wollte ich ja nicht eine Schildkröte werden, sondern eine haben. Ich blicke aus dem Fenster. Einzelne Blätter rieseln von den Ästen der Linde, die mir wie Arme vorkommen. Auf einmal sehe ich in jedem Baum einen verhinderten Menschen. Ich drücke meine Finger gegen die Lider, bis es hell wird. Dann streife ich mit der Kaffeetasse zu meinem Computer und öffne meinen Mailaccount.
Heike, eine Freundin, der ich mein Leid geklagt habe, hat mir geschrieben.
Sie schlägt mir vor, eine Psychotherapie zu machen. Wütend klicke ich sie weg.
Auf gut gemeinte Ratschläge kann ich verzichten, denke ich.
Ich starre in die Tasse hinein und Bilder rasen durch meinen Kopf.
Ich werfe die Tür hinter meinem Rücken zu und gehe die Treppen hinunter. Das Treppenhaus riecht nach Parfüm. Die Besitzerin hat mehrere Computer-Putzer, die an den Gängen herumsurren. Das Haus ist in Pastellfarben gehalten. Marmorboden. Seltsam, denke ich manchmal, dass sie dennoch auch selbst die ganze Zeit putzt. Manchmal beobachte ich sie von meinem Balkon aus. Die Besitzerin klaubt jedes der Blätter vom Boden ihres schönen Balkons. Obwohl sie doch die Computerhelfer hat. Draußen sitzen sehe ich sie nie. Sie hat viel zu viel Angst vor den Schadstoffen in der Luft, hat sie einmal zu mir gesagt. Keine uninteressante Frau eigentlich. Informatikerin. Der Mann Informatiker. Keine Kinder. Radtouren mit Tandems, die von Elektromotoren betrieben werden, Reisen in die weite Welt mit ihrem kleinen Helikopter. Sieht alles nach Kleinfamilienidylle aus, denke ich. Im Grunde.
Wenn sie hin und wieder zum Putzen am Balkon erscheint, trägt sie pinke Pantoffeln aus Plüsch und einen Frottier-Mantel. Sie ist dünn, eingefallen.
Als ich an diesem Tag ins Treppenhaus gehe, tapst mir eine kleine Katze entgegen.
Genau in dem Moment tritt die Besitzerin aus ihrer Wohnung.
Ein markerschütternder Schrei ertönt.
»Ist das Ihre?«, gellt die Besitzerin.
Verwirrt schüttle ich den Kopf und sehe sie an.
Ihre Hände zittern.
»Hier sind Tiere verboten!«, ruft sie aus.
Ich verstehe nicht ganz. Schließlich handelt es sich ja hier nicht um einen wilden Tiger, sondern um eine kleine Babykatze. Und außerdem habe ich mit dem Tier nichts zu tun.
»Ich bring sie raus«, sage ich, um die Besitzerin zu beruhigen.
Diese irrt jedoch bereits im Treppenhaus umher auf der Suche nach ihren Putz-Robotern. Solche besitzt sie tatsächlich. Es ist ein Phänomen. Vielleicht, denke ich, sollte ich mich nach einer neuen Wohnung umsehen, nach einer billigeren, denn möglicherweise geht es bald auch mit meiner Karriere bergab. In welch wahnsinniger Welt wir leben, denke ich, während ich durch das halbschattige Treppenhaus streife. Mit einem Mal erscheint mir alles schaurig und gruselig. Ich ziehe den Kopf ein.
Im Treppenhaus begegnet mir ein kleiner Mann mit schwarzen Wuschelhaaren. Ich bemühe mich, ihn gar nicht erst anzusehen. Mir tut der Rücken weh und ich trage ein Mahnmal in Form einer kleinen Falte im Gesicht.
»Hallo«, sagt er, »ich bin Semir.«
Ich drehe mich zur Seite. Möchte nicht angeblickt werden.
»Hallo«, murre ich und gehe rasch weiter.
Mir tut der Rücken weh.
3. Freunde
Am nächsten Tag beschließe ich, Heike und Herbert zu besuchen. Heike ist eine alte Freundin, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Ihr Mann ist Psychotherapeut. Also, eigentlich wollte er Priester werden, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht, denke ich, sollte ich Herbert einmal von meinem Problem erzählen. Möglicherweise wäre eine Psychotherapie doch keine schlechte Idee. Ich klingle an der Wohnungstür, sie wird geöffnet.
»He, Süße.«
Heike trägt ein pinkes Kleidchen und begrüßt mich lächelnd. Ich setze mich. Sie schenkt mir Kaffee ein.
»Wo drückt’s?«
Ich schlucke. Wie soll ich anfangen?
»Im Rücken«, sage ich umständlich, »und im Gesicht. Also, da ist eine Falte. Ich …«
Herbert lächelt und klopft mir auf die Schenkel.
»Alles ist heilbar«, meint er, »nicht wahr, Hexi?«
Heike wuselt um ihn herum und lächelt süßlich. Sie stellt Zucker auf den Tisch, freilich kalorienfreien. Ich bin skeptisch, denn ich traue dem Markt nicht. Aber Heike schwört darauf. »Besser als dieser synthetische Stevia-Blödsinn!«, meint sie.
»Hast du viel Stress?«, fragt mich Herbert.
Er kritzelt eine Nummer auf einen Zettel, einer seiner besten Kollegen wahrscheinlich, denke ich. Gut so, denke ich.
»Geht so.«
»Das ist Franz Leimhart. Ein Guter. Such ihn auf. Macht Existenzanalyse.«
Ich nicke.
»Danke.«
»Hast du schon gegessen?«, fragt Heike und mustert mich besorgt.
Ich merke, wie ich beginne, mich unwohl zu fühlen. Ich mag nicht essen. Seit Tagen habe ich nur noch auf Salat Lust, vielleicht, weil ich mich Schildkröten im Moment sehr nahe fühle. Ich mag den beiden von dem Problem erzählen, das jenseits meines linken Mundwinkels in einer Linie hinabläuft. Doch aus mir kommt kein Ton. Ich ringe nach Luft.
»Danke. Ja«, sage ich schließlich.
Herbert fixiert mich. Er hat diesen Mikroskopblick. Es gibt Frauen, die auf das stehen, weiß ich Bescheid. Vor allem, wenn die Männer mit diesen Blicken ihre Therapeuten sind. Dementsprechend hat Herbert auch seine Klientin geheiratet. Heike nämlich. Eine rührige Geschichte. Ich habe sie oft gehört. Beide waren in Scheidung. Heike ließ sich von Herbert therapieren. Irgendwann beschlossen sie, miteinander auszugehen. Heike vergaß bei den Dates immer sein Gesicht. Aber es war spannend. Früher einmal. Das sieht man ihnen an. Jetzt arbeitet Herbert wieder mehr, er ist alt, die Instabilität seiner Frau nervt ihn, sie macht ein bisschen Kunst, ja, Aquarell, sie trägt gern teure, ausgeschnittene Kleider und hochhackige Schuhe. Hin und wieder geht sie mit ihm ins Fitnessstudio. Sie wetten um teure Kleider, Markenmode, sie wetten um Theaterbesuche. Heike gewinnt. Ihr Glück, denn sie hätte auch kein Geld, das sie Herbert geben könnte, wenn er die Wetten gewänne. Was sie aber hat: sie ist schön. Innen und außen. Männer haben gern schöne Frauen an ihrer Seite, denke ich. Ich betrachte Heike und Herbert. Beiden ist mit den Jahren ein Bauch gewachsen. Eine Zeit lang hatte er ihr wohl die Welt zeigen können, schließlich war er ihr Therapeut gewesen, sie blickte auf zu ihm. Gleichzeitig brachte sie Frische in sein Dasein, das gewisse fruchtige Etwas. Das hörte schnell auf. Er schlief dann, wie ich aus Heikes Erzählungen weiß, eine Zeit lang nicht mit ihr, überlegte, ob er zu seiner Frau zurückkehren sollte, aber da hatte es sich Heike schon in seiner Wohnung gemütlich gemacht, sie hatte einfach beschlossen zu bleiben. Auch, wenn er nicht mit ihr ins Bett ging. Irgendwann wurde aus ihnen dann doch ein Winning-Team. Das ist natürlich nicht die Version der Geschichte, die mir die beiden erzählen. Aber es ist meine.
»Du darfst dich nicht verausgaben«, rät Herbert, »du siehst grauenhaft aus.«
Ich nicke.
»Mehr essen.«
»Ja, Papa«, grinse ich gespielt.
Er zieht eine Augenbraue in die Höhe.
»Kann man mit seiner Tochter schlafen?«
Idiot, denke ich. Ich lächle ihn aber nur an und zwinkere Heike zu, die nichts gehört hat, da sie gerade an der Spüle hantiert. Dann stehe ich auf und steuere auf die Toilette zu.
»Wir üben gerade Englisch«, ruft Heike mir nach.
Ich lache und merke, dass es schrill klingt.
»Daughter where go?«, höre ich Herbert heiser schreien.
Rasch knalle ich die Toilettentür zu und stopfe mir einen Kaugummi in den Mund. Mein Magen fühlt sich grauenhaft an. Ich krümme mich auf der Muschel, greife mit meiner Hand auf den Rücken. Das tut weh, fühlt sich hart an. Wie ein Panzer. Ich werde ein Monster, denke ich. Ich werde ein uraltes Reptil. Ich muss mit jemandem darüber sprechen. Aber ich habe Angst, Heike und Herbert zu verschrecken. Vielleicht ist es doch besser, einen Therapeuten aufzusuchen. Seufzend ziehe ich mir die Jeans in die Kniekehlen. Das Kauen beruhigt mich. Ich forme den Kaugummi zu einer Blase. Die Kaugummiautomaten waren das Mysterium meiner Kindheit, erinnere ich mich. Seltsam, wie schnell man die Magie dieser Dinge vergisst. In ihnen steckten bunte Welten. Flummis in schillernden oder grellen Farben, meliert und mit Mustern. Kügelchen, die meist pink waren und auch so schmeckten. Man konnte sie beißen, sie ploppten auf. Manche prickelten im Mund. Und es gab Monsterköpfe, Radiergummis und kleine Bären aus Wolle in durchsichtigen Kügelchen, die man aufmachen konnte. Dann konnte man die Monsterköpfe auspacken. Manchmal waren auch Totenschädel drin. Ich mochte die Monsterköpfe am liebsten, weil sie der Schildkröte am ähnlichsten waren. Je größer die Zähne, je kugeliger die Augen, desto besser fand ich die Monster. Sie rochen nach Gummi, sie wurden mit der Zeit ledrig und verloren an Farbe, aber das war egal. Man verlor sie selbst auch leicht, wenn sie noch grell und flimmernd waren. Schließlich spielte ich mit ihnen Ball. Aber dann gab es neue. Hin und wieder jedoch blieben Figuren stecken, ließen sich nicht aus dem Automaten bekommen. Das war das Drama des Tages. Ich klopfte, trat. Die Münze steckte. Ich war wütend, wütend auf das Rot des Automaten, auf seine Widerborstigkeit, auf das Metall und den Knauf, an dem man drehen musste.
Ich stehe auf und ziehe den Zipp meiner Hose zu. Gleich, vermute ich, werden sie mich noch einmal fragen, ob ich etwas essen möchte.
Die Menschen wissen nicht, wie sie einander seelisch nähren sollen, denke ich, als ich mich wieder dem Tisch nähere und sehe, dass Heike einen riesigen Teller mit Kuchen aufgebaut hat. Darum drücken sie einander immer wieder so viel Kuchen hinein. Stopfen einander die Münder. Stopfen einander aus. Mit Essen oder guten Ratschlägen.
Den Blick stopfen sie sich mit Bildern zu, möglichst schnell, rasch und grell, sonst käme der Blick noch auf die Idee, etwas anzusehen. Weil sie es nicht auf die Reihe bekommen, einander seelisch zu geben, was sie brauchen, konsumieren sie, lutschen sie, verschlucken sie und pressen einander alles Mögliche so lange hinein, bis sie platzen.
»Ich mein es ja so gut!«
Das Gegenteil von gut sein ist, es gut zu meinen. Wir meinen alle immer so viel. Herbert meint am meisten, schließlich ist er Psychotherapeut und hat das gelernt. Dringend muss er gebraucht werden, denke ich und merke, wie ich in meinen Gedanken immer ironischer werde. Natürlich, er wird auch gebraucht. Schließlich weiß er ja, wie es geht. Seiner Frau kann er es zumindest erklären. Die war auch seine Klientin. Da kann er brav groß sein und sich darüber aufregen, wie anstrengend sie ist. Warum habe ich ihn eigentlich um seine Hilfe gebeten, frage ich mich plötzlich.
»Ich mach mir Sorgen, Süße, was hast du denn so lang am Klo gemacht?«, fragt Heike da und legt ihre Hand auf meinen Rücken. Ich zucke zurück. Sie sieht mich entgeistert an.
»Was denn? Warum zuckst du auf?«
Es ist mein Rücken, der mir ein bisschen weh tut. Das sage ich aber nicht laut.
»Ach, nichts«, winke ich rasch ab.
Heikes weiche Hände mit den pink lackierten Fingernägeln tasten nach mir. Sie greift mit einer sanften Geste nach meinen Schultern.
»Oh, du bist aber wirklich hart«, meint sie, »sehr verspannt.«
Ich schlucke und presse die Lippen gegeneinander.
»Soll ich dich massieren? Du Arme. Mann! Zum Heulen, wie hart sich dein Rücken anfühlt«
»Es geht schon«, weiche ich verlegen aus und bemühe mich um einen toughen Tonfall.
Herbert verdreht die Augen.
»Womit habe ich nur so eine instabile Frau verdient, wirklich. Leidet immer mehr als die anderen.«
Du hast sie dir ausgesucht, denke ich, und sie ist instabiler, weil sie intelligenter ist als du. Aber ich halte meinen Mund.
Männer wie Herbert verstehen nicht. Dazu haben sie zu viel Zeit mit Neurolinguistischem Programmieren verbracht. Dazu haben sie zu wenig gelitten und immer zu genau gewusst, was der Weg ist. Ja, der Weg! Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, die beiden um Rat zu bitten?
»Es kommt nur aufs Gehen an«, sagt Herbert, als würde er meine Gedanken lesen.
Aber ich kann fast nicht mehr gehen, denke ich, ich möchte lieber nur noch kriechen. Mein Rücken ist ein Panzer geworden. In meinem linken Mundwinkel klafft eine riesige Kerbe. Es hat keinen Zweck, denke ich, ich kann die beiden unmöglich mit meiner Verwandlung konfrontieren.
»Wirklich«, meint Herbert und greift nach meiner Hand, »Hauptsache, du bleibst nicht stehen.«
Ich nicke.
Wahrscheinlich sagt er das allen seinen Klienten. Und sie glauben ihm, schließlich hat er so schöne breite Männerhände, und er riecht nach Vanille und hört zu. Da ist es endlich still, das ist es vor dem Laptop oder einem anderen Flimmerquadrat nie. Da kommt man zur Ruhe. Er ist so erdig, der Herbert. Sagt immer brav »mhm« nach jedem Satz. Und dann versteht er einen, denken die Leute. Falsch, Herbert wiederholt nur, das ist seine Technik, und dann spiegelt er den Menschen ihre Körperhaltung wider. Wie spiegelt man eigentlich eine Schildkröte, frage ich mich plötzlich.
Ich weiß keine Antwort.
Jetzt ist Herbert verlegen, vielleicht, weil ich nicht antworte, oder weil ich seinen Händedruck nicht erwidere. Er verschwindet auf die Toilette. Heike beginnt die Teller vom Tisch zu räumen, und ich helfe ihr. Soll ich über die Verwandlung sprechen, frage ich mich. Aber ich habe Angst, Heike vor den Kopf zu stoßen.
»Zwei arbeitende Frauen. So mag ich das«, tönt Herbert, als er wieder erscheint.
»Ich geh dann mal. Bis dann«, murmle ich.
»Bleib doch«, sagt Heike und ihre Mandelaugen sehen mich traurig an.
»Du störst nicht. Und wir laden dich gern auf etwas zu essen ein. Bleib zum Abendessen.«
»Danke«, entgegne ich.
Ich habe nur auf Salat und Wasser Appetit im Moment.
Heike fährt mit ihren weichen Händen über meinen Oberarm.
»Lass dich doch verwöhnen.«
»Ich mag nicht. Ich nehme es mir schon, wenn ich etwas brauche«, sage ich, »außerdem muss ich heute noch arbeiten.«
»Das Leben besteht nicht nur aus arbeiten«, sagt Herbert und stopft sich ein Stück Schokolade in den Mund, die Heike auf dem Tisch platziert hat.
»Oder?«, meint er mit einem Seitenblick auf sie.
»Weiß nicht«, murmelt Heike zaghaft.
»Vielleicht ein Glas Wein?«
Ich winke ab.
»Und Wein trinkt sie auch keinen«, beschwert Herbert sich.
»Ja, Papa«, murre ich zurück.
Heike will das Thema wechseln.
»Herbert muss Englisch lernen. Wir reden jetzt nur mehr Englisch. Machst du mit?«
Ich seufze und erwidere, während ich mir umständlich meine Schuhe anziehe: »Okay. No problem. I was with an American for a long time.«
»Shall I also get an american girlfriend?«, entgegnet Herbert prompt, die Schokoladefäden im Mund langziehend.
Nun muss Heike auf die Toilette.
Schweigen. Ich beobachte die Linde hinter dem Fenster und denke an den »treeman«.
»Manchmal ist Heike schwierig«, sagt Herbert plötzlich.
Ich fixiere meine Fingernägel.
»Sie ist eine schöne Frau«, entgegne ich.
Eine ausweichende Antwort, aber etwas Besseres und Richtigeres fällt mir im Moment nicht ein.
»Ein Segelschiff hat sie sich eingebildet. Eine Hütte in den Bergen. Ein Haus. Und jetzt auch noch diese Wohnung hier.«
»Sie weiß, was sie wert ist«, sage ich, »es gibt keine perfekten Menschen.«
»Sie rennt von einer Party zur anderen. Sie ist rastlos. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Das Haus in den Bergen, das hätte ich nicht aufgeben wollen. Da knistert es im Kamin nachts. Sie hat lieber das Schiff behalten. Ich hab extra den Segelschein gemacht. Nie abgeholt übrigens.«
»Ja«, murmle ich.
»Du verstehst mich, Flora.«
»Hm«, kommt es vage aus mir, während ich meine Jacke vom Haken angle und hineinschlüpfe.
»Bleib da und trink was mit mir.«
Den Zipp zuziehen.
»Ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten.«
»Kleiner Maulwurf.«
Ich möchte etwas antworten, etwas, das ein bisschen cool klingt vielleicht, aber aus mir kommt kein Ton. Ich setze meine Wollhaube auf.
Kopf einziehen, mein Kind, Kopf einziehen, denke ich. Aber dieser Mann macht mich fertig.
Ich kann nicht atmen.
Endlich kommt Heike aus der Toilette wieder. Sie sieht noch trauriger aus als zuvor. Ich küsse sie auf die Wangen und verschwinde dann.
Als ich daheim ankomme, liegt ein Brief vor meiner Tür.
Wer schreibt denn heute noch Briefe, denke ich.
Ich bücke mich, falte ihn auf. Eine kugelige Schrift ist zu sehen, die ein bisschen an die eines Grundschülers erinnert.
»Hallo. Ich bin dein neuer Nachbar. Semir«, lese ich.
Seltsam, denke ich. Vielleicht macht sich das Nachbarskind einen Spaß mit mir? Nein, er sah so aus, als käme er nicht aus Österreich. Wahrscheinlich ist er der Rechtschreibung tatsächlich nicht mächtig. Ich knülle den Zettel zusammen und krame nach meinem Hausschlüssel. Was für komische Tage, denke ich. Schildkrötentage, denke ich. Das Wort gefällt mir. Es klingt nämlich besser, als es sich anfühlt.
Erst später, als ich meinen Laptop aufklappe, um mit der Grafik der neuen Page zu beginnen, erinnere ich mich, dass sich der gelockte Mann am Gang mit Semir vorgestellt hat. Wahrscheinlich so ein komischer Stalker, denke ich. Frau Meertich und ihre Katzen-Phobie fällt mir ein. Ich habe schon seit Längerem überlegt, auszuziehen. Auf einmal spiele ich wieder mit dem Gedanken.