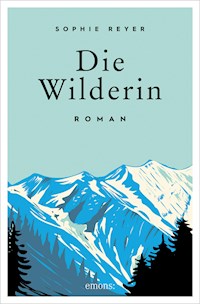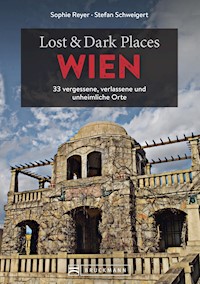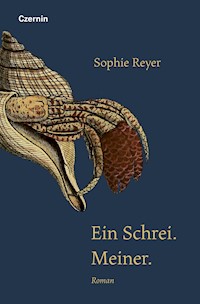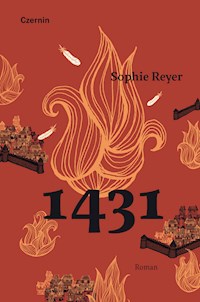
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johanna von Orléans, Märtyrerin und französische Nationalheldin, wird 1431 als englische Gefangene in Rouen hingerichtet. Ungemein feinfühlig und präzise schreibt Sophie Reyer über das Leben der heiligen Jungfrau, ihr Erwachsenwerden und ihren Niedergang. Johanna wächst während des Hundertjährigen Krieges in einem kleinen französischen Dorf auf. Bereits als junges Mädchen hat sie Visionen, die sie immer stärker prägen, bis sie dem Fanatismus verfällt. Johanna weiß, dass sie aus dem traditionellen Frauenbild ausbrechen und in den Krieg ziehen muss. Doch sie gerät in einen Strudel aus Hinterlist und Verrat, aus dem sie nicht mehr herauskommt. Kurz vor ihrer Hinrichtung trifft sie schließlich auf Nicolas Loyseleur, ihren vermeintlichen Beichtvater. Dieser soll ihr ein Geständnis entlocken, wird aber selbst immer tiefer in ihren Bann gezogen. Mit viel Fingerspitzengefühl beschreibt Sophie Reyer Johannas Leben – die Entwicklung einer starken, jungen Frau, die den konventionellen Erwartungen widerspricht und ihr Leben selbst bestimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sophie Reyer
1431
Roman
Sophie Reyer
1431
Roman
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Reyer, Sophie: 1431 / Sophie Reyer
Wien: Czernin Verlag 2021
ISBN: 978-3-7076-0726-0
© 2021 Czernin Verlags GmbH, Wien
Lektorat: Evelyn Bubich
Autorinnenfoto: Konstantin Reyer
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Druck: Florjancic
ISBN Print: 978-3-7076-0726-0
ISBN E-Book: 978-3-7076-0727-7
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Inhalt
Prolog
1. Kindheit
2. Gott ist ein Lichtweber
3. Älterwerden
4. Feenbaums Wunder
5. Lernen
6. Vater
7. Aufbruch
8. Wachsen
9. Ankunft
10. Der Dauphin
11. Panzer
12. Schlachten
13. Die Reise geht weiter
14. Krieg
15. Der Kampf geht weiter
16. Rausch
17. Krönung
18. Verzögerungen
19. Gefangenschaft
20. Der Sprung
21. Hinrichtung
Epilog
Prolog
Am Ende und am Anfang, da ist immer eines: Brennen. So auch jetzt. An diesem 30. Mai 1431. Ketzerin, sagen sie, als man sie aufrichtet. Die, die man Jungfrau nennt. Die mit dem heiligen Augenaufschlag. Die im Körper einer einfachen Bauernmagd steckt. Früher rotwangig, jetzt blass, auf dem Place du Vieux-Marché in Rouen. Und überall: Brennen. Ja, Flammen auch in den Mündern der Menschen. Lauffeuer, von Lippe zu Lippe springt der Funke über: »Die Jungfrau! Sie wird hingerichtet!«
So viele Zuschauer wie möglich sollen Zeugen ihres Todes sein, oder? So zumindest will es die Regierung, ja? Eben noch krank in einem Gefängnis weggesperrt, diese Frau, munkelt man im Dorf. Und weiter: dass der König keinesfalls sehen wolle, dass sie einfach so sterben würde. Eines natürlichen Todes. Darum ordnete man noch schnell diese Hinrichtung an! Sie muss inszeniert werden, auch, wenn sogar die Richter weinen. Auch, wenn die Mehrzahl der Zuschauer schaudert und sich tief bewegt zeigt. Jetzt hat es einfach zu sein, es führt kein Weg daran vorbei! Ja, der Earl von Warwick selbst soll gesagt haben: »Sie darf nicht eines natürlichen Todes sterben. Unser Herrscher schätzt sie zu sehr, jetzt, nachdem er sie doch so teuer erkauft hat!«
Grausig ist der Beruf des Henkers, meint man. Aber dieser hier, der jetzt vor dem Mädchen steht, das Johanna heißt, es an den Pfeiler kettet, er schaudert. Im Wissen, dass er verdammt ist, als er die Jungfrau vor sich sieht. Im Wissen, er würde schon bald eine Heilige hingerichtet haben. Aber was hilft es: Pflicht ist Pflicht! Man beobachtet ihn, beobachtet sie, die Jungfrau, von außen: ihren Lidschlag, ihr Zittern. Wer liebt, tanzt mit dem Tod. Er lernt nach und nach alle Schritte Gottes, sagt sich Johanna, doch die Stimmen schweigen dazu. Angespannte Stimmung. Aufgerissene Münder. Sie ist mit einem Mal eine Drehtür ohne Richtung. Gelber Sand im Hirn. Sie ist nicht in sich. Ist bloß nebenan. Danach das Knistern von Flammen, ein Schicksal ist besiegelt. Sie brennt. Johanna brennt. Um sie herum neugierige Blicke, die sie würgen. Doch sie erkennt schon nicht mehr. Welt hinter Vorhang. Nebel und Rauch.
»Ich bitte Gott, dass meine Seele einmal an dem Ort sein wird, dort, wo, wie ich glaube, diese Frau jetzt sitzt!«, wispert da einer der Priester. Dann Stille und das Knistern von brennendem Holz.
Später mag der eine oder andere Soldat eine weiße Taube aufsteigen gesehen haben. Das ist alles. Johanna ist indes verbrannt.
1. Kindheit
Man hat sie angeklagt. Der Ketzerei beschuldigt. So wird es ihm erzählt. Sofort ist er Feuer und Flamme für den Fall. Wer mag sie sein, diese Johanna? Dieses Mädchen mit der trotzigen Schönheit, das sich als Heilige ausgibt, als wäre so etwas selbstverständlich? »Könnt Ihr euch vorstellen, euch als einer ihrer Verbündeten auszugeben?«, fragt der Bischof und sein Unterkinn labbert dabei. Loyseleur verachtet ihn insgeheim. Der Bischof widert ihn an wie all die Gelehrten, die so tun, als läge ihnen etwas an der Religion, und die doch in Wahrheit nur ihre Machtspiele spielen. Doch er nickt. Nimmt das Angebot an. Er will das Geheimnis dieser Frau herausfinden, die kaum älter ist als ein Kind. Und ja: Die Kindheit scheint dieser Johanna wichtig zu sein. Von einem Feenbaum ist bei dem Verhör die Rede und von einem Heiratsversprechen, das sie Gott gegeben haben mag, dort, am Fuße des Baumes. Man dringt also in Johanna in den ersten Verhandlungen. Fragt sie aus.
Das Mädchen hält sich wacker. Bietet den Gelehrten die Stirn in ihren flammenden Reden, die von Engeln beflügelt zu sein scheinen. Dann verfrachtet man Johanna in ihr Gefängnis. Der Bischof wirft Loyseleur einen verstohlenen Blick zu. Es ist sein Signal, und er versteht. Er folgt der Magd, lautlos wie ein Schatten. Folgt ihr in den Turm, in dem man sie gefangen halten wird. Eng ist dieser und sie würde darin bestimmt zum Nachdenken kommen, oder? Das Verlies hat einen Durchmesser von in etwa neun Meter sechzig. Ähnelt einer Bleibe, die sie laut Faktenlage einmal in der Burg Chinon, dem Turm von Coudray, gehabt haben mag, damals, beim Thronanwärter. Dennoch: Hier wird es anders sein für Johanna, das weiß er. Hier schläft die Angst überall in den Räumen. Das einzige Möbelstück. Er folgt dem Mädchen unauffällig und betrachtet die Szenerie. Johanna, deren Blick spröde um sich stößt, wird in den Raum gebracht, brutal. Da: ihr Bett. In Fußeisen wird sie nun auch an einen Holzbalken gekettet, gleich neben ihrer Liegestatt. Dennoch: Weniger streng als eigentlich vorgesehen gestaltet man die Haft, weiß er Bescheid. Denn zu Beginn hatte der Bischof einen Schmied für einen eisernen Käfig bestellt. Was mag in ihn gefahren sein, dass er es sich doch anders überlegt hat? Loyseleur weiß es nicht. Betrachtet das widerspenstige Mädchen, an dem er mehr und mehr Gefallen gewinnt. Es würde nicht leicht werden, ihr Herz zu gewinnen.
Still, stumm und schön liegt es da, das Tal der Maas. Als würde es schlafen. Johanna liebt es, das Tal ihrer Kindheit. Denn hier ist ihr Beginnen. Und sie liebt auch den Feenbaum. Wie sie singen und tanzen zu dessen Füßen, die Kinder aus dem Dorf! So beginnt Johannas Freude, so beginnt sie früh.
Die Kinder breiten ihre Tücher aus, um unter dem Baum ihr Mahl im Freien einzunehmen. Die Welt ist erfüllt von Sonnenschein. Blumenkränze darf Johanna flechten. Das ist eine ihrer frühesten Erinnerungen. Und dann, freilich: Das Zusammensein mit der Großmutter. Johanna singt mit den Kindern. Sie singt öfter als sie tanzt. Aber sie tanzt auch. Das Leben ist schön. Denn es gibt die Großmutter. Die Großmutter – und wie sie mit dem Brot umgeht. Ins Feuer werden die Krümel geworfen, die übrig bleiben.
»Damit die Hauskobolde sie essen und zufrieden sind, oder?«, sagt die Großmutter.
Sie sagt: »Was der Herrgott einem gibt, muss man schätzen!«
Sie lacht und ihr Gesicht ist das weiße Gewand eines Engels. Die Großmutter ist magisch, findet Johanna. Ihr Leben hat sie in einem Glasschrank verstaut, in dem sich allerlei Krimskrams entdecken lässt. Damit klimpert sie ein wenig, betrachtet ihre Ketten. Das klingt kitzelig und hell und beruhigt sie und die Kinder um sie herum. So finden sie zu sich und auch Großmutter tut das. Und dieses Erklingen hilft, denn das Leben schlägt immer wieder zu. Eines Tages findet Johanna einen Vogel reglos auf dem Boden liegen. Sein Gefieder ist überzogen von Reif. Sie bringt ihn der Großmutter.
»Er ist tot«, sagt diese, »die Kälte hat ihn tot gemacht, Johanna!«
Erbost blickt das Kind sie an. Nichts kehrt wieder, begreift es da. Groß ist der Schmerz. Kahle Baumkronen wie knochige Finger im Dunkel der Äste. Das Gemurmel der Welt wird mit einem Mal laut in Johanna.
»Darf man denn töten?«, fragt sie.
Die Großmutter nickt.
»Wenn’s dem Menschen nützt, ja!«
Johanna überlegt. Die Kühe fallen ihr ein, die sie alle lieben und die dennoch vom Vater geschlachtet werden.
»Wenn man es isst – dann?«, will sie wissen.
»Ja«, kommt es zur Antwort.
»Und sonst?«
»Gewiss nicht.«
Johanna betrachtet die Großmutter und beschließt, fortan von ihr zu lernen. Klug scheint sie zu sein. Ja: Die Großmutter ist ihre eigene Heilerin, sie braucht keinen Arzt. Im Wald pflückt sie die Kräutlein, die Freunde für sie sind. Manchmal erzählte die Großmutter ein Märchen:
»Da in der Senke des Moos- oder Wolfsgraben zur Zeit der Schneeschmelze, aber auch bei Regen, einige Gerinnsel zusammentreffen, vermutete man lange Zeit, dass es auch eine kleine Ansiedlung von Elfen und Kobolden in dieser Region gegeben haben musste. Auf jeden Fall kann man heute noch seltsame Pflanzen und Kräuter an diesem Standort nachweisen. Die Schwarze Nieswurz, auch Schneerose genannt, blüht dort jeden Sommer und im Frühjahr ist das ganze Gebiet mit Bärlauch übersät. In früheren Zeiten soll hier einmal eine pflanzenkundige Frau heilkräftige Kräuter gesammelt haben. Sorgfältig, so geht die Sage, pflückte sie Kraut um Kraut und legte dieses behutsam in ihren Korb, nicht ohne jedoch immer wieder kurz Rast zu machen und dabei zu schluchzen und zu klagen. Dieses Weinen und Klagen rührte einige der anwesenden Elfen so sehr, dass sie sich dem Weiblein zu erkennen gaben. Da erzählte die Frau von ihrem Leid: Ihre Enkeltochter, so berichtete sie, sei sterbenskrank, und nur das sogenannte ›Königskraut‹ könne ihr helfen. Sofort steckten die kleinen Elfen ihre blond gelockten Köpfchen zusammen und begannen zu tuscheln. Und mit einem Mal hatte die Elfenkönigin eine Idee: Man würde einfach die Kobolde, die in der nächstgelegenen Siedlung lebten, um Hilfe bitten! Diese erwiesen sich auch gleich als kooperativ und pflückten das Königskraut. Bereits kurz darauf trank das Mädchen einen Tee mit dem besagten magischen Kraut – und schwupp! – war es geheilt!«
So lautet eine der Geschichten der Großmutter. Johanna liebt diese Geschichten. Und am liebsten hat sie es, wenn die Großmutter sie am Fluss erzählt. So sitzt man gern am Ufer, lauscht dem Plätschern. So stürzen Wellen über Klippen, schäumen auf, zerstoßen sich an Klüften und wirbeln dann wieder glücklich ineinander. Alles hat Augen: der Äther, die Ähren. Alles singt. Die Grillen sind tönende Glocken am Morgen, Johanna öffnet ihr Ohr und schickt stumm Stoßgebete, denn sie hat keinen Mund vor Staunen. Wird im Gehen Wurzeln und Erz. Auftreten, das ist Leben! Das ist ihr Land! Warum würgen und kauen am eigenen Kram der Gedanken? Dachlos sein unterm Feenbaum! Und sich zur Erde ducken, sich mit den Wurzeln unterhalten, sich dann entleiben lassen wie Gras, wenn Wind kommt. So wie die Großmutter es tut, oder? Stänglein spielt Johanna, spielt Gras, und sie gesteht sich die Schwachheit zu. Gott ist ihre Fackel. Man wechselt nicht Sonne! Es gibt bloß einen für den Umgang! Johanna hat Augenbrennen und Angst, wenn sie an ihn denkt, aber sie liebt ihn, denn die Großmutter erzählt immer so schön von Gott, wenn sie wie jetzt am Wasser sitzen. Traulich ist es. Johanna nimmt Gott als Haarsträhne zwischen die Lippen und sagt sich: »Alles ist gut!«
Die Brotkrümchen werden ins Wasser geworfen, sodass sie die Oberfläche spicken. Für die Wassernixen, weiß Johanna Bescheid. Und freilich auch ein bisschen für die anderen Wesen, die im Wasser hausen. Da schießen auch gleich sämtliche Fische empor, so schau doch! Sie alle hasten und nesteln dabei, suchen, schnappen nach den Krumen und sind zufrieden. Johanna ist begeistert. Silbrig glitzern die Weißfische, sind fremde Kristalle im All des Wassers, in dessen All-Einheit.
»Lass mich Same sein!«, sagt Johanna dann heimlich zu Gott und lauscht der Einweihung des Wassers. Nagende Sehnsucht. Geburtsvorgang in ihr: Verdunkelung.
»Du musst immer mit mir reden, dich mit mir teilen. Mitteilen heißt, wir teilen das Leid entzwei!«, sagt die Großmutter, während sie das Brot in Krumen bricht und Johanna dann auch welche reicht.
»Danke, Großmutter!«, nickt Johanna, »ja.«
Manchmal nimmt sie in den Armen der Großmutter dann auch der Schlaf mit. In ihr macht es »Ach«, denn es ist schön und traurig zugleich. Wie das Leben. Das weiß Johanna schon jetzt. Denn Christus hat für sie geblutet, so erzählt der Dorfpfarrer. Und Blut ist kein Wasser, auch wenn es fließt wie der Fluss. Der Dorfpfarrer begeistert Johanna schon früh. Sie liebt die Umzüge. Das Regnen der Blüten, der Veilchen- und Rosenblätter, und die Honoratioren der Priester, das Schimmern ihrer kostbaren Ornate. Und wie sich dabei das gemeine Landvolk freut, lächelt. Da sind die kecken Bäuerinnen mit ihren golden und silbern bestickten Hauben, sie plaudern, plappern, leiern.
Und abends, nach der Predigt, scheint es, als funkelten die Sterne immer besonders hell.
»Sag, Großmutter, sieht jeder die Sterne?«, fragt Johanna.
»Ja. Die bleiben immer gleich!«
»Ehrlich?«
Die Großmutter nickt. Weich fallen die Falten an der Stirn der Großmutter. Wie Bettlaken vor dem Schlafengehen zurechtgestreichelt, weiß Johanna Bescheid.
»Überall hat’s denselben Mond, dieselben Sterne!«, fährt diese da fort.
»Ja?«
»Ja. Und das immer.«
Joanna denkt weiter nach.
»Nur wir werden und vergehen?«
»Ja, Kind. Nur wir!«
Für einen Moment ist es still.
»Aber auch das ist nicht schlimm!«, fügt die Großmutter hinzu und zieht sie zärtlich an sich. Johanna seufzt. Die Großmutter ist einfach gelassen. In ihr schläft die Zufriedenheit. Die Großmutter hilft ihr durch den Tag, der magisch ist, denn Johanna ist noch klein. So sind Johannas Tage getaktet. Hinterm Haus gibt es Zelte aus Stroh, die haben keine Türen. Sind Hütten ohne Eingang. Johanna spielt darin. Oder sie streift zum Fluss, starrt auf die Wasseroberfläche, fixiert die Schilfinsel am Ende des Sees, ohne sie wirklich zu sehen, oft stundenlang. Irgendwann änderte sich das Licht, Wolken ziehen vorbei. Das Schauen ist eine Vertrautheit. Im Licht können sogar Steine rosig aufblühen wie Blumen, denkt sie. So wächst Johanna heran.
Wer bin ich, fragt sie sich manchmal. Alles verschwimmt dann vor ihren Augen, wird riesig. Es gibt keine Vertrautheiten mehr, zu schnell verändert sich alles, das Leben rast und sie ist unfähig, es anzuhalten. Wie ein Mantel scheint etwas über der Welt der Dinge zu liegen und sie weiß selbst nicht recht, wie sie damit umgehen soll. Eine Art Rinde. Auch sie selbst bildet eine Kruste aus, seit sie vom Tod gelernt hat, aber das gefällt ihr nicht. Zuflucht birgt der Seelenbaum, Zuflucht bergen allein die Falten der Großmutter. Diese Kerben, die Gebirgsschluchten sind. Wie faltig die Großmutter ist!
»Immer wieder kommt ein Frühling«, sagt die Großmutter, und das macht Johanna hoffen. Und sie hat recht: Gott ist dann buttergelbes Sonnenlicht. Man kann gar nicht traurig sein, denkt Johanna, überall lauert das Glück. Nicht wahr. Pfirsichfarben die Wolken, ein Zittern am Himmel, ein Frieden.
Frühling und alles so, dicht als sähe die Welt sich zum ersten Mal im Spiegel. Die Knospen an den Bäumen springen stets erneut auf! Wenn der Baum blüht, erinnerte er an rosarot gefärbte Wolken, findet Johanna. Der Puls hinter der Stirn ist dann wie ein Hammer, durchzuckt sie, scheint sie zu zersprengen vor Freude, während sie sich innerlich zurückbiegen muss. In allem spürt Johanna das Beginnen, schon als Kind. Und in ihm den Tod. Sie spürt auch, wie sie alt wird. Noch glänzen die Umrisse des Sees im frühen Licht. Es ist der See ihrer Kindheit. Aber dass das nicht so bleiben wird, weiß Johanna schon.
2. Gott ist ein Lichtweber
Am nächsten Morgen kommt er zu ihr in die Zelle. Das Mädchen blinzelt, kratzt sich am Kopf und blickt ihn aus schaumigen Augen an.
»Wer bist du?«, fragt sie.
Er lächelt.
»Vielleicht ein Engel?«
Johanna stößt ein Schnauben aus.
»Eingeschleust hast du dich«, poltert sie und fixiert ihn mit kritischer Miene.
Er muss lachen, er hat nichts anderes erwartet. Klug scheint diese kleine, rotzige Magd zu sein, oder? Dennoch, Loyseleur muss das Spiel beginnen. Er hat es dem Bischof versprochen.
»Was macht dich so sicher?«, flüstert er und nähert sich der Magd mit einem Stück Brot.
Sie hat die Augen eines hungrigen Tieres, ihr Leib erbebt kurz, doch sie scheint sich nicht für die Nahrung zu interessieren. Johanna spuckt aus. Er sieht in ihren Augen das Temperament eines Kriegers aufflackern, wenn auch nur kurz. Das ist kein Bauernmädchen, denkt er. Das ist keine gewöhnliche Frau.
»Die Engländer müssen mich freilassen. Gegen Lösegeld!«, sagt Johanna indes und presst trotzig ihre Lippen aneinander. Er lacht.
»Bist du einfältig!«
Johanna winkt ab.
»Es gibt Wunder«, wispert sie leise.
Er beißt in das Brot und sieht sie an.
»Und sonst, wie geht es dir hier?«
»Ich rede mit Gott, das reicht mir!«, antwortet Johanna.
So schnell gibt er nicht auf. Pferde hat er gezähmt. Er weiß, was es heißt, einen Willen zu brechen.
»Und wenn ich von ihm käme?«, meint er lächelnd, während der an dem Stück Brot kaut.
Er kann sehen, wie Johanna im Munde der Speichel zusammenläuft vor Hunger. Darauf hat er es angelegt. Er reicht ihr ein Stück, doch die Jungfrau zuckt nur zusammen, rückt ab. Ein Moment der Stille.
»Keine Angst«, wispert Loyseleur bemüht sanft, spricht wie zu einem Tier, einer Wildkatze, die es zu beschwichtigen gilt. Johanna mustert ihn kritisch.
»Die Wachen, sie kommen zu nahe, ich weiß es«, meint er da.
Johanna nickt widerspenstig und nun ist sein Moment gekommen. Er beugt sich ein Stück weit nach vorn.
»Ich aber – ich werde es nicht tun, versprochen!«, wispert er und kann mit einem Mal ihr Haar riechen, das ihr fettig und braun ins runde Gesicht hängt.
»Du hasst es, wenn man dich anfasst, hab ich recht?«
»Rein bin ich!«, braust Johanna auf und entfernt sich noch ein Stück weit von ihm, der immer noch kaut.
»Ich aber«, sagt er, »kann dir helfen. Ich werde mit dem Bischof reden, damit man dich nicht zwingt, Frauenkleider anzuziehen.«
Johanna faucht.
»Du bist mir ein schöner Engel!«, meint sie und spuckt noch einmal aus.
»Ich zieh sie ohnehin nicht an. Und ich brauch keine Engel. Die Engländer helfen mir bestimmt. Bald bin ich wieder frei!«
Dann beißt sie sich auf die Lippen und zieht sie zusammen zu einem Strich. Vielleicht, um nicht der Versuchung zu erliegen, doch nach dem Brot zu greifen. Loyseleur lässt die Rinde für sie liegen, als er aufsteht. Das würde nicht einfach werden. Aber was hatte er erwartet?
Eine haardünne weiße Linie liegt am Ende des Sees. Die beginnende Finsternis ist noch rötlich. Das macht die Sonne, weiß Johanna. Sie flieht über jede Grenze in tänzerischer Leichtigkeit und steht am Ende des Horizonts. Über die Oberfläche des Sees legt sich der Wind in tanzenden Wellen. Er ist ein rhythmisches Sich-Wiegen, Kommen und Schwinden, die Welt klingt, klinkt sich in das Atmende des Windes ein. Die Pflanzen haben Blumengesichter und abends brennt der Mohn. Die Blumen senken sich, die Sternenmuster verschwinden zu winzigen Strichen, wenn man den Blick zusammenkneift. Johanna liebt das flimmernde Weiß und dennoch wird ihr in einer Art Schmerz ihr Körper bewusst, wenn sie nach oben sieht – eine Last, die sie lieber loswerden würde. Ein Fast-Nicht-Knistern liegt in der Landschaft als letzter Tagesrest. Alles andere ist gut zwischen den Tannenzweigen. Und auch Johanna ist gut, als Kind. Weil sie nicht weiß, was es heißt, böse zu sein, sieht Johanna es auch in den anderen nicht.
In der Kindheit ist trotz des Todes und der Schwere des Körpers am Abend alles bei sich und heil. Und manchmal streut die Großmutter Maiskörner für die Hühner aus und das ist auch gut. In der Sonne steht sie dann, die Strahlen der Sonne sind Aureolen, umspülen sie. Als leuchtende Fluten und gestillte Träume. Es ist gläsern: So, als müsste man aufpassen, dass man nichts Falsches sagt. Alles könnte zerbrechen, wie ein einziger Faden eine Stickerei auflösen kann, weiß Johanna. Die Stille der Großmutter ist schön und wehrlos an diesen Abenden. Sie ist ewig wie der Moment und am Vergehen wie der Tag, auf den sich die Nacht senkt, und beides zugleich. Die Schönheit des Leuchtabends scheint aus jedem einzelnen Korn als Halm hervorzusprießen. Die Hände fassen nach den Körnern, rinnen aus. Verschenken sich so an die Welt. Und nachts kann Johanna in einer Wolke aus ihrem eigenen Haar liegen. Dann scheint es, als wäre alles zu erlösen. So wie der Priester gesagt hat. Zu erlösen von dem Tod. Eingefügt in eine Welle aus Licht, das nicht außen ist, ist Johanna in diesen Tagen. Der Vorhang vor ihrem Schlafzimmerfenster weht wie Geisterflügel. Und Johanna freut sich, denn morgen darf sie wieder mit den Kindern spielen. Die Schönheit des Spiels kommt immer aus gläserner Tiefe. Manchmal aber, im Dunkeln, ist es sehr laut. Da umkreisen sie alle Gedanken. Johannas Angst lässt sie zusammenducken und zwischen ihr und der Welt liegt ein Schleier. Da steht die Stimme, es ist fast die eigene und sie ist ihr doch fremd. Die Worte zerhämmern das Geheimnis der Dinge. Noch hat Johanna Angst vor der Stimme. Aber sie wird sich an sie gewöhnen. Einstweilen geht das Leben hier weiter. Man tanzt unterm Feenbaum. Heimlich, denn manche meinen, das sei heidnisch. Aber es gibt auch andere Tänze, die der Priester gutheißt. Viele Dorffeste. Im Dorf sind diese Festgelage wichtig und laut. Johanna nimmt Teil daran, wie auch die Großmutter es tut. So verstreicht das Leben. Johanna ist verliebt in das lockige Haar des Gartens, auch wenn die Arbeit am Hof hart ist. Und sie liebt die Wolken am Himmel. Auf der Stirn einer Wolke leuchtet die Sehnsucht, und sie kann sie immer betrachten, wenn sie das Vieh weidet. Den Finger kann sie hinein stecken in das Bild der Wolken und kosten. Seitdem schmecken sie salzig – wie der Finger. Johanna ist froh, weil sie einen Gott hat.
Noch ist sie klein. Noch hält die hitzige atmende Steppenlandschaft das Schicksal der Welt in der Hand. Johanna ist Kind und ist glücklich. Kann man sich vom Himmel abstoßen? Nein, man kann es nicht. Und stets kehrt der Frühling wieder. Der Frühling ist schön und nutzlos. Er eröffnet ihr einen Blick in die Durchsichtigkeiten der Welt. Es ist, als würde Johanna Wind sehen, wenn Frühling kommt. Oder Luft. Oder Gott. Wenn indes schon Dreschzeit ist, riecht es nach Hitze und Heu. Johanna hat Freundinnen, mit denen spielt sie am Feenbaum. Und auch sonst: Sie stecken in Garben, sie klettern auf Heuballen. Johanna ist Kind und sie ist alles, die Landschaften, die Hitze, die versengten Tage. Disteln im Haar und Webkugeln, vom Herumtollen, vom Klettern auf das Baumhaus. Aufgeschreckt in den Tag hinein. Nachts pumpert es manchmal am Gang und sie hat Angst. Aus den nachtschwarzen Himmeln schreit es. Für einen Moment schwirren dann die geheimen Angstgeister heran. Dass es nur Fledermäuse und Falken sind, die am Sims hausen, weiß Johanna da noch nicht. Durch ihre Kindheit torkeln Angst und Freude wie eine Katze und Johanna hascht nach dem Schwanz der Katze, ein Kitzeln und ein Tappen. Sie zieht mit klobigen Händen daran. Aber mit dem Tod und der Nacht kommen auch immer wieder Narben um Narben, ungesehen, ungesagt. Johanna holt sich einen weichen Moospolster, den sie streichelt gegen die Angst. Sie liebt die Eicheln, den Kiesel. Wer Steine missbraucht, missbraucht auch Menschen, weiß Johanna. Nie hebt sie einen Stein auf. Nie wirft sie einen Stein. Friedlich soll das Dasein sein, wie die Großmutter es sagt, findet sie. Alles liegt doch in seiner Fülle! Hinterm See ist die Ferne und atmet Magie. Um den Mond, der eine Hostie ist, liegt ein Hauch: Dunst, Dunkel. Das Glück ist die streichelnde Großmutterhand. Manchmal trennt nur eine Nacht den Sommer vom Winter und die Tage sind hell. Im Winter dehnt sich das Eis, auf dem schwer ein Nebel ruht. Blutig steht eine Sonne am Horizont. Die Erde. Ihr lichtgewirktes Kleid. Wie Fieber brennend durch die Adern glüht, so ist Gott, weiß Johanna Bescheid. Da fällt ihr auf, dass ihr Arm ein Gelenk hat. Dicke Wurzeln wachsen aus ihrem Wald. Die Welt. So beschäftigt sie sich nach und nach mit ihrem Körper: Die Haare flechten, die Knochen sortieren, aufstehen, immer wieder und immer wieder, harte Arbeit auf dem Feld. Vor Hunger knabbert dieser Körper sich selbst an. Ungesehen. Schwer ist der Körper. Bloß wenn es ans Schlafen geht, dann verwandeln sich die Dinge und im Schlaf wird alles leicht. Die Nacht aber macht Angst, wenn man nicht schlafen kann und wach liegt.
Manchmal hilft dann das letzte brennende Licht auch nicht mehr gegen die Dunkelheit. Es macht die Schatten nur noch tiefer. Im Schrank des Zimmers fließen die Welten ineinander, lauern Geister neben Kleidern, lauert Furcht hinterm Alltag, hinter der harten Arbeit auf dem Feld. Unsagbare Angst hat Johanna dann, sie will leben, denn Gott ist eine Geranie, kommt in Massen und überschwemmt sie, rosa und schreiend, ja, eine Blumenflut, er ist eine Sonne, die sich in trägen, schwülen Wellen auf sie herab ergießt. Gott ist wie eine Handvoll Erde und einmal angefangen, in ihn hinab zu schlüpfen, kann sie gar nicht mehr heraus. Ihr Körper, eine Pflanze mit Gliedmaßen, mäandernd, der ewigen Sonne ausgesetzt, ja, mäandernde Melodie, wandernd, wieder und wieder, Schritt und Tritt in Blumen, lauert Gott ihr auf. Sucht in ihr das Steuerruder. Es ist wie eine Sucht. Ein Gewirke ist jedes Bild in ihr, Vorsinnen in sich selbst. Manchmal schweigt er aber auch.
Ach, könnte der Atem Vogel werden, denkt Johanna und denkt dabei an die Großmutter.
Sie tanzt auf den Stoppeln des Feldes, lässt sich lachend vom Regen verjagen, Johanna, windverknotet, und am Kehlkopf, diesem Ei, nistet schon das Singen. Bis es ausschlüpft, tanzt sie, einstweilen, um die Zeit zu überbrücken. Froh sind ihre Fingerglieder, wenn sie an der Luft nesteln dürfen: Gott, du bist da! Und die Hand ist eine salzene Wunde, die versucht, zu wachsen. Johanna schluckt sich die Zeit zurecht, die Angst hinterm Gaumen, und tanzt.
Käme ein Engel, wäre er Nest, Gefieder, denkt sie.
Die Blätter sind Gelenke, an denen der Wind rüttelt. Lippenbrand: Alles ist Gottes Geschöpf, versucht Johanna sich zu sagen, wieder und wieder. Die Wahrheit hat viele Seiten. Johanna bemüht sich, den Ausblick zu behalten. Dann kann etwas blühen, denkt sie.
Sie erzittert, als sie so von Gott durchschritten wird. Gott ist ein Lichtweber, entnimmt ihr alle Schwere. Er schwankt und bebt in ihr. Wie Äste im Wind. Wie sehr diese Landschaft bei sich ist! Johanna möchte ihr Leben aus sich herausschreien. Junge Vögel öffnen ihre Schnäbel wie in Atemnot. Auch sie wollen zu Gott. Der Sonnenschein entrückt Johanna ein wenig. Sie muss sich von Gott erholen, von ihrer Heiligkeit, von zu viel Lichtgespinst im Hirn. Dass es nicht einfach ist, denkt sie.
Da begegnet ihr erstmals ein Engel. Michael heißt er und er steht in der Landschaft wie ein Sturm. Michael dreht sich und sein Kleid bildet Wellen, ist eine schwarze, gewellte Flut ohne Ende. Sie wirft sich Michael in Falten voraus, die wie Zelte sind. Unter denen kann man sich verstecken, in die Grätsche gehen, weiterziehen, weiß Johanna. Ihr Saum verlangt nach Wind, Wildheit, und so läuft sie dazwischen durch, immer wieder. Sie reitet mit der Finsternis in Michaels Kleidern, reitet, peitscht dahin und die Finsternis gehorcht und wird Licht.
»Wie ist das Fegefeuer?«, fragt sie Michael, denn der Dorfpfarrer hat einmal erzählt, dass da die Seelen hinkommen.
»Da ist Übergang!«, antwortet der Engel.
»Ist das schlimm?«
»Nein, der Himmel folgt dir überall hin!«, entgegnet Michael.
»Aber wie ist es da?«, will Johanna wissen.
»Zwischen nichts und nichts schwebt man!«
»Also kein Halt?«
»Ja! Aber du bist jung. Also lächle. Nur lächelnd kann man Acker bauen.«
Johanna nickt. Sie weiß, dass Michael recht hat. Und Johanna wächst. Noch ist sie ein Kind, ganz knabenkühn. Gleichzeitig besitzt sie aber die Zartheit eines Schmetterlings, und die kommt von innen. Verschlissen ihre Kleider, wenn sie spielt, hängen die Fetzen von ihr herab.
Ja, Johanna kann wild sein: Sie ist ein Bauernmädchen. Doch den Tod will sie nicht, den leblosen Vogel in der Erinnerung, der von Raureif überzogen war. So läuft Johanna manchmal auch traurig und ziellos herum. Aus Angst.
»Was hast du, Kind? Was rennst du denn so?«, fragt die Großmutter einmal.
»Der Tod – er ist hinter mir her!«, ruft Johanna aus.
»Woher weißt du das?«
»Er kommt alle holen, sagt der Dorfpfarrer!«
»Dann halte dich an Gott!«
»Der ist zu weit oben!«
Johanna schweigt kurz.
»Und mir kommt vor: Recht hier ist das Leben erst, wenn’s ans Sterben geht!«, fügt sie plötzlich hinzu.
»Was du dir für Gedanken machst, Kind!«, lächelt die Großmutter.
»Ja!«
»Ach, Johanna.«
Immer wieder sucht Johanna sich auch gute Gedanken. Dass die Blumen sogar im Dunkeln im Walde fortblühen, denkt sie da. Sie lassen sich nicht umbringen. Aber sie sind kostbar. Nicht jeder Bauer hat welche.
Nun erscheint sie, das erste Mal deutlich: eine dünne, gläserne Stimme von innen. Flötenvögel im Kopf. In ihrem Wesen liegt eine Entschlossenheit, die jeden aufleuchten lässt, der ihr begegnet.
»Johanna, heilig bist du!«
Da lachen Johannas Augen.
Am Morgen steigen Wolken auf: Wenn der Wind kommt, dann jagen sie über die Landschaft und Johanna jagt ihnen hinterher. In Johanna ruft es: »Heilig bist du!« Noch weiß sie nicht, dass das direkt von Gott kommt. Doch sie ist schon verzückt. Und wenn sie verzückt ist, leuchtet gleichsam geisterbleich ihr ganzes Gesicht. Wenn sie die Stimme nicht hört, werden ihre Augen aber wieder heimatlos. Was bleibt, ist dann nur die Großmutter als Sicherheit: wie sie das Brot bäckt.
»Was machst du mit den Resten, Großmutter?«, fragt Johanna.
»Die gehören ins Feuer, die bringen dann Glück. Damit die toten Seelen singen!«, kommt es zur Antwort.
»Ehrlich?«
»Ja!«
Die Großmutter reicht ihr ein Stück Brot.
»Iss«, sagt sie.
Johanna schüttelt den Kopf, weil ihr gerade wieder der tote Vogel einfällt.
»Ich mag nicht!«
»Die Gabe Gottes sollst du loben und schätzen!«, sagt die Großmutter ein wenig tadelnd.
»Warum?«
»Weil er sonst straft, Johanna!«
Da springt Johanna auf und holt den toten Vogel aus der Lade, den sie aufgehoben hat. Die Großmutter blickt sie erstaunt an. Während ihr die Großmutter folgt, läuft Johanna indes in den Garten und beginnt zu graben.
»Der Vogel ist tot. Was machst du, Johanna?«, will die Großmutter wissen.
»Ich gebe ihn jetzt Gott zurück, Großmutter! Die Zeit ist gekommen.«
Ein seltsames Kind ist sie, denkt die Großmutter und versteht nicht und fragt deshalb nach: »Das geschieht durchs Eingraben?«
»Ja!«
»Bist du sicher?«, will die Großmutter wissen.
»Ja!«
Johanna hält inne. Stille.
»Das machen Menschen doch auch, oder?«, fragt sie dann und betrachtet ihre erdigen Hände. Die Großmutter lächelt.
»Nicht alles, was Menschen machen, muss auch richtig sein!«, meint sie.
Johanna überlegt. »Der Tod ist grässlich, Großmutter, oder?«, fragt sie dann.
»Er ist das Einzige, worauf wir hinleben!«
»Warum?«
»Um bei Gott zu sein!«
Johanna wird wieder traurig. Sieht der Großmutter in die Augen. Schwarz wie die Löcher zwischen den Galaxien sind ihre Pupillen, denkt sie. Was für ein einsames Alter die Kindheit ist! Alles sagt immer bloß ich, ich und ich und ich.
»Aber!«, ruft Johanna da aus, doch mehr fällt ihr nicht ein.
»Schau, das Fleisch, Johanna! Es kommt von den Tieren. Wir töten sie, damit es uns etwas nutzt!«, sagt die Großmutter da.
»Ich weiß. Deshalb möchte ich nichts essen, was Augen hat«, nickt Johanna.
»Davon wird man aber satt. Und das Schlimme, Johanna, das ist nicht das Töten!«, erklärt die Großmutter zärtlich.
»Sondern?«, will Johanna wissen.
»Das Quälen!«
Johanna überlegt.
»Verstehe«, sagt sie dann.
3. Älterwerden
Auch in den nächsten Tagen geht man nicht gut mit Johanna um, wie er beobachten kann. Man gafft sie an wie ein wildes Tier. Wie allen der Geifer aus den Mündern schwappt! So befingert man die Jungfrau, wieder und wieder. Vor allem Jeannotin Simon, dem Schneider, scheint es große Freude zu bereiten, mit seinen Händen an ihr herumzuwerken. Johanna ist empört, schreit laut auf, knackt mit dem Kiefer. Eine Bestie ist sie, die schnaubt und um sich stößt. Das hören auch die Soldaten und treiben daraufhin umso mehr ihre Scherze mit ihr.
»Eine Ohrfeige hast du dem Schneider gegeben, Kleines?«, hänseln sie sie. »Na, dann versuch’s mal mit uns!«
So tönt es im Kellergewölbe. Und er, Loyseleur, ist Zuschauer, ist Beobachter, der auslotet. Die Soldaten also. Vor ihnen scheint Johanna, im Gegensatz zum Schneider, Angst zu haben. Er kann es genau sehen. Wie ihre Augen rollen, wie sie innerlich aufzuckt, wenn sie vor der Kammer stehen. Durch ein Loch in der Wand, das der Bischof für ihn angefertigt hat, kann er stets einen Blick in die Zelle der Jungfrau werfen. Nun sieht er sie zittern. Denn sie weiß: Stets könnten die Soldaten eindringen, Johanna verletzen, ihr wehtun. Er betrachtet die Jungfrau. Müde scheint sie zu werden, zerrt jeden Tag weniger an den Ketten, ja, eine Art Lähmung scheint sich in ihr breitzumachen. In den nächsten Verhandlungen befragt man sie wiederholt zu den Erzengeln.
»Wie sieht der heilige Michael aus?«, will der Earl von Warwick, ein hagerer Mann mit scharfem, stechendem Blick und einer grob hervortretenden Hakennase, wissen.
»Hell«, entgegnet Johanna.
Doch das reicht Warwick und Cauchon, Bischof von Beauvais, freilich nicht als Antwort.
»Und die Haare?«
»Engel und Haare?«, entgegnet die Jungfrau zweifelnd.
Da beginnt das Priesterpack sofort, sich darüber zu empören.
»Sollte ein Engel nicht Haare haben?«, tönt es und in dem Gerichtssaal werden die Stühle und Tische verrückt, wühlt das Denken in den Gesichtern. Alles Idioten, denkt Loyseleur. Die Jungfrau ist eingeschüchtert. Seltsam, aber es ist, als gehe ihr diese Frage wirklich zu Herzen, überlegt er.
»Ich weiß nicht!«, murmelt die Jungfrau da.
Langsam scheint sie an Kraft und Stärke zu verlieren, es fällt ihm auf. Ja, Johanna beginnt zu stammeln, zu stottern. Ihre Stimme strauchelt.
»Und andere Körperteile?«, fragt man sie.
Müde flackert ihr Gesicht auf. Loyseleur will nach ihren Handgelenken greifen, mit einem Mal tut ihm die tierische Jungfrau leid.
»Was?«, fragt etwas blass aus Johanna heraus.
»Hast du andere Körperteile gesehen?«, will Cauchon wissen.
Johanna blinzelt.
»Von wem?«
»Na, von den Heiligen!«, entgegnet Warwick und lacht schallend.
Er merkt, wie der Jungfrau nach und nach rötliche Farbe ins Gesicht schießt. Zornig bricht es da wieder aus ihr hervor, als wäre ihre Kraft zurückgekehrt:
»Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Anstatt das zu tun, hätte ich aber eigentlich lieber, dass ihr mir den Kopf abschlagt!«
Cauchon schweigt mit offenem Mund. Diese Aussage ist sogar einem Priester zu viel.
»Und hast du sie gesehen?«, will Warwick nun wissen.
Die Magd nickt, und das Haar fällt ihr schmutzig und strähnig ins Gesicht.
»Ja, mit Augen. Und es roch süß!«, sagt sie trotzig.
»So wie jetzt meine Hand?«, meint hänselnd einer der Soldaten und beginnt, während er sich die Lippen leckt, über ihren Mund zu streichen. Johanna spuckt aus. Ein Hieb vom Wärter reicht jedoch, dass sie den Kopf einzieht.
»Gewiss doch!«, sagt Johanna, mit einem Mal leise und sanft, »und als Ihr mich verließt, weinte ich, denn ich sehnte mich danach, dass Ihr mich zu euch nehmen würdet!«
Cauchon nickt, sein Doppelkinn wabbelt.
»Sie sind kein Engel!«, sagt Johanna, aus der nun eine Stärke und Helligkeit dringt, die nichts mehr mit ihrer eben noch tierischen Gebärde gemein hat. »Denn ich kenne die Engel. Ich habe sie gesehen, ja, mit meinen eigenen Augen. Und ich glaube so fest daran, dass es Engel waren, wie ich daran glaube, dass Gott lebt.«
Dass die Großmutter eine besondere Frau, ja gleichsam eine gute Hexe, ist, lernt Johanna mit den Jahren. Für die Heilung hat sie stets Kräuter bereit, die sie im Wald sammelt.
»Warum lässt du dich nicht von einem Arzt behandeln?«, fragt Johanna einmal, als die Großmutter an hartnäckigem Keuchhusten leidet. Eisuhren scheinen in ihr zu wandern, wenn es in ihrer Brust rasselt. Johanna hat Angst um die Großmutter.
»Weil der Körper sich selbst heilt. Der weiß schon, wie!«, sagt die Großmutter.
»Bist du sicher?«, fragt Johanna.