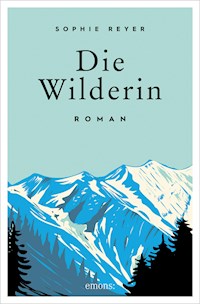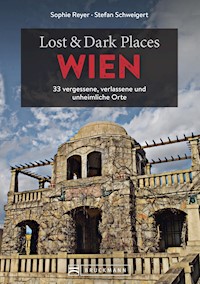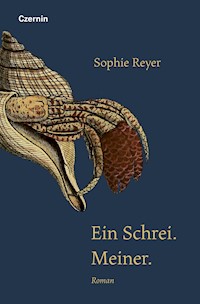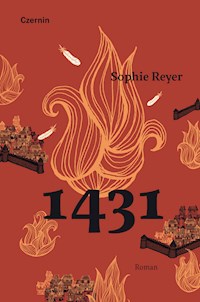14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief." (Altes Volkslied) Käthe wächst in der Provinz auf. Sie fühlt sich einsam und hässlich. Die Mutter ist in die Stadt gezogen, der Vater spricht kaum mit ihr. Doch dann trifft sie Johanna mit ihrem schiefen Eckzahn, von dem sie sofort fasziniert ist und findet in ihr ein neues Zuhause. Die beiden Mädchen verbindet eine große Leidenschaft zu Musik und zu Musicals. Bald merkt Käthe, dass irgendetwas an ihren Gefühlen für Johanna "nicht ganz normal" zu sein scheint. Sophie Reyer, eine der vielseitigsten und interessantesten Stimmen der jungen österreichischen Gegenwartsliteratur, erzählt mit leichter Hand und ungemein präzise eine zarte Liebesgeschichte über die Wirren des Erwachsenwerdens und ein Mädchen, das ein Mädchen liebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOPHIE REYER
ZWEI KÖNIGSKINDER
Roman
Sophie Reyer
ZWEI KÖNIGSKINDER
Roman
Gedruckt mit Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien
Reyer, Sophie: Zwei Königskinder / Sophie Reyer
Wien: Czernin Verlag 2020
ISBN: 978-3-7076-0689-8
© 2020 Czernin Verlags GmbH, Wien
Lektorat: Evelyn Bubich
Satz, Umschlaggestaltung: Mirjam Riepl
Coverbild: William Elford Leachs Zoological Miscellany
Autorinnenfoto: Konstantin Reyer
Druck: GGP Media GmbH
ISBN Print: 978-3-7076-0689-8
ISBN E-Book: 978-3-7076-0690-4
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
»Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Das Wasser war viel zu tief.«
(ALTES VOLKSLIED)
INHALT
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
EPILOG
1. KAPITEL
Als ich Johanna das erste Mal begegnete, war das Erste, was mir auffiel, ihr schiefer Eckzahn. Es muss im Kirchenchor gewesen sein, an einem dieser regnerischen Tage. Meine Mutter war aus dem Dorf gezogen, und mein Vater die meiste Zeit über still. Eine Art Schatten ging mit dem Schweigen einher. Vielleicht wusste er nicht, was er mit mir anfangen sollte? Auf jeden Fall schickte er mich nachmittags meistens in die Pfarrgemeinde. Es gab nicht viele Alternativen, das Dorf war klein, gleichsam hingespuckt in die hügelige Weinlandschaft, in der immer zu viel Wind wehte. Der Eckzahn blieb mir in Erinnerung. Ich weiß noch, wie ich Johanna beobachtete. Sie riss ihren schmalen Mund auf, wenn sie sang, und sah dabei wie ein Fisch aus. Ich konnte immer wieder den Zahn sehen, der ein bisschen zu groß war, leicht hervorsprang und von einer Zahnspange gehalten wurde. Ich weiß nicht warum, aber der Zahn gefiel mir. Auch an mir waren sämtliche Dinge zu groß, im Besonderen die Nase. Später hörte ich oft, dass das doch typisch sei für dieses Alter. Ich weiß es nicht. Ich fühlte mich einfach nicht in einer passenden Form. Während das Becken seltsam breit aussah und der Oberkörper viel zu kurz zu sein schien, schlenkerten meine Arme eigentümlich lang an mir herunter. Die Finger sehen aus wie Spinnengebein, dachte ich, wenn ich in den Spiegel sah.
»Schön«, rief die Klavierlehrerin, als sie mich nach dem Sommer wiedergesehen hatte. Sie hatte damit die Finger gemeint, die nun über die Oktaven hinausgreifen können würden. Ich selbst fand mich und meine langen Finger nur seltsam. Wusste nicht so recht, wo ich sie hingeben sollte. Sie waren ständig im Weg, baumelten an mir hinab wie deformierte Fremdkörper. Auch die Handgelenke sahen komisch aus, so, als könnten sie in jedem Moment abbrechen. Wenn ich mich im Spiegel betrachtete, grauste mir vor den roten Pünktchen, die immer wieder mein Gesicht übersäten. Sie kamen und gingen über Nacht. Eine Brust war größer als die andere. Ich fühlte mich als seltsamer Auswuchs meines Selbst. Ähnlich war es mit meinen Gefühlen. Die spielten verrückt in meinem Bauch oder waren auf einmal wieder ganz verschwunden. Ließen eine Art Leere zurück. Im Herzen, im Hirn. Ein Druck an den Schläfen, der es schwermachte, zu schlucken. Als Mutter wegging, war dieser Druck fast unerträglich geworden. Und dann Johannas Eckzahn.
An diesem Abend wusste ich, ich musste mich mit ihr verbünden. Ich sah ihr zu, wie sie sang, hörte ihre hohe Knabenstimme jubilieren. Ich riss meine Augen auf. Sie blickte schamhaft zu Boden. Ihre Wimpern schimmerten dunkelgolden. Ich musste lächeln.
»Mach den Mund zu, Käthe. Der Sopran ist dran«, murrte die Chorleiterin Sabine.
Ich blickte in ihr wulstiges Gesicht und nickte mit offenem Mund.
»Ich bin Käthe«, sagte ich später und streckte Johanna meine Hand hin.
»Johanna.«
»Du singst schön.«
»Danke. Und du singst tief.«
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
»Danke«, sagte ich deshalb zur Sicherheit, und schob mir eine der Haarsträhnen bemüht locker hinter das rechte Ohr.
In der Zeit, in der ich Johanna begegnete, drehte ich mir mein Haar mit den Lockenwicklern meiner Mutter ein. Die hatte sie dagelassen, in dem Haus, das viel zu groß war für uns, meinen Vater und mich. Die Lockenwickler sahen aus wie Schaumrollen. Ich wickelte die einzelnen Strähnen um die runden, genoppten Dinger. Dann steckte ich diese mit kleinen Plastiknadeln fest. Das pikste an der Kopfhaut. Es war ein guter Schmerz. Ein Schmerz, der mich daran erinnerte, dass ich einen Kopf hatte. Außerdem waren die Lockenwickler eines der wenigen Dinge, die mir meine Mutter von sich dagelassen hatte.
Seitdem spürte ich oft Schläge in meinem Bauch. Zum Beispiel, wenn ich durch die Gänge der Dorfschule streifte und die Jungs ansah, die mir fremd erschienen.
Ich versuchte, schön auszusehen. Spielte mit einer meiner Haarsträhnen. Sie rochen nach dem billigen Shampoo, das man in der Trafik im Dorfzentrum kaufen konnte. Bevor ich in die Chorproben ging, wusch ich mir immer das Haar. Es sollte leuchten. Ich verteilte den Schaum darin. Dann rollte ich die Strähnen auf, fixierte sie mit den Plastiknadeln. Dann föhnte ich. Das dauerte lange. Obwohl ich das Haar nur bis zum Kinn trug, war es schwer und dicht. Die Lockenwickler hingen, sie taten weh. Das Gewicht ließ sich nur schwer ertragen, ich ertrug es aber, und das den ganzen Nachmittag. Bis es zu dämmern begann. Dann löste ich die runden Wickler aus dem Haar. Einige der Zacken waren bereits abgebrochen. Immer wieder verhedderten sich Strähnen in diesen Leerstellen, die zwischen die Zacken geraten waren. Manchmal riss ich daran, rupfte mir versehentlich Strähnen aus. Ich hatte auch Nester im Haar, besonders da, wo der Nacken begann. Ich kämmte, fluchte. Aber ich hörte nicht auf. Dass sich mein Haar wellen sollte, das bildete ich mir einfach ein. Jetzt spielte ich damit. Das hatte ich mir bei meiner Cousine abgeschaut. Sie war achtzehn und jeder liebte sie.
Aus der Nähe sah ich, dass Johannas Haar fein war. Es fühlte sich bestimmt samtig an, dachte ich. Rollte sich am Ende der Strähnen leicht nach innen. Meines hingegen war von strohiger Beschaffenheit.
»Ich mag deine Haare«, sagte Johanna, als hätte sie meine Gedanken gelesen.
Ich lächelte.
»Danke.«
»Die sind so gerade«, fuhr sie fort.
Ich seufzte leise. Die vielen Nachmittage. All die Anstrengung: umsonst. Nach weniger als einer Stunde hingen meine Haare wieder an mir hinab wie glatte Nudeln. Ich wusste nicht, wie kurz ich sie noch hätte schneiden sollen, dass sie nicht an meinen Wangen klebten, aussahen wie hingepappt.
»Aha«, antwortete ich schließlich, um irgendetwas zu sagen.
Wir standen eine Weile so da und schwiegen einander an. Ich konnte Johannas Atem an meiner Wange spüren. Hinter dem Fenster hatte es zu dämmern begonnen. Der Moment schwappte über mich. So, dachte ich, könnte sich Sein anfühlen. Der Rest des Chors war bereits gegangen. Sabine klappte das Klavier zu, schob ihre Mappen unter die Arme und lächelte uns an.
»Na, ihr Küken, jetzt aber ab mit euch. Eure Eltern werden schon warten.«
Sie blickte mich von der Seite an.
»Ich meine, … dein Vater, Käthe.«
Ich nickte und schlüpfte in meine Jacke, ohne Johannas Eckzahn noch einmal zu mustern.
Johanna lächelte Sabine an. Ihre Zahnspange blitzte.
»Vielen Dank, Sabine. Und auf bald.«
Sie drehte sich um, und ich sah den Ansatz ihres Nackens. Ihr Haar war dunkelblond. Und da hastete ich ihr mit stammelnden Schritten nach. Konnte gerade noch erkennen, wie Johanna in den Regen entschlüpfte, der eine Art Schleier hinter ihrem Rücken bildete. Die Tür eines blitzenden großen Wagens sprang auf. Ich sah die Konturen eines Mannes, stark hervorspringende Backenknochen, ein ausgemergeltes Gesicht. Dicke Brillengläser. Das musste ihr Vater sein.
Es dauerte, bis ich das erste Mal mit Johanna allein war. In der Zwischenzeit hatte ich einiges über sie herausgefunden. Die Familie war offenbar reich und vor Kurzem in ein Haus nahe am See gezogen, die Mädchen aber besuchten eine Eliteschule in der Stadt und man sah sie meist nur in der Kirche. So vergingen die Tage. Der Frühling war bereits fortgeschritten. Es war ein milder Nachmittag, an dem wir beide mit Regenschirmen vor der verschlossenen Türe des Chorraums standen. Ich starrte auf Johannas Eckzahn, als sie den Schirm abspannte. In ihren Augenbrauen hatten sich kleine Wasserperlen verfangen, die glitzerten. Sie lächelte. Es sah ein wenig verschoben aus. Ihre Augen waren klein und versteckten sich hinter Brillengläsern.
»Hallo«, sagte sie.
»Hallo.«
»Es ist zu.«
Ich deutete auf den Chorraum. Johanna rüttelte an der Tür. Sie rüttelte aber auf eine Art, die so vorsichtig war, dass mir warm ums Herz wurde, als ich ihr dabei zusah. Ich stützte mich auf meinen Schirm und pustete mir eine Locke aus dem Gesicht, die bereits begann, sich auszurollen.
»Sieht so aus, als wäre niemand da«, seufzte Johanna.
»Ja«, nickte ich.
Stille. Johanna machte keine Anstalten zu gehen. Sie trug eine taillierte Jacke, die ihre dünne, langgezogene Figur verbarg. Johanna sah aus wie ein Knabe. Ihr Haar war dunkelblond. Die Arme lang.
»Weißt du, wie schön du singst?«, sagte sie plötzlich.
Da geriet ich gleich ins Schwärmen.
»Du singst doch so schön. Das habe ich dir schon oft gesagt, oder?«
Sie hatte den glockenhellen Sopran eines Knaben. All das passte zu ihr. Zu den schmalen Hüften, den hellen Blusen, die sie trug.
Wir standen lange so beisammen und hörten in den Regen hinein. Johanna erzählte, wo sie wohnte. Der Vater war bestimmt kein einfacher Bauer, so wie meiner. Ein Duft ging von Johannas Locken aus, der an Zimt denken ließ, an Vanille und ein wenig an Zahnputzcreme.
»Und du, wie alt bist du?«
»Dreizehn«, sagte ich.
»Du wirkst älter«, meinte Johanna.
Ich wusste nicht, ob das gut oder schlecht war. Es lag bestimmt an meinem Vater und dem Verschwinden der Mutter. Es lag an dem verlassenen Hof, auf dem wir lebten, und daran, dass ich keine Freunde in der Dorfschule hatte. Das hätte ich Johanna gern erzählt. Stattdessen starrte ich auf die Kacheln am Boden und beobachtete, wie sich ein kleines Rinnsal zwischen ihnen bildete. Ich hatte den Regen mitgebracht. Ich blickte wieder hoch und auf Johannas Kinn, da ich mich nicht traute, ihr in die Augen zu sehen. Die Art, wie ihre Schlüsselbeine hervortraten, fiel mir das erste Mal auf. Es machte ein komisches Gefühl in meinem Bauch. Die Luft stand still. Es knistert, dachte ich. Ich wollte den Moment einfrieren.
»Hast du eine Telefonnummer?«, fragte ich irgendwann.
Johanna lächelte.
Sie kramte ein loses Blatt Papier hervor und schrieb in kleiner gedrungener Schrift ihre Nummer auf.
»Vielleicht magst du mal auf Kuchen kommen, zu mir und meinem Vater?«, schlug ich vor.
Johanna sah mich einen Moment lang fragend an.
»Hast du keine Mutter?«, wollte sie wissen.
Ich wiegte den Oberkörper leicht hin und her, um mir nicht anmerken zu lassen, dass ich mich auf einmal ein wenig schämte.
»Doch. Aber in der Stadt.«
»Warum ist sie nicht hier?«, meinte Johanna irritiert.
Ich schwieg. Ein Bild stieg vor meinem inneren Auge auf: Meine Mutter, wie sie Kisten ins Auto packte. Den Kofferraum zustieß. »Ich werde dir schreiben und rufe dich an«, sagte sie, und dann drückte sie mich in eine Umarmung, die einem Würgen gleichkam. Ich konnte kaum atmen, erinnerte ich mich. Auch jetzt nicht. Kein Ton kam aus mir. Natürlich redeten die Leute im Dorf. In so einem Dorf war es nicht normal, dass eine Frau einen Mann mit seinem Hof, seinen Schafen und einem jungen Mädchen allein ließ. Ich sah bedrückt zu Boden. Johanna merkte es.
»Ist nicht so wichtig!«
Johanna lächelte. Sie fragte nicht weiter. Das fühlte sich gut an. Dann fügte sie hinzu:
»Ja. Ich besuche dich gern. Wenn meine Schwester mitkommen darf?«
Ich war ein wenig irritiert, ließ mir aber nichts anmerken.
»Ist deine Schwester älter als du?«
»Ja. Zwei Jahre. Sie ist siebzehn. Wir machen alles gemeinsam.«
»Verstehe.«
Später sah ich immer wieder Johannas Schrift an. Die Buchstaben kamen mir vor wie Figuren, die sich unter einer großen Last beugen mussten. Denen es zu eng war. Noch vor dem Schlafengehen hielt ich mir den Zettel mit den gedrungenen Kügelchen vor die Augen. Säuberlich, klar, eingezwängt. Diese Worte fielen mir Jahre später ein. Sie passten zu Johanna.
Als ich Johanna das erste Mal am Telefon anrief, schwiegen wir beide lange. Keine wusste so recht, was sie sagen sollte. Wann aufhören. Wann den Hörer zurück auf die Gabel legen. Ich beobachtete, wie die Blätter der Bäume hinter dem Fenster im Wind zitterten. Ein wenig zitterte ich mit.
Früher, da war alles einfach gewesen. Man hatte mit Puppen gespielt. Mit den Puppen hatten sich Leben erzählen, hatte es sich träumen lassen. Früher hatte ich oft Freundinnen zum Puppenspielen eingeladen. Am Telefon hatte ich damals eine Taktik gehabt: Ich hatte so lange geschwiegen und gewartet, bis die andere aufgelegt hatte. Da war ich sicher gewesen, dass ich das Richtige getan hatte. Aber Johanna tat dasselbe. Sie wartete auch darauf, dass ich den Hörer auf die Gabel legte. Ich war ratlos. Ich hörte ihren raschen Atem. Wir waren beide aufgeregt, irritiert. Johanna sprach so schön, ihre hochdeutschen Ausdrücke waren mir fremd. Miteinander zu spielen, wäre leicht gewesen, der Freundin die Puppe leihen, mit ihr auf Bäume klettern. Aber wir waren aus dem Alter herausgewachsen. Mit den Puppen hatte man Sehnsucht spielen können, und dabei die Eltern ersetzt. Sie hatten komisch gerochen und ihre Wimpernlitzen klappten zu, wenn man sie nach hinten kippte. Ich mochte Puppen. Sie konnten nicht weglaufen. So wie meine Mutter. Diese kleinen Frauen hatten sich umziehen dürfen bei meinen Spielen, hatten nicht von allein stehen können. Ich hatte ihnen die Haare gestutzt, oder sie verfilzen lassen. Aber diese Zeiten waren jetzt vorbei. Ich war in einem Alter, wo man nicht mehr spielte und noch nicht wusste, was man stattdessen eigentlich tun sollte. Mit Johanna wurde ich mir dieser Tatsache das erste Mal bewusst.
Die Erwachsenen begreifen nicht, wie das ist, wenn man erwachsen wird. Obwohl es jeder einmal erlebt hat. So begannen meine Sommer allein. Früher waren sie getaktet gewesen durch das Spiel mit der Mutter. Durch flatternde Kleider, die um die Beine wehten, mich streichelten, sich zart und gleichzeitig aufregend anfühlten. Aufregend wie das Kitzeln des Grases unter den Sohlen, aufregend wie die Blase der Schweine, die ihnen entnommen wurde beim Sauschlachten, und mit der man dann, während man das Fleisch auf dem Feuer grillte, Ball spielte. Spielen, das war es, was ich früher getan hatte. Ich war der Mutter hinterhergelaufen, während ich eine riesige Puppe aus Stroh mit mir schleppte. Die Mutter spielte damals noch ein konventionelles Hausmütterchen, mit einem Tuch um den Kopf, wie alle Frauen im Dorf. Auch dieses Dorf war für mich als Kind riesig gewesen.
Zum Brunnen vor der Kirche hatte es mich oft gezogen, und das glich einer Weltreise. Der Feldweg lang und gefährlich. Die Beine musste man einziehen, wenn Schlangen des Weges krochen. An den Rand flüchten, sobald einer der Bauern mit einem Leiterwagen vorbeifuhr. Oder einer der Traktoren, deren Auspuffe laut ratterten. Im Sommer zierten schneckenartig zusammengerollte Ballen aus Laub die Straße, die aussahen wie kleine Nussschnecken, die ich nur ein paar Mal im Jahr zu essen bekam. Meine Füße liefen, strauchelten damals zum Brunnen, der auf dem großen Dorfplatz stand. Ich suchte ihn und blickte in seinen Schlund hinab. Tief und groß erschien er mir.
»Das macht man nicht!«, rief damals meine Mutter. »Allein weglaufen. Am Ende findest du nicht mehr nach Hause zurück!«
Von da an hatte ich immer Angst vor dem Brunnen. Und noch mehr, als ich das Lied »Zwei Königskinder« zum ersten Mal hörte. Ich erinnere mich noch ganz genau: Der grüne Teppich. Meine kleinen Füße. Die großen Hände der Mutter und eine Musikkassette. Alles war sehr klar und einfach damals.
»Was ist mit denen?«, habe ich gefragt.
»Die ertrinken«, war die rasche Antwort, sie kam ein wenig rau.
»Warum?«
»Sie lieben sich«, murmelte meine Mutter, die bereits auf dem Weg zur Arbeit war und eigentlich nicht mit mir reden wollte.
»Aha.«
Von da an hörte ich die Kassette mit dem Lied »Zwei Königskinder« oft. Ich wurde süchtig nach den Klängen, drückte wiederholt auf Play, bis die Kassette eierte. Aber es half nichts. Je älter ich wurde, desto größer wurde die Angst. Als meine Mutter uns verließ, hatte sie ihren Höhepunkt erreicht. Aber zum Glück begegnete mir da Johanna.
Meinem Vater gefiel es, dass ich endlich ein wenig Anschluss gefunden hatte. Noch dazu bei einem Mädchen, dessen Eltern reich und religiös waren. Johanna ging brav zur Kirche, und so war auch ich motivierter, sie gemeinsam mit ihr zu besuchen.
»Gott ist für die Dummen und die Schwachen«, hatte meine Mutter einmal gesagt.
Vielleicht stimmte das ja. Aber es gab kaum Alternativen. Die meisten Mädchen waren ausgebucht mit Dorfschule, Klavierkursen und Jungscharunterricht, und zu den wenigen Jungs von nebenan, die abends immer am Spielplatz abhingen, durfte ich nicht gehen. Das verbot mein Vater. Auch wenn er abends meist schweigend in der Küche saß und trank und nicht so recht wusste, was er mit mir reden sollte, nahm er doch wahr, ob ich mich in meinem Zimmer befand oder nicht.
Die Höhepunkte in Johannas und meinem Leben lagen in den gemeinsamen Konzerten, in die mich Johannas Eltern alle paar Wochen mitnahmen. Für mich waren diese eine neue Welt. Die Stadt war laut und rauschte, und die Kristallluster funkelten in allen Farben. An einem dieser Abende muss es passiert sein. Wir saßen im Saal, die Luster glitzerten, Menschen husteten. Meine seidige Strumpfhose pickte an meinen Schenkeln fest. Ich wischte ständig meine Hände in dem Programmheft ab, sodass es sich nach und nach vollsog mit meinem Schweiß.
»Ich liebe Mozart«, schwärmte Johanna, und eine Locke fiel ihr über die linke Augenbraue. Ich betrachtete hingebungsvoll ihre Schulterblätter, dann den Eckzahn. Arbeitete mich langsam vor zu ihren Augen, die hinter Brillengläsern verborgen waren und versuchte, ihre Farbe zu bestimmen. Johannas Augen änderten sich mit ihrer Laune. Jetzt waren sie grün. War grün gut? Ich wusste es nicht. Ich holte tief Luft. Die Finger des Pianisten drückten sich wieder in die Tasten hinein.
»Du bist meine beste Freundin«, flüsterte ich.
Johannas kleiner voller Mund formte sich zu einem Lächeln.
»Was?«
»Du bist meine beste Freundin«, rief ich.
Die Frau vor uns drehte sich um.
»Psst. Jetzt kommt der dritte Satz.«
Johannas Augen strahlten.
»Du meine auch«, sagte sie.
Mir stockte für einen Moment der Atem.
»Und ich dachte, das wär’ die Birgit.«
»Nein, ist sie nicht. Sie wohnt nur in unserer Nähe«, sagte Johanna.
Oft hatte ich Johanna gemeinsam mit diesem Mädchen, das in meine Klasse ging und »ein Krüppel« war, gesehen. Im Dorf verhielt man sich ihr gegenüber zwiespältig; die einen waren besonders nett zu Birgit, die anderen betrachteten sie als minderwertige Existenz.
»Und ihre Eltern sind oft bei uns«, ereiferte sich Johanna, »nichts weiter.«
Wieder drehte sich die Frau um.
»Könnt ihr nicht schweigen, ihr Rotzgören«, sagte sie. Ihre Unterlippe bebte.
»Ja«.
Ich lächelte die Frau selig an.
»Ja, Sie haben Recht.«
Mit einem Mal war alles leicht, die Gefühle machten Hüpfer in meinem Bauch, denn Johanna hatte mir ihre Freundschaft gestanden. Ich lächelte selig. Dann musste ich an Birgit denken. Fast tat sie mir leid. Sie war klein und pickelig. Johanna hingegen groß und schlank. Ich betrachtete sie wieder, von der Seite. Ihre Haut schimmerte seidig. Sie schien leicht sonnengebräunt und war von nougatfarbenem Glanz. Johannas Beine waren lang, die Fesseln schmal. Und aus der Zahnspange würde sie herauswachsen, dachte ich. Mir gefiel ihr großer und graziler Körper. Ich hingegen war kleingewachsen, das Becken breit, meine Haut hell. Edle Blässe, hatte meine Mutter früher manchmal gesagt. Aber in einem Bauerndorf wird edle Blässe nicht so gern gesehen. Nach dem Konzert, in dem wir beste Freundinnen geworden waren, durfte ich noch mit zu Familie Hauslinger. Wir aßen Torte und ich sah das erste Mal Johannas Zimmer. Es war keine drei Meter breit. Zwei Betten standen nebeneinander, mit blauen schlichten Überzügen bedeckt.
»Wo schläfst du?«, fragte ich Johanna.
»Links.«
Rechts lag offenbar ihre Schwester Emilia. Das Zimmer war wirklich sehr eng. Warum es in einem so großen Haus nicht mehr Platz für die Mädchen gab, verstand ich nicht ganz. Ich setzte mich zu Johanna an die Bettkante und lächelte sie verlegen an. Es begann zu dämmern, und wir redeten und redeten.
»Wartet daheim niemand auf dich?«, fragte Johanna.
Ich zuckte mit den Achseln.
»Mein Vater arbeitet immer bis acht Uhr auf dem Hof«, murmelte ich. »Er ist ja Bauer.«
Mehr wollte ich über meine Eltern nicht sagen. Es passte nicht in diese Blase, in der Johanna und ich wohnten, wenn wir allein waren.
Johanna verdrehte die Augen.
»Meiner ist Statistiker«, entgegnete sie. »Trockene Mathematik. Da sind mir die Bauern schon lieber!«
Ich lächelte verlegen.
»Hast du Lust, den Tanz auszuprobieren, den wir im Chor gelernt haben?«, fragte Johanna plötzlich.
Ich nickte. Zögernd griff ich nach ihrer Hand, die sie kalt, aber zart in meiner Hand ablegte. Eine Hand aus Glas, dachte ich. Eine Hand ohne Kontur. Johanna knipste mit einem Finger den Rekorder an und begann sich zu bewegen.
Sie war dünn, aber wenn sie ihr Becken rotieren ließ, hatte sie Feuer. Ich holperte, mit Johanna im Arm. Ich schwitzte in ihre Finger hinein. Sie roch gut, das Haar, ihren Kopf wie einen Helm umschließend, wehte an ihren Schläfen hin und her. Sie könnte ein Prinz sein, in ihrem leichten, hochgeschlossenen Hemd, dachte ich. Auf einmal drang ein Kichern von der Tür zu uns herein. Es war Emilia, Johannas Schwester. Sie zeigte blitzend weiße Zähne.
»Was macht ihr denn da?«
»Walzer tanzen!«, rief Johanna laut, »wie wir im Elmayer!«
Später erfuhr ich, dass der Elmayer eine Tanzschule in der Stadt war, die Emilia und Johanna, Mädchen der gehobenen Gesellschaftsschicht, die sie waren, besuchten.
»Das machen aber Männer mit Frauen!«, entgegnete Emilia.
»Die ist nur neidisch«, flüsterte Johanna in mein Haar.
Ich fing ein wenig Atem von ihr mit meinem Mund auf.
»Ja«, sagte ich.
Nachts konnte ich vor Freude nicht einschlafen.
In den nächsten Tagen rief ich Johanna öfter an als zuvor. Am Telefon war Johanna immer noch manchmal sehr still. Wir schwiegen beide. Eine Mischung aus Unsicherheit und Begeisterung.
Johannas Vater mochte mich offenbar nicht. War es, weil wir im Konzert getuschelt hatten? Jedenfalls durfte ich nicht oft zu den Hauslingers kommen. Manchmal fuhr ich vorgeblich zufällig mit dem Rad an Johannas Haus vorbei und klopfte gegen das Milchglasfenster der Haustüre. Meist öffnete dann die Mutter, eine kleine, dauergewellte Frau mit biederem Händedruck und Falten der Trauer um den laschen Mund.
»Johanna«, rief sie, und es klang nicht wahnsinnig freundlich. Aber Johanna lief sofort aus ihrem Zimmer und blieb dann lange an der Treppe stehen, sprach stundenlang mit mir. Keiner bat mich herein. Für Johannas Eltern war die Familie das Wichtigste, hatte Johanna einmal gesagt. Und dann kam der liebe Gott. So vergingen die Tage, und ich tat, was man in einem Dorf als pubertierender Mensch eben tut: Ich überlebte.
Ich liebte die Natur, liebte den Wind. Ich trank ihn förmlich, wenn er meine Lippen streifte. Süßlich weiß war er, besonders im Sommer, wenn die Steppe hinter dem Haus nur so von Insekten flatterte und flirrte. Ein Bild jagte das andere, die Welt stürzte in mich hinein. Seit meine Mutter weg war, hatte ich große Angst. Vor flüchtigen Schatten der Bäume, die sich im Wind wiegten, zerrann die Welt. Leer war die Landschaft hinter dem Haus, nur Ebene und Boden, von dem Rauch aufstieg. Allein der Sonnenaufgang machte sie manchmal noch bunt, überzog sie mit einer orangenen und vor Schönheit ganz fremden Glut. Dann trank ich die Luft. Und hoffte, alles würde irgendwann wieder gut werden. Denn die Luft war ja bereits gut. Voll war sie, erfüllt von sich selbst. Der Tag war lang, die Stunden des Sommers bröckelten nur so dahin in der Hitze. Nichts geschah, außer dass mein Vater abends mit schwieligen Händen vom Feld kam. Am nächsten Tag würde er wieder arbeiten müssen.
In der Schule war das Schlimmste der Schwimmunterricht, den wir zu Beginn des Sommers besuchen mussten. Die gackernden Mädchen, die ihren Vorbau spazieren trugen, zur Schau trugen. Sie hatten hübsche Badeanzüge an, die sich im Nacken zuschnüren ließen, oder auch im Rücken mit einem Clip verschließbar waren. Ich trug immer einen schwarzweißen Badeanzug, der an den Beinen ein wenig länger war, sodass er nicht in mein Gesäß rutschen konnte. Ein Muster von Gänseblümchen bedeckte ihn. Ich war eine wandelnde Wiese. Nur leider ohne Brüste, die wollten einfach nicht richtig wachsen.
»Dein Badeanzug ist aber nicht sehr schick«, rief ein Mädchen mir nach.
»Du siehst aus wie ein Bub«, sagte ein anderes.
»Na und?«
Eine bessere Antwort fiel mir leider nicht ein. Aber zum Glück war ich lernfähig und stopfte mir beim nächsten Mal, als wir schwimmen gingen, meine Brüste mit Kleiderfetzen aus. Aber auch das schien nicht zu helfen. Denn meine Mitschülerinnen sahen mir dabei zu, als ich die weißen Lappen aus meinem Anzug schälte. Man lachte mich aus, als ich meinen Oberkörper entblößte.
»Und, hast du dich ausgestopft?«
»Das ist ja peinlich.«