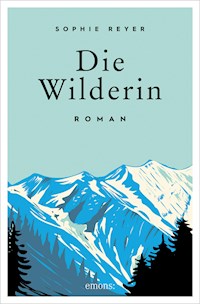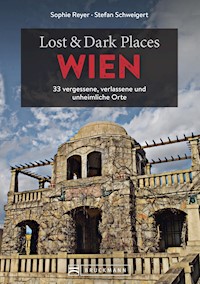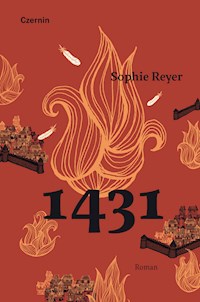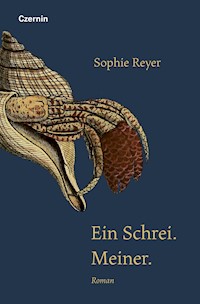
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andrea fühlt sich zunehmend fremd in ihrem eigenen Körper. Sie ist depressiv und hat Halluzinationen, ausgelöst durch ein Trauma in ihrer Kindheit. In ihrer Therapeutin findet sie zunächst eine Rettung, doch ihre Wahnvorstellungen nehmen sie immer mehr gefangen. Sophie Reyer lotet in ihrem neuen Roman auf äußerst feinfühlige und poetische Art die Grenzen der Psyche aus. Ist sie noch ein Mensch? Diese Frage stellt sich Andrea immer öfter. Die Narbe an ihrem Bauch, die von einer Blinddarmoperation geblieben ist, wird zur Schnittstelle zwischen realem Leben und Maschine. Schließlich wird Andrea zu einer Gefahr, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihren Verlobten Sascha. Linda Maier, Andreas Psychiaterin, kämpft ihrerseits mit einer schweren Vergangenheit. Für beide Frauen beginnt die Suche nach der Realität und auch nach Freiheit. Sophie Reyer ist ein außergewöhnlicher Roman gelungen, über die Suche nach sich selbst und über zwei Frauen, die versuchen, ihre psychischen Krankheiten zu überwinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sophie Reyer
EIN SCHREI. MEINER.
Roman
Sophie Reyer
EIN SCHREI. MEINER.
Roman
Czernin Verlag, Wien
Alle handelnden Personen sind frei erfunden.
Reyer, Sophie: Ein Schrei. Meiner. / Sophie Reyer
Wien: Czernin Verlag 2022
ISBN: 978-3-7076-0774-1
© 2022 Czernin Verlags GmbH, Wien
Lektorat: Evelyn Bubich
Autorinnenfoto: Konstantin Reyer
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
ISBN Print: 978-3-7076-0774-1
ISBN E-Book: 978-3-7076-0775-8
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
»Die einzige Bindung besteht darin,
dass du dich selbst als etwas anderes siehst.«
(MAHABHARATA)
INHALT
PROLOG
GEBURT
THERAPIE
BEGINNEN
ANFANG
SCHMERZ
ENTDECKUNG
LERNEN
MISSBRAUCH
SCHLAMMMONSTER
GELÄHMT
GROSSMUTTER
VOR GERICHT
BACKEN
DAS LEBEN DANACH
BÜCHER
VERWIRRUNG
PILLEN
RECHERCHE
FRAGEN
ENTDECKUNG
TROST
LINDAS GEHEIMNIS
NOCH MEHR FRAGEN
EVAS HUNGER
ZWEI GROSSMÜTTER
ELEKTROSCHOCKS
HÖHEN
NOCH MEHR FRAGEN
SCHREIBEN UND SCHEITERN
DAS ANDERE ICH
ANNA
TÖTEN
TEILUNG
ZURÜCK ZU SASCHA
ABSCHIEDE
ABSCHIEDE
ZUSAMMENBRUCH
ZUSAMMENBRUCH
DIE KLINIK
BEKENNTNISSE
DIE ÄRZTIN
VERSUCHE
BEKENNTNISSE
ENDE, ERDE
EPILOG
PROLOG
Am Anfang ist Erde. Das ist eine Welt aus Dichtigkeit, in die ich hineingeboren werde. Eine Welt der Armut. Das Brennen, am Leben zu sein, ist fürchterlich. Die Tränen strömen: Ich bin. Wie Rauchsäulen steigt Gas in mir auf. Es sind meine Augen, die da sehen. Schummrig, verhangen vom Schleier, der durch das Weinen entsteht. Dann Hände, Mutter, schummrige Welt zwischen dem Blick. Ich liege zwischen Fingern wie ein Kranker in Zwangsjacke. Über meinem Kopf schweben Stimmen, die an alte Filme oder Regentropfen erinnern: ein Flimmern. Das ist das erste Bild, das ich von mir in meinem Leben habe. Zu Beginn tut es weh.
GEBURT
LINDA
Wer weiß schon, wie alles anfängt? Eines ist sicher: In ein paar Wochen werde ich auf die Welt kommen. Ich bin noch nicht geboren. Aber mit meinem ersten Gefühl erschließe ich den Kosmos. Ich sehe meine Hand vor meinen Augen, werde mir meiner bewusst. Ja, ich habe Hände. Ich habe Hände. Das hat mit Begreifen zu tun. Ich begreife die Welt. In meinem Beginnen.
Am Anfang: ein Schrei. Meiner. Ich entdecke, dass ich eine Stimme habe. Noch ist sie mir fremd. Gleich fremd und nahe wie alles, was mich umgibt.
»Ein Mädchen«, sagt eine Stimme.
Ich verstehe den Sinn, der mit ihr mitschwingt.
»Ein Mädchen.«
Ich begreife, dass sie mich meinen, kann mir aber nicht erklären, was genau das ist: dieses Ich. Ich weiß nur, das Licht ist grell, die Wärme verschwunden, und die Mutter weit weg. Einen Meter weit weg. Das ist enorm viel, wenn man so klein ist. Ich schreie. Ein zweites Mal. Diesmal bewusst. Ich werde auf Mutters Brust gelegt.
»Danke«, höre ich eine Stimme flüstern.
Zum ersten Mal. Es ist die Stimme meiner Mutter.
»Linda«, sagt sie, während sie meinen Kopf berührt. Ihre Hand über meinem Haupt zu einer Schale geformt.
»Linda!«
Ihre Brust nimmt mich auf. Mein Atem wird ruhiger, langsam. Jetzt bin ich eins, eins mit der Mutter. Alles scheint gut. Auch das Licht stört nicht, das scharf an meinen geschlossenen Lidern schneidet.
»Linda, mein Kind!«
Ich seufze.
So ist mein Beginn: Ich bin überall, durchdringe alles. Ich kenne keine Befriedigung, weil ich nichts brauche. Der Beginn hat mich angestrengt, und auch das Schreien. Müde schlafe ich ein.
In den ersten Monaten: riechen, hören und tasten. Schnell begreife ich, dass ich ohne die Mutter nichts kann außer atmen. Aber es ist noch schlimmer: Ich spüre auch ihren Schmerz, ihre Angst, und wenn sie mich an die Brust hält, denke ich manchmal, sie wäre ein Monster, das mich verschlingen will. Dann wieder ist ihre Brust süß und ich liebe, wie sie mich wiegt. Wie der Brustkorb sich in Wellen hebt und senkt. Die Mutter ist Nahrung und Angst für mich. Sie ist jene, die Schlaflieder singt, jene, die mich beruhigen kann. Die Mutter ist ein Ozean aus Milch. Sie küsst mich, lächelt.
»Mein Kind«, sagt sie immer wieder.
»Mein Kind!«
Und dann sagt sie meinen Namen, auf den ich höre. Nicht, weil ich die Wörter verstehe, sondern weil ihr Sinn mich erreicht, mich erreicht wie alles, was von der Mutter kommt:
»Linda!«
Mit der Zeit wird das schummrige Helle, das durch meine geschlossenen Lider dringt, klarer. Ich beginne, Umrisse wahrzunehmen. Konturen. Ich sehe, dass die Welt nicht nur grell ist, sondern auch kantig. Scharf. Und je mehr ich mich anstrenge, desto schärfer wird sie. Ich will mich dagegen wehren, strecke meine Hände aus, balle sie zu Fäusten. Und begreife erst jetzt: Diese rosafarbenen Dinger, sie gehören zu mir. Aber ist das wirklich wahr? Das soll ich sein? Diese Hand, die verschwommen vor meinen Augen auftaucht? Ich kann das Wort »ich« noch nicht mit meinem Selbst verknüpfen. Linda. Ich. Alles kommt mir fremd vor. Ineinander verwoben und doch voneinander getrennt. Es ist nicht leicht. Ich beginne zu weinen. Zum Glück weiß meine Mutter, was zu tun ist. Sie nimmt mich wieder an die Brust. Sie fängt an zu singen:
»Heile, heile Gänschen. Ist schon wieder gut.«
Mein Weinen ist jetzt nicht mehr so stark.
Sie singt weiter: »Linda hat ein Wehwehchen, hab nur wieder Mut.«
Ich atme nun regelmäßiger. Bin blau, ganz Auge, starre sie an. Spüre, wie meine Knie aneinander reiben, einander noch fremd. Ich würde mich selbst gern besser kennen. Das Lied macht mich neugierig. Ich lausche der Mutter.
Sie singt: »Heile, heile, Hopsasa. Tritschi, tratschi, trallala!«
Ihre Stimme zittert. Sie küsst mich auf die Stirn. Auch wenn ich den Sinn des Liedes nicht begreife, werde ich ruhiger. So begegnen mir zum ersten Mal die Wörter. In Form eines Liedes, einer Wiege, einer Beruhigung. Die Wörter schützen mich, auch wenn ich das, was sie meinen, nur fühlen und nicht denken kann. Ich werde neugierig auf die Wörter. Ich höre auf zu weinen und lausche. Ich lächle. Und das gefällt der Mutter. Noch bin ich wie eine Schmelzvorrichtung. Wenn ich jemanden anlächle, werden die Augen der andern zu Wachs. Gut und hell. Das beruhigt mich. Ich sehe meine Schönheit gespiegelt in ihnen. Irgendwann schlafe ich ein.
Nun beginnen die Wörter auch aus mir zu kommen. Ich begreife, sie sind abhängig von den Lippen, dem Gaumen, der Zunge. Ich habe nämlich nicht nur einen Schrei, Hände und einen Namen, ich habe auch einen Mund und all diese Werkzeuge darin. Mit ihnen werden die Wörter geformt. Das ist der Beginn. Jetzt tun die Ecken nicht mehr ganz so weh, und mit der lauten Welt kann ich umgehen, weil es dafür auch das Singen der Mutter gibt. Die Wörter sind besonders. Sie bezeichnen etwas. Dennoch begreifen sie nichts. Auch ich begreife nichts, aber die Welt beginnt, mich zu reizen. Ich beginne langsam, alles zu entdecken: meine speckigen Beinchen, meinen Nabel, meine Fingernägel. Ich spiele mit ihnen. Ja, ich füttere sie sogar! Dennoch sind sie mir fremd. Genauso fremd wie die Mutter manchmal. Wie den Körper als den eigenen erkennen? Ich bestehe aus Kopf, Füßen, Händen, aber all das bin doch nicht ich. Welcher Teil soll ich sein? Am ehesten bin ich die Mutter, obwohl sie außerhalb von mir ist. Die Mutter, ja. Mit ihr fängt das Leben an. Und auch der Wahnsinn.
THERAPIE
ANDREA
Es ist ein heller Tag, als ich die Praxis betrete. Hell, freundlich, und ein bisschen unscheinbar. Dennoch bin ich irgendwie beklommen. Mein Herz klopft, meine Zunge liegt mir schwer im Hals. Fast so wie bei einer Geburt fühlt es sich an. Ich bin mir selbst auf eine komische Art und Weise fremd. Hätte Sascha mich nicht gedrängt, wäre ich nicht hierhergekommen. Denn im Grunde ist mein Leben wunderbar. Ich habe einen fixen Job in einem Architekturbüro, an dem das Einzige, was mich stört, die Tatsache ist, dass ich zu viel Zeit vor dem Rechner verbringe. Davon kriege ich Verspannungen in den Schultern. Ich habe einen wunderbaren Mann, den ich bald schon heiraten werde. Sascha. Wieder hole ich tief Luft und atme schwer. Mein Mann ist auch der Grund, warum ich jetzt hier stehe, die Finger um meinen Daumen rolle und ein wenig unsicher hin und her stakse. Ich betrachte die Frau, die mich eben eingelassen hat. Friedlich wirkt sie. Sie ist weder groß noch klein, um die Vierzig, und hat ein kleines Bäuchlein, das über den schwarzen Hosenrock lappt. Sympathisch. Ihre Haut ist von einem rosigen Schimmer, um die Augenwinkel erkenne ich ein paar Fältchen, die in mir Zuversicht erwecken. Das Haar trägt sie kurz und wasserstoffblond. Am Ansatz sind bereits einzelne graue Strähnen zu erkennen. Sie bittet mich auf einen Stuhl und lächelt mich an. Ich setze mich und sehe weiter in das Gesicht, das vor mir liegt wie eine Landschaft, offen und hell. Verbaut nur durch eine eckige und recht intellektuell wirkende Brille.
Die Therapeutin Linda Maier nimmt die Brille ab. Sie legt sie sorgfältig auf den Tisch und reibt sich kurz die Augen. Dann sieht sie mich mit einem Blick an, der alles durchdringt. Ein Röntgenblick. Sie zieht eine Augenbraue in die Höhe und schiebt mir einen Bogen zu.
»Bitte füllen Sie das hier aus«, meint sie freundlich. »Für die Krankenkasse!«
Ich nicke erleichtert. Papierkram, darin bin ich gut. Ich kann wunderbar mit Daten und Zahlen umgehen, habe ein fotografisches Gedächtnis, merke mir alle Wege. Manchmal scheint mir, ich würde Strukturen in einer Landschaft mehr lieben als Menschen. So geht es mir auch mit Zahlen und Buchstaben. Sascha ist da freilich eine Ausnahme. Ich nehme den Stift in die Hand. Beim Ausfüllen der Adresse stocke ich.
»Ist etwas unklar?«, will Linda Maier wissen und zieht erneut ihre scharf gezeichnete Braue hoch. Ich lächle, unsicher, nach innen gerichtet. Sie lächelt zurück, ihr Lächeln hat ein wenig mit Glück zu tun. Ich schüttle den Kopf.
»Nein, ich habe nur überlegt, dass ich ja bald schon umziehe!«
Linda Maier lächelt.
»Ist das der Grund, warum Sie hier sind?«
Rasch lasse ich meinen Blick sinken. Gesichter machen mir Angst, wenn ich sie zu lange ansehe. Ich schreibe, drücke ein wenig fester auf als notwendig. Der Stift kratzt am Papier.
»Ja … und nein«, murmle ich.
Die Therapeutin lächelt, streift sich das helle Haar, das im Licht der Sonne nun fast golden wirkt, hinter die Ohrläppchen, räuspert sich und richtet sich dann gerade auf.
»Warum wollen Sie denn eine Therapie machen?«, will sie nach einem kurzen Moment des Schweigens wissen.
Ich seufze, hole tief Luft.
»Mein Freund liegt mir seit Jahren in den Ohren …«, antworte ich. »Und da wir bald heiraten werden …«
Um die Mundwinkel der Therapeutin kräuselt sich ein sanftes Lächeln, das sehr echt wirkt.
»Also Fremdbestimmtheit?«, fragt sie.
Beschämt blicke ich auf meine Fingernägel, ihr Blick kommt ein wenig näher, als es sich gesund anfühlt.
»Nicht ganz«, murmle ich.
»Gut so, das spricht für die gemeinsame Arbeit.«
Die Therapeutin fährt sich durchs Haar. Ihre pink lackierten Fingernägel fallen mir auf. Sie geben der angespannten Situation ein wenig Luft. Ich bin Architektin. Ich liebe Farben, Formen, ich liebe Verspieltes.
»Ich falle in letzter Zeit immer wieder um«, erkläre ich dann wahrheitsgemäß. »Und dann bin ich irgendwie … doppelt.«
Fragend zieht Linda Maier wieder eine Augenbraue nach oben.
»Doppelt?«
»Nun«, versuche ich es weiter und nehme dabei die Hände zur Hilfe, »es ist dann so, als würde ich mich teilen und mich gleichzeitig von außen ansehen.«
»Verstehe«, sagt Linda Maier.
Sie beugt sich nach vorn, stützt ihre Hand auf, legt das Kinn hinein. Sie scheint zu überlegen.
»Haben Sie eine Vermutung, was die Ohnmacht ausgelöst hat?«, will sie dann vorsichtig wissen.
Betreten sehe ich wieder auf meine Fingernägel. Faszinierend, so ein Daumen, wenn man unsicher ist und sich scheu fühlt. Ich nicke, ohne die Therapeutin anzusehen.
»Möchten Sie es mir mitteilen?«, fragt sie.
Ich seufze auf, fahre mir durchs Haar. Womit beginnen? Mit den vielen Stunden vorm Computer? Mit der Tatsache, dass mich, nachdem ich meinen achtstündigen Arbeitstag beendet habe, auf dem Nachhauseweg oft das Gefühl überkommt, ich müsste Zebrastreifen mit der Maus langziehen? So, als wären sie Balken in meinem Grafik-Programm. Oder damit, dass ich Gesichter manchmal mit Bildschirmen verwechsle? Dass ich mein neues Buch nicht finde und googeln möchte, wo ich es hingelegt habe?
»Ich bin vollkommen überarbeitet«, murmle ich schließlich.
Linda Maier nickt.
»Was machen Sie beruflich?«, will sie wissen.
»Ich arbeite in einem Architekturbüro«, erkläre ich, »und sitze oft zehn Stunden am Stück am Laptop.«
Über die Gesichtszüge der Therapeutin flattert eine sanfte, mütterliche Regung.
»Das ist sicherlich sehr belastend. Wie lange sind Sie schon auf dem Gebiet tätig?«
Ich weiche aus.
»Nein. Eigentlich liebe ich meinen Job. Ich bin ja schon seit über zehn Jahren Architektin!«, erkläre ich rasch. Wieder sehe ich die Therapeutin an. Ihr Ausdruck bleibt verständnisvoll.
»Was hat zu Ihrer akuten Überarbeitung geführt?«, will sie sanft wissen.
Ich lausche ihrer Stimme, die tönend klingt, wie der Wind, der durch die Blätter der Bäume fährt. Ich überlege.
»Sie ist nicht akut, sie ist chronisch, meine Überarbeitung«, sage ich dann.
Die nächste Frage kommt schnell, scharf und weniger sanft.
»Woran liegt das?«, fragt die Therapeutin.
Ich denke an Sascha. Daran, wie wunderbar er riecht, wie hell sein Lachen ist, daran, dass er einfach perfekt ist. Mir fällt kein Grund außerhalb von mir selbst ein.
»An mir«, sage ich schließlich.
Da lächelt die Therapeutin wieder und ihre Augen bekommen einen Glanz, der etwas Füchsisches hat. Ich komme mir vor, als hätte man mich dabei erwischt, wie ich nach versteckten Weihnachtsgeschenken suche.
»Das heißt, Sie könnten den Zustand ändern, wollen es aber nicht«, meint sie.
Ich schlucke. Betrachte wieder meine Hände.
»Na ja, wollen …«, murmle ich.
Stille.
»Erzählen Sie mehr von Ihrer Arbeit!«
Also berichte ich vom Grafik-Programm, von Maßstäben, Mausklicks und Balken.
»Sie leuchten ja richtig!«
Ich lache.
»Ich liebe meine Arbeit eben!«
»Das merkt man«, antwortet sie und sieht mich eine Zeitlang schweigend an.
Ich erkenne, dass ihre Augen grün sind. Grün und gut. Sie wirken kristallklar, fast wie ein blank geputzter Spiegel. Ein reiner Spiegel ist auch ihr Gesicht. Ich finde mich wieder in ihm. Lange betrachte ich Linda Maier und entschließe mich, dass ich ihre rötliche, nicht mehr ganz glatte Haut mag.
»Aber zurück zu dem Gefühl, doppelt zu sein«, sagt sie.
Ich nicke.
»Ja?«
»Wie genau ist das?«
Ich überlege, schließe kurz die Augen, um mich genau zu erinnern.
»Ein wenig so, als sähe ich mich selbst von außen. Ich habe dann einen Körper, der wie eine Schale ist, und ich bin daneben und spreche mit ihm.«
Die Therapeutin blickt interessiert auf.
»Sie haben also eine Stimme, wenn sie außerhalb Ihres Körpers sind?«
»Ja … nein … eher das Echo einer Stimme.«
Stille.
»Und was sagt sie?«
Ich schweige. Krame in meinem Kopf nach Bildern.
»Ich erinnere mich nicht«, gebe ich schließlich zu.
Linda Maier nickt und sieht aus dem Fenster. Ich komme mir leer vor, einsam, wie fallen gelassen. Diesmal muss ich nicht mehr auf meine Hände blicken.
»Das klingt komisch, oder?«, frage ich.
Die Therapeutin schüttelt den Kopf.
»Hier gibt es kein komisch«, sagt sie, »wir beobachten nur. Und ich denke, genau das sollten Sie auch tun«, fügt sie hinzu und legt ihre leicht faltigen Hände in den Schoß, sodass ich die pinken Fingernägel nicht mehr sehen kann. Fast bin ich ein bisschen traurig darüber.
»Wie?«
Sie fährt sich erneut durch das helle Haar, das jetzt ein wenig struppig vom Kopf absteht.
»Beobachten Sie, was passiert, wenn Sie das nächste Mal in so einen Zustand geraten!«
Der Ton ihrer Worte ist nun wieder wie das Säuseln von Wind. Er beruhigt mich. Ich nicke.
BEGINNEN
LINDA
In einem einfachen Elternhaus komme ich zur Welt. Die Tage takten sich von Anfang an mühsam. Die Familie ist schon früh von finanziellen Sorgen gebeutelt, sodass man verzichten, zusammenrücken muss. Vielleicht habe ich deswegen immer Durst? Ja, ich liebe es zu trinken. Alles, was trinkt, lebt. Darum macht es Freude, immer wieder Wasser in sich hineinzuschütten. Alles, was lebt, hat Durst.
»Was ist nur mit dem Kind?«, murmelt der Vater besorgt. »Kriegt es denn nicht genug?«
Schon am Anfang werde ich hinterfragt. Dabei will ich doch nur an die Brust der Mutter.
»Was ist nur mit dir?«, will sie immer wieder wissen, wenn ich nach ihr taste.
Ich lächle sie an, das kann ich inzwischen schon, und sie gibt mir ihre Brustwarze. Ich sauge daran, dann lasse ich den Kopf nach hinten gleiten. Glücklich bin ich, jetzt, da ich getrunken habe. Meine Augen bewegen sich fröhlich und lachen.
Die Mutter lächelt zurück. Rund ist ihr Gesicht, eine Art Spiegel. Schön und unheimlich zugleich. Ich kann sie genauso wenig begreifen wie mich selbst.
Bizarr sind die Figuren der Sichtbarkeit. Aber nicht nur die Mutter. Das Wasser zum Beispiel. Gleich ist das Wasser, immer rauscht es. Überall ist Wasser gleich. Es ist eins und es lässt sich trotzdem verteilen. Ich verstehe nicht, was es auf sich hat mit den Dingen. Und warum sie alle etwas heißen: Katze, Heiligenschein, Licht. Das Leben kommt mir überaus seltsam vor.
In den ersten Jahren meines Lebens bin ich oft bei der Großmutter. Sie ist Köchin bei einem Pfarrer. Die Großmutter ist weich und warm. In allen weckt sie Güte. Die Katze, die hinterm Haus umherstreunt, traut sich zu ihr. Sonst beißt, sie, fletscht die Zähne, zeigt Krallen. Sie hat einen kaputten Schwanz. Jemand muss ihr wehgetan haben. Ich weiß nicht, warum die Katze die Großmutter liebt. Aber sie hat recht damit.
Ich krieche auf dem Boden umher, erkunde die Welt, wenn die Großmutter kocht. Es gibt herrliche Teppiche und einen riesigen Nachttopf unter dem Bett des Pfarrers, der mich unglaublich fasziniert. Er ist so groß wie ich und er tönt hohl, wenn man dagegen schlägt. Der Topf ist faszinierend, schon allein, weil er da unten auf dem Boden steht. Denn auf Augenhöhe ist sonst fast niemand mit mir. Die Erwachsenen sind hauptsächlich Füße, die vorbeigehen. Nur die Katze, die sich manchmal krümmt, wenn sie mich sieht, ist auf derselben Ebene. Ich bin neugierig auf sie.
»Zieh bloß nicht die Katze am Schwanz!«, sagt die Großmutter eines Tages.
Und ich, wie herausgefordert durch diese Warnung, tue natürlich genau das. Die Großmutter hatte recht mit ihrem Verbot. Was nun passiert, ist unangenehm. Die Katze faucht, schreit, kratzt mit ihren Krallen über meine helle, speckige Haut. Ein brennender Schmerz. Aber er ist schnell vorbei.
Einmal kann ich beobachten, wie die Großmutter die Katze füttert.
»Mutziputzi!«, ruft sie laut singend.
Schon kommt die Katze dahergetrappelt, ihre Zunge ist entsetzlich rosa, sie leckt sich das Fell und frisst. Als die Katze wieder weg ist, nähere ich mich dem Schälchen. Dann greife ich zu, mit meinen speckigen, mir selbst noch fremden Händen. Ich esse der Katze das Fleisch weg. Die Großmutter sieht das und schreit: »Spuck das aus!«
Ihr Busen bebt dabei und ihre Faltenberge sind grimmig. Was für ein Schrecken! So habe ich sie noch nie erlebt. Meist ist die Großmutter sanft und friedlich und warm wie ein frischgebackener Laib Brot. Ich spucke, schlucke. Es hat nicht schlecht geschmeckt. Aus großen Augen heraus sehe ich die Großmutter an. Was ist denn so schlimm daran, das Fleisch der Katze zu essen? Die Erwachsenen essen doch auch Fleisch. Ich verstehe die Welt nicht. Mir schaudert. Ich kann mich nicht bewegen vor Schock.
»Na steh doch nicht da wie angewurzelt«, ruft die Großmutter in diesem Moment versöhnlich, »geh wieder spielen!«
Die Welt ist komisch. Du handelst, man lässt kein gutes Haar an dir. Du verharrst in der Starre, man nennt dich angewurzelt. Dabei musst du doch erst einmal das alles durchstehen. Das alles. Also dieses Ich. Es ist seltsam. Ich beschließe, keine verbotenen Dinge mehr zu machen, mich unauffällig zu verhalten, damit keiner schreit. Das geht sogar eine Zeitlang gut.
Ich liebe die Mutter, aber bald schon merke ich: Ich muss allein trinken und atmen. Dass die Mutter das nicht für mich erledigen wird, lerne ich früh. Immer scheint die Mutter überfordert mit allem. Sie putzt, sie weint, sie schimpft, sie arbeitet. Dass sie arbeitet, ist aber auch gut so. Dann kann ich die Welt allein entdecken. Die Weite hinterm Haus, der Wald, der am Rande der Stadt liegt. Sie rufen nach mir. So schlüpfe ich in die einfachen Schuhe. Ich wandere und wandere. Alles bewegt sich und lacht mir freundlich zu. Ich halte der Welt die Arme auf. Ich liebe die umherrennenden Leute auf der Straße und den Vanilleduft der Frauen. Immer wieder bleibe ich still und lausche. Alles ist wie Wasser. Vielleicht trinke ich deswegen so gern. Die Dinge bestehen aus Wasser, und ich lerne von ihnen. Zum Beispiel, dass man nicht schneller fließen kann, als man ohnehin fließt, und dass man ankommt. Denn ich komme immer an in der Weite des Waldes. Dort ist es grün und leuchtend. Manchmal bewegt sich Schönes im Vogelgezwitscher. Der Frühling, die Gräser, der Wind, der mit mir im Arm über die Wiesen und durch das Dickicht schwebt. Ich liebe die Tiere des Waldes, und ich betrachte sie alle aufmerksam. Das flink wuselnde Eichhörnchen, die schlauen Ameisen auf ihren Hügeln, die zwitschernden Vögel. Von Anfang an habe ich Tiere lieb. Die Schildkröten bewundere ich besonders. Über die hat nämlich die Großmutter einmal erzählt, dass ihnen weder Wasser noch Feuer etwas anhaben kann, und dass sie rein und beständig sind. Aber im Wald gibt es leider keine Schildkröten zu sehen, bloß im Zoo, und der ist teuer. Doch das ist egal. Auch hier im Wald ist immer etwas los. Ich beobachte die Landschaft. Ich träume, meine Augen sind voller Sterne. Mein Kopf ist eine Wolke und meine Stirn leuchtet. Die Sonne ist eine Göttin. Sie umarmt mich. Alles regt sich auf Erden und die Luft seufzt. Ich erkenne die Dinge des Schweigens und bin eine Königin in der Welt. Eine Zwergin noch, aber ein Zwergenkönigin! Manchmal kommt es mir sogar vor, als wäre ich die Tochter der Sonne! Ich bin ein besonderes Kind! Doch leider fällt das nur mir auf. Und auch mit der Schönheit der Landschaft ist es bald vorbei. Denn ich werde älter.
Immer wieder höre ich, dass Kinder ihre Eltern lieben müssen. Ich versuche es auch. Aber wenn ich bei der Großmutter übernachte, fehlen sie mir gar nicht. Dafür schäme ich mich manchmal richtig. Ich tue aber freilich so, als würde ich sie lieben. Auch ansonsten versuche ich, immer das zu machen, was die Großen auch machen. Trotzdem will ich auf keinen Fall wie sie sein. Sie haben Falten und Sorgen, und sie müssen arbeiten. Keinen Spaß gibt es im Leben der Mutter. Sie schimpft, weil sie morgens aufstehen muss. Sie schimpft, weil sie kochen muss. Sie schimpft, weil es abends kein gescheites Fernsehprogramm gibt. Außerdem haben Erwachsene tiefere Stimmen, kleinere Augen und Haare an den Oberarmen. Das gefällt mir nicht. Und alles, was sie tun, ist von Verboten durchzogen.
Es ist verboten, Schränke zu öffnen, vor allem den Kühlschrank. Darum umgibt ihn ein doppelter Zauber. Ich wage es nicht, ihn zu berühren, aber ich bete ihn an. Wenn die Mutter und der Vater ausgehen, klebt die Mutter Zettel an den Kühlschrank, an die Tür, an das Bett, für die Babysitterin. Sie muss alle Laden wieder schließen und sie muss sehr ordentlich sein. Die Babysitterin ist ordentlich. Sie hat eine dicke Brille und Pickel. Sie will Gitarrenlehrerin werden. Sie wird meine beste Freundin bleiben, bis an mein Lebensende. Aber davon weiß ich jetzt noch nichts.
ANFANG
ANDREA
Als ich eine Woche später wieder bei Linda Maier bin, fühle ich mich schon weniger beklommen. »Ich gehe also zu meiner Babysitterin«, simse ich Sascha, und versuche, ein wenig humorvoll zu klingen. Aber als die Therapeutin die Haustür öffnet, habe ich doch ein wenig Angst.
»Hereinspaziert!«, werde ich von einem lächelnden Gesicht begrüßt.
Mit Freude nehme ich ihre bunten Pulswärmer wahr, die ihrem Auftreten etwas Verspieltes geben. Ich setze mich auf das weiche Sofa, sinke ein wenig ein. Linda Maier lächelt, und um ihre Augen schieben sich kleine Fältchen zusammen.
»Sie sehen müde aus.«
Ich seufze und wische mir über die Augen.
»Ja. Ich hatte einen seltsamen Albtraum«, murmle ich leise und lasse meinen Blick aus dem Fenster gleiten. Wie Segelboote sehen die Wolken am Himmel aus. Linda Maier nickt.
»Wollen Sie versuchen, sich zu erinnern?«, fragt sie nach einem Moment der Stille.
Ich überlege, merke wie meine Augen unruhig werden, wie sie umherhuschen.
»Also, da war ein Haus«, beginne ich in meinem Kopf zu kramen, »und ich habe … eine jüngere Person gesehen … glaube ich, also eine männliche jüngere Person, und ein Kind.«
Pause. Langsam steigen die Bilder vor meinem inneren Auge auf.
»Und ich habe beobachtet, wie der Ältere den Jüngeren … das Kind … irgendwie also …«, ich merke, wie ich ins Stammeln gerate. Das Wort drückt in mir. Es will aber nicht hinaus aus mir: »… vergewaltigt hat …«
Ich schweige kurz. Versuche, mich zu sammeln.
»Das habe ich irgendwie beobachtet … wie der Ältere den Jüngeren vergewaltigt und ihn anschließend ermordet.«
Meine Lider flackern. Ich versuche, mich zu erinnern. Langsam weicht der Schleier von den schattenhaften Bildern, die ich weggeschoben habe. Klar und deutlich steigt der Traum in mir auf.
»Er hat ihn erschlagen«, sage ich und merke, wie mir übel wird.
Ich bemühe mich, nicht aufzustöhnen. Für einen Moment rasselt mein Atem, doch es ist zu spät, wieder den Riegel vor die inneren Bilder zu schieben.
»Und dann hat er ihn …«, sage ich mit einer Stimme, die klirrend klingt und mir selbst fremd ist, »… gegessen!«
Plötzlich muss ich lachen.
»Genau, ich erinnere mich! Er hat ihn zu Brei gekocht«, rufe ich.
Mit einem Mal taucht die Szenerie wieder klar und scharf umrissen vor mir auf.
»Ich hab dann nur diesen blubbernden Kochtopf gesehen. Aber ich hab gewusst: Darin wird ein Mensch gekocht«, sage ich leise.
Für einen Moment schweige ich. Hinter dem Fenster hat das Licht die Wolken zerteilt. Sie sehen jetzt nicht mehr aus wie Segelboote, sie erinnern an Speere, an Messer oder an andere spitze Gegenstände. Ich schweige.
»Das war grauenhaft«, murmle ich.
Linda Maier zieht eine ihrer scharf gezeichneten Augenbrauen in die Höhe.
»Das zu sehen und zu wissen, dass da drin jetzt ein Mensch gekocht wird …?«, fragt sie.
Ich nicke.
»Ja genau … also alles … dass der Mensch vorher missbraucht wurde und dann umgebracht … Das war grauenhaft. Das war furchtbar«, stammle ich.
Linda Maiers Gesicht spiegelt meinen Ausdruck wider, ohne seine verständnisvollen Züge zu verlieren.
»Schrecklich eigentlich …«
»Ja, total schrecklich«, antworte ich.
»Träumen Sie öfter so schreckliche Dinge?«, will Linda Maier wissen.
Ich schüttle den Kopf.
»Nein, noch nie hab ich so etwas Schreckliches geträumt. So was nicht«, sage ich leise und wische mir dann mit der Hand über den Mund, wie um einen schalen Geschmack loszuwerden.
Die Therapeutin sieht mich einfühlsam an, eine helle Haarsträhne fällt über die Stirn. Auch sie berührt kurz ihren Mund und schweigt.
»Mhm.«
Wieder muss ich den Kopf schütteln, weil die Erinnerung an den Traum auftaucht. Die Bilder stechen. Sie tun weh.
Ich versuche, mich an weitere Details zu erinnern:
»Und dann ist der auch noch frei herumgelaufen, der Mörder. Aber komisch, ich hab im Traum nicht gedacht, dass der böse ist. Ich hab sogar gedacht … es war so, als hätte ich es verheimlichen müssen. Also, ich hab alles gewusst … also der Mörder …«
Meine Sprache stockt, der Kehlkopf liegt mir schwer im Hals.
»… war Ihnen irgendwie nahe«, sagt die Therapeutin.
Ich schaue erstaunt auf. Ihr Blick scheint mich zu lesen.
»Genau, der war mir nahe«, erinnere ich mich dann mit Schaudern. »Ich hab niemandem sagen können, was er da verbrochen hat. Das war bedrückend.«
Ich lehne mich zurück. Der Himmel ist wolkenfrei, blau, in mir aber scheint alles dunkel. Linda Maier sieht mich aus grüngrauen Augen an.
»Mhm«, nickt sie. »Und sonst?«
Ich zucke mit den Schultern.
»Das war’s auch schon eigentlich. Aber trotzdem schrecklich«, murmle ich.
»Haben Sie Angst gehabt?«, will die Therapeutin wissen.
Ich spüre dem Traum nach.
»Nein. Keine Angst«, gebe ich zu und wundere mich über mich selbst.
Linda Maier streift ihre Pulswärmer ab und legt sie auf den Tisch. Nachdenklich reibt sie ihre Hände gegeneinander.
»Okay. Also, als Sie das gesehen haben, was ist da passiert? Was haben Sie gedacht?«
Ich versuche, mich zu erinnern, aber mein Kopf kann keine klaren Gedanken fassen.
»Ich kann es nicht sagen. Es war … grauenhaft«, murmle ich.
Linda Maier legt den Kopf in die Schräge, legt kurz ihre Arme um sich.
»Im Wesentlichen grauenhaft. Das ist also das wichtigste Gefühl: dieses Grauen!«
»Ja«, entfährt es mir da etwas lauter, »das Grausame. Und dass man da in was drin ist, was man nicht will. Warum muss ich das sehen, hab ich gedacht. Das will man gar nicht sehen.«
Linda Maier schüttelt bestätigend den Kopf.
»So etwas wollen Sie nicht sehen!«
»Nein«, sage ich.
Die Therapeutin richtet ihren Körper gerade und pustet sich eine Strähne aus dem Gesicht. Etwas Würdevolles liegt in diesem Anblick.
»Sie wollen damit nichts zu tun haben!«
»Genau!«, bestätige ich.
Dann zögere ich und füge leise hinzu:
»Aber ich hab es gesehen. Das macht es irgendwie …«
»… schwer?«, will Linda Maier wissen.
»Ja!«
»Wie einen Rucksack. Man trägt ihn und kann’s niemandem sagen. Oder so ähnlich«, fährt sie fort.
Ich stimme ihr zu. Wie gut sie meine Gefühle versteht.
»Ja, weil man die Person kennt«, sage ich.
Linda Maiers Gesicht wird mit einem Mal riesig.
»Und sie beschützen muss, aus irgendeinem Grund …«, sagt sie.
Da spüre ich, dass mir übel wird. Um wen geht es denn eigentlich?, denke ich. Um sie oder um mich? Bilder aus meiner Kindheit schießen in meinen Kopf. Ich schiebe sie weg.
»Ich also … nein, also ich …«, stottere ich leise und merke, wie ich innerlich brüchig werde.
Die Therapeutin bleibt sanft. Wie eine Sonne steht ihr Gesicht im Raum, leuchtend.
»Es ist zu nahe vielleicht? Nicht? Sie fühlen sich reingezogen.«
Bestätigend nicke ich.
»Es ist zu nahe«, murmle ich.
»Oder? Viel zu nahe!«, wiederholt sie.
In mir bricht etwas auseinander.
»Ja, ganz«, flüstere ich.
»Hautnah!«, ruft die Therapeutin.
Ich versuche, Distanz zu gewinnen.
»Ja, der Topf. Der war nicht weit weg. Höchstens ein paar Meter. Also, im Traum.«
»Ja, natürlich. Im Traum.«
»Und wenn Sie raten müssten: Warum macht der das?«
»Ich … Wie? Ach so, ich bin eigentlich schon woanders …«, murmle ich, während mein Blick wieder aus dem Fenster kippt und mein Inneres mit ihm.
»Wie Sie wollen … sagen Sie!«
»Es ist ja so«, beginne ich und merke, wie meine Stimme gehetzt wirkt, wie ein gejagtes Tier, »dass eine Person im Traum ein Kind ist. Die ältere ist viel stärker.«
»Okay. Also die ältere Person tötet das Kind im Traum?«, will Linda Maier wissen.
»Ja, genau. Damit es keine Beweise gibt«, sage ich mit sehr überzeugter Stimme und wundere mich darüber, wie schnell ich immer noch spreche.
Linda Maier nickt.
»Die Spuren verwischen«, erklärt sie verständnisvoll. »Und damit die andere Person ganz weg ist … also das Kind …«, fährt sie fort und zögert kurz, doch ich bin schneller:
»… kocht sie es. Dass sich das ganz auflöst. Gekocht. Gegessen. Weg!« Mit den Händen wirble ich in der Luft herum.
»Ja, alles weg«, sagt sie. »Im wahrsten Sinne des Wortes: gegessen.«
Jetzt müssen wir beide lachen.
»Wie das Sprichwort, genau. Es bleibt nichts übrig.«
SCHMERZ
LINDA
Was ich in den ersten Jahren gut kennenlerne, das ist der Zorn der Mutter. Ich wittere ihn schon, noch bevor sie schreit. Ich erkenne ihn an der Verengung ihrer Pupillen. Es ist dann so, als wäre sie ein Granitblock. Ich schaue sie in diesem Moment immer an. Wie im Traum. Meistens ist der Reis schuld. Ich habe ihn wieder einmal hinuntergeworfen, anstatt ihn zu essen, damit der blaue Küchenboden ein Feld wird. Reisfeld, das Wort habe ich gehört. Ich denke, dass vielleicht etwas wächst, wenn ich den Reis auf den Boden streue. Eine gute Idee, oder? Die Mutter sieht das anders. Sie ist wütend, sie lodert.
Eines Tages, als ich von einem langen Spaziergang in der Natur heimkomme, ist die Mutter besonders böse.
»Wie kannst du dich nur allein herumtreiben?«, ruft sie und funkelt mich an.
Der Tod ihrer eigenen Mutter, die sich mit Alkohol und Tabletten ins Jenseits befördert hat, er zehrt an meiner Mutter. Die Mutter ist wütend, und ihre Welt ist aus Warten auf den Vater, aus Kopfhängenlassen und aus Schimpfen gebaut. Die Wut meiner Eltern darf nicht meine werden. Ich schweige. Das macht meine Mutter noch wütender. Dann holt sie sogar mit der Hand aus und schlägt zu. Eben noch war ich eine Meistertänzerin – jetzt bin ich aus allen Wolken gefallen.
Für einen Moment schweige ich. Und noch bevor die Zunge sich regen kann, packt meine Mutter mich unsanft am Handgelenk und zerrt mich in mein Zimmer. »Mama!«, rufe ich da und bekomme Angst. Hart ist ihr Griff, und er hat so gar nichts gemein mit den sonst so zarten Berührungen der Mutter, wenn sie mich aufhebt und an ihre warme, pochende Brust presst, die wie die Sonne ist.
»Mama, du tust mir weh!«
Doch die Mutter hat mich längst unsanft auf die Kissen geworfen und dreht sich um. Ich kann es kaum glauben. Da geht sie, geht einfach weg! Sie entwischt wie ein Kolibri und ich eile hinter ihr her, als wäre ich eine Speerspitze. Nach einigen Schritten habe ich sie eingeholt, klammere mich an sie, klammere mich fest an ihrer karierten Schürze, in der Teigreste sich verklebt haben.
»Bleib da, Mama, bitte!«
Die Mutter verdreht die Augen, seufzt.
»Sei doch nicht so anhänglich«, murrt sie, ein wenig sanfter werdend. Dann schiebt sie mich in das Zimmer zurück und schließt die Tür. Ich höre den Schlüssel, wie er sich im Schloss umdreht. Ein bedrohliches Geräusch. Ich weine, aber ich werde nicht gehört. Nach und nach sinkt die Müdigkeit wie eine große Dunkelheit in mich. Dennoch, es dauert, bis ich einschlafen kann.
In dieser Nacht wälze ich mich unruhig umher. Im Traum erscheinen mir Wesen, deren Lichter blenden, und ich weiß nicht, ob sie Sonnen oder Feuer sind. Der Mond schüttet Staub auf mich. Alles ist hellblau. Die Nacht dreht mich um. Wer bin ich? Schrecken im Gesicht. Angst wie Krallen. Mein Bedürfnis ist jetzt das Sterben. Mein einziges. Da kommen hässliche Tiere auf mich zu und flattern girrend um mich herum. Sie haben Spukgesichter und umklammern meine Seele. Ich schreie.
»Ich will nicht!«
Aber keiner hört mich. Die Wesen werden mehr und mehr, ihre Flügel sind dunkel und sie töten die lichtfarbenen Schmetterlinge, die sonst meine Träume bewachen.
»Wir kochen dich in deinem Topf, und dann essen wir dich!«, rufen sie.
»Hilfe!«, schreie ich.
Am nächsten Morgen, als ich mit der Mutter zum Markt gehe, ist die Welt wie verwandelt. Da sehe ich, wie sie wirklich sind: die Erwachsenen. Und ich sehe die ranzigen, stinkigen Straßen. Alles verfault in der Kleinstadt, zwischen hässlichen, verrotteten Menschen stehe ich da und weiß nicht weiter. Lügnerisch sind sie und innerlich schmutzig, diese Menschen, denke ich. Es ist mir, als sähe ich zum ersten Mal. In mir verlöscht der Tag. Freilich, auch feine Damen mit langen Röcken und hochhackigen Schuhen staksen, ihre Schirme gegen den Himmel gerichtet, neben feinen Herren mit samtenen Blicken umher. Aber solche Damen sieht man nicht allzu oft hier. Meist sind es eher einfache, manchmal sogar verkrüppelte Leute.
»Ich will nach Hause, Mama«, murmle ich leise, als eine der Verkäuferinnen von einem Stand ihr eine Birne schenken möchte. Doch sie schüttelt den Kopf.
»Durst«, sage ich leise.
Irritiert blickt die dicke Verkäuferin mich an, lacht dann aber laut auf, sodass ihr Doppelkinn labbert. Sie reicht meiner Mutter ein Glas Wasser, dass diese mit peinlich berührtem Lächeln annimmt. Rasch greife ich nach dem Glas. Ich muss trinken, trinken. Alles, zu dem ich hinaufgesungen habe, ist verschwunden. Jetzt gibt es nur noch das Trinken als letzte Rettung. Dann muss man nicht reden. Ich schütte Wasser in mich hinein, immer wieder, wie um einen großen Schmerz wegzuspülen. Die Mutter greift nach dem Glas, nimmt es mir beschämt weg. Stockend sehe ich sie an. Fieber verbrennt mir den Mund. Plötzlich ist das Leben laut. Mir tut das Ohr weh. Die Meere meiner Träume, die ich vorher immer umsegelt habe, sind jetzt einsam. Alle Sehnsucht ist mit einem Mal aus meinem Kopf geglitten und ins Dunkel geströmt, einfach so. Zitternd sehe ich die Mutter an.
»Du glühst!«, sagt sie, langsam doch besorgt, und bedankt sich bei der Marktfrau. Dann streifen wir rasch nach Hause. Wir gehen durch den Wald. Aber der Wald ist jetzt kein begehbarer Wald mehr. Der Boden wie Teer, die Bäume wurzellos.
»Du Arme«, sagt meine Mutter und streicht mir über die Stirn.
Dann hebt sie mich hoch, trägt mich.
Ich atme. Ich bin glücklich, für einen Moment, denn die Mutter ist wieder lieb zu mir. Die Mutter streichelt mich jetzt und es ist, als würde man eine Blume an meine Brust stecken. Sie darf sich nur nicht entfernen, denke ich, denn dann wäre es, als stieße man einen Dorn in mein Herz. So schlafe ich erschöpft an der Brust der Mutter ein.
Am nächsten Morgen stellt ein Kinderarzt die Diagnose: Meningitis.
In der darauffolgenden Zeit liege ich oft im Bett. Beim Spazierengehen habe ich einen Stein gefunden, den ich jetzt immer wieder betrachte. Ich beatme den Stein, damit er lebendig wird. Weil ich mich allein langweile. Aber alles geht nicht, das lerne ich schnell. Auch die Sterne sind zu hoch oben und ich kann nicht mit ihnen spielen. Ich blicke in den Nachthimmel hinein und es ist, als sähe ich durch einen Schleier, durch Milch. Aufgelöst ist die Ferne, und ich habe gleichzeitig Sehnsucht und Angst vor ihr. Der Vorhang wird ein Segel, und das Fenster ist ein Boot, wie in meinem Kinderbuch. Ich stelle mir vor, dass ich damit umherfahre. Der Wind fängt sich darin, bauscht es auf, und die Bauschung treibt mich ins Weite. Ich betrete mein Boot und fahre darin hinaus. Ins Blau hinein. Weit, weit hinein in den Himmelsraum. Will befreit sein. Da merke ich, dass ich unendlich müde werde, und wende das Gesicht. Alles ist still.
ENTDECKUNG
ANDREA
In Gedanken versunken wende ich Linda Maier das Gesicht zu.
»Er hat es also aus der Wirklichkeit verschwinden lassen, das Kind. Und warum hat er das gemacht? Es umgebracht? Davor?«, fragt sie.
Ich blicke hoch. Mein Blick hat sich im Vorhang vor dem Fenster verloren, der sich im Wind bauscht und an das Segel eines Bootes erinnert. Ich denke kurz nach.
»Aus Spaß, glaube ich«, sage ich dann. Mir schaudert.
»Dieser Täter hat so viel Macht«, sage ich tonlos, »den berührt nichts.«