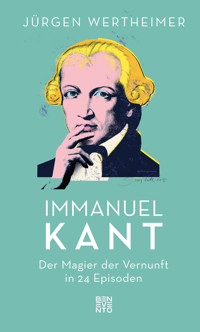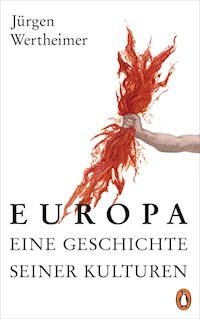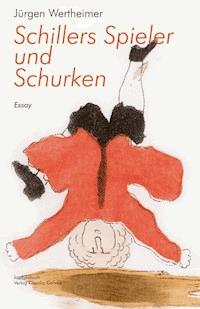
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schillers Figuren werden in diesen Essays gesehen als Spieler und Schurken, und ein neuer Blick auf Schillers Modernität tut sich auf: Jeder pflegt sein eigenes System, in dem der andere Spielfigur ist. Pressestimmen: „.ein bemerkenswerter Essay [.] Nebenbei räumt er mit törichten Schiller-Klischees auf [.] Vieles von dem, was Wertheimer in seinem Buch ausführlich darlegt und erläutert, frappiert auf den ersten Blick, leuchtet bei weiterem Nachdenken ein und vermag durchaus auch zu überzeugen. Zumindest macht er uns mit einer ungewohnten Seite von Schiller vertraut und ermöglicht eine neue Sicht auf den Dichter.“ (literaturkritik.de) „Hier wird gegen den Strich gebürstet und so der spielerischen Seite des Genius amüsant nachgespürt [.in] einem klug ausbalancierenden Text.“ (Thüringer Allgemeine)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jürgen Wertheimer
Schillers Spieler und Schurken
Essay
konkursbuch
Verlag Claudia Gehrke
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
Vorbemerkung
Hoher Einsatz, volles Risiko: Schillers Weg zum Theater
Räuber spielen
Liebesspiele und Kabalen
Polit-Poker und Selbst-Inszenierung: Fiesko
Don Karlos: System-Spielerei
Der Solist als Spieler: Wallenstein
Wilhelm Tell: Den Mythos spielen
Frauen spielen nicht
Wahnsinnige Jungfrauen und blutige Bräute
Spiel des Schicksals oder Spiel der Triebe? Die Braut von Messina
Das doppelte Spiel des „Dimitrij“
Nachspielzeit
Quellen
Zum Autor
Zum Buch
Ein frischer Blick auf den deutschen „Klassiker“.
Hat man sich wirklich klargemacht, was für Charaktere Schiller ausgebrütet hat? Spieler, hauptsächlich Spieler, mit Macht, mit Liebe … Ein neuer Blick auf Schillers Modernität tut sich auf. Jeder pflegt sein eigenes System, in das die anderen als Stichwortgeber, Spielfigur, Gesinnungsmaske eingebaut und mit inszeniert werden …
Es wird skrupellos betrogen, gezockt, gelogen und getrickst beim Lieblingsspiel, dem Schach mit lebenden Figuren. Die besten Spieler Schillers treiben das Spiel auch mit sich selbst. Diese riskante Komponente Schillers haben auch die neueren Biografien weitgehend übersehen.
„Ein bemerkenswerter Essay […] Nebenbei räumt er mit törichten Schiller-Klischees auf […] Vieles von dem, was Wertheimer in seinem Buch ausführlich darlegt und erläutert, frappiert auf den ersten Blick, leuchtet bei weiterem Nachdenken ein und vermag durchaus auch zu überzeugen. Zumindest macht er uns mit einer ungewohnten Seite von Schiller vertraut und ermöglicht eine neue Sicht auf den Dichter.“ (literaturkritik.de)
„Hier wird gegen den Strich gebürstet und so der spielerischen Seite des Genius amüsant nachgespürt […] in einem klug ausbalancierenden Text.“ (Thüringer Allgemeine)
Vorbemerkung
Ein paar Jahre sind seit dem Erscheinen des Schiller-Buches vergangen, was das allgemein vorherrschende Schillerbild anbelangt, ist weitgehend alles beim Alten geblieben. Deshalb kann eine Neuauflage nicht schaden, gleichwohl die Hoffnung, dass wir das festgemauerte Bild des „Idealisten“ und „Freiheitspathetikers“ Schiller substanziell korrigieren, schwindet. Es ist, als ob man gegen das Klischee der „Aufklärung“ als angeblich primär vernunftorientierter Epoche anzukämpfen versuchte. Dabei ist der Fall Schillers geradezu idealtypisch geeignet, um den Hintergrund der Aufklärung in seiner Besonderheit zu beleuchten und so auf einmal zwei Vorurteilsblöcke anzugreifen.
Die Aufklärung ist ein relativ rabiates Verfahren zur emotionalen, mentalen und intellektuellen Mobilisierung des Einzelnen und zu einer kollektiven systematischen Ent-Entmündigung. Auch jener Form der Entmündigung, die durch sanfte Systeme betrieben wird. Schiller ist ein Autor, der mit einer Radikalität wie kein zweiter seiner Zeit die Suggestivkraft solcher ideologischer Entmündigungsverfahren aufzeigt. Mit Systemen zu spielen, heißt, sich ihrer zu bedienen. Schiller zeigt mit großer Verve die prekäre Ambivalenz, Akteur und Opfer des rauschhaften und berauschenden skrupellosen Spiels mit dem Spiel zu werden: ob Franz Moor, Fiesco oder Marquis Posa, Tell oder Wallenstein – sie alle begreifen nicht oder zu spät die entscheidende Regel zu beachten: nur mit dem Schein – artistisch – zu spielen, nicht aber: mit dem Leben.
Jürgen Wertheimer, Februar 2012
Schiller als Spieler? Ausgerechnet Schiller? Pathos, das Erhabene, idealistische Kasuistik – alles Mögliche verbindet sich mit seinem Namen. Aber nichts, was auf Leichtigkeit, Ironie, Verspieltheit hinwiese. Merkwürdig, wie einer hinter seinem Bild verschwinden kann.
Eine „unendliche Leichtigkeit des Seins“ ist Schiller zwar nicht unbedingt zuzusprechen – aber eine souveräne artistische Leichtigkeit des Spiels, darin war Schiller unerkannt Meister. Es ist erstaunlich, dass man diese Qualitäten so lange weitgehend übersehen konnte.
Die spielerische Seite des Weimarer Klassikers ist durchaus nicht das Resultat einer gegen den Strich des Üblichen gerichteten Lesebemühung, sondern Konsequenz einer Konzeption, die bei Schiller differenziert reflektiert wurde. Sein Essay Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1794) wartet noch immer auf eine wirkliche Entdeckung. Er beschreibt das kühne Experiment, den Menschen spielerisch zu sich selbst zu bringen und eine andere Form der Menschlichkeit lustvoll zu entdecken. Spieltrieb statt Moralpredigt, warum nicht?
Schillers Konzept ist komplex und greifbar zugleich. Richtig spielen heißt zu lernen, womit man spielen kann und womit nicht. Und wie und mit welchen Gefühlen der Akt des Spiels verbunden sein soll. Richtig zu spielen heißt für ihn mit allen Sinnen zu agieren, heißt das Spiel zu spielen und mit dem Spiel zu spielen, leicht und schwerelos zu werden, heißt Freude, Freude am Schein, am „schönen Schein“, am „Schein der Dinge“ zu empfinden. Kurz: Spielen als eine „Revolution“ der gesamten Wahrnehmungsfähigkeit zu begreifen.
Dass der Mensch nur da ganz Mensch sei, wo er spiele und nur dann spiele, wenn er ganz Mensch sei, ist ein Programm, eine Forderung, die an den Nerv einer Gesellschaft rührt. Wer spielt ist engagiert und distanziert zugleich, steht zwischen und über den Dingen. Es ist kein Zufall, dass Schiller selbst nie das war, was man einen Parteigänger nennt. Keine Zeile Revolutionsschwärmerei aus seiner Feder. Keine Zeile restaurativen Gemaules. Schiller untersucht Ideologien, er bewohnt sie nicht. Ob Fiesko, Jeanne d‘Arc oder Wilhelm Tell: Schillers Interesse gilt Manipulatoren, Verschwörern, Intriganten, Schauspielern und Profiteuren der Macht gleichermaßen. Er untersucht das Verhältnis Masse – Individuum in all seinen Varianten; er zeigt wie politische Inszenierungen kippen und selbst gläubiger Idealismus sich in Intrige verwandelt. Ein Marquis Posa gerät über kurz oder lang ebenso in das Fahrwasser des Intrigenspiels wie Wallenstein als Grenzgänger zwischen Kalkül, Kommerz und Kumpanei. Selbst der scheinbar mächtigste Mann der Welt, Philipp II., muss erkennen, dass er seinerseits nur Spielball übergeordneter Institutionen war. Ein radikal illusionsfreier Autor, der politische Entwicklungs- und Einwicklungsverfahren schonungslos transparent machte, ist in Schiller zu entdecken. Einer, der den Aufklärungsprozess nicht tugendhaft ausstaffierte, sondern ihn radikalisierte und gelegentlich sogar spielerisch ad absurdum führte.
Schillers Sprachscharniere drehen sich und lassen aus Ideen Taten, aus Phantasien Machtverhältnisse werden. Sprachspiele hebeln die Wirklichkeit aus den Angeln und verwandeln Ahnungen in Realitäten. Es mag wohl wahr sein, dass „der Geist sich den Körper baut“, doch nicht weniger zutreffend ist, dass die Sprache sich ihre Wirklichkeiten herstellt. Die Alten klammern sich an ihre Sprache und werden von ihr zermahlen. Die vielen Jungen werden häufig von ihr weggetragen und in Situationen geführt, denen sie nicht gewachsen sind.
Tatort Wahrnehmungs-Labor: Schillers Denkfiguren verformen und verwandeln Gedanken in Realitäten. Wie bei Kafka geraten die Figuren in die Labyrinthe ihres eigenen Sensoriums, die Monstren gebären und Teil eines neuronalen Netzwerks der Unterdrückung und der Befreiung werden. Lange vor der Moderne des 20. Jahrhunderts ist das Phänomen der W a h r n e h m u n g und ihrer sprachlichen Verfertigung an die Stelle der so genannten Wirklichkeit getreten. Schiller spürte die entscheidenden Kipp- und Dreh-, Winde- und Wendepunkte von gesellschaftlichen Trends im Ansatz auf und dokumentierte sie: den Riss im Familiengemälde, den dogmatisch-sterilen Sog des Aufklärungskults, den Irrwitz horizontloser Großmacht- und Glaubenspolitik im europäischen Maßstab. All diese Phänomene macht er in seinen besten Momenten oft in zwei messerscharfen Repliken dingfest, sprachdicht. Es scheint, als triebe Schiller seine Ideen systematisch durchs Feuer seiner Szenen, um ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen und im Laboratorium des Dialogs auf ihre Konsequenzen hin zu befragen. Dabei schreckt er vor der Ironie, auch der Ironie der Selbstdemontage des Pathos durch Überzeichnung nicht zurück. Eine verspielte Genauigkeit, etwas Hochästhetisiertes, das unversehens von rabiaten Wirklichkeitseinbrüchen attackiert wird. Eine Dramaturgie der Mischungen, permanenter Ambivalenzen, Überblendungen, Verschachtelungen.
Ob individuelle Amokläufe oder herrscherliche Gewaltdelirien – Schiller macht beide Phänomene in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung transparent. Und er macht dabei lange Zeit vor keinem Tabu Halt. Giftmord auf offener Bühne, Vergewaltigung, monströse Impotenz der Inquisition; politische Bankrotteure, Saboteure, Egomanen, das Menschenschach der Methodiker der Macht; Lüge, Täuschung, Hochverrat als politisches Instrument – alles wird ans Licht gezerrt, um in überwältigender Vielfalt der Perspektiven eine Inventur der Möglichkeiten zu erstellen– am Ende dieser ersten Moderne.
Resultat, ein Resultat, das die verbindende Formel aller seiner und auch aller unserer „Stücke“ sein könnte: Jedes Machtspiel spielt (bewusst, häufiger unbewusst) in den Koordinaten eines zweiten, übergeordneten Machtspiels, das seinerseits von einem Machtspiel auf dritter, vierter Ebene überlagert wird: Karlos manipuliert von Marquis Posa, beide vom König, der wiederum vom Inquisitor – so sieht ein typisches Schiller-Szenarium aus. Doubles und Quadraturen der Macht installieren ein Vexierspiel der Bezüge, in dem es am Ende nur mehr Spieler und Gespielte gibt und die Rollen aufs Bestürzendste permutieren. Die Sprachwut und Gefühlsexaltation vieler Figuren erklärt sich von hieraus als blinder, hoffnungsloser Versuch, sich aus diesen verschraubten Instanzlabyrinthen gewaltsam hinauszuschleudern. In dieser komplizierten Befreiungssüchtigkeit ist er vielleicht ein Zeitgenosse, zumindest ein entfernter Verwandter von uns. Beideim goldenen Aufklärungscontainer aus lauter Vernunft, Verstand, Standards und Normen, und sie wollen da raus! Die Nerven liegen blank. Die Sprache wird zerrissen. Alle torkeln nach vorn. In den Abgrund. Im verstaubten, blinden Spiegel von Schillers Stücken können wir schemenhaft und mit gelindem Erschrecken etwas erkennen: uns.
In den folgenden Skizzen werden unterschiedlichste Spiel-Ordnungen und -Inszenierungen untersucht: solche aus Schillers Leben, vor allem aber die seiner großen Dramen, die nichts anderes sind als emotional hoch aufgeladene Spielfelder, auf denen es meist um Leben und Tod geht. Um die Vorgänge zu verdeutlichen, wurden in den Text auch einige ungewohnt lange Zitate eingearbeitet. Das Ganze versteht sich als ernsthaftes, wenngleich essayistisches Spiel mit dem Text und keinesfalls als ein gewichtiges Stück klassischer Schiller-Philologie, die ja in hinreichendem Maße vorhanden ist.
Mein Dank gilt meinen Mitarbeitern Christina Gößling, Jan Kühnel und Ida Tschichoflos, die das Manuskript betreuten, ebenso wie den Zuhörern der Studium-Generale-Vorlesung, die dem Vorhaben, mehr über die „zum Bersten vollen Textkörper“ Schillers (E. Jelinek) zu erfahren, inspirierend interessiert folgten.
Hoher Einsatz, volles Risiko: Schillers Weg zum Theater
In einem berühmt gewordenen Brief vom 28. Juli 1835 legt Georg Büchner ein noch immer überraschendes Bekenntnis ab. Im Zusammenhang mit Überlegungen zum zeitgenössischen Theater bzw. Drama schreibt er:
Was [...] die sogenannten Idealdichter anbetrifft, so finde ich, daß sie fast nichts als Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos, aber nicht Menschen von Fleisch und Blut gegeben haben [...] Mit einem Wort, ich halte viel auf Goethe oder Shakespeare, aber sehr wenig auf Schiller.
Zugegeben, eher Ausdruck einer spezifischen Wahrnehmung denn objektive Aussage. Doch von diesem Tiefschlag hat Schiller sich bis heute nicht vollständig erholt: Pathos, affektiertes Gehabe, Wesen aus Marmor oder Pappe – bis in die Gegenwart verfolgen und überlagern diese Klischees über den„Moralisten“ und „Idealisten“ Schiller den fantastisch präzisen, politisch präsenten, absolut illusionslosen Radikalaufklärer Schiller.
Fast scheint es, als ob Büchner eine falsche Spur legte, um von der eigenen Nähe zu Schiller abzulenken: Dantons Tod (1835) und Wallensteins Tod (1800) – nicht nur die Titel ähneln einander, auch die Struktur gibt Anlass, über eine verdeckte Beziehung nachzudenken. Beide gehen ihren Weg als Dramatiker mit hohem Risiko, am Rande, manchmal jenseits der so genannten Legalität. Für beide war der Weg zum Theater alles andere als vorgegeben. Büchners argumentative Abwehr seines alter ego Schiller jedenfalls soll nur von potentiellen Gemeinsamkeiten ablenken.
Von wegen Pathos und naiver Idealismus – Schiller analysiert glasklar und ohne Illusionen. Doch noch ein zweites Vorurteil hält sich unbeirrbar: das des Dichters Schiller. Ganz abgesehen davon, dass man diesen „deutschen“ oder – noch schlimmer – „teutschen Jüngling“ halt nun einmal im Kopf behalten hat. Aber wie kann einer denn ein „deutscher Jüngling“ sein, wenn es „Deutschland“ noch gar nicht gibt, sondern das „Ausland“, von Stuttgart aus gesehen, bereits vor Mannheim beginnt?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!