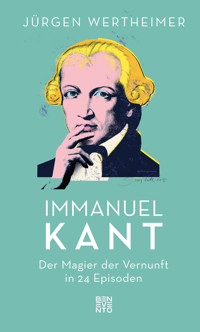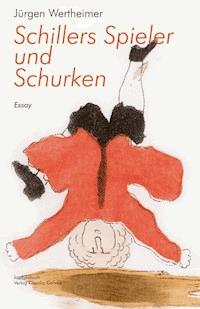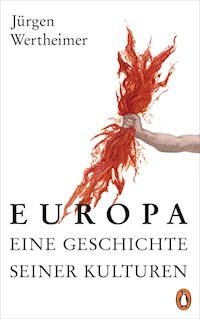
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Kulturgeschichte für Europa heute – von der Antike bis in die Gegenwart
Was hält Europa zusammen? Gibt es Gemeinsamkeiten in den Werken der Kunst und Kultur, die sie als europäisch kenntlich machen? In einer fesselnden Reise durch über 2000 Jahre europäischer Kulturgeschichte zeigt Jürgen Wertheimer, was Europa ausmacht: Es nimmt sich seit jeher als Gemeinschaft wahr, die ständigem Wandel unterliegt, die zwischen Autonomie und Zusammenhalt schwankt – ohne sich auf ein starres Selbstbild zu verpflichten. Trotz aller Krisen und Kriege liegt darin auch seine Stärke: Seit der Antike hat sich eine einzigartige Kultur der Neugier, Selbstbefragung und Offenheit gebildet, die sich in den vielfältigen kulturellen Zeugnissen Europas spiegelt – von Homer bis in unsere Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 798
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Was hält Europa zusammen? In einer neuen Kulturgeschichte Europas von den mythischen Anfängen bis heute zeigt der Literatur- und Kulturwissenschaftler Jürgen Wertheimer, worin die DNA des Kontinents besteht: Europa nimmt sich seit jeher als Gemeinschaft der Vielfalt wahr, die ständigen Veränderungen nach innen und außen, Verhandlungen, Streit und Diskussionen unterliegt – ohne sich auf ein festes Selbstbild zu verpflichten. Trotz aller Krisen und Kriege liegt darin auch die Stärke: Seit der Antike hat sich daraus eine Kultur der Befragung, Selbstbefragung und Offenheit gebildet, die sich in den kulturellen Zeugnissen der vergangenen Jahrhunderte, vor allem in der erzählenden Literatur, spiegelt. Sie wird von vielen in der Welt geliebt und bewundert, aber auch beargwöhnt, gefürchtet und bekämpft. Gute Gründe, sich darauf zu besinnen!
Über den Autor
Jürgen Wertheimer, geboren in München, studierte Germanistik, Komparatistik, Anglistik und Kunstgeschichte in München, Siena und Rom. Seit 1991 ist er Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter gemeinsam mit Nicholas Conard »Die Venus aus dem Eis. Wie vor 40 000 Jahren unsere Kultur entstand« (Knaus, 2012). Seit 2017 leitet er das »Projekt Kassandra. Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung«.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Jürgen
Wertheimer
EUROPA
EINE GESCHICHTE
SEINER KULTUREN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2020 Penguin Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Bernd Klöckener, Berlin. Mitarbeit: Florian Rogge
Karten: Peter Palm, Berlin
Bildbearbeitung: Helio Repro, München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagabbildung: Fall of Giants (Caduta dei giganti),
by Pietro Longhi, 1734, Fresco (Detail) © Mondadori Portfolio/
Electa/Cameraphoto Arte/Bridgeman Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN978-3-641-23042-5V002
www.penguin-verlag.de
Dieses Buch ist auch als E-Book erhältlich.
Inhalt
Vorwort
Einführung
I Gründungsmythen
1 Europa kriecht an Land
2 Die Mutter aller Schlachten
3 Geburt der Polis
4 Die Entdeckung des Mittelmeerraums
5 Odysseus und Jahwe: die zweite Wurzel Europas
6 Troja 2.0: Rom
Grenzen – europäische Schicksalslinien
II Metamorphosen
7 Europa gründet ein Imperium
8 Rom wandert aus
9 Ex oriente lux
10Die Legende vom »christlichen Abendland«
11 Deus lo vult: Gott will es
Wie halten wir’s mit der Religion?
III »Eine Neuvermessung der Welt«
12 Der »Herbst des Mittelalters«: Extremisten und Décadents
13 Irdische Paradiese
14 Ein Sturm erfasst die Welt
15 Siglo de Oro: das »goldene Zeitalter«?
16 Die Kunst der Wissenschaft
Tabula rasa oder Endlosschleife?
IV Das Projekt »Aufklärung«
17 Mythendämmerung
18 Witz, Satire, Trauerspiel und Enzyklopädie: die Künste der Aufklärung
19 Die große Revolution – und ihre Folgen
Wahrnehmungsschulen: europäische Zugänge zur Welt
V Das Jahrhundert der Widersprüche
20 Die Welt muß romantisiert werden«
21 Verlorene Illusionen
22 Oceanische Gefühle«: die Jahrhundertwende
23 Europa implodiert: der Zusammenbruch der alten Systeme
Wir sind wir – oder sind wir die anderen?
VI Selbstmord und Weiterleben
24 Der Absturz
25 Die Regeneration
26 Unser Europa: Bruchstellen
27 Zukunftstraum Europa
Das Europa der Frau
Was wir gelernt haben – könnten
Dank
Anmerkungen
Bibliographie
Bildteil
Vorwort
Europa ist ein Kunstprodukt, ein Artefakt, das angemessen behandelt werden muss. In den falschen Händen kann es im wahrsten Sinn zu Bruch gehen. Und ja, Europa ist eine Mimose, ein Hybrid – im Vergleich mit anderen Kulturen ist es viel filigraner, zerbrechlicher. Das ist nicht nur seine Schwäche, sondern auch seine Stärke.
Als Artefakt aus Gegensätzen, Ähnlichkeiten (auch trügerischen), Gemeinsamkeiten und Widersprüchen, Ambivalenzen und Affinitäten, Bindungs- und Auflösungstendenzen ist es ein labiles und zugleich seit mehr als 2000 Jahren bestehendes Gebilde. Stets im Zerfall und Aufbau zugleich begriffen.
Vereinigte Staaten von Europa – ein Widerspruch in sich selbst.
Europa der Vaterländer – eine Vision aus der Mottenkiste.
Das Band gemeinsamer europäischer Werte – pure Einbildung.
»Europa« hat immer dann am besten funktioniert, wenn man es verstand, eine gewisse artistische Balance zwischen Autonomie-Ansprüchen und Bindungs-Bedürfnissen zu halten. Bei der inneren Widersprüchlichkeit der Elemente, aus denen sich dieser Kontinent zusammensetzt, ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Dieses Buch unternimmt den Versuch, sich diesem verwirrenden Kontinent zu nähern und ihn in all seiner Widersprüchlichkeit zu erkunden. Erstaunliche Höhenflüge und verheerende Abstürze gehören ebenso dazu wie rabiate Ausbruchsversuche und engherziger Rückzug. Doch genau mit diesem doppeldeutigen, vielstimmigen, fragmentarischen, unvollständigen Europa, so wie es in den zweieinhalb Jahrtausenden seiner Existenz geworden ist, haben wir es zu tun. Die Vorstellung eines in sich geschlossenen Ganzen ist pure Illusion. Wir sollten uns mit dem Europa, wie es ist, anfreunden und das Beste daraus zu machen versuchen.
Daher will und kann dieses Buch auch keine umfassende und vor allem keine vollständige Geschichte der europäischen Kulturen sein. Wer nach Lücken sucht, wird sie finden. Wer etwas über die großen Dynastien, die angeblich das Gesicht Europas geprägt haben, erfahren möchte, wird enttäuscht sein. Dies hier ist weit mehr das Protokoll einer durch persönliche Erfahrungen wie auch Irrtümer geprägten Wanderung entlang der Geschichte der kulturellen Verwandlungen und Konstanten dieses Kontinents mit seinen frappierenden Dreh- und Angelpunkten.
Es ist unmöglich, ein objektives Bild von Europa zu zeichnen. Ich kann nur versuchen wiederzugeben, welche Reflexe und Reflexionen sich in den langen Jahren und Jahrhunderten, der Chronologie folgend, eingestellt und entwickelt haben – von seiner Vorgeschichte bis zur Gegenwart.
Natürlich hätte es andere Gliederungsmöglichkeiten gegeben, man hätte Schwerpunkte herausgreifen, nach zentralen Merkmalen sortieren können. Mich hat das Prinzip des Nacheinanders deshalb interessiert, weil es ja immer auch ein Europa vor einem Europa gab. Allzu häufig blicken wir auf diesen Kontinent mit dem Blick derer, die aus der Rückschau bereits alles besser wissen. Ich möchte demgegenüber einzelne Episoden auch so beschreiben, wie sie möglicherweise von den Menschen seinerzeit verstanden wurden, noch bevor diese bereits wussten, wissen konnten, wie der nächste Schritt, den man im Begriff war zu tun, aussehen könnte, wohin der Weg, den man ging, führen würde. Europa – ein Rätsel, dessen Auflösung man noch nicht kennt.
Um dennoch einige Orientierungsmarken zu setzen, wurde die bisweilen einschüchternde Stoffmenge in sechs Teile gegliedert, die entscheidende Bewegungen zusammenfassen. Zudem gibt es eine Reihe von Zwischenkapiteln, die einige übergreifende Aspekte europäischer Erfahrung bündeln und – im schnellen Vorüberfliegen, sozusagen im Zeitraffer eines Gangs durch die Jahrhunderte – zusammenfassen.
Beim Verfolgen dieser Spur wurde manches neu entdeckt, anderes wiederbelebt. Vieles blieb notgedrungen Fragment, insgesamt ein Palimpsest aus Gedachtem, Gelesenem, Geschriebenem, Überarbeitetem, Wiedergefundenem. So wie dieses Europa selbst ja ein Patchwork aus Erinnerungen, Realitäten und Fiktionen ist und alles andere als ein in sich geschlossenes Ganzes. Wer einfache »Wahrheiten« sucht, sollte sich nicht mit Europa befassen.
Der Plural im Buchtitel möchte dieses heterogene Moment andeuten. Dieser Kontinent war über die Jahrhunderte hinweg etwas zwischen Melting Pot und bisweilen Hexenkessel – nie jedoch ein homogenes Gebilde mit »festen Außengrenzen«, wie sich das manche einreden. Es ist an der Zeit, mit solchen ebenso antiquierten wie windschiefen Vorstellungen aufzuräumen, weil sie uns daran hindern, in der jetzigen labilen Situation die richtigen Antworten zu geben. Jedenfalls bessere als die der jetzigen EU, die den Beitritt weiterer Staaten weitgehend von ökonomischen Gegebenheiten abhängig macht, was viele der betroffenen Länder als eine Art Zwangsjacke empfinden. Nähme man den Faktor »Kultur« wirklich ernst, betrachtete man ihn nicht als dekoratives oder pittoreskes Zubehör: Man käme zu einer vollständig anderen Europa-Idee. Denn kulturelle und künstlerische Phänomene sind nicht der Appendix der sogenannten politischen oder sozialen Wirklichkeit, sondern ihr innerster Ausdruck. Sind Fingerabdruck, Signatur all dessen, was für eine Gesellschaft wirklich von Belang ist, dessen, was sich auf und hinter ihrer Oberfläche abspielt. Sind Frühwarnsystem und Rückschau in einem. Sind Indikatoren für all das, was uns zusammenhält, aber auch trennt. Wer ihre Signale ignoriert, verzichtet auf den vielleicht wichtigsten Indikator für Entscheidungsprozesse.
Tübingen, 2020
Einführung
Balkan, Mazedonien, Katalonien, Rechtsruck, Nationalismus, Außengrenzen, Eurokrise und jetzt auch noch der Brexit – Europa ist angeschlagen. Fällt man auseinander oder bleibt man doch »irgendwie« beisammen? Kaum jemand wird in Abrede stellen, dass uns etwas Entscheidendes verloren gegangen ist – ein sinnstiftender Rahmen, der die »Idee« Europa überzeugend veranschaulicht.
Ist es möglich, dass uns genau das abhandengekommen ist, was Europa ausmacht: sein Mythos, seine Seele? Dass Europa seine Identität, seinen »Schatten« verlor? Wie in der wundersamen Geschichte des deutsch-französischen Autors Adalbert von Chamisso, in der der Held, Peter Schlemihl, seinen eigenen Schatten, Chiffre für seine Identität, verliert.
Wie Schlemihl um seinen Schatten kam? Nun, er hat ihn verkauft.
Das vermeintlich gute Geschäft sollte für ihn freilich zum existenziellen Desaster werden. Ohne seinen Schatten wurde der junge Mann schlagartig zum sozialen Außenseiter, zum lebenden Toten. Zu einem Wesen ohne sozialen Raum.
Nein, wir wollen uns hier nicht mit einem romantischen Märchen abspeisen lassen. Aber Fakt ist, dass der unbestreitbare materielle Reichtum Europas sich als zerstörerisch für sein inneres Selbstbild und das Bild in den Augen der Welt erwies. Fakt ist, Europa hat sich bereichert wie nie – und ist zugleich aufs Höchste irritiert und verunsichert. Die europäische Geschichte hat ihre Geschlossenheit nach innen verloren und ihre Wirkmächtigkeit nach außen verspielt. Der kleine große Kontinent ist gezwungen, über sich nachzudenken und nach seinem Puls zu tasten, um festzustellen, ob das Herz noch schlägt.
Hektisch versuchen jetzt manche, gegen das Gefühl einer drohenden Krise anzusteuern und im Schnellverfahren eine geschlossene Geschichte aus dem Hut zu zaubern: symbolisch, politisch, wirtschaftlich, militärisch. Europa fehle, so hört man, die »Narration«, die »große Erzählung«.
Doch die erwähnte Schlemihl-Geschichte hat einen Nachspann, der für unsere Überlegung, was Europa ausmacht, von Interesse ist. Statt des verlorenen Schattens erwirbt der unglückliche Held jene Siebenmeilenstiefel, die ihn ab jetzt im Sauseschritt um die Welt tragen werden. Der »hohe und breite Rücken der Alten Welt« – die, wie es heißt, »vermeintliche Wiege« der Kultur – verschwindet unter seinen Schritten, er durchquert alle Regionen der Erde, kehrt über Euphrat, Tigris, Niger,Nil, Niagara und Mississippi zurück nach Europa, um von dort aus nach kurzer Rast China, Tibet, Sumatra und Indonesien zu durchmessen.
Und in der Tat, Mitte des 19. Jahrhunderts, zur Blütezeit des Kolonialismus, verfügte das kleine Europa nahezu über die gesamte Welt. Alles, an dessen Spätfolgen wir jetzt noch laborieren, wurde damals festgelegt – sodass es durchaus angemessen erscheint, dass dem Protagonisten schier schwindelig wird und er sich nach Hemmschuhen sehnt, die dem globalisierten Schnelldurchlauf durch die Welt zumindest für Momente Einhalt gebieten. Ein Drehschwindel stellt sich ein, der sich als erster Schritt zur Gesundung erweist. Denn Schlemihl erkennt, wie selbstgefährdend es ist, sich hemmungslos in und auf die Welt zu stürzen und zu glauben, man könnte über alle Differenzen hinwegsehen, -gehen, -fliegen.
Was für Schlemihl gilt, trifft auch auf Europa zu: vorbei die Zeit des grenzenlosen, siebenmeilenartigen Durchmessens der Welt. Manchmal fördern Hemmschuhe das Funktionieren der Wahrnehmung und des Verstandes. Wer es unternimmt, über eine Kulturgeschichte Europas im gegenwärtigen fragilen Zustand nachzudenken, tut gut daran, sich des alten Schlemihl-Prinzips zu erinnern und sich in einer besonderen Gangart zu bewegen: zwischen Zeitraffer und Zeitlupe, im Bannkreis des Schattens und zugleich auf der Flucht vor ihm.
Denn die Gefahr, gewohnheitsträge im Bett der Tradition zu verharren und die ebenso vertrauten wie nichtssagenden Stereotypen zu wiederholen, ist nicht eben gering: klassische Antike, Renaissance, Aufklärung, Freiheit, Toleranz, Demokratie – eben der ganze Kanon angeblich europäischer, vielleicht sogar nur europäischer Ideale und Werte.
Nicht, dass der Blick auf die kulturellen Gipfel und Höhenkämme völlig irreführend wäre. Aber er birgt die große Gefahr des Verlusts an Bodenhaftung in sich.
Europa ist kein Luftschloss, keine Vision, kein Phantasieprodukt, sondern eine konkrete, höchst irdische und gegenwärtige Angelegenheit. Und da hilft es auch nicht, auf straffere Organisationsstrukturen zu setzen oder sich auf einen gedanklichen Konkurrenzkampf beziehungsweise einen »Wettstreit der Ideen« mit den USA oder China einzulassen. Viel wichtiger wäre es, ernsthaft danach zu fragen, was wir sind und wofür wir eigentlich stehen – inmitten einer globalisierten Welt, die kein ausgeprägtes Faible für Ruinen hat. Denn im Weltmaßstab ist Europa genau das: Eine relativ edle, sehr in die Jahre gekommene kulturelle Ruine, die ihre Bewohner noch immer dazu bringt, von alten Zeiten zu träumen, statt sich zu fragen, was ihre wirklichen Eigen-Arten sind. Und ob es nicht vielleicht auch ein ganz anderes, verborgenes, in seiner Wertigkeit noch weitgehend unentdecktes Europa gibt. Ein Europa jenseits der üblichen Schlagworte und plakativen Werte republikanischer oder christlich-abendländischer, klassischer oder fortschrittsgläubiger Natur. Ja, ob es überhaupt ein Europa, ein Europa gibt …
Die japanisch-deutsche Autorin Yoko Tawada stellte diese Frage auf die ihr eigene freundlich-hintergründige Art. Als sie, von Japan kommend, mit der Transsibirischen Eisenbahn Richtung Europa fuhr, wähnte sie sich in Sibirien schon am Ziel, also in Europa angekommen. Wo »unser« Europa allmählich endet, hatte ihr Europa bereits angefangen, und in Moskau glaubte sie sich im Zentrum des Kontinents.
Man weiß ja nicht einmal, ob es sich um ein geopolitisches Gebilde handelt oder um das Projekt eines besonderen Stils der Governance – demokratisch, republikanisch oder egalitär? Steht der Begriff »Europa« für einen speziellen Typus der Wissensgesellschaft oder für einen Wirtschaftsraum? Ist es eine Chiffre für religiös grundierte Werte oder primär ein plurilinguales oder plurikulturelles Gewebe, eine Art Textur aus Nuancen? Sicher ist, dass es weltweit kaum eine zweite Region gibt, in der sich auf kleinstem Raum, zum Teil nur zwei- oder dreihundert Kilometer voneinander entfernt, so viele unterschiedliche Kulturen herausgebildet haben wie in Europa. Nirgends sonst stößt man auf eine solch kleinräumige Vielfalt kultureller Zonen, die sich – aller Differenz zum Trotz – dennoch bis zu einem gewissen Grad als zusammengehörig empfinden. Eine Zusammengehörigkeit, deren Reichweite und Intensität einem permanenten Wandel ausgesetzt ist.
Denn dieses Etwas, das sich Europa nennt, änderte im Lauf der Jahrhunderte selbst seinen Umriss wie eine gigantische Amöbe. Mal leckte die Zunge Europas an Sibirien, dann wieder zuckte sie zurück bis zum Ural. In den Jahren des Kalten Krieges reichte sie sogar nur bis zur Oder-Neiße-Grenze. Das spätantike Europa umfasste den byzantinischen Raum, dann wieder war hinter Wien Schluss. Es gab Zeiten, da gehörte der gesamte Mittelmeerraum einschließlich Nordafrikas dazu – gegenwärtig schotten wir die Außengrenzen genau davor ängstlich ab und wissen andererseits nicht einmal mehr, ob Großbritannien dazugehört oder eine autonome Insel ist. Wir feiern Europa für mehr als ein halbes Jahrhundert Frieden und sehen dabei von den Balkankriegen der 1990er-Jahre mit mehr als 250 000 Toten ab – vermutlich, weil wir diesen Teil des Kontinents als nicht ganz zugehörig betrachten.
Die Kontur Europas verändert sich also fortwährend und lässt sich nie auf einen Zustand fixieren. Ständig galt und gilt es, neue Regelwerke für das Zusammenspiel der einzelnen Module zu ersinnen, Membrane zwischen ihnen aufzulösen oder zu verstärken, ohne dass sich je ein fester Mittelpunkt bestimmen ließe: Weder Straßburg noch Brüssel sind als Zentren zu betrachten, allenfalls als Verwaltungszentralen. Selbst das britische Empire oder das Habsburgerreich repräsentierten nur ein Teileuropa. London und Wien, Paris und Berlin waren immer nur Zentren auf Abruf. Europa ist stets, auch und gerade in seinen Blütezeiten, ein Geflecht aus Regionen und Peripherien ohne eigentliche Mitte gewesen.
All dies mag irritierend und widersprüchlich klingen, doch letztlich handelt es sich um eine außerordentlich kreative Versuchsanordnung, die das expansive Erbe Europas ein Stück weit erklären mag. Im Grunde war und ist Europa eine einzige auf Dauer gestellte Transitzone. Ein kulturelles Treibsandgebiet ohne Leitkultur und alles andere als ein Normierungskartell. Dies ist eine mögliche Erklärung für einige seiner auffälligsten Signaturen.
Denn eines war und ist für dieses sich permanent wandelnde, sich verwandelnde, Chamäleon-artige, extrem facettenreiche Geflecht aus Möglichkeiten und Ambivalenzen wichtiger als alles andere: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation!
Lebensformen, die immer wieder auf Ähnliches, oft Gleiches stoßen, sind nicht gezwungen, sich selbst infrage zu stellen. Solchen jedoch, die sich an allen Ecken und Enden mit Neuem, Unbekannten, Fremden konfrontiert sehen, bleibt keine andere Wahl, als sich mit den anderen vertraut zu machen oder ihnen zu misstrauen, sich entweder abzugrenzen oder Kontakt zu suchen. Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit sind immer wieder neu zu definieren, um einen komplizierten Modus des Zusammenlebens unter besonderen Bedingungen zu ersinnen. Kurz, Qualitäten zu schulen, Fertigkeiten zu erlernen, die anderswo nicht oder jedenfalls nicht in dem Maße nötig sind.
Zu den wirklich unveräußerlichen und historisch beglaubigten Errungenschaften des europäischen Systems gehören nicht »Werte« (die auch andere Kulturen zu Recht für sich beanspruchen könnten), sondern ein sehr spezieller Stil, mit Werten umzugehen.
Es gilt, dieses europäische Grundgefühl, diese kommunikativen Techniken zu stärken, zu vermitteln und ihre Fortentwicklung zu befördern. Erst nach einem umfassenden Selbstreflexionsprozess sollten wir darüber entscheiden, ob es uns zusteht, global zu intervenieren. Das Bild Europas, wie es sich in der Wahrnehmung und Erfahrung von Außenstehenden darstellt, ist derzeit nur bedingt dazu geeignet, um damit in die Offensive zu gehen.
Sucht man auf diesem Weg nach Orientierung, findet man sie nicht nur in politischen Programmen, vielleicht dort am allerwenigsten überzeugend. Auch die Definition wirtschaftlicher Vorstellungen ist nicht immer hilfreich, weil dort in der Regel ein Denken mit dem Ziel der Gewinnoptimierung dominiert.
Wenn es uns um Europa geht, wirklich ernsthaft geht, sollten wir nicht andächtig vor erhabenen Kulturruinen verharren, sondern nach der inneren Geschichte auch an entlegener Stelle oder mit neuem Blick suchen. Vor allem auch nach den Gefühlen, die dieser vielgestaltige Kontinent im Laufe der Jahrhunderte ausgebrütet hat – im Guten wie im Bösen.
Es sind nicht nur die humanistischen Schriften, die philosophischen Traktate und ideologischen Erklärungen, die uns Aussagen hierüber liefern, sondern auch – an vielleicht unerwarteter Stelle – die Literatur, der sprachgewordene Fingerabdruck des Denkens und Empfindens ganzer Kollektive. Es kann jedenfalls kein Zufall sein, dass zwei Erscheinungsformen, zwei Genres der Literatur sich hier und nirgendwo anders ausbildeten: der Roman und das Drama.
Der Roman als vielstimmiges, perspektivenreiches, großformatiges Erzählgebilde mit offenem Ende und das Drama, das Theater als erregende Widerspruchsmaschine voller Energien und Emotionen. Europa produzierte und absorbierte solche Szenarien der Mehrstimmigkeit wie kaum eine zweite Kulturlandschaft: süchtig nach literarischen Stimulanzien als Gegenwelten zu dogmatischen, sakralen oder politischen Lehren.
Europa, die Idee Europa ist Inkarnation eines langfristigen, nachhaltigen Aufklärungs- und Säkularisierungsprozesses – Paul Veyne zufolge glaubten schon die Griechen nicht an ihre eigenen Mythen. Und es ist eindrucksvoll, wie wir uns der Narrative aus fremden Räumen bedient und sie uns anverwandelt haben. Wenn wir uns wirklich zu einer Art »Leitidee« versteigen wollten, wäre es weitaus plausibler und realitätsnäher, sich an der Weisheit und den Erkenntnissen Tausender von Geschichten zu orientieren als an abstrakten Entwürfen und Wunschgebilden.
Europa war seit seinen Anfängen etwas Pulsierendes, Lebendiges, Osmotisches, immer in Bewegung. Weit eher ein Geflecht mäandernder Flüsse als ein begradigter Kanal. Diesem migrativen, auf steten Aufbruch und Austausch angelegten dialektischen Grundcharakter gilt es auch heute gerecht zu werden. Denn europäische Werte waren nie statisch, sondern immer im besten Sinn des Wortes Verhandlungssache. Und: Europa ist von Beginn an ein Ort dramatischer innerer Widersprüche – und überlebte möglicherweise genau deshalb alle erdenklichen Krisen. Eine innere Widersprüchlichkeit, die sich bereits in der Entstehungsgeschichte Europas ausdrückt.
I
Gründungsmythen
Europa erschuf sich gleichsam aus dem Nichts. Eine Kreation, eine Komposition aus Basisgeschichten, Phantasie und strategischen Interessen. Ein bis dahin »leerer Raum« ohne feste Zugehörigkeit wurde systematisch mit Bedeutung gefüllt und Schritt für Schritt in einen politischen Raum verwandelt. Ein ganz wichtiges Instrument hierzu: die Technik der Abgrenzung, des Scheidens. Nicht wie der biblische Gott zwischen Licht und Finsternis, sondern zwischen »Ost« und »West«.
1 Europa kriecht an Land
Irgendwo zwischen Syrien und Libyen beginnt die Geschichte Europas. Und sie beginnt wie in einem bunten orientalischen Märchen. Aber es handelt sich nicht um ein Märchen aus »Tausendundeiner Nacht«, sondern um eine genuin griechische Geschichte, vielleicht sogar um die Mutter aller Geschichten: Göttervater Zeus hat sich in Europé, die Tochter des mythischen Phönikerkönigs Agenor, verliebt. Als sie am Strand mit Gefährtinnen spielt, taucht er in Gestalt eines Stieres auf. Um sie zu entführen. Er tut dies auf eine offenkundig so vertrauenserweckend-charmante Art, dass sie spontan, auf seinem Rücken reitend, mit ihm geht. Er schwimmt mit der schönen Last auf dem Rücken übers Meer nach Kreta. Dort verwandelt er sich zurück und zeugt mit ihr drei Söhne, darunter Minos, den späteren Erfinder des kretischen Labyrinths. Entsprechend einer früheren Verheißung Aphrodites, wurde die neue Heimat nach ihr »Europa« benannt: Noch in der Nacht vor ihrer Entführung hatte Europé davon geträumt, dass zwei Kontinente sich um sie stritten: Asia und das zukünftige Europa. Asia wollte sie mit dem Argument an sich binden, dass sie doch hier geboren sei und deshalb hierhergehöre. Der neue Kontinent verwies darauf, dass der Mensch frei sei, zu gehen, wohin er wolle – und entführte sie in die neue Welt, nach Kreta.
Das griechische Märchen hat es also in sich. In anmutigen Bildern beschreibt es einen programmatischen Neuanfang, der mit einer Entführung beginnt und in einem Gründungsmythos endet. Auf Kreta wird Europé zur Mutter einer neuen, antilevantinischen Mittelmeerkultur – der gesamte Mittelmeerraum wird sozusagen neu vermessen und geht auf Kurs »West«. Und kein Geringerer als Zeus selbst stand Pate bei dieser Verpflanzung und Umwidmungen der alten ägyptisch-orientalischen Kulturen auf die Inseln der Ägäis. Ein geopolitischer Paradigmenwechsel par excellence.
Sich kulturell zu formieren, zu positionieren heißt auch, sich abzugrenzen und Trennungslinien zu ziehen. Das geschieht exemplarisch. Mythen fungieren als Inklusions- und Exklusions-Medien. Sie sind Teil eines göttlich legitimierten, menschlich gemachten politischen Schachspiels.
Und dieses »Europa« ist ein Kunstprodukt aus dem Geist der strategischen Abgrenzung. Da es im Mittelmeerraum kaum natürliche Grenzen gibt – das Meer galt den Griechen nicht als Barriere, sondern als Verbindung, sie nannten es »ho pontos« (»die Brücke«) –, musste man artifizielle, ideologische Abgrenzungen finden. Hinter der auf den ersten Blick etwas abstrus anmutenden kleinen Entführungsgeschichte steckt weit mehr. Wenn man so will, wird hier eine für Jahrtausende gültige kulturelle wie geopolitische Grenze zwischen West und Ost gezogen.
Denn auch das Nachspiel der Geschichte hat es in sich: Nach ihrer Landung auf der Geburtsinsel des Zeus wird die entführte Prinzessin zur Stammmutter einer neuen Dynastie. So wie Kreta zum Ausgangspunkt jener minoischen Kultur werden wird, die sich innerhalb kurzer Zeit über weite Teile des ägäischen Raums ausbreiten sollte. Funde belegen, dass der Einfluss der kretisch-minoischen Kultur bis ins östliche Mittelmeer reichte.
In den langen Jahrhunderten seiner Blüte (grob gerechnet zwischen 2500 und 1500 v. u. Z.) hatte Kreta eine einzigartige kulturelle Signatur entwickelt: Die Überreste gewaltiger Paläste ohne schützende Umfassungsmauern, die der britische Archäologe Arthur Evans zu Beginn des 20. Jahrhunderts freilegen sollte, lassen auf eine ebenso reiche wie verfeinert-raffinierte Kultur schließen. Eine Kultur, die es sich erlauben konnte, sich ganz und gar unheroisch und anmutig zu präsentieren, und weder mit den Namen großer Herrscher prunkte, noch ein Register über Siege und Niederlagen führte: Auf Tausenden von Tontäfelchen, die gewaltige Brände gehärtet und vor dem Verfall bewahrt hatten, fanden sich exakte Aufzeichnungen über Herden, Ernten, Steuern und Opfergaben. Hinweise auf bedeutsame historische Ereignisse und Triumphe sucht man vergebens. Dafür überliefern die Fresken an den ehemaligen Palastmauern das Bild einer auf spielerische Eleganz, weibliche Dominanz und urbane Selbstsicherheit ausgerichteten Welt. (Siehe Abbildung 1 in Tafelteil 1.)
Minoische Kolonien waren über den gesamten Mittelmeerraum verstreut. Ihre großen, schnellen Schiffe benutzten Wasserstraßen, die bis Zypern, Sidon, Tyros reichten und die gesamte Ägäis bis hin zu den afrikanischen und italienischen Küsten und dem Schwarzen Meer umfassten. Das minoische Experiment war also eine sehr ernsthafte Antwort auf die erfolgreiche Expansion der phönikischen Handels- und Kriegsflotten, die den gesamten nordafrikanischen Mittelmeerraum beherrschten. So gesehen war die minoische Kultur ein erster früher Vorstoß, eine Art europäischer Pionierversuch – und mit einer entführten phönikischen Prinzessin als Stammmutter geradezu eine, elegant verpackte, Kampfansage an den »Osten«.
Von Griechenland konnte zu diesem Zeitpunkt noch kaum die Rede sein. Man kann es eher als Spätfolge und Weiterentwicklung der minoischen Expansion bezeichnen. Oder, um es noch krasser und noch paradoxer zu formulieren: Griechenland wird im Nachhinein das minoische Experiment mitsamt der Geschichte Europés und ihrem Migrationshintergrund als entscheidenden Schritt der Ablösung vom dunklen Erbe der phönikischen Levante interpretieren. Eine ebenso kühne wie erfolgreiche Strategie, um neue Koordinaten zu etablieren.
Als Homer Jahrhunderte, Jahrtausende später in der Ilias Kreta als ein mächtiges Land im »dunkelwogenden Meer« mit »neunzig Städten« besang, war das minoische Kreta längst Geschichte. Griechenland hatte sein Erbe angetreten – oder weniger zurückhaltend ausgedrückt –, hatte es übernommen, gekapert. Das sprichwörtliche Labyrinth von Knossos mit dem schrecklichen Minotaurus war geknackt, das Ungeheuer tot. Und wiederum hatte ein griechischer Mythos Kreta als Folie zur Profilierung der eigenen, erst im Entstehen begriffenen Geschichte benutzt. Im Zentrum stand ein grauenerregendes Mischwesen, halb Stier, halb Mensch. Geschaffen von Dädalus, einem ebenso genialen wie skrupellosen Erfinder, der – aus Athen verstoßen – im Dienst des kretischen Hofes stand. Er konstruierte eine Kuhattrappe aus Holz, um die Zeugung dieses Kunstwesens zu ermöglichen.
Von wegen Archaik – weit mehr griechische Technologie vom Feinsten steht am Anfang dieses heroischen »Drachenkampfes«, in dem ein, wen wundert es, griechischer Held der frühen Zeit zum Retter wird: Theseus, eine der ersten der großen europäischen Projektionsfiguren, der einem Erlöser gleich alle feindlichen oder auch nur undefinierbaren Mächte abwehrt und besiegt, seien es die bedrohlichen Amazonen oder eben das minoische Ungeheuer.
Andere konkurrierende Kulturen wie die der Phöniker oder der Minoer mögen über spezielle und überaus elaborierte Kenntnisse technischer, nautischer, ökonomischer Art verfügt haben. Auch kann aufgrund der reichen Funde kein Zweifel an einem äußerst kultivierten, verfeinerten Lebensstil der minoischen Kultur sein. Was aber die eminente Fähigkeit der Griechen betrifft, die Lufthoheit im Bereich der Narration zu erobern, so ist sie singulär. Das Erfinden von Geschichten und Figuren, die die Taten der jungen griechischen Kultur legitimieren und in einen weltanschaulichen und damit auch weltpolitischen, weltgeschichtlichen Kontext stellen, ist ihre größte Kompetenz und der Schlüssel zum Erfolg.
Und dieser Theseus, der alles, was der werdenden hellenischen Kultur im Wege steht, erdrosselt, ermordet, in seinen Bann zieht oder zähmt, ist einfach göttlich gut erfunden. Nebenher verfügt der Superheld auch noch über die Fähigkeit, kreativ zu agieren. So gelingt es ihm, die Vielzahl der attischen Stämme zu einigen und der athenischen Vorherrschaft zu unterstellen. Dieser Zusammenschluss unter den Vorzeichen eines demokratischen Freistaats ist eine der vielen Taten, die Theseus zugeschrieben wurden (Plutarch). Sie dienten einemalleinigen Zweck: den kulturellen und politischen Zugriff der Griechen auf den Rest der ägäischen Welt zu begründen. Selbst das Schiff, mit dem er Kreta erobert und damit symbolisch dessen Bann gebrochen hatte, wurde folgerichtig in Athen wie ein Kultobjekt ausgestellt und über Jahrzehnte, Jahrhunderte bewahrt. (Siehe Abbildung 2 in Tafelteil 1.)
Das würdige Wrack wurde zum Ausgangspunkt einer der frühesten – typisch europäischen? – intellektuellen Diskussion, deren Ursprung Plutarch (um 45 – um 125) überliefert:
Das Schiff, auf dem Theseus […] ausfuhr und glücklich heimkehrte, den Dreißigruderer, haben die Athener […] aufbewahrt, indem sie immer das alte Holz entfernten und ein neues, festes einzogen und einbauten, derart, daß das Schiff den Philosophen als Beispiel für das vielumstrittene Problem des Wachstums diente, indem die einen sagten, es bleibe dasselbe, die anderen dies verneinten.1
Kult und Gedankenspiel – der Mythos wird zu einer Denksportübung, die bis in die Gegenwart unter dem Namen des »Theseus-Paradoxons« diskutiert wird. Das dadurch aufgeworfene philosophische Problem ist ein verbreitetes Beispiel in der Philosophiedidaktik und wird auch in der zeitgenössischen Ontologie vielfach diskutiert. Immer geht es dabei im Kern um die Frage, welche Veränderungen ein Objekt durchlaufen kann, bevor es seine Identität verliert, worin sein Wesen besteht – eine Frage, die das europäische Denken bis in die Moderne prägen wird.
Solch eine Diskussion, angelagert an ein angeblich »mythisches« Objekt – ist es übertrieben zu sagen, dies sei eine typisch »europäische« Denkfigur? Zugleich aber wurde mit diesen fast versponnen wirkenden Spekulationen knallharte, höchst pragmatische Weltmachtpolitik betrieben. Der Status des Schiffes, seine faktische Präsenz, steht der emblematischen Wucht der Arche Noah in keiner Weise nach. Ehrwürdige Ruine oder Neubau, Nostalgie und/oder Fortschritt – in dieser scheinbaren Episode scheint bereits einiges von dem gespeichert, was das in Antithesen und Synthesen fortschreitende Fluidum des europäischen Programms von diesem Moment an beinhalten wird.
Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Mit dieser Frage, die zugleich der Titel seines bekanntesten Buches ist, verstörte der französische Archäologe und Historiker Paul Veyne in den 1980er Jahren den Positivismus seiner Zeit, der von einem mehr oder weniger unreflektierten Faktendenken ausging. Er zeigte, dass es Geschichten sind, die unser Weltbild und unsere Wahrnehmung bestimmen, und zwar durchaus doppelbödige Geschichten. Einige davon haben wir gerade kennengelernt. Sie machen deutlich, wie konstruiert und fragil, wie skrupellos und kreativ unsere Art ist, Geschichte herzustellen, unsere Geschichte zu schreiben. Und auch wie virtuos wir damit umzugehen verstehen. Einerseits wandeln wir gläubig auf den Spuren der Alten und lesen jedes Gran Wirklichkeit fast andachtsvoll auf. Zugleich bezweifeln wir jeden Echtheitsanspruch und lösen die Illusionen in der Säure unseres kritischen Verstandes auf. Ein gewagter Ritt auf der Rasierklinge der sogenannten Wirklichkeit, sei sie göttlichen oder irdischen Ursprungs. Wir sind es, die über ihre Gültigkeit entscheiden.
Kreta war durch seine Überwindung zu einer Art attischer Außengrenze geworden, gleich weit entfernt von Nordafrika wie von der kleinasiatischen Küste. So bildete sich in der Zeit des allmählichen Niedergangs der minoischen Kultur um 1500 v. u. Z. ein neuer Herrschaftsraum heraus, der die Keimzelle dessen werden sollte, was wir jetzt Europa nennen. Das später in Schutt und Asche gelegte Troja gehört ebenso zu dieser Geschichte wie der ewige Kampf gegen die Phöniker und Karthager und vor allem gegen den Erzfeind, die Perser. Jene mächtigen Perser, die ein Jahrtausend später die Akropolis als Zentrum des werdenden Europa zerstören sollten, weil sie in der erstarkenden Macht aus dem Westen eine Bedrohung sahen. Wiederum hundert Jahre darauf sollte sich diese in Gestalt Alexander des Großen (356–323 v. u. Z.) personalisieren und konkretisieren.
Als selbsternannter neuer Herkules oder Theseus wird Alexander den in seinen Augen mittlerweile erstarrten »griechischen Traum« innerhalb weniger Jahre rauschhaft steigern und ihm in Form einer gigantischen Osterweiterung eine geradezu irrwitzige Dimension verleihen. Aus Makedonien, seinerzeit als Hinterhof des attischen Kulturraums verachtet, über den Olymp und weiter, sehr viel weiter, bis zum Himalaja sollte sein verwegener Weg im Namen eines hellenischen Weltreichs führen: die Levante, Theben, Kleinasien werden im Handstreich genommen, Persien, Ägypten und Teile Indiens folgen.
Der »Sohn des Zeus«, zu dem ihn das in der Antike hoch angesehene Orakel von Siwa erklärte, rächt sich zum einen an den Persern, zum anderen unternimmt er erste Versuche, die Grenzen zwischen Orient und Okzident zu verwischen beziehungsweise die Kulturen miteinander zu vermischen – zum Verdruss seines griechischen Heeres, das sich nicht mehr hinreichend gewürdigt sieht: Plötzlich will Alexander persisches Hofzeremoniell, integriert persische Soldaten in die Truppe, betet ägyptische Götter an, heiratet orientalische Frauen. Hatte man dafür gekämpft? War man dafür 18000 Kilometer durch Wüsten und Wälder marschiert? Einerseits die Ilias zu verehren, griechische Philosophen wie Aristoteles im Tross mit sich zu führen und zugleich das, wofür Griechenland stand, zu verwischen, zu vermischen, zu verraten – konnte das gut gehen?
Nun, wir wissen, es ging nicht gut: Befehlsverweigerung im Heer war an der Tagesordnung – bis hin zur Meuterei. Alexander starb unter ungeklärten Umständen mit gerade einmal 33 Jahren. Nachfolger, die das neue Weltreich hätten zusammenhalten können, waren nicht in Sicht. Es zerfiel innerhalb weniger Jahrzehnte.
Sollte Alexander alles richtig gemacht und sich dennoch geirrt haben? Die Antwort musste lauten: ja – und sie muss auch heute so lauten. Spätestens als Europa auf dominante Hochkulturen mit jahrhundertelanger Erfahrung und eigenen Traditionen stieß, also letztlich von Anfang an, hätte es lernen können, seinen Eroberungsimpuls unter Kontrolle zu halten. Die größte Kulturnation jener Zeit, Persien, aber auch Indien und Ägypten konnte man allenfalls überrollen – nicht jedoch wesensmäßig besetzen oder umdefinieren. Europa hat diese Lektion nie wirklich gelernt, und viele seiner späteren Irrtümer basieren genau auf diesem Mangel. Grenzen zu ziehen oder zu überwinden ist eine Sache, um seine Grenzen zu wissen eine andere, nicht weniger wichtige.
Hätte Alexander auch andere Möglichkeiten gehabt, als diesen gewaltigen Vorstoß nach Osten zu unternehmen? Was wäre gewesen, wenn? Wenn Alexander auf der Suche nach einem Reich, das für seine Ansprüche groß genug gewesen wäre, den geographisch nächstliegenden Entschluss gefasst hätte und von Makedonien aus in Richtung Nordwest marschiert wäre? Den Balkanraum überwunden, von der Adria aus Germanien und Gallien erobert und Europa eine völlig andere, auf das spätere Mitteleuropa fokussierte Kontur gegeben hätte? Hirngespinste? Sicherlich. Denn in den Köpfen der Vordenker und Mentoren Alexanders steckten andere Ideen. Allen voran ist hier der griechische Philosophiestar Aristoteles (384–322 v. u. Z.) zu nennen, den ein merkwürdiges Schicksal als Mentor des jungen Alexander ausgerechnet an den Hof des Duodezfürstentums Makedonien verschlagen hatte, nach Pella, keine zehn Kilometer von jenem Grenzort Idomeni entfernt, der mittlerweile durch die Blockade der Balkanroute eine makabre Berühmtheit erlangt hat.
Idomeni, ein Schicksalsort Europas? In gewissem Sinne durchaus. Denn es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Grenze zwischen Griechenland und seinen Nachbarn im Norden noch immer eine europäische Trennlinie markiert, an der sich seit mehr als 2000 Jahren Konflikte entzünden und manifestieren. Man denke nur an den verheerenden Streit um den bloßen Namen »Makedonien«.
Warum also marschierte Alexander so entschieden Richtung Osten? Seit den persischen Invasionen – 480 v. u. Z. waren Xerxes’ Truppen sogar in Athen einmarschiert – hatte sich ein traumatischer Abstoßungsprozess aufgebaut, aufgestaut, der sich irgendwann entladen musste. Wann, war nur eine Frage der Zeit. Die Gestaltwerdung Europas, eines griechischen Europa mit großen Ansprüchen, war gewissermaßen eine Reaktion auf das Überschwappen Persiens auf den »europäischen Raum«.
Alles, was sich in den darauffolgenden Jahrzehnten unter dem Namen der »Perserkriege« abspielte, war letztlich nichts anderes als ein einziger fulminanter Versuch, wieder ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte herzustellen. Alexander lag tendenziell richtig, aber er schoss gewaltig über das Ziel hinaus. Angefeuert und motiviert durch hellenische Ethnozentriker wie Aristoteles, jagte er den Perserkönig Dareios III. (um 380–330 v. u. Z.) in mehreren Schlachten buchstäblich vor sich her und stülpte für eine kurze Zeit von zehn Jahren Europa über Asien – man kämpfte buchstäblich am Hindukusch für das Europa der Zukunft.
Die Ikonographie der Kunstgeschichte schwelgte noch viele Jahrhunderte später in diesem phantastischen, scheinbar den ganzen Kosmos erfassenden Traum. Der Kampf des Ostens gegen den Westen gehört von Beginn an zu den Konstanten und Traumata des europäischen Denkens, ganz gleich, ob es um die Abwehr der Phöniker, der Perser oder – seit dem Aufstieg des Osmanischen Reiches – der Türken geht. Die entscheidende Weichenstellung jedoch war bereits Jahrhunderte früher vorgenommen worden. Der Schauplatz dieser Entscheidung: Troja. Der Name der zweiten Basisgeschichte Europas: Ilias.
2 Die Mutter aller Schlachten
Troja – ein Ort mit vielen Namen: Wilusa, Tarusia, Hisarlık oder auch (W)Ilios. Zugleich ein Ort mit überragender Bedeutung: Mutter aller abendländischen Schlachten gegen »den Osten« als Sammelbegriff für die seinerzeit mächtigsten Völker und Reiche der Welt: Ägypten, Persien, die Phöniker, Babylonier, Assyrer.
Stellen wir uns diesen verlassenen Ort an den Dardanellen zu Beginn des 1. Jahrtausends v. u. Z. vor. Ein von dürrer Macchia überwuchertes Ruinengelände, vielleicht eine kleine Weihestätte. Wenige Griechen hatten sich in der Umgebung niedergelassen – mag sein, dass man sich einiges von dem erzählte, was hier vor fünf oder sechs Jahrhunderten geschehen sein sollte. Eine große Schlacht der Panachaioi,2 der »Gesamtgriechen«, gegen eine der Militärmächte aus dem Osten. Möglicherweise gab es auch einige Sänger, die von diesem Krieg berichteten, darunter einen aus der kleinasiatischen Küstenstadt Smyrna/Izmir – Homer. Dass sein Epos, die Ilias, zum Markstein europäischen Selbstverständnisses werden sollte, war sicher nicht abzusehen, doch die Absicht, dem Chaos der Trümmerlandschaft »Troja« Sinn zu geben, es politisch zu deuten, ist unverkennbar.
Ob die Griechen an ihre Götter glaubten, weiß man nicht. Dass jedoch das Ereignis des Trojanischen Krieges sie zum ersten Mal im Verlauf der Geschichte wirklich vereinigt hatte, daran glaubten sie sicher mit vollem Recht. Zumindest taten sie das im Gefolge der um 730/20 v. u. Z. entstandenen Ilias, dem Gründungsepos der hellenischen Idee. Bis dahin gab es eine Reihe einzelner, heftig miteinander rivalisierender Stämme. Jeder Stadtstaat, jede Polis achtete streng auf ihre Autonomie. Erst das Unternehmen des großen Krieges – so die Interpretation Homers – ließ ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen. Aus Ioniern, Doriern, Thebanern, Korinthern, Mykenern wurden »Achaier« oder (unserem Sprachgebrauch näher) »Hellenen«. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl aus dem Geist eines gemeinsamen Feindbildes, das nicht schwer zu finden war: die auf der anderen Seite des Ufers, jenseits der Dardanellen, die Trojaner.
Aus vergleichsweise nichtigem Anlass – angeblich wegen des Raubes der sprichwörtlich schönen und charakterlich etwas ungreifbaren Helena3 – setzt sich der Tross Richtung Troja in Bewegung, der Auftakt zu einer für beide Seiten qualvollen zehnjährigen Belagerung der Stadt.
Wir alle haben die Ilias gelesen oder glauben, sie gelesen zu haben. Nicht, weil wir die Abläufe genau im Kopf haben, sondern weil sich ganz spezielle Gefühle mit den darin geschilderten Ereignissen verbinden, weil sie in uns vertraute Stimmungen evozieren: der Zorn des Achilles; die vergeblichen Warnrufe Kassandras; die Listen des Odysseus; Eifersüchteleien und Gemeinschaft, Rache und Solidarität, das Blut der Feinde, der Bratenduft der Opfertiere – die 15 000 Hexameter der Ilias sind Tausende von Jahren entfernt und scheinen in gewissen Augenblicken doch auch wieder hautnah zu sein. Denn im Grunde handeln sie von dem, was man die Psyche der Helden nennen könnte.
Homer beginnt an einer Schlüsselstelle und zieht uns unmittelbar ins Geschehen hinein. Im Lager der Griechen herrscht nach Jahren fruchtloser Versuche, die Burg zu erstürmen, die Pest. Die Stimmung der Truppe ist auf dem Hund. Kleinste Vorkommnisse führen zu Zerwürfnissen, Drohungen und Handgreiflichkeiten – so jämmerlich beginnt das Gründungsepos der abendländischen Kultur. Selbst die Götter scheinen überfordert. Man hat sich auf einen Krieg eingelassen, der ein gigantisches Fiasko zu werden droht. Die Flotte verrottet am Strand, die Hoffnung auf einen Sieg ist gleich null. Und nun entlädt sich der Frust auch noch nach innen, spaltet das Lager der Griechen. Achill weigert sich weiterzukämpfen. Falls er tatsächlich je stattgefunden haben sollte, der »Trojanische Krieg«, ein sonderlich erhabenes Schauspiel scheint er nicht gewesen zu sein. Ein Stresstest für die labile Gemengelage der eben erst entstehenden Griechen.
Ein Stresstest allerdings, den sie, wenn nicht glanzvoll, so doch suggestiv bestehen werden. Denn es kam nicht auf das an, was und wie dieser Krieg faktisch war, sondern auf das, was man daraus mythologisch, literarisch, politisch – eben auch durch dieses Epos – machen würde. Nämlich einen Testlauf für das Großprojekt der »Vereinigten Staaten von Griechenland«.
Natürlich hat Homer keine ideologische Auftragsarbeit erledigt. Aber sicher ist es nicht verfehlt zu sagen, dass die Ilias alles in sich aufnahm, was unausgesprochen in der Luft lag. Denn worum geht es? Um das Problem, das im Zentrum aller Vereinigungen und Zusammenschlüsse steht: den Ausgleich zwischen Einzelinteressen und den Bedürfnissen und Zielen des Kollektivs.
Die Gründung einer Union hat notwendigerweise einen Verlust an Autonomie für die einzelnen Clanchefs zur Folge. Aus Einzelkämpfern für eigene Interessen mussten Vasallen für die gemeinsame Sache werden: Achill, Agamemnon, Diomedes, Patroklos und Odysseus könnten unterschiedlicher kaum sein. In ihrem auf Dominanz ausgerichteten Verhalten war kollektives Handeln nicht angelegt. Es galt, etwas zu erlernen, was über ein Zusammenwirken zur Sicherung materieller Interessen (Rohstofflagerstätten, Handelsrouten) hinausgeht, ohne dass man bereits von einem gemeinsamen Ethos sprechen sollte.
Die Botschaft, die es untereinander wie nach außen zu kommunizieren galt, war pragmatischer und zugleich ideeller Natur. Es war darum zu tun, ein Wir-Gefühl einzuüben, ein Wir-Gefühl ohne Kollektivismus. »Wir – zusammen unschlagbar« könnte es lauten. Oder: »Wir – schwierig, aber menschlich«. Konsequent und effizient im Kampf gegen die Feinde. Ein starker Verband aus Individuen, jeder ein Unikat, eigensinnig, verrückt – mit einem Wort, »groß«.
Es geht um das Profil einer spezifischen Kultur des Miteinanders unter göttlichen Auspizien. Denn auch der Trojanische Krieg beginnt mit einem göttlichen Vorspiel im Himmel, also im Olymp. Die Götter verständigen sich über die Spielregeln dieses Experimentalkrieges. Und es ist kein Zufall, dass gerade die klügste und am strategischsten denkende Göttin, Athene, auf Seiten der Griechen steht.
Obwohl die Götter für den Verlauf des Krieges eine wichtige Rolle spielen, finden die entscheidenden Begegnungen und »Lektionen« im irdischen, zwischenmenschlichen Bereich statt. Dazu gehört eine jahrzehntelange Vorkriegsgeschichte mit so bekannten Episoden wie dem Paris-Urteil, dem Raub der Helena, der Opferung Iphigenies4 sowie die unter anderem in der Odyssee dargestellte Nachkriegsgeschichte mit ihren weiteren zehn Jahren Irrfahrten, Heimkehrerkatastrophen, Abenteuern. Kurz, ein gewaltiger Fundus an Grund- und Extremsituationen einer aristokratischen Kriegerelite wird suggestiv gestaltet und verdichtet.
Was die Ilias betrifft, so greift die Dichtung aus dem ebenfalls zehn lange Jahre währenden Kriegsgeschehen letztlich ganze vier Tage heraus – die Phase beginnt damit, dass Achill seine zornige Verweigerungshaltung überwindet5 und wieder in das Kampfgeschehen eingreift, und reicht bis zum Tod des Trojanerhelden Hektor, mit dessen Beisetzung die Ilias dann endet. Die bekannteste Episode – die List, die Stadt mittels des sprichwörtlichen Trojanischen Pferdes zu erobern – bleibt ausgespart. Fast scheint es, als wollte der Erzähler dem Gegner die letzte Stufe der Demütigung ersparen und sich mit der symbolischen Darstellung der Niederlage begnügen. Auch dies möglicherweise ein Zeichen in Richtung einer neuen Kultur, die sich anschickt, den fatalen Zirkel von Rache und Vergeltung zu durchbrechen, ein zentrales Thema auch noch Jahrhunderte später im griechischen Theater. So wie in den Persern (472 v. u. Z.) des Aischylos. Nach dem großen Sieg über den Erbfeind konzentriert sich das Drama ganz auf die Seite der Unterlegenen. Entsprechend endet auch die Ilias nicht mit der Verhöhnung des Gegners, nicht mit Triumphgeheul, sondern mit einem fast gespenstisch zurückhaltenden Abzug.
Wie denn bei aller Härte der Auseinandersetzung ein gewisser Respekt für den gleichwertigen Gegner mitschwingt. Gerade der Vorzeigheld, Achill, ist zwar einerseits von geradezu lustvoller Tötungsenergie besessen – er begnügt sich nicht damit, Hektor zu töten, vielmehr schleift er dessen Leichnam dreimal um die Feste, tötet gleichsam den Toten –, doch dann schenkt der Erzähler ausgerechnet dieser rabiaten Kampfmaschine eine fast anrührende Szene. Nach dem Kampf bemüht sich König Priamos, Hektors unglücklicher Vater, um den zerschundenen Leichnam seines Sohnes. Dazu begibt er sich ins feindliche Lager. Allein. Vorbei an den Vorposten bis zum Zelt des Achill. Der liegt, sichtlich mit sich zufrieden, nach dem Nachtmahl auf seiner Kline, Speisen und Getränke stehen noch in Reichweite.
Homer schildert, wie Priamos vor Achill auf die Knie sinkt, um »hin zum eigenen Mund des Sohnmörders Hände zu führen« (XXIV, 506).6 Der Erzähler berichtet über die emotional hoch aufgeladene Szene und spart Nuancen nicht aus. Achill »ergriff seine Hand und schob sachte von sich den Alten« (XXIV, 508). Danach brechen beide in Tränen aus. Der eine, um so an die Sohnesliebe von Achill zu appellieren, der andere, weil im Leiden des Priamos Erinnerungen an den eigenen Vater auftauchen. Dann springt der junge Held auf, zieht den Greis hoch und spricht zu ihm:
Ärmster, viel Schlimmes hast du schon ausgestanden im Herzen! Wie brachtest du’s über dich, zu den Danaerschiffen zu kommen, ganz allein, vor dir die Augen des Manns, der ich viele und gute Söhne dir habe getötet? Von Eisen muss wahrlich dein Herz sein! Aber komm, setz dich auf den Stuhl! Doch die Schmerzen, die wollen trotzdem wir ruhen lassen im Innern, so tief wir betrübt sind […]. (XXIV, 503–508)
Das mutige Verhalten seines Gegenübers nötigt dem sonst Gnadenlosen eine Art von sprödem Gefühl ab. Wobei auch ein gewisser Respekt vor möglicher göttlicher Unterstützung mitschwingt. Er lässt den Toten reinigen, salben, kleiden und hebt ihn eigenhändig aufs Lager.
Bruno Snell hat überzeugend gezeigt, dass die archaische Zeit ihre sehr eigenen Vorstellungen von Körper und Seele hatte.7 So gab es keinen Begriff, der den Körper als Ganzes bezeichnet hätte. Es gab ausschließlich Bezeichnungen für einzelne Glieder des Leibes. Zueinander addierte Teile, aufgelöst in geometrische Einzelelemente, wie man sie auf den Vasenmalereien des 7. Jahrhunderts sehen kann.
Ähnlich scheint es sich mit der Sprache der Gefühle verhalten zu haben. Die Seele kann man sich nur als thymos, als körperliches Organ denken, das von Schmerz wie von einer Waffe getroffen und zerrissen werden kann. Gemischte Gefühle gibt es allenfalls in einem mechanisch-physikalischen Sinn, nicht als gemischte Empfindung. Sappho wird Jahrhunderte später von »bittersüßem« Eros sprechen können8 – Homer kannte allenfalls den Kampf des Ich gegen den thymos. Ambivalente Gefühle wurden ebenso als von Übel betrachtet wie solche, die den Organismus wechselweise lähmen und erregen. Erst sehr viel später, in der Poetik des Aristoteles, wird man sich bemühen, Gefühle zu kanalisieren, zu unterdrücken und zu domestizieren.
In der Frühzeit des 8. Jahrhunderts, in der wir uns mit Homer befinden, waren die emotionalen Codes noch ungleich unmittelbarer und direkter. Nachdem die Leiche versorgt und das Lösegeld dafür abkassiert wurde, kehrt Achill in das Zelt zurück und fordert Priamos in aufgeräumtem Ton auf, nunmehr Trauer Trauer sein zu lassen:
»Also lass denn auch uns beide nun aufs Essen bedacht sein,
göttlicher Greis; dann magst deinen Sohn du wieder beklagen, ist er nach Troja gebracht; du wirst ihn viel noch beweinen!«
Sprach’s und sprang auf, der Pelide und schlachtete gleich drauf ein weißes Schaf, das häuteten dann und bereiteten zu die Gefährten, schnitten es fachgerecht klein und steckten es dann auf die Spieße, brieten es drauf mit Umsicht und zogen alles herunter.
Und Automedon griff nach dem Brot und verteilte in schönen Körben es auf dem Tisch. Doch das Fleisch verteilte Achilleus.
Und sie streckten die Hände aus nach den Speisen vor ihnen. (XXIV, 619–627)
Dann vereinbart man Waffenruhe, erlaubt die Bestattung des Toten – und legt sich schlafen. Danach geht alles sehr schnell. Das Epos endet, wie erwähnt, fast abrupt.
Ganz offenbar stehen wir an einem Wendepunkt der Geschichte – im Herbst der großen Heroen. Zugegeben, noch brauchte man sie, jedenfalls in diesem Krieg. Doch ihre Tage sind gezählt. Auch Achill wird den Triumph der Griechen nicht mehr erleben. Kurz nach Hektors Bestattung kommt er durch einen tückischen Pfeil zu Tode. Die entscheidenden Akzente setzen andere, die nicht durch kämpferische Aktionen, sondern durch Einfälle, List und Intellekt glänzen, allen voran Odysseus. Seine Idee bringt Troja zu Fall, und ihm ist nicht zufällig ein zweites, nicht weniger gewichtiges Epos gewidmet: die Odyssee.
Doch schon im Rahmen der Ilias spielt Odysseus eine zentrale Rolle. Immer wieder muss er die oft kindlich anmutenden Trotzreaktionen einzelner Protagonisten moderieren. Krisenmomente wie der im Zusammenhang mit Achilles eingangs erwähnte sind überaus häufig, und oft stehen die gekränkten oder frustrierten Antagonisten einander, glühend vor Wut, die »Augen dunkel umrändert«, gegenüber – bebend und auf offener Szene weinend.
Aber erst durch die Folge solch gemeinsam durchlebter emotionaler Einbrüche und ihrer Überwindung kann jenes Wir-Gefühl entstehen, das auf die Erfahrungen einer Gruppe zurückgeht. Letztlich sind diese Demütigungen, Rückzugsgefechte, Dominanz- und Versöhnungsrituale alles Stellvertreterkriege für die ungelöste Frage der Hierarchie. Selbst nach zehn Jahren gibt es in diesem Agglomerat aus zwanzig oder mehr Kontingenten, Ethnien, Stämmen noch keine feste Ordnung.
Man kann die Ilias auch als eine Art Laborbericht aus der Werkstatt der beginnenden Demokratisierung lesen. Natürlich noch nicht einer Demokratisierung im modernen Sinn. Doch werden in diesem Text Sprach- und Verhaltensregularien entwickelt, die zu einer neuen Grammatik bezähmter Gefühle führen könnten. Das Sich-Einüben in diese Grammatik eines gemeinschaftlichen Zusammenspielens ist ein zäher Prozess mit vielen Rückschlägen – zumal das heroische Alphatier Achilles es vorzieht, seiner Mutter unter Tränen sein Leid zu klagen, statt in den Kampf einzugreifen. So ist die Gruppe gezwungen, sich selbst zu organisieren, also über den Kampf zum Zusammenspiel zu finden. Und in der Tat werden wir Zeugen eines anderen, schöneren, geordneteren Kampfstils. Im vierten Gesang wird das Vorgehen der Griechen in Termini einer beängstigend ruhigen Naturgesetzlichkeit beschrieben:
Wie an der heftig tosenden Küste die Woge des Meeres sich erhebt, eine dicht auf die andere, vom Westwind getrieben – auf hoher See wölbt erst auf sie ihr Haupt, dann aber am Festland braust sie, sich brechend, gewaltig, und ringsum die Klippen türmt sie, vornübergebogen, sich hoch und speit aus den Salzschaum: So zogen damals dicht aufeinander der Danaer Reihen rastlos hin in die Schlacht. Es gebot den eigenen Leuten jeder der Führer; stumm gingen die Männer; man konnte da meinen, dass – in der Brust keine Stimme – ein solch großes Heer ihnen folgte, lautlos, vor den Kommandanten in Furcht, und an allen glänzte die Rüstung, mit der angetan in Reihen sie schritten. (IV, 422–432)
Anders die Darstellung der Gegner. Da hallt es nur so von vielfältigen Stimmen und Lauten:
Aber die Troer – wie Schafe im Hof eines schwerreichen Mannes zahllos stehen, wenn ihnen die weiße Milch wird gemolken, dauernd blökend, wenn die Stimme der Lämmer sie hören: So erscholl von den Troern ein wirres Geschrei durch das Heer hin. Denn nicht gleich war das Rufen aller noch einerlei Stimme, sondern gemischt war die Sprache, vielstämmig waren die Männer. (IV, 433–438)
Dort diffuses Gewimmel, hier geordnete Kampfkraft. Man spürt, da sollen Gemeinschaftsgefühle entfaltet und in Szene gesetzt werden. Auch Individuen können in diesen Situationen, unterstützt und gecoacht durch Götter, über sich hinauswachsen. So reißt keine Geringere als Athene dem angeschossenen Diomedes den Pfeil aus der Schulter und putscht ihn, den Verwundeten, zur Attacke auf den Kriegsgott Ares auf, der in den Reihen der Trojaner kämpft.
Die sprachliche Aufrüstung der Affekte entlädt sich in der Ilias als in Hexameterrhythmen gefasste Dauerstimulation. Das Testosteron aus Worten – ob vorgetragen, mitgesungen, vorgespielt, nachgefühlt – überträgt sich auf das Kollektiv und vermittelt über Zeit und Raum hinweg ein kulturelles Grundgefühl, eine unverwechselbare Signatur, die sich offensichtlich rapide verbreitete. Bildliche Zeugnisse der Schlacht um Troja finden sich bereits im 7. Jahrhundert in großer Zahl und stellen häufig Schlüsselsituationen des Epos dar.
Das alles hat noch nichts mit einer großgriechischen oder gar europäisch zu nennenden Weltsicht oder einem entsprechenden Wertehorizont zu tun. Der »europäische« Gedanke entwickelt sich nicht top down, sondern bottom up. Wie wenig ideologiegeleitet die Situation zunächst noch ist, zeigt sich schon daran, dass zwischen den Trojanern und Griechen weltanschauliche Unterschiede kaum auszumachen sind. Sie kämpfen zwar verbissen gegeneinander, und dabei treten leise Unterschiede der Einstellung zutage, ansonsten aber gelten hier wie dort in etwa dieselben Regeln und Normen. Es ist, als ob man eine Grenze ziehen wollte, um zwei weitgehend gleichartige Räume voneinander zu trennen. Um Territorien voneinander abzugrenzen und eine Balance der Kräfte im östlichen Mittelmeerraum herzustellen, ohne dabei bereits kulturelle Gegenwelten zu definieren.
Erst allmählich sollte sich dieser Raum der Ägäis – bislang eher Vakuum als Machtzentrum – mit Werten, die ihn definieren, füllen. Dass der Krieg nach Heraklit der »Vater aller Dinge« sei, darf man mit Fug und Recht bestreiten. Diese Funktion erfüllt eher das Phänomen der Grenze. Bereits das Ziehen von symbolischen Grenzen setzt Mechanismen in Gang, die Menschen in ihrem Selbstverständnis verändern können. Erst kommt die Grenze, dann die Ideologie – zumindest für Troja trifft diese Regel zu. Vielleicht nur eine durchschnittliche Festung am Rande des hethitischen Reiches, an der Küste Kleinasiens. Möglicherweise, nach Manfred Korfmann, auch eine Stadt oder eine Handelsstation. Nicht mehr, nicht weniger. Erst durch die Erfindung des »Trojanischen Krieges« wurde daraus ein Symbolort für einen neuen Herrschaftsraum von (über-)nationaler Bedeutung. Homers Text bildet diese Realität nicht einfach ab, sondern er stellt sie her. Das Troja, in dem die Ilias möglicherweise spielte, wurde weder von Schliemann noch von einem seiner Nachfolger entdeckt, und vielleicht lässt es sich im Gewirr der Schichten auch nicht mehr aufspüren. Mehr noch, möglicherweise ist es im Gewirr dieser Schichtungen aus Fakten und Fiktionen noch nie aufzuspüren gewesen. Wir wissen bis jetzt nicht einmal, ob die sensationellen Grabungen Korfmanns das »wirkliche« Troja ans Licht gebracht haben.9
Doch das tut letztlich nichts zur Sache. Denn längst hat sich der von Homer gestiftete »Mythos Troja« von dem vergleichsweise armseligen Trümmerfeld, das man vor Ort gefunden hat, gelöst und ist zu einer imaginativen Realität geworden. Ein Mythos, in dem sich die gesamte weitere europäische Geschichte spiegeln und in den sie sich einschreiben wird. Alexander der Große hatte die Ilias unter seinem Kopfkissen, Rom begriff sich als neues Troja, und nahezu der gesamte europäische Adel leitete seine Herkunft über alle möglichen und irrwitzigen Verrenkungen von Troja ab. Nur die Literatur war so frei und so frech, die Möglichkeit zu denken, der Trojanische Krieg hätte gar nicht stattgefunden (Jean Giraudoux).
3 Geburt der Polis
Die Männer, die aus dem Trojanischen Krieg zurückkamen, waren Verändernde und Veränderte. Von den Erfahrungen auf dem Schlachtfeld gezeichnet, passten sie nicht mehr ins soziale Gefüge der Orte, von denen sie ausgezogen waren, und blieben doch im Gedächtnis deren Leitfiguren. Agamemnon, der einst mächtige König Mykenes, wird, wie die Orestie schonungslos darstellt, unmittelbar nach seiner Rückkehr von der eigenen Frau erschlagen.10 Und Homer erzählt von den Irrfahrten des Odysseus, der sich zehn Jahre lang über die Meere quälen muss, bevor er nach Ithaka zurückkehren wird und dort seinen Sitz von Schmarotzern und Konkurrenten korrumpiert vorfindet. Zu diesem Zeitpunkt tragen bereits breit erzählende Epen die Geschichten der Helden um die mediterrane Welt. Auch wenige herausragende Dichterinnen wie Sappho (geboren 630 v. u. Z.) sind integraler Bestandteil dieser mediterranen Traumfabrik, in der Götter- und Menschengeschichten nicht immer harmonisch, aber mit großer Selbstverständlichkeit ineinanderfließen.
Mit der Erfindung des Dramas findet im 5. Jahrhundert v. u. Z. ein entscheidender Medienwechsel statt. Natürlich gab es Rituale und kultische Vorführungen schon früher und an anderen Orten. Aber es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass das Drama als zentrale öffentliche Form der kulturellen Selbstdarstellung ein Produkt der noch jungen griechischen Stadtstaaten war. Unterhalb des Burghügels der Akropolis, die steilen Mauern als Hintergrundkulisse, kann man seine Reste noch heute besichtigen: das Dionysos-Theater in Athen, eines der Zentren der neuen Entwicklung. Dort fanden im Dezember und März jedes Jahres mehrtägige »Dionysien« von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang statt. Im Verlauf dieser religiös und politisch akzentuierten Volksfeste kamen jeweils verschiedene Stücke zur Aufführung, die am Ende prämiert wurden.
Man spricht häufig davon, dass das Theater im alten Griechenland vor allem das Ziel hatte, die Bürger zu selbstständigem Handeln zu erziehen. Eine Formulierung, die die Brisanz und die Intensität dieser Aktionen nur bedingt zum Ausdruck bringt. Denn es ging darum, den gesamten Kosmos der Werte, der Verhaltensnormen und der Emotionen umzubauen, ihn polistauglich zu machen. Ein Projekt, für das es keine Vorbilder gab und das doch alternativlos war: Man musste Lebensformen entwickeln, die sich im Wissen um ihre heroische, mythologische Herkunft aus dem Schatten dieser Vergangenheit lösten und Räume schufen, die für die Gegenwart des 5. und 4. Jahrhunderts v. u. Z. bewohnbar waren. Man stand vor der Aufgabe, diesen neuen Lebensstil praktisch zu erarbeiten, ihn einzuüben und zu kommunizieren. Mit dem Theater (er-)fand man das optimal dafür geeignete Medium.
Wir sollten aber nicht den Fehler begehen, uns darunter irgendwelche drögen didaktischen Bildungslektionen vorzustellen, auch wenn insbesondere das klassische griechische Theater im Verlauf des 19. Jahrhunderts genau dazu gemacht wurde. Vor allem war das griechische Theater zu seiner Zeit ein Instrument, um Gefühle und Emotionen in Aufruhr zu versetzen.
Es ist kein Zufall, dass der Theoretiker der Agenda »Polis«, Aristoteles, die Tragödie als primär affektgeleitet definiert. Die Tragödie, heißt es im 6. Abschnitt seiner Poetik, sei eine »Nachahmung von Handelnden […], die Jammer [eleos] und Schaudern [phobos] hervorruft und hierdurch eine Reinigung [katharsis] von derartigen Erregungszuständen bewirkt«.11 Mit dem Begriff der »katharsis« wird dabei also die entscheidende Idee einer Reinigung nicht der Gefühle, sondern einer Befreiung von diesen Gefühlen beschrieben. Im Drama hat man die Möglichkeit, extreme Erfahrungen »gefühlsecht« und dennoch gefahrlos zu durchleben. Eine realistische Simulation als Ersatzspielplatz unerwünschter oder problematischer Gefühle.
Diese geniale Idee entwickelte sich selbstverständlich nicht von einem Moment auf den anderen, sondern allmählich, angereichert durch Erfahrungen und Strategien. Alle zielten darauf, das Publikum auf die richtige Art anzusprechen und zu formen. Zunächst war da im Wesentlichen nur ein Schauspieler im Wechsel mit dem Chor, bevor Aischylos (525–456 v. u. Z.), der älteste der großen griechischen Dramatiker, einen zweiten Schauspieler und damit einen Antagonisten einführte.
Von da an bestimmten vehemente Streitgespräche das Geschehen auf der Bühne, erregte und erregende Auseinandersetzungen, die den Chor als Repräsentanten des Volkes und Echokammer des Publikums zwangen, sich emotional zu positionieren, pro oder contra oder auch hin- und hergerissen. So kommt es nahezu automatisch zu neuen Formen der Auseinandersetzung und letztlich auch damit verbundener Werte. Wo Schlagabtausch mit Wörtern an die Stelle des Kampfes mit Schwertern oder Speeren tritt, gelten andere Spielregeln. Der Kampf der Argumente fordert andere Fähigkeiten als der mit Waffen, und an seinem Ende steht häufig nicht ein strahlender Sieger, sondern ein erträglicher Kompromiss: Prozess statt Blutrache. Das klingt sehr viel theoretischer und akademischer, als es sich auf der Bühne abgespielt haben mag, denn all diese Dramen sind letztlich rabiate Kämpfe unterschiedlicher Ordnungssysteme, erbitterte Kämpfe von Recht gegen Recht.
Mit den drei Teilen seiner Orestie12gewann Aischylos 458 v. u. Z. den Siegespreis, und bis heute vermögen gute Inszenierungen dieser Schlacht der Gefühle uns vom ersten Moment an in ihren Bann zu ziehen. Wenn man die Todesschreie des Agamemnon hört und später Klytämnestra mit blutigem Schwert auf die Bühne tritt, ist man entsetzt über die Tat und die scheinbare Skrupellosigkeit der Mörderin. Später, wenn sukzessive die Hintergründe der Tat ans Licht treten, kippt das Urteil, und man sympathisiert beinahe mit der, die man eben noch verfluchte.
Ganz offenbar geht es also nicht darum, Empathie, Mitleid mit den unglücklichen, geschundenen, geschlagenen, getriebenen Menschen aufder Bühne zu erwecken, noch nicht einmal darum, ihre individuellen Gefühle auszuleuchten. Nicht mit diesen höchst zwielichtigen Figuren soll man leiden. Es sind die Zustände, in die sie geraten, an denen man leiden soll. Es ist der Sog des Verhängnisses, von dem sie förmlich ergriffen werden, der uns erregt, wogegen etwas in uns sich sträubt.
Griechische Tragödie, das ist der öffentlich vorgetragene, öffentlich ausgetragene leidenschaftliche Versuch, sich aus den Zwängen archaischer Rituale, Rachemechanismen und Schicksalsobsessionen, an deren Fäden wir zu hängen scheinen, zu befreien. Denn alle, die wir in ihr Unglück stürzen sehen, müssen so handeln, wie sie handeln. Klytämnestra muss ihren Mann, der als Sieger von Troja zurückkehrt, töten, um den Berg an Schuld und Lügen, der sich zwischen beiden angehäuft hat, abzutragen. Orest muss Klytämnestra, seine Mutter, töten, um dem Gesetz seiner Götter und dem seiner Ehre zu genügen. Kassandra muss ihre Ahnungen herausschreien – wohl wissend, dass ihr auch jetzt, wie einst vor Troja, niemand glauben wird. Und im Wissen darum, was sie erwartet, betritt sie den Palast: Als erotisches Beutestück von Agamemnon mitgeschleppt, wird sie dort von Klytämnestra in einem Aufwasch mit entsorgt. Wer je auf die Idee kam, das attische Theater mit den Kategorien des Edlen und Schönen auch nur ansatzweise in Verbindung zu bringen, muss bildungstrunken, bildungsblind gewesen sein. Es gibt kaum eine härtere, rücksichtslosere Bewährungsprobe für Wahrhaftigkeit als dieses Theater. Die schreckliche und zugleich bis zu einem gewissen Grad banale Zwangsläufigkeit alles menschlichen Tuns wird ganz ohne heilsgeschichtlichen Hintergrund mit grausamer Pragmatik dargestellt. Durch das Halbrund der Theater hallt ein gewaltiger, bisweilen aus den Fugen geratener Klangkörper, starre, befremdende Masken, hohe Kothurne und eine nicht weniger harte, völlig unsentimentale, wenngleich hoch leidenschaftliche Sprache tun ein Übriges. Sie lassen uns zu Augen- und Ohrenzeugen werden – alles intensiv miterlebend und dennoch in emotionaler Halbdistanz.
Nirgends ist Kassandras oder Orests hoffnungslos zerrissener Dazwischen-Zustand je unprätentiöser und gnadenloser dargestellt worden als hier. Ihre Verflechtungen, ihre Mitschuld, ihre fatalen Erklärungs- und Rechtfertigungsversuche, der Fluch ihrer Berufung, der Fluch seiner Verfluchung, Hochmut, Verzweiflung: Alles, alles drücken diese zerberstenden, hohl hinter Sprachtrichtern tönenden, zwischen Bariton und Kopfstimme wimmernden, umbrechenden Stimmen im Zusammenspiel mit ihren bebenden Gliedern aus. Und man spürt mit jedem Wort, dass die Versuche, sich aus dem Bann der archaischen Gespenster zu lösen, auf schwankendem, blutigem Grunde stattfinden.
Und selbst wenn (wie im dritten Teil der Orestie) die didaktische Absicht dieses Pionierstücks eines eben entstehenden, der Not abgerungenen, demokratischen Systems einschließlich Urnengang und Abstimmung ins Zentrum rückt und das Ganze ideologisch zu werden beginnt, bleibt das Gefühl der Bedrohung erhalten. Mit nur einer Stimme mehr, bezeichnenderweise der Stimme der Schutzgöttin Athene, wird Orest schließlich vom Rat der Ältesten der Stadt, dem Areopag, in unmittelbarer Nähe des Theaters auf der anderen Seite der Akropolis, vom Vorwurf des Mordes freigesprochen und der Bann der Erinnyen gebrochen. Zumindest für jetzt und hier, wo der in diesem Moment wieder aufgenommene, entschuldigte Orest auf dem für ihn schwankenden Boden der Bühne steht.
Erleichtert, hochmütig, verzweifelt. Zwar wurde das tödliche Gesetz der Blutrache mit gewaltiger Kraftanstrengung in der griechischen Polis außer Kraft gesetzt – aber jeder im Rund mag gespürt haben, dass dieser Schuldschnitt das böse und das unschuldige Blut, das vergossen wurde, nicht einfach vergessen machen kann. Noch ist dies eine Welt, die sich nur einen Steinwurf entfernt von archaischen Ritualen, bluttriefenden Rachegöttinnen und einem alles zermalmenden Schicksal bewegt.
Das wagemutige Theater der griechischen Polis liebte und riskierte es, ob in Athen, Epidauros oder Dutzenden anderen Städten, den Blick in die Abgründe und Gefährdungen des eigenen, fragilen Systems zu werfen. Wie auch Sophokles (497/6–406/5 v. u. Z.) dies getan hat. Selbst und gerade in seinem zu Recht berühmtesten und von der Jury der Dionysien ausgezeichneten Stück, Antigone (442 v. u. Z.).
Eine todesmutige junge Frau, die ihr Leben einsetzt für – scheinbar ein bloßes Beerdigungsritual, in Wirklichkeit für den Kampf gegen ein in ihren Augen korruptes Herrschaftssystem. Eine selbstbewusste junge Frau stellt den Staat auf offener Bühne infrage. Sie will den Ernstfall. Sie schafft den Ernstfall. Sie ist der Ernstfall, entschlossen, die Grenzen des Systems zu erkunden und darüber hinauszugehen. Antigone vollzieht ihre Tat, die Bergung des Leichnams des toten Bruders, gegen den erklärten Willen des Herrschers, Kreon, fast unter den Augen der Macht.