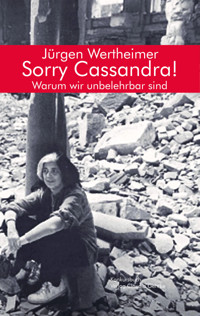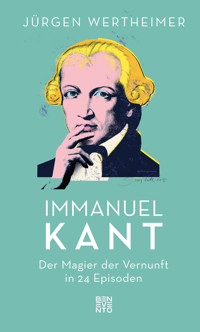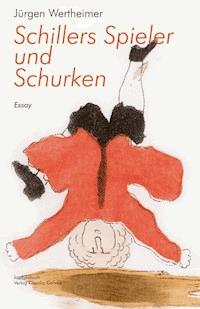Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet das, was unser Leben in eintscheidenden Momenten stabilisiert, soll Gefahren beinhalten? Doch Vertrauensmissbrauch gilt zu Recht als Sakrileg, oft kann man nicht sagen, ob ein Vertrauensvorschuss gerechtfertigt ist. Wann man einen Neurowissenschaftler danach fragen würde, wo denn der Sitz dieses Gefühls ist, - er müsste passen. Um sich der Komplexität des Vertrauens anzunehmen, haben sich der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer und der Gehirnforscher Niels Birbaumer zusammengetan. Der eine schaut tief in den Fundus der Literaturgeschichte, der andere in unser Gehirn. Kann der Vertrauenscode vielleicht doch entschlüsselt werden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen WertheimerNiels Birbaumer
VertrauenEin riskantes Gefühl
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
© 2016 Benevento Publishing,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH,
Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotorafie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Umschlaggestaltung: b3K design, Andrea Schneider, diceindustries
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN 978-3-7110-5164-6
Wenn ich vertrauen könnte
aber es ist kein Mensch dem ich vertraue
vertrauensselig
das ist abgeschlossen
vorbei
Thomas Bernhard: Der Ignorant und der Wahnsinnige
Ich bin natürlich froh darüber,
dass ich Ihnen vertrauenswürdig scheine,
aber unzufrieden damit,
dass Sie sich mir anvertraut haben.
Franz Kafka: Beschreibung eines Kampfes
Vorwort
Vertrauen, ein riskantes Gefühl? Ausgerechnet das Gefühl, das unser Leben in entscheidenden Momenten stabilisiert, soll Gefahren beinhalten?
Der Entschluss, sich dem Thema des Vertrauens ein weiteres Mal und auf ungewöhnlichem Wege zu nähern, ist das Resultat von Zweifeln. Zweifeln an der scheinbar nicht hinterfragbaren Akzeptanz des Vertrauens als sozialer Leitkategorie. Zweifel aber auch an der Möglichkeit, diesem vertrackten Etwas, halb Rettungsanker, halb Falle, mit den herkömmlichen psychologisch, therapeutisch, sozial, philosophisch oder religiös angelegten Mitteln näherzukommen. Auch anregende Studien wie die von Niklas Luhmann und Ute Frevert können stets nur Mutmaßungen anstellen, theoretische Konzepte, Definitionen anbieten. Was wirklich in uns vorgeht, wenn wir bedingungslos vertrauen oder misstrauisch zu werden beginnen, können sie nicht beschreiben.
Vielleicht, so dachten wir, kann ein Zusammenwirken von Hirnforschung und Literatur weiterführen. Deshalb dieser Versuch, einen Dialog zwischen zwei einander zunächst etwas fremd gegenüberstehenden Methoden zu versuchen. Die Gehirnforschung, zwangsläufig fixiert auf Eindeutigkeit, Nachweisbarkeit – die Literatur, nicht weniger zwangsläufig orientiert an Möglichkeiten, Fiktionen, Fantasien. Das Resultat dieses Experiments: möglicherweise weder ein Buch über Literatur noch eines über das Gehirn in seiner materiellen Form. Wohl aber eines über das geheime Leben eines Verhaltensreflexes, den wir »Vertrauen« nennen. Dabei sind wir nicht fixiert auf diesen Begriff. Das Phänomen des Vertrauens beziehungsweise des Misstrauens kann sich in den unterschiedlichsten Gestalten manifestieren und auf allen möglichen Ebenen zeigen. Angst, Apathie, Ekel, Aggression, Gewohnheit, Rituale – die Krake des Vertrauens erfasst den ganzen Körper und ist nur sehr bedingt lokalisierbar.
Um den Erscheinungsformen des Vertrauens näherzukommen, bedarf es keiner Ausflüge in die Randzonen extremer Gefühlslagen: Paranoide und schizophrene Verhaltensweisen stehen nicht im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Uns liegt daran, das Brisante im Bereich des sozial Akzeptierten zu untersuchen, nicht so sehr die extremen Ränder unserer Affekte.
Vertrauen ist ähnlich wie Mitleid ein Gefühl, das vielleicht nicht »sexy«, aber überlebenswichtig ist.
Jürgen WertheimerNiels BirbaumerAugust 2016
Kapitel 1 Einige Grundlagen und etwas Theorie
Am 24.3.15 startet Germanwings-Flug 4U9525 von Barcelona nach Düsseldorf mit 150 Passagieren an Bord um genau 10:01 Uhr. 40 Minuten später wird die Maschine an einem Felsen der französischen Alpen zerschellen – offenbar vom Copiloten selbst ins Verderben gesteuert. Es gab keine Überlebenden dieses Crashs. Im Glauben an die Zuverlässigkeit der Piloten hatten sich alle einem todessüchtigen Selbstmörder anvertraut.
Silvesternacht 2015/16, Domplatte Köln. Ohne Vorwarnung verwandelt sich eine ausgelassene Neujahrsfeier unter freiem Himmel in eine erschreckende Treibjagd auf junge Frauen. Dutzende von ihnen werden eingekreist, angepöbelt, sexuell angegriffen. Die Polizei steht den unerwarteten Geschehnissen hilflos gegenüber. In der für sie selbstverständlichen Annahme, sich auf diesem Platz frei und gefahrlos bewegen zu können, hatten die Frauen sich einer nicht erwarteten Gefahr ausgesetzt.
Ein Paar an einem Tisch in einem Lokal. Man unterhält sich gedämpft, lauernd. Sie, mit leise empörter Stimme: »Du vertraust mir nicht!«. Seine Antwort kommt zögerlich und zugleich etwas süffisant: »Ich liebe Dich. Vertraut hab ich Dir nie.«[1]
Drei Beispiele aus unterschiedlichen, öffentlichen wie privaten Lebensbereichen, die zeigen, dass unser tägliches Leben und unsere soziale Ordnung auf Vertrauen beruhen. Kaum ein Tag, an dem nicht von einer großen Institution, sei es eine Automarke oder eine Partei, um Vertrauen geworben würde. Besonders im Moment der Krise. Diese Werbungsversuche zeigen aber auch, dass kaum ein Gefühlszustand trügerischer und gefährlicher ist als der des Vertrauens. Im positiven Fall verbindet er Menschen und stabilisiert die Gesellschaft. Im negativen Fall, wenn Vertrauen enttäuscht oder gebrochen wird, verwandelt sich der Akt des Vertrauens in ein Katastrophenszenarium. Jedem geglückten Betrug geht nicht zufällig ein Akt des Vertrauens voraus. Erfolgreiche Betrüger sind großartige Vertrauensdarsteller, müssen es sein, um ihre Opfer dazu zu bewegen, ihnen Vertrauen zu schenken.
Aus diesem Grund haben sich ganz unterschiedliche Wissensbereiche immer wieder intensiv mit dem Phänomen des Vertrauens beschäftigt, allen voran die Experimentalpsychologie. Ihr ging und geht es vor allem darum, die wichtigsten Determinanten (Ursachenfaktoren) auf psychologisch-sozialer Ebene präzise herauszuarbeiten. Diese psychologischen Erkenntnisse bilden die Grundlage für eine neurobiologische Theorie des Vertrauens. Ohne eine präzise verhaltenspsychologische Definition von Vertrauen lassen sich die entscheidenden Hirnfaktoren nicht isolieren. Die Hirnforschung hat sich bisher wenig mit dem Phänomen befasst, nicht aus Ignoranz oder Desinteresse, sondern wegen der Schwierigkeit, die verschiedenen Aspekte und Ebenen des Phänomens in hirnphysiologischen Experimenten zu operationalisieren.
Vertrauen fassen und Vertrauen fordern
Obwohl man zwischen den Anfangsphasen des Vertrauens gegenüber Fremden und den späteren Konsolidierungsphasen vertrauensvollen oder misstrauischen Verhaltens unterscheiden muss, ist erstaunlich, dass in allen psychologischen Untersuchungen, die sich mit dieser Besonderheit des Vertrauens befassen, das Vertrauen gegenüber Fremden eine Verhaltenstendenz darstellt, die, wenn sie einmal entwickelt wurde, über die gesamte Lebensspanne relativ stabil bleibt. Dasselbe gilt für Misstrauen und die Angst vor Vertrauensbruch. Auch diese Eigenschaften bleiben erstaunlich stabil.
Wichtig für unser Verständnis und die Analyse von Vertrauen ist die scheinbar triviale Tatsache, dass Vertrauen immer das Resultat einer Interaktion zwischen den Eigenheiten einer spezifischen Vertrauenssituation und den individuellen Charakteristiken der vertrauenden Person darstellt. Dies bedeutet, dass man auf der einen Seite annehmen muss, dass Individuen ihr Vertrauen an situationsspezifischen Variablen, wie zum Beispiel der Vertrauenswürdigkeit des oder der Anderen, ausrichten, und Vertrauensverhalten somit variiert. Auf der anderen Seite steht die Tatsache, dass Personen eine relativ stabile Verhaltenstendenz gegenüber Fremden und Neuem aufweisen und sich somit in verschiedenen Situationen stets in ähnlicher Weise verhalten.
Diese Interaktion zwischen den stabilen Eigenheiten des Individuums und den situationsspezifischen Auslösern gilt es nun quantitativ zu beschreiben und in ein theoretisches Modell einzubauen, das erlaubt, sowohl situationsspezifisch als auch personenspezifisch Vertrauensverhalten vorherzusagen. Bei derartig komplexen psychologischen Verhaltenskategorien wie der des Vertrauens ist natürlich nicht ein spezifischer Faktor verantwortlich, sondern Vertrauensverhalten ist ein Zusammenspiel vieler situativer und persönlicher Determinanten. Unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften spielen dabei eine Rolle.
Wenn man einen Neurowissenschaftler fragen würde, wo denn der Sitz des Vertrauens ist, brächte man ihn in Schwierigkeiten. Der Versuch, dieses Grundgefühl menschlichen Zusammenhalts in irgendwelchen aktivierten Gehirnsegmenten anschaulich zum Aufleuchten zu bringen, würde sich als Fehlschlag erweisen. Was im Fall von »Liebe«, »Angst« oder »Glück« so gut zu funktionieren scheint – kaum eine Zeitschrift, die nicht die berühmten bunten Gehirnscans zeigen würde –, misslingt im Fall des Vertrauens gänzlich. Denn die beeindruckenden bildgebenden Verfahren erklären nicht, was diesen Lichtblitzen wirklich zugrunde liegt, was sie bedeuten und wie sie mit anderen, darstellbaren Hirnaktivitäten verbunden sind.
Was also tun, um dem Urphänomen »Vertrauen«, dem Phänomen »Urvertrauen« näherzukommen? Auch begriffsgeschichtliche Annäherungen führen nicht wirklich weiter, beschreiben sie doch immer nur unsere diskursiven Vereinbarungen, Sprachregelungen, mittels derer wir uns über die jeweiligen kulturellen Normen in Bezug auf das Phänomen Vertrauen – sozusagen bei Tageslicht – verständigen. Über die dunkle, begriffsabgewandte Seite dieses Gefühls hinter den Gefühlen wissen wir dennoch zu wenig.
Missbrauch, Misstrauen und Zerstörung von Vertrauen prägen unser Handeln. Dennoch rangiert der Begriff des Vertrauens auf dem Bazar recycelbarer Werte nach wie vor an oberster Stelle: Kaum eine politische Rede, in der es nicht vehement gefordert oder vorausgesetzt würde. Was diese rhetorische Vertrauenssüchtigkeit so skurril erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass sie inmitten einer Welt stattfindet, der man jegliche Vertrauensseligkeit gründlich ausgetrieben hat: weltweite Bespitzelung, frei flottierender Datenhandel und die Kriminalisierung jener, die dagegen protestieren, sprechen eine deutliche Sprache. Doch die Gebetsmühle der Vertrauensbeschwörungen dreht sich unablässig weiter. Straff organisiertes »Controlling« rund um die Uhr, aber keiner, der sich entsprechend der alten Apparatschik-Losung des »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« dazu bekennen würde. Im Gegenteil, ein ominöses »Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser« scheint inzwischen die Losung des Tages zu sein, selbst die »Controller« verlangen Vertrauen in die Art ihrer Vorgehensweise.
Ob die Alltagsweisheit eines skeptischen »Trau, schau, wem?« oder die patriotische Losung eines pathetischen »In God we trust«, ob Gottvertrauen, Urvertrauen, Vertrauensvorschuss – das diffuse, aber starke Gefühl des Vertrauens ist der Kitt, der die Welt im Innersten zusammenhält. Umgekehrt ist fehlendes Vertrauen oder glatter Vertrauensbruch wie ein Gift, das organische Zusammenhänge zersetzt und Bindungen auflöst. Liebe, Beruf, Politik, Religion – weltweit beruhen Ordnungen auf Vertrauen und vertrauensbildenden beziehungsweise Vertrauen suggerierenden Beschwörungsversuchen.
Wir sollten den Ursprüngen unserer nachweisbaren Vertrauenssüchtigkeit nachgehen, um etwas über uns selbst zu erfahren. Denn auch dies ist sicher: Kaum ein anderes Gefühl ist so trügerisch und undurchschaubar wie das des Vertrauens. Vertrauen, ein Gefühl, das aus Gefühlen besteht, kann extrem trügerisch sein. Blindes Vertrauen kann für den Vertrauenden der direkte Weg in die Hölle sein, wobei das Prekäre genau darin besteht, Vertrauen auch gegen den äußeren Anschein bedingungslos zu investieren, ja investieren zu wollen. Und sei es nur, um sich nicht dem Vorwurf kleinlichen Misstrauens, des schäbigen Gegenspielers des Vertrauens, auszusetzen. Schnell kann das gute Gefühl der Treue, des Vertrauen-Wollens in Selbstzerstörung münden, eine leere Wahnvorstellung, die den Vertrauenswilligen der Gefahr aussetzt, zum Opfer zu werden.
Vertrauensverhältnisse sind Privatsache, sind eine höchst persönliche, ja intime Angelegenheit. Zugleich aber beinhalten sie auch eine eminent wichtige politische Dimension. Der bloße Akt der Vertrauensspende ersetzt oder schafft Werte. So wie der Akt des Vertrauensentzugs sie zerstört. Vertrauen ist mithin der Stoff, aus dem gesellschaftliche Bindungen bestehen. Auch wenn es sich nur um Wunschbilder handeln sollte. Es stellt sich sogar die Frage, ob alles Vertrauen letztlich bloße Projektion ist, also eine Illusion, darstellt, die eine Art Ordnungs- und Sinngefüge vermittelt. Religion, Politik, Wirtschaft – alles menschliche Handeln unterliegt dem Kalkül des investierten und erworbenen Vertrauens.
Die Dynamik der Vertrauensverhältnisse ist gewaltig und sie vermag es, paradoxe Reaktionen hervorzurufen, etwa Vertrauen in Momenten zu fordern, in denen tiefstes Misstrauen angebracht wäre, oder aber Vertrauen grundlos zu entziehen, dort, wo Vertrauenswürdigkeit angemessen erscheint. Der Akt des Vertrauensbruchs wird noch immer als gravierender Verstoß gegen die gesellschaftliche Ordnung betrachtet, obwohl jeder davon ausgeht, dass Vertrauensbrüche ständige Begleiter des Alltags sind. Vertrauen, Vertrag und Versicherung stehen in einem spannenden, dialektischen Verhältnis zueinander.
Die Vertrauensprogrammierung ist so gesehen Teil eines subtil kodierten Machtsystems. Teil eines Machtsystems ohne Inhalte und Werte. Im Gegenteil: Unreflektiert betrieben, kann die Forderung nach Vertrauen sogar Teil eines perfiden Selbstentmündigungsprozesses sein.
Umso wichtiger ist es, die Grammatik des Vertrauens zu erlernen, ihre Rituale ohne ethische Wunschvorstellungen oder ideologische Verblendungen zu studieren. Es müsste ein Labor geben, in dem man Wirklichkeit und Wirklichkeitswahrnehmungsprozesse gefahrlos und dennoch hautnah durchspielen kann. Es müsste ein Archiv geben, in dem man Szenarien des Vertrauens dokumentiert fände. Nun, es gibt solch ein Archiv, dessen Wert als unendlich reiche Quelle für die Entschlüsselung der Vertrauenscodes wir unverständlicherweise bislang wenig nutzen: das der Literatur.
Das Archiv der Literatur
Über die Zeiten hinweg, kulturübergreifend und in allen nur erdenklichen Facetten spiegelt die Literatur die Szenarien unserer vertrauensbildenden und vertrauenszerstörenden Verhaltensweisen, sie spielt sie durch, akribisch und zumeist auch ohne ideologische Scheuklappen. Sie durchleuchtet den dubiosen Mythos des Urvertrauens ebenso wie pragmatisches Vertrauenskalkül, dringt in die intime Innenwelt sprachlosen Vertrauens ebenso ein wie in die Paranoia grenzenlosen Misstrauens. Sätze wie »Wenn wir immer wüssten, wem wir trauen können«, »Du hättest mir nicht misstrauen sollen«, »Jetzt müssen Sie mir vertrauen« oder aber »Du darfst niemandem vertrauen« durchziehen unseren Alltag und zeigen unsere Unsicherheit, Widersprüchlichkeit und Bedürftigkeit im Umgang mit den Koordinaten des Vertrauens. Literarische Texte sind präzise Dokumentationen jener Verläufe, die unser Handeln bestimmen. Ein Blick in sie ersetzt manches Gehirn-Scanning – ist, wenn man so will, eine Art Gehirn-Scanning mittels Tinte und Papier.
Nur die Literatur verfügt über den Grad an Komplexität – man kann auch sagen, an Wahrheitsversessenheit –, um dem Phänomen des Vertrauens auf Umwegen näherzutreten. Historische Quellen, religiöse Schriften, politische Bekundungen, theologische Interpretation, sie alle verfolgen letztlich ideologische Ziele, innerhalb derer das Vertrauen eine ganz bestimmte, meist strategische Rolle spielt. Vertrauen stellt jedoch einen hochkomplizierten, diffizilen Zwischenzustand dar, der auf vielen anderen Gefühlen aufbaut, wächst oder verdorrt. Und nur, wenn man bereit ist, das gesamte Gefüge unserer emotionalen Ausstattung zu erkunden, hat man eine Chance, die Gesetze dieser Macht zu verstehen. Auf dem Umweg über Hass und Liebe, Angst und Ekel, Scham und Trauer, Melancholie, Depression oder Gelächter kommt man schließlich dem Kern jenes Systems näher, das man pauschal mit dem Begriff des »Vertrauens« belegt. Denn nichts wäre verfehlter als die Annahme, Vertrauen sei per se erwünscht und selbstverständlich.
Erinnern wir uns an den Fall »Effi Briest«, der bekanntesten Heldin Theodor Fontanes. Erst kurz vor ihrem Tod als Ausgestoßene findet sie die Worte, um die heillose Verstrickung in die Strategien ihres Mannes zu durchbrechen. Diesem ist es gelungen, ihre Ängste als Mittel der Domestizierung einzusetzen. Mittel hierzu war der Einsatz einer ganzen Reihe von perfiden Techniken, die systematisch zur Zerstörung jeder Vertrauensgrundlage führten. Nur auf diesem Boden war es ihm möglich, eine Unkultur des Beschuldigens, der Unmöglichkeit des Verzeihens, aufzubauen, die zur Vernichtung des anderen führen muss.
Fragt man nach den Gründen für diese planmäßige Zerstörung von Vertrauen, kann man nur zu einem Schluss kommen: Vertrauen als Ausdruck individuellen Empfindens schwächt Systeme, die auf Dominanz ausgerichtet sind. Was als moralische Schaufenstertugend erwünscht ist, wird als persönliches Gefühl zum Problem. Ein Problem, das gelegentlich in ein Labyrinth scheinbar widersprüchlicher Verhaltensweisen führt. Ein Blick in die zugrundeliegenden psychologischen Faktoren zeigt jedoch, dass hinter dem Chaos unserer Reaktionen eine durchaus geregelte Ordnung zu erkennen ist. Und diese Ordnung zu entschlüsseln vermag sicher nicht die Literatur allein. Der Blick der Hirnforschung kann heute in verborgene Zonen unseres Verhaltens eindringen und Dinge sichtbar machen, die wir bisher in dieser Klarheit nicht erkennen konnten. Zur Verdeutlichung der kognitiven Prozesse finden Sie im Anhang vier Abbildungen, auf die wir uns im folgenden Text beziehen.
Unsicherheit, Unwissen, Angst
Zwei wesentliche psychologische Aspekte zeichnen alle Vertrauenssituationen aus: Zum einen Unsicherheit und Risiko: Der Vertrauende hat keine Kontrolle über das Verhalten dessen, dem er vertraut. Zum anderen basieren Vertrauenssituationen darauf, dass die Person, der man vertraut, im Interesse des Vertrauenssuchenden handelt. Wer einem anderen vertraut, geht stets das Risiko ein, betrogen und verletzt zu werden (vgl. Abb. 1).
Zum ersten Faktor, dem der Unsicherheit und des Risikos: Vertrauen ist nur dann notwendig und entsteht nur dann, wenn Informationen über die Absichten des Gegenübers fehlen, wenn man also das Verhalten des Gegenübers nicht vorhersagen kann. Ist es völlig vorhersagbar, benötigt man weder Vertrauen noch Misstrauen. Vertrauen wird primär in Situationen benötigt, die von sozialer Unsicherheit geprägt sind. Dies impliziert natürlich immer auch das Risiko des Betrugs, sodass der Vertrauende stets die Wahrscheinlichkeit positiver oder negativer Konsequenzen seines Vertrauens abschätzen muss. Dieser Vorgang des Abschätzens möglicher Konsequenzen ist in der Psychologie und in der Neurowissenschaft gut erforscht und kann sehr schnell unbewusst oder auch rational bewusst erfolgen.
Aber selbst dann, wenn aus dem Vertrauenschenken mit Sicherheit positive Konsequenzen zu erwarten sind, bleiben Betrug oder Enttäuschung immer der Zwilling des Vertrauens. Zwischenmenschliches Vertrauen ist also immer mit einer riskanten Entscheidung verbunden, da man sich in einer unsicheren Situation von den Verhaltensweisen eines anderen abhängig macht. Ob man jemandem vertraut, hängt also von der Erwartung ab, ob die andere Person in einer positiv-unterstützenden Reaktion handeln wird, obwohl die Möglichkeit besteht, dass dieses Vertrauen durch Betrug enttäuscht wird. Unsicherheit, Risiko und Erwartung bestimmen also nicht nur das Vertrauen, sondern steigern auch die Verletzbarkeit.
Das Verständnis von Vertrauensprozessen wird dadurch erschwert – und dies lässt sich an vielen literarischen Beispielen illustrieren –, dass die kognitiven Erwartungen und Vorstellungen und das reale vertrauensvolle Verhalten nicht unbedingt korrelieren müssen. Das bedeutet, dass eine Person auf Vorstellungsebene subjektiv jemandem vertrauen und gleichzeitig ein Verhalten zeigen kann, das das Gegenteil anzeigt. Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall. Dies macht dann auch die Analyse der hirnphysiologischen Vorgänge schwierig, da neuronale Korrelate der kognitiven Prozesse des Vertrauens, vor allem der Erwartung und der Unsicherheitsreduktion, anders aussehen als die Prozesse, die dem realen motorischen Verhalten in Vertrauenssituationen zugrunde liegen. Die drei zentralen Komponenten des Vertrauensverhaltens sind also Vertrauenserwartung, Risiko- und Verlustaversion und Betrugssensitivität.
Abb. 2 spezifiziert nochmals die wichtigsten Ursachenfaktoren für Vertrauensverhalten gegenüber den in Abb. 1 dargestellten generellen Einflussfaktoren. In Abb. 2 sind im mittleren Abschnitt die drei Hauptkomponenten von Vertrauensverhalten dargestellt. Links sind die drei bisher isolierten Persönlichkeitsfaktoren, die Vertrauensverhalten determinieren, dargestellt, nämlich Fairness/Gerechtigkeitssinn/Ehrlichkeit/, Angst/Furcht und Forgiveness/Bereitschaft zu verzeihen. Die drei zentralen Komponenten von Vertrauensverhalten sind I Vertrauenserwartungen, II Risiko- und Verlust-Aversionen und III Betrugssensitivität. Die stabilen Persönlichkeitseigenschaften interagieren mit drei situativen Ursachenfaktoren, nämlich Hinweisreize für Vertrauen, vorausgegangene Vertrauenserfahrungen und soziale Projektion des eigenen Vertrauens auf andere. Auf der Grundlage der Vertrauenserwartungen wird die Wahrscheinlichkeit für Risiko und Verlust eingeschätzt und auf der Grundlage der potenziellen Betrugssensitivität wird ebenfalls dieser Faktor von Risiko und Verlust abgeschätzt: All diese Faktoren werden dann auf der Reaktions-Ausgangsseite zu dem gewählten Vertrauensverhalten kondensiert.
Abb. 2 zeigt auch, wie auch in den literarischen Beispielen deutlich wird, die zentrale Rolle, welche die Angst in Risikosituationen für die Entstehung von Vertrauen spielt. Insofern hat Angst als die persönliche Eigenschaft einer grundsätzlich abwehrenden Einstellung gegenüber Unsicherheit (Risiko-Aversion) und gegenüber potenziellen Verlusten eine zentrale Bedeutung in der positiven Motivation, anderen zu vertrauen. Diese Risiko- und Verlustaversion ist eng mit der Persönlichkeitseigenschaft »Angst und Furcht« verbunden und ist daher für die individuellen Unterschiede im Vertrauensverhalten wesentlich mitverantwortlich.
Die Erwartungen gegenüber dem Verhalten der Anderen sind wesentlich von den Hinweisreizen für positives Vertrauen oder Vertrauensbruch abhängig. Genauso bestimmen vorausgegangene Vertrauenserfahrungen und soziale Projektion des eigenen Vertrauens auf den anderen diese Erwartungen. In jedem Fall hat die vertrauende Person den potenziellen Verlust zu akzeptieren. Diese Akzeptanz hängt auch von der Sensibilität für solche Verlustereignisse ab, die selbst wiederum mit der Persönlichkeitseigenschaft »Bereitschaft zu verzeihen« zusammenhängt, die in fast allen Persönlichkeitstheorien eine zentrale Rolle spielt. Die Tendenz zu Risikovermeidung und die Vermeidung von Verlust können miteinander korrelieren und gemeinsam Vertrauensverhalten bestimmen. Eine Person kann in ihrem Vertrauensverhalten durch die Angst, ein Risiko einzugehen, determiniert sein oder durch die Angst vor dem Verlust einer erwarteten positiven Konsequenz. Insofern muss man für die Vorhersage von Vertrauensverhalten zwischen Vermeidung von Risiko (nach Abschätzung und Erwartung der Vertrauenswürdigkeit entsprechend der Vertrauenssituation) und der Angst vor Verlust unterscheiden, welche primär von der Abschätzung des Betrugs und der Sensibilität gegenüber Betrug bestimmt wird. Beide, Aversion gegenüber Risiko wie auch Aversion gegenüber Verlust, hängen eng mit Ängstlichkeit zusammen.
Während also die Angst vor Risiko und die Angst vor Verlust sowohl als dauerhafte stabile Eigenschaften wie auch als situative Variablen schwer zu erfassen sind, fällt es leichter, die Entwicklung und den Erwerb von Erwartungen in die Vertrauenswürdigkeit zu messen: Dazu gehören im Prinzip alle beobachtbaren Hinweisreize in der Umgebung des Vertrauenssuchenden und natürlich dessen, der Vertrauen mehr oder weniger ausstrahlt. Der Gesichtsausdruck spielt eine große Rolle und wurde ebenso untersucht wie die Körpersprache und Eigenschaften von Stimme und Sprechen.
Obwohl Merkmale wie Gesichtsausdruck, Körpersprache und andere nonverbale Signale als entscheidend angesehen werden für die Korrektheit der Vorhersage der Vertrauenswürdigkeit, taugen diese Merkmale in der täglichen Realität kaum zur Abschätzung der Vertrauenswürdigkeit. Trotzdem sind wir subjektiv weiterhin davon überzeugt, dass sie eine große Rolle spielen und unsere Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit aufgrund von Gesichtsausdruck und Körpersprache bleibt erstaunlich stabil und sicher, auch wenn die reale Vorhersagegüte damit nicht zusammenhängt. Interessant ist auch, dass viele glauben, die Abschätzung der subjektiven Absichten des anderen, also Empathie, sei eng mit Vertrauen verbunden und würde den Vertrauenszuwachs oder -abfall wesentlich mitbestimmen. Faktisch zeigen aber die meisten Experimente, dass die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und mitzuempfinden, in der praktischen Vorhersage der Vertrauenswürdigkeit kaum eine Rolle spielt.
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Abschätzung der Vertrauenswürdigkeit aus Hinweisen über die Reputation des oder der Vertrauenspendenden. Auch hier sind die Versuchspersonen davon überzeugt, dass Informationen über die Reputation äußerst wichtig für das Fassen von Vertrauen sind, was subjektiv auch zutrifft, praktisch allerdings spielt reale oder eingeschätzte Reputation in der Abschätzung des Verhaltens des anderen in einer Vertrauenssituation keine bedeutsame Rolle.
Anders ist die Situation bei den Gedächtnisvariablen, also der Abschätzung der Vertrauenswürdigkeit aufgrund vorausgegangener Erfahrungen. Hier zeigt sich, dass mit zunehmender Erfahrung mit Vertrauenssituationen und Eingehen von derartigen Risiken auch die Präzision der Vorhersage der Vertrauenswürdigkeit anderer zunimmt. Auch soziale Projektion ist ein guter Vorhersagefaktor für die Abschätzung der Vertrauenswürdigkeit. Personen, die sich selbst als vertrauenswürdig einschätzen und entsprechende Erfahrungen gespeichert haben, zeigen in der Regel eher positive Vertrauensverhaltensweisen als Menschen, die dazu neigen, ihr eigenes Misstrauen auf das Verhalten ihrer Interaktionspartner zu projizieren. Kooperative und prosoziale Menschen vertrauen leichter und bekommen auch leichter Vertrauen geschenkt. Misstrauische, feindselige Menschen lösen das entsprechend negative Verhalten bei anderen aus, selbst in Situationen, in denen Vertrauen geschenkt oder reziprok zurückgegeben werden soll. Menschen, die die Persönlichkeitseigenschaften »Fairness und Ehrlichkeit« in einem hohen Maß besitzen, zeigen auch entsprechende Verhaltensweisen in Situationen, in denen Vertrauen entwickelt oder abgeschätzt werden muss.
Situationen, in denen Vertrauen entstehen soll, sind von Situationen, welche keine Unsicherheit und kein Risiko enthalten, also Situationen der absoluten Zuversicht, zu unterscheiden. Handelt es sich um Vertrauenssituationen, so hängen die Erwartungen in die Vertrauenswürdigkeit eines Fremden oder relativ Fremden von drei Faktoren ab:
a)von situativen oder persönlichkeitsbezogenen Hinweisreizen auf Vertrauen,
b)von vorausgegangenen, im Gedächtnis gespeicherten Vertrauenserfahrungen, die in ähnlichen Situationen gesammelt wurden,
c)von der sozialen Projektion der eigenen Vertrauenswürdigkeit auf den anderen.
Das bedeutet, die eigenen Erwartungen in die Vertrauenswürdigkeit einer Person hängen sehr stark von den Persönlichkeitseigenschaften Fairness und Ehrlichkeit ab. (s. Abb. 2) Auf der Grundlage dieser drei Evidenzen bildet sich der/die Vertrauenssuchende ein Urteil über die Wahrscheinlichkeit der Vertrauenswürdigkeit beziehungsweise der Wahrscheinlichkeit des Betrugs. Die Persönlichkeitseigenschaften Fairness und Ehrlichkeit hängen eng zusammen mit Abneigung gegenüber sozialer Ungleichheit und einem starken Bedürfnis nach Reziprozität und Kooperation. Insofern bilden alle diese Verhaltensweisen einen deutlichen Gegensatz zu jenen Faktoren, welche eine positive Erwartung der Vertrauenswürdigkeit determinieren.
Die Illusion des Vertrauens oder die Angst vor dem Betrug
Generell sind Personen eher bereit ein Risiko einzugehen, wenn der Ausgang der Situation vom Zufall abhängt, als wenn er aus selbstsüchtigem und vertrauensunwürdigem Verhalten resultiert. Dieses Phänomen wird in der Psychologie auch als Betrugsaversion bezeichnet und scheint ebenfalls eine relativ stabile menschliche Eigenschaft zu sein.
In der Neurobiologie macht man für die Entstehung von Vertrauen im Gehirn vor allem das Hormon Oxytozin verantwortlich. Untersuchungen, in denen der Einfluss von Oxytozin auf die verschiedenen Determinanten des Vertrauens gezeigt wird, machen allerdings deutlich, dass Oxytozin vor allem zu einer Reduktion der Aversion gegenüber Betrug führt, oder anders gesagt, dass es die Sensibilität bezüglich selbstsüchtigen und vertrauensunwürdigen Verhaltensweisen reduziert (siehe unseren noch folgenden Abschnitt über Oxytozin).
Die Aversion gegen Betrug geht so weit, dass viele Menschen lieber Vertrauen zu jemand Vertrauensunwürdigem fassen als zu erfahren, dass sie von jemandem betrogen wurden. Dabei spielt die Persönlichkeitseigenschaft »Bereitschaft zu verzeihen« (»Forgiveness«) eine Rolle. Diese Persönlichkeitseigenschaft scheint in der Bevölkerung normal verteilt zu sein. Dies bedeutet, dass die individuellen Differenzen bei der Betrugssensitivität am besten durch Persönlichkeitseigenschaften dieses Faktors »Forgiveness« erklärt und mit entsprechenden Fragebögen gemessen werden können.
Diese Persönlichkeitseigenschaft ist eng korreliert mit Belohnungssensibilität und Extraversion: Menschen zeigen in Situationen, in denen sie Vertrauen fassen, deutliche Aktivierung in positiven belohnungsbezogenen Hirnarealen, die auch bei anderen positiven Reizen aktiviert werden. Bereits vor der Entwicklung neurobiologischer Modelle für soziale Interaktion und Vertrauen hat man eine Beziehung zwischen Extraversion (nach außen auf soziale Faktoren gerichtetes Verhalten) und der Bereitschaft zu vertrauen gefunden. Diese Bereitschaft hängt mit einer geringen Sensitivität für Betrug zusammen und mit einer niedrigeren Schwelle für Belohnung.Das heißt, dass so veranlagte Menschen auch Vertrauensverhalten als deutlich positiv verstärkend erleben. Im »wirklichen Leben«, also der von der Literatur erfassten Realität, verhält es sich demgegenüber häufig wesentlich komplexer: Aus Angst vor dem Verlust sozialer Bindung kann Vertrauensbereitschaft auch nur vorgespielt werden.
Persönlichkeitsfaktoren und Vertrauensprofile
Unter vielen möglichen Persönlichkeitsfaktoren sind vor allem Ängstlichkeit und Kooperationsbereitschaft für den Aufbau von Vertrauenssituationen relevant (s. Abb. 2). Personen, denen man eher vertraut, sind Menschen, bei denen man ein geringes Maß an Ausbeutung, ein geringes Maß an Gewinnsucht und ein hohes Maß an Kooperation im sozialen und finanziellen Bereich erwartet. Geringe Labilität und hohe Kooperationsbereitschaft sind somit positive Prädiktoren für Vertrauenswürdigkeit und negative Prädiktoren für Betrugssensibilität. Was geschieht, wenn diese potenziell vorhandenen Persönlichkeitsfaktoren in konkreten Situationen gleichsam einem Stresstest unterzogen werden, ist eine andere Frage, der sich – oft bis in die letzte Konsequenz – die Literatur stellt.
Während es kaum Geschlechtsdifferenzen zwischen Vertrauenswürdigkeit und Vertrauensverhalten gibt, zeigt sich ein Altersfaktor in fast allen Untersuchungen insofern, als man eher bereit ist, älteren Menschen zu vertrauen als jüngeren, was durchaus mit der Beobachtung übereinstimmt, dass das Verhalten jüngerer Menschen schwerer vorhersagbar und darüber hinaus von geringerer Erfahrung mit Vertrauenssituationen gekennzeichnet ist.
Es scheint auf der Hand zu liegen, dass wir weitgehend von Impulsen angetrieben werden, die mit dem Begriff des Belohnungssystems im weitesten Sinne in Verbindung stehen. Es ist mehr als plausibel, dass wir uns gerne so verhalten würden, dass aus unserem Verhalten eine Belohnung und nicht eine Bestrafung erwächst. Weniger klar hingegen ist, was wir in einer gegebenen Situation als Belohnung empfinden. Geldgewinn, schlichter Vorteil, liebende Zuwendung, Freundschaft, Leiden (im Dienste einer höheren Moral), Leiden, um sich hochmütig von den Normen der Masse abzusetzen, das volle Ausleben einer Todesgefahr, ja selbst die Bestrafung können als Belohnung empfunden werden – und durchaus nicht nur bei Kafka.
Genau an dieser Stelle geraten die Möglichkeiten einer quantifizierenden Messung in Irritation, denn dort, wo das wirkliche Leben anfängt, endet in der Regel die Gültigkeit der Experimentalsituation unter idealtypischen Bedingungen. Und beginnt fast folgerichtig die Stunde der Literatur.
Wir werden uns in den folgenden Kapiteln durch alle Höhen und Tiefen des gelebten und erlebten Vertrauens, durch seine Schattierungen und Ambivalenzen, durchzukämpfen haben. Wir werden Triumphe und schandbare Niederlagen, strategisches Kalkül und wortlose Spontaneität kennenlernen. Werden das unterdrückte Einsickern des Misstrauens und die Spuren des Verrats kennenlernen und bei all dem immer wieder feststellen, dass das Vertrauen eine hoch komplexe Mixtur aus unterschiedlichsten Ingredienzien ist, eine Art Krake der Emotionalität, möglicherweise mit Hauptsitz im Gehirn, aber mit einer Vielzahl von Tentakeln, die in andere, auch entfernteste Regionen des Körpers reichen. Und wir werden merken, dass das Vertrauen weit mehr eine Drehscheibe der Gefühle denn ein Gefühl ist. Liebe, Empathie, Angst, Neid, Hass und Heiterkeit, ja selbst Melancholie, Ekel und Indifferenz werden durch die Metaebene des Ver- oder Misstrauens gesteuert beziehungsweise sind auch deren Produkt. Hier entscheidet sich, wie die anderen Gefühle durchmischt oder ausgeblendet, gelebt, verdrängt, unterdrückt, verborgen oder gesteigert werden. Hier entscheidet sich der Umriss dessen, was wir mit dem Behelfswort der Identität eher zudecken als erklären – und damit auch der Grad der inneren Stabilität, dessen, was wir als System der Werte und Normen, unseres tatsächlich gelebten Ver- oder Misstrauens empfinden. Wenn wir uns im Spiegel Auge in Auge gegenüberstehen, wie in einem der zu recht bekanntesten Gedichte Kurt Tucholskys (Insel 2006, 699f.):
Plötzlich fängt sich dein Blick im Spiegelund bleibt hängen.Du siehst:
Die nackt rasierten Wangen− »Backe«: das ist gut für andere Leute −den sanft geschwungenen Mund, die glatte Oberlippe,die Krawatte sitzt – nein, doch nicht:zupf!
Jetzt bist du untadlig. Haare, Nase, Hals, Kragen, Rockschultern sind ein gut komponiertes Bild –tief bejaht dich dein Blick.
Wohlgefällig ruhst du auf dir,siehst die seidigen Ränder der Ohrbrezeln,unmerklich richtest du dich auf –du bist so zufrieden mit dirund fühlst das gesunde Mark deines Lebens.
Übrigens haben die Fliegen auf dem Spiegelglas gesessen,oder ein chemischer Vorgang hat das Quecksilber bepickelt:kleine blinde Pupillen sitzen darauf …
Nun stell den innern Entfernungsschätzer der Augen wieder um: An der rechten Schläfe – aber nur, wenn man schärfer hinsieht –stehen ein paar kleine Runzeln,Schützengräben der Haut – nein, es sind noch keine Runzeln,doch da, an dieser Stelle, werden sie einst stehen.
Dann bist du ein alter Mann;dann sagen die Leute: »Der alte Hauser –«;dann wird ein Mädchen leise ausgelacht, der du etwas zuflüsterst –»Mit dem alten Mann …?« sagen ihre Freundinnen.
Ein Portrait, Innen- und Außenansicht eines ganz normalen Daseins unter ganz normalen Bedingungen. Mit ihm müssen wir uns beschäftigen, wenn wir wirklich mehr über die Funktionsmechanismen des Vertrauens erfahren wollen.
Und auch dem Irrwitz unserer zuweilen skurrilen Vertrauenssüchtigkeit müssen wir uns stellen, wie sie in einem der bekanntesten Stücke der modernen Literatur, Max Frischs Biedermann und die Brandstifter, zum Ausdruck kommt. Durchdrungen von der Idee, nicht so argwöhnisch sein zu wollen wie die anderen, überlässt der Herr des Hauses den Verbrechern schlussendlich sogar die Zündhölzer. Mit dem moralischen Appell, »ein bisschen Vertrauen!« in die anderen zu investieren, geht der Protagonist sehenden Auges ins Verderben.
So wollen wir dem Phänomen des Vertrauens in seiner beklemmenden und faszinierenden Widersprüchlichkeit auf die Spur kommen. Es bedarf dazu keiner philologischen Nachlese oder bildungsbeflissener Lektüre. Die einzelnen Werke der Literatur werden hier nicht um ihrer selbst willen vorgestellt, sondern lediglich als Material. Was beileibe keine Abwertung sein soll, im Gegenteil: Basisepisoden, Grundkonstellationen unserer Vertrauensaktivitäten – fast wie im wirklichen Leben – nachzuspüren, ist keine kleine Sache!
Kapitel 2 Mythos Urvertrauen:Woher kommt es? Wie lang bleibt es?
Vermutlich ist das sogenannte »Urvertrauen« eine gutwillige Erfindung, eine Chimäre. Wo das »Vertrauen« als bewusstes Konzept anfängt, endet die Selbstverständlichkeit. Jene fraglose Selbstverständlichkeit, mit der wir anfangs der Welt begegnen. Diese Selbstverständlichkeit ist das Resultat von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Uns bleibt schlicht keine andere Wahl, als uns auf die anderen bedingungslos einzulassen. Sobald wir uns ihnen mehr oder weniger willentlich »anvertrauen«, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wir »finden«, »schenken«, »erwerben«, »verlieren« oder »gewinnen« Vertrauen, und es ist sicher kein Zufall, dass wir uns für diesen Zustand fast ausnahmslos ökonomischer Begriffe bedienen, ganz so, als ob das Vertrauen ein Investment wäre.
Fakt ist: wenn das Kind aus dem Zustand der Selbstverständlichkeit fällt und zum ersten Mal – mehr oder weniger unbewusst – die »Vertrauensfrage« stellt, beginnt ein anderes Kapitel seines Daseins. Es ist gezwungen, über die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit seiner Umwelt (und seiner selbst) nachzudenken, über sie zu spekulieren und in sie zu investieren; also eine Art Wette abzuschließen mit dem Risiko belohnt oder bestraft zu werden. Ein riskantes, aber überlebensnotwendiges Spiel mit hohem Einsatz.
Oder ist alles ganz anders und wir kommen tatsächlich geborgen in einer Blase des Urvertrauens in diese Welt, geschützt vor Zugriffen, die es missbrauchen könnten? Alle beugen sich über uns, schließen uns in ihre Arme, beschützen uns, halten Mangel von uns fern. Sie lassen etwas in uns entstehen und wachsen, das uns – trotz aller möglichen bitteren Erfahrungen später – auch durchs weitere Leben trägt. Und falls dem so ist, ist weiter zu fragen, woher diese Disposition kommt. Entsteht sie tatsächlich bereits pränatal, im Uterus, indem das Gehirn permanent positive wie negative Erfahrungen registriert, speichert, sammelt, sich ihrer erinnert? Wird man also von Natur aus bereits potenziell zutraulich oder argwöhnisch geboren?
Dafür spricht in der Tat einiges. Allerdings heißt das nicht, dass dieses angeborene Urvertrauen nicht später modifizierbar oder verlernbar wäre. Mittels eines fetalen Magnetoenzephalographen (fMEG) können wir die magnetischen Veränderungen der Hirnaktivität des Fötus im Mutterleib ab dem 6. Monat störungsfrei messen.
Natürlich können wir damit nicht Urvertauen abbilden, das in vielen Hirnregionen abgespeichert wird. Wir können aber sehen, wann sich das Gehirn des Fötus erregt oder entspannt, wir können untersuchen, welche Verhaltensweisen der Mutter darauf Einfluss haben, welche Hormone von der Mutter auf das Kind übertragen werden, wie Schlaf und Wachsein wechseln und vieles andere mehr. All dies zeigt, dass diese emotionalen Gehirnareale, die später das steuern, was wir mit Vertrauen umschreiben, durch Einflüsse von außen (Lärm, Sprache und Laute, Lichtänderungen, Schmerz und Tastreize, Temperatur), aber auch durch psychische Einflüsse der Mutter stark verändert werden können. Es konnte nachgewiesen werden, dass ein sogenanntes emotionales Lernen möglich ist. Daraus müssen wir schließen, dass auch Emotionen, die mit Vertrauen zu tun haben, erlernt werden: Wenn etwa mehrfach bei einer bestimmten Körperposition der Mutter (zum Beispiel Abwehr) ein lauter, bedrohlicher Lärm ertönt, so zeigt das Gehirn des Kindes später auch ohne den Lärm, nur beim Einnehmen einer ähnlichen Position wie die der Mutter, dieselbe starke Hirnaktivierung und der Fötus zeigt dieselben Abwehrbewegungen. Es hat Lernen stattgefunden: Der emotional neutrale Reiz (Position) löst nun eine negative emotionale Reaktion aus. Je nach Stärke, Häufigkeit, Tageszeit und so weiter kann diese konditionierte (gelernte) Reaktion lange bestehen bleiben.
Natürlich speichert der Fötus diese Vorgänge und Erfahrungen nicht bewusst und er wird darüber nie berichten können, da der Hippocampus noch nicht ausreichend entwickelt ist. Den Hippocampus benötigen wir zum bewussten Aneignen und Verarbeiten von Episoden und Ereignissen. Zum Speichern emotionaler Veränderungen, für Empfindungen wie Abwehr, Abscheu, Freude, Behaglichkeit oder Vertrauen benötigen wir keinen Hippocampus.
Lange vor solchen Einblicken in das Gehirn versuchte man sich das Zustandekommen unserer Kopfgeburten vorzustellen. Einer der ersten war der englische Dichter Laurence Sterne, der uns in seinem Roman Tristram Shandy Einblicke in pränatale Erfahrungen, gleichsam »ab ovo«, vom Eisprung ab, gewährt – erstaunlicherweise bereits Mitte des 18. Jahrhunderts. Mitten im Zeugungsakt und im Eifer des Gefechts frug, so der Erzähler, die Mutter seinen Vater, ob dieser drangedacht hätte, »die Uhr aufzuziehen«. (Reclam 1978, 6) Für den in diesem Moment im Entstehen begriffenen Tristram sollte sich dieser Augenblick als schicksalshaft für das weitere Dasein erweisen. Denn von nun an ist etwas im Gemüt des kleinen Homunkulus gestört; er fürchtet, dass es durch diese unglückliche Verknüpfung von Ideen, zwischen denen keinerlei Zusammenhang besteht, zu einer irreparablen Verschiebung in seinem Kopf gekommen sei. Alles sei durcheinandergeschüttelt.
Es fällt auf, dass ein Zustand beschrieben wird, bei dem »etwas« im Gehirn noch in statu nascendi, also schon während des Heranwachsens im Mutterleib, aus dem Takt geraten ist. Wie häufig auch heute noch die Naturwissenschaftler bedient Sterne sich dabei eigentümlicher Bilder und Metaphern, um diese speziellen Wahrnehmungsverschiebungen zu beschreiben. Sterne hat erkannt, was wir oben bereits ausgeführt haben: Bewusstes emotionales Lernen mit Wiedergabe von Episoden existiert noch nicht. Irritiert stellt Tristram fest, dass die Teilchen in seinem Kopf wackeln und schiefe, zersplitterte Bilder in ihm herumtorkeln. Von einem Vertrauen auf eine gesicherte Wahrnehmung kann nicht die Rede sein.
Und auch ein später »Nachfahre« von Tristram, Günter Grass’ Oskar Matzerath (Die Blechtrommel), entscheidet sich aus guten Gründen gegen das Erwachsenwerden und damit auch gegen das Übernehmen von Verpflichtungen und sozialer Verantwortung. Sein Verzicht hat nichts mit Selbstaufgabe zu tun – im Gegenteil, über weite Strecken des Romans erweist der 135 Zentimeter kleine Held sich als äußerst präsent, selbstbewusst und widerständig. Obwohl er als Patient in einer Heil- und Pflegeanstalt landet, macht er einen gesunden, kreativen Eindruck. Er arbeitet an seinen Memoiren und öffnet stolz das Archiv seiner Erinnerungen.
Wirkliche Patienten in wirklichen Psychiatrien befinden sich zumeist in sehr viel weniger privilegierten Situationen: auch ihnen sind Bruchstücke ihres Ich abhandengekommen, Abschnitte der eigenen Geschichte gingen verloren, die Ordnung des Diskurses ist gestört, gelegentlich zerstört. Der jüngst in New York verstorbene englische Psychiater und Neurowissenschaftler Oliver Sacks erzählt in seinem Buch Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte aufs Anrührendste und Anschaulichste von genau solchen Fällen. Und auch er landet interessanterweise genau bei jenen Eigentümlichkeiten, die auch einen Tristram Shandy und einen Oskar Matzerath auszeichnen: Da ist zunächst das Gefühl, dem eigenen Körper, den eigenen Sinnen nicht mit jener Selbstverständlichkeit vertrauen zu können, die die vermeintlich Normalen auszeichnet. Die einschneidende Erfahrung des Verlusts des Grundvertrauens in sich selbst, der plötzlich zutage tretenden Unmöglichkeit, die Koordinaten des eigenen Da-Seins, der Selbst-Wahrnehmung zu erfassen und zu bestimmen, lässt das ganze System »Individuum« kollabieren. Erst wenn etwas so Substanzielles wie der Zugriff auf die eigenen Erinnerungen, die eigene Identität, teilweise oder ganz wegbricht, wird die Not eines Lebens ohne ein Minimum an Vertrauensbezügen offenbar.
Vielleicht ist der Begriff des Vertrauens zu hoch angesetzt. Rebecca, eine der Patientinnen von Oliver Sacks, eine, wie er selbst sagt, »Ansammlung von Behinderungen und Unfähigkeiten« (Rowohlt 2001, 237) erweist sich bei genauerem Hinsehen als faszinierende Mischung aus Defiziten und Kompensationsversuchen. Unter der Kruste von Desorientiertheit, Hilflosigkeit und Verschlossenheit befindet sich ein Mensch auf der fast rabiaten Suche nach »Mustern«: »Ich bin eine Art lebendiger Teppich. […] Wenn ich kein Muster habe, falle ich auseinander und löse mich auf.« (ebd., 244) Man muss sich fragen, ob nicht die Spur des Vertrauens ein solches, ganz wesentliches Muster darstellt. Sich fraglos, unbewusst auf seine Sinne verlassen zu können ist ein Privileg, dessen existenzielle Bedeutung erst im Fall einer – oft auch nur geringfügigen – Störung bemerkt wird. Obwohl Rebeccas Wahrnehmung, ihr Raum-Zeit-Gefühl und ihr gesamtes Einordungsvermögen im alltäglichen Leben stark beeinträchtigt sind, ist sie gelegentlich imstande, unerwartet starke poetische Kräfte freizusetzen, sie zu bündeln und eine Art internes symbolisches »Muster« zu entwerfen.
Wir müssen angesichts der Störungen Rebeccas zwischen verschiedenen Formen des Vertrauens unterscheiden. Sacks meint hier sensorisches Vertrauen, also Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und Erkennen der Umgebung und der Umrisse des eigenen Körpers. Daneben existiert noch motorisches Vertrauen, also Vertrauen in die intendierten Bewegungen meines Körpers auf ein Ziel hin, und natürlich soziales Vertrauen. (Vgl. Abb. 1) Hinter allen drei Vertrauensarten steckt die Gemeinsamkeit des Erlernens von Bekanntem, Familiärem, und des Erlernens von Fremdem und Neuem, wobei Letzteres nicht notwendigerweise von Misstrauen begleitet sein muss. »Gesundes« Misstrauen kann auch entstehen, wenn Bekanntes auf neue Art wahrgenommen wird.
Die Auflösung und Fragmentierung unserer Wahrnehmung wie wir sie unvollständig in der Schizophrenie beobachten können (zum Beispiel wird ein leiser Piepton zu einer lebensbedrohlichen Geheimzahl), ist auf die Unterbrechung einiger assoziativer Verbindungen (Konnektivitäten) vor allem in der linken Sprachhemisphäre zurückzuführen. Diese wiederum ruft eine Fragmentierung vor allem semantischer (bedeutungshaltiger) und sprachlicher Zusammenhänge hervor: Die Sinnzusammenhänge gehen verloren. Im Extremfall, im Endstadium der Demenz, verliert alles Vertraute seine Bedeutung, löst sich in seine Einzelteile auf, da fast alle Verbindungen der Nervenstränge des episodischen Gedächtnisses in Kortex und Hippocampus absterben. Dabei kann motorisches Vertrauen durchaus erhalten bleiben: Der Kranke findet den Weg zur Toilette, weiß aber dort nicht, was sie bedeutet und was er dort soll. Im Gehirn bilden diese sinnvollen und vertrauten Gestalten über Oszillationen der Nervenströme aller beteiligten Zellen ein »Zellensemble«. Diese Oszillationen bewirken, dass immer wieder dieselben Zellen, die einen bestimmten Inhalt, eine »Gestalt« repräsentieren, zusammengebunden werden und ihre synaptischen Verbindungen so verstärken, dass sie ein bleibendes »vertrautes« Zellensemble bilden. Zellensembles, die ein einfaches Bild repräsentieren (Toilette) sind eng beieinander an einer bestimmten Stelle im Großhirn lokalisiert. Da die Zellen eng beieinander liegen, brauchen die Nervenimpulse wenig Zeit, um von einer zur nächsten Zelle zu springen, wobei die Oszillationen sehr schnell mit sogenannten Gammawellen (über 30Hz) erfolgen.
Soziales Vertrauen ist über weite Strecken des Gehirns in vielen emotionalen und kortikalen Regionen verteilt, und die Oszillationen, die dieses riesige Ensemble mit all den Erinnerungsinhalten ab beziehungsweise vor der Geburt zusammenbindet, kennen wir nicht. Wir wissen nur ungefähr, wo es liegt, und dies entspricht genau der Natur unserer in der Phase des Urvertrauens erworbenen assoziativen Verbindungen der beteiligten Hirnareale.
Der Leser hat vielleicht bemerkt, dass auch die neurobiologische Sicht des Vertrauens beziehungsweise der verschiedenen Vertrauensarten (sensorisch, motorisch, sozial) in elementaren und biologisch geradezu vital notwendigen neuronalen Prozessen repräsentiert ist, die in viele, wenn nicht alle kognitiven Analysen und Reaktionen verstrickt sind. Dies erklärt auch teilweise, warum wir so rabiat gegenüber Fremdem, Unvertrautem reagieren können: Es gefährdet den Zusammenhalt unserer Hirnprozesse. Misstrauen und die Auflösung des Vertrauens, oder nur seine Bedrohung durch Fremde(s), gefährdet die geordnete assoziative »Gestalt« unseres Gedächtnisses, unserer Wahrnehmung der Ziele und Intentionen und den semantischen Sinn, die Bedeutung all dessen.
Oliver Sacks beobachtet überrascht, gerührt und entzückt, dass es dann einem nahezu debilen Menschen wie Rebecca unter diesen Umständen gelingt, ihr Leben auf narrative Weise zu organisieren. Mit einem Mal kann sie auch komplexe Zusammenhänge begreifen, indem sie sie sich selbst erzählt. Dort, wo ein abstrakter Gedanke nichts ausrichten konnte, erzeugt diese symbolische innere Kraft ein tragfähiges Gefühl für die Welt. Feste Rituale, das sich Einleben in Theaterrollen, alles was dazu dient, innere Energien und Emotionen kontrolliert freizusetzen, erweist sich als mentale Krücke, um sich einigermaßen kontrolliert und im Rahmen eigener Koordinaten bewegen zu können. Um diese Art des »Vertrauens« wieder zu gewinnen, bedarf es zumindest eines kleinen Vertrauensvorschusses, eines sozialen Kontaktfeldes, sei es auch noch so gering. Was ist solch ein Kontakt anderes als eine kleine Vertrauensspur, ein Rinnsal, das in einen breiteren Strom münden kann? In solchen Momenten kann Rebecca wieder sehen, gehen. In diesen Momenten vermag sie es, sich in der Welt wieder auszukennen, oder glaubt zumindest, sich in ihr wieder auskennen zu können.