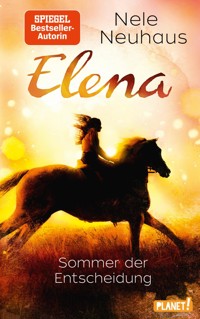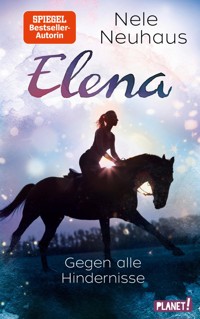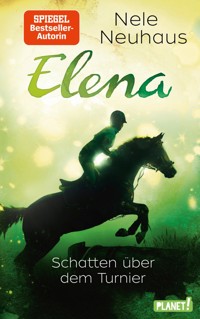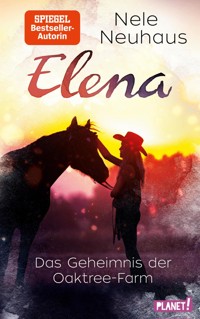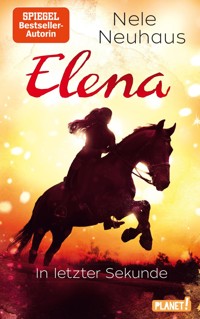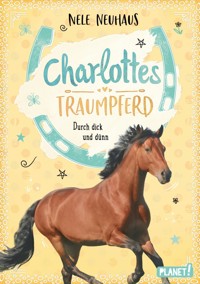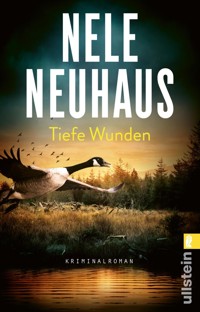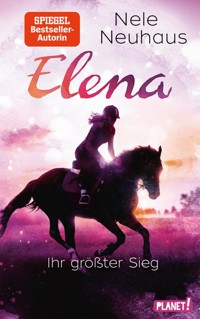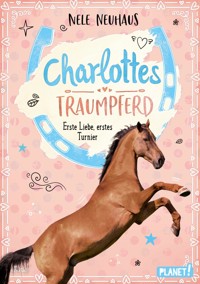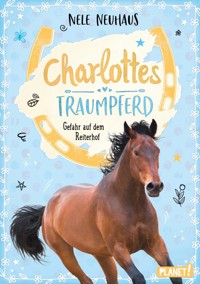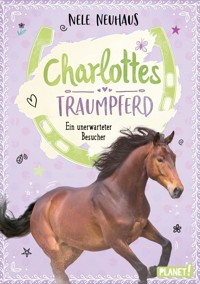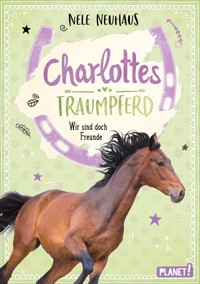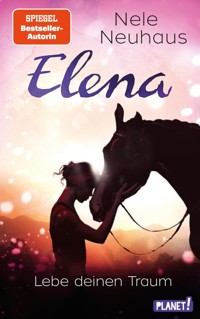10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Millionen-Bestseller von Nele Neuhaus! »Nele Neuhaus versteht es perfekt, die Spannung auf konstant hohem Niveau zu halten.« krimi-couch.de Zwei tote Mädchen. Ein schrecklicher Verdacht. Ein Dorf, das Rache will… Sulzbach im Taunus: An einem regnerischen Novemberabend wird eine Frau von einer Brücke auf die Straße gestoßen. Die Ermittlungen führen Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein in die Vergangenheit. Vor vielen Jahren verschwanden in dem kleinen Taunusort Altenhain zwei Mädchen. Ein Indizienprozess brachte den mutmaßlichen Täter hinter Gitter. Nun ist er in seinen Heimatort zurückgekehrt. Als erneut ein Mädchen vermisst wird, beginnt im Dorf eine Hexenjagd. *** Dieser Krimi wird Sie in den Bann ziehen: süchtig machend, unterhaltsam und voller Wendungen! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Schneewittchen muss sterben
Nele Neuhaus, geboren in Münster / Westfalen, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus und schreibt bereits ebenso lange. Ihr 2010 erschienener Kriminalroman Schneewittchen muss sterben brachte ihr den großen Durchbruch, heute ist sie die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands. Außerdem schreibt die passionierte Reiterin Pferde-Jugendbücher und Unterhaltungsliteratur. Ihre Bücher erscheinen in über 30 Ländern. Vom Polizeipräsidenten Westhessens wurde Nele Neuhaus zur Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber ernannt.
Er wusste, was er getan hatte. Das hatten sie ihm schließlich Hunderte Male erklärt – erst die Polizei, dann sein Anwalt, der Staatsanwalt und die Richterin. Es war schlüssig gewesen, es gab Indizien, es gab Zeugen, es gab das Blut in seinem Zimmer, an seiner Kleidung, in seinem Auto. Und doch fehlten in seiner Erinnerung volle zwei Stunden. Bis heute war da nichts als ein schwarzes Loch.Vor vielen Jahren verschwanden in dem kleinen Taunusort Altenhain zwei Mädchen. Ein Indizienprozess brachte den mutmaßlichen Täter hinter Gitter. Nun ist er in seinen Heimatort zurückgekehrt. Als erneut ein Mädchen vermisst wird, beginnt im Dorf eine Hexenjagd.ZWEI TOTE MÄDCHEN.EIN SCHRECKLICHER VERDACHT.EIN DORF, DAS RACHE WILL.
Nele Neuhaus
Schneewittchen muss sterben
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2010 by Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München nach einer Vorlage von bürosüd° GmbH, MünchenBei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: © masterfile /royalty-free (Hahn auf Kirchturm); © FinePic®, München (Typo, Himmel, Wolken)Autorenfoto: © Andreas MalkmusE-Book-Konvertierung powered by pepyrus
ISBN 978-3-548-92085-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Donnerstag, 6. November 2008
Freitag, 7. November 2008
Samstag, 8. November 2008
Sonntag, 9. November 2008
Montag, 10. November 2008
Dienstag, 11. November 2008
Mittwoch, 12. November 2008
Donnerstag, 13. November 2008
Freitag, 14. November 2008
Samstag, 15. November 2008
Sonntag, 16. November 2008
Montag, 17. November 2008
Dienstag, 18. November 2008
Mittwoch, 19. November 2008
Freitag, 21. November 2008
Samstag, 22. November 2008
Sonntag, 23. November 2008
Montag, 24. November 2008
Dienstag, 26. November 2008
Danksagung
Anmerkung
Leseprobe: Monster
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Simone
Prolog
Die rostige Eisentreppe war schmal und führte steil nach unten. Er tastete an der Wand nach dem Lichtschalter. Sekunden später tauchte die 25-Watt-Birne den kleinen Raum in schummeriges Licht. Lautlos öffnete sich die schwere Eisentür. Er ölte regelmäßig die Scharniere, damit kein Quietschen sie aufweckte, wenn er sie besuchte. Warme Luft, vermischt mit dem süßlichen Duft verwelkender Blumen, drang ihm entgegen. Sorgfältig schloss er die Tür hinter sich, schaltete das Licht ein und verharrte einen Moment reglos. Der große, etwa zehn Meter lange und fünf Meter breite Raum war schlicht eingerichtet, aber sie schien sich hier wohl zu fühlen. Er ging hinüber zur Stereoanlage und betätigte die PLAY-Taste. Die raue Stimme von Bryan Adams füllte den Raum. Er selbst konnte der Musik nicht viel abgewinnen, aber sie liebte den kanadischen Sänger, und er pflegte Rücksicht auf ihre Vorlieben zu nehmen. Wenn er sie schon verstecken musste, dann sollte es ihr an nichts fehlen. Wie üblich sagte sie nichts. Sie sprach nicht mit ihm, antwortete ihm nie auf seine Fragen, aber das störte ihn nicht. Er rückte die spanische Wand, die den Raum diskret teilte, beiseite. Da lag sie, still und schön auf dem schmalen Bett, die Hände auf dem Bauch gefaltet, das lange Haar breitete sich wie ein schwarzer Fächer um ihren Kopf aus. Neben dem Bett standen ihre Schuhe, auf dem Nachttisch ein Strauß verwelkter weißer Lilien in einer gläsernen Vase.
»Hallo, Schneewittchen«, sagte er leise. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Die Hitze war kaum auszuhalten, aber sie mochte es so. Schon früher hatte sie schnell gefroren. Sein Blick wanderte zu den Fotos, die er für sie neben ihrem Bett aufgehängt hatte. Er wollte sie bitten, ob er ein neues Foto dazuhängen durfte. Aber er musste diese Bitte zu einem geeigneten Moment anbringen, nicht dass sie beleidigt war. Vorsichtig setzte er sich auf die Bettkante. Die Matratze senkte sich unter seinem Gewicht, und für einen Moment glaubte er schon, sie habe sich bewegt. Aber nein. Sie bewegte sich nie. Er streckte die Hand aus und legte sie an ihre Wange. Ihre Haut hatte im Laufe der Jahre einen gelblichen Farbton angenommen, fühlte sich fest und ledrig an. Sie hatte wie immer die Augen geschlossen, und wenn auch ihre Haut nicht mehr so zart und rosig war, ihr Mund war so schön wie früher, als sie noch mit ihm geredet und ihn angelächelt hatte. Eine ganze Weile saß er da und betrachtete sie. Nie war der Wunsch, sie zu beschützen, stärker gewesen.
»Ich muss wieder gehen«, sagte er schließlich bedauernd. »Ich habe so viel zu tun.«
Er stand auf, nahm die welken Blumen aus der Vase und vergewisserte sich, dass die Flasche Cola auf ihrem Nachttischchen voll war.
»Du sagst mir, wenn du etwas brauchst, ja?«
Manchmal vermisste er ihr Lachen, dann wurde er traurig. Natürlich wusste er, dass sie tot war, dennoch fand er es einfacher, so zu tun, als wisse er es nicht. So ganz hatte er die Hoffnung auf ein Lächeln von ihr nie aufgegeben.
Donnerstag, 6. November 2008
Er sagte nicht »Auf Wiedersehen«. Niemand, der aus dem Knast entlassen wird, sagt »Auf Wiedersehen«. Oft, sehr oft hatte er sich in den vergangenen zehn Jahren den Tag seiner Haftentlassung ausgemalt. Jetzt musste er feststellen, dass seine Gedanken eigentlich immer nur bis zu dem Augenblick gegangen waren, in dem er durch das Tor in die Freiheit trat, die ihm plötzlich bedrohlich erschien. Er hatte keine Pläne für sein Leben. Nicht mehr. Auch ohne die gebetsmühlenartigen Vorhaltungen der Sozialarbeiter war ihm seit langem bewusst, dass die Welt nicht auf ihn wartete und er sich auf allerhand Vorbehalte und Niederlagen in seiner nicht mehr besonders rosigen Zukunft würde einstellen müssen. Eine Karriere als Arzt, die er damals nach seinem Einser-Abi angestrebt hatte, konnte er vergessen. Unter Umständen mochten ihm sein Studium und die Ausbildung zum Schlosser, die er im Knast absolviert hatte, weiterhelfen. Auf jeden Fall war es an der Zeit, dem Leben ins Auge zu sehen.
Als sich das graue, zackenbewehrte Eisentor der JVA Rockenberg mit einem metallischen Scheppern hinter ihm schloss, sah er sie auf der anderen Straßenseite stehen. Obwohl sie in den vergangenen zehn Jahren die Einzige aus der alten Clique gewesen war, die ihm regelmäßig geschrieben hatte, war er erstaunt, sie hier zu sehen. Eigentlich hatte er seinen Vater erwartet. Sie lehnte am Kotflügel eines silbernen Geländewagens, ein Handy am Ohr, und rauchte mit hastigen Zügen eine Zigarette. Er blieb stehen. Als sie ihn erkannte, richtete sie sich auf, steckte das Telefon in die Manteltasche und schnippte die Kippe weg. Er zögerte einen Augenblick, bevor er die kopfsteingepflasterte Straße überquerte, den kleinen Koffer mit seinen Habseligkeiten in der linken Hand, und vor ihr stehen blieb.
»Hallo, Tobi«, sagte sie und lächelte nervös. Zehn Jahre waren eine lange Zeit; genauso lange hatten sie sich nicht gesehen, denn er hatte nicht gewollt, dass sie ihn besuchte.
»Hallo, Nadja«, erwiderte er. Eigenartig, sie bei diesem fremden Namen zu nennen. In Wirklichkeit sah sie besser aus als im Fernsehen. Jünger. Sie standen sich gegenüber, blickten einander an, zögerten. Ein kühler Wind trieb das trockene Herbstlaub raschelnd über das Pflaster. Die Sonne hatte sich hinter dichten grauen Wolken versteckt. Es war kalt.
»Schön, dass du wieder draußen bist.« Sie schlang ihre Arme um seine Mitte und küsste seine Wange. »Ich freue mich. Echt.«
»Ich freue mich auch.« In dem Augenblick, in dem er diese Floskel aussprach, fragte er sich, ob das stimmte. Freude fühlte sich anders an als dieses Gefühl der Fremdheit, der Unsicherheit. Sie ließ ihn los, weil er keine Anstalten machte, sie ebenfalls zu umarmen. Früher einmal war sie, die Nachbarstochter, seine beste Freundin gewesen, ihre Existenz in seinem Leben eine Selbstverständlichkeit. Nadja war die Schwester, die er nie gehabt hatte. Aber jetzt hatte sich alles verändert, nicht nur ihr Name. Aus der burschikosen Nathalie, die sich für ihre Sommersprossen, für die Zahnspange und ihren Busen geschämt hatte, war Nadja von Bredow geworden, eine berühmte und gefragte Schauspielerin. Sie hatte ihren ehrgeizigen Traum verwirklicht, hatte das Dorf, aus dem sie beide stammten, weit hinter sich gelassen und war auf der Leiter des gesellschaftlichen Ansehens bis ganz nach oben geklettert. Er selbst konnte seinen Fuß nicht einmal mehr auf die unterste Stufe dieser Leiter stellen. Seit heute war er ein Exknacki, der zwar seine Strafe abgesessen hatte, den aber die Gesellschaft nicht gerade mit offenen Armen erwartete.
»Dein Vater hatte für heute nicht freibekommen.« Unvermittelt machte sie einen Schritt von ihm weg, mied dabei seinen Blick, als ob sich seine Befangenheit auf sie übertragen hätte. »Deshalb hole ich dich ab.«
»Das ist nett von dir.« Tobias schob seinen Koffer auf den Rücksitz ihres Autos und setzte sich auf den Beifahrersitz. Das helle Leder hatte noch keinen einzigen Kratzer, das Wageninnere roch neu.
»Wow«, sagte er ehrlich beeindruckt und warf einen Blick auf das Cockpit, das dem eines Flugzeugs ähnelte. »Tolles Auto.«
Nadja lächelte kurz, gurtete sich an und drückte auf einen Knopf, ohne den Schlüssel in die Zündung gesteckt zu haben. Sofort sprang der Motor mit einem dezenten Surren an. Gekonnt manövrierte sie den wuchtigen Wagen aus der Parklücke. Tobias’ Blick streifte ein paar mächtige Kastanien, die dicht an der Gefängnismauer standen. Ihr Anblick von seinem Zellenfenster aus war während der vergangenen zehn Jahre sein Kontakt zur Außenwelt gewesen. Die Bäume im Wechsel der Jahreszeiten waren für ihn zum einzig realen Bezug nach draußen geworden, während der Rest der Welt in einem diffusen Nebel hinter den Gefängnismauern verschwunden war. Und nun musste er, der verurteilte Mädchenmörder, nach Verbüßung seiner Strafe zurück in diesen Nebel. Ob er wollte oder nicht.
»Wo soll ich dich hinfahren? Zu mir?«, fragte Nadja, als sie den Wagen auf die Autobahn lenkte. Sie hatte ihm in ihren letzten Briefen mehrfach angeboten, zunächst bei ihr einzuziehen – ihre Wohnung in Frankfurt sei groß genug. Die Aussicht, nicht nach Altenhain zurückkehren und der Vergangenheit ins Auge blicken zu müssen, war verlockend, dennoch lehnte er ab.
»Später vielleicht«, sagte er deshalb. »Ich will erst mal nach Hause.«
Kriminaloberkommissarin Pia Kirchhoff stand im strömenden Regen auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes bei Eschborn. Sie hatte ihr blondes Haar zu zwei kurzen Zöpfchen geflochten, eine Basecap aufgesetzt und sah nun, die Hände tief in den Taschen ihrer Daunenjacke vergraben, mit ausdrucksloser Miene ihren Kollegen von der Spurensicherung zu, die eine Zeltplane über das Loch zu ihren Füßen spannten. Bei den Abrissarbeiten eines der baufälligen Flugzeughangars hatte ein Baggerfahrer in einem der leeren Treibstofftanks Knochen und einen menschlichen Schädel entdeckt und sehr zur Verärgerung seines Chefs daraufhin die Polizei gerufen. Nun stand die Arbeit seit zwei Stunden still, und Pia durfte sich die Schimpftiraden des übellaunigen Vorarbeiters anhören, dessen multikulturelle Abbruchmannschaft sich beim Auftauchen der Polizei schlagartig dezimiert hatte. Der Mann zündete sich die dritte Zigarette innerhalb einer Viertelstunde an und zog die Schultern hoch, als ob das den Regen daran hindern könnte, ihm in den Jackenkragen zu laufen. Dabei fluchte er unablässig vor sich hin.
»Wir warten auf den Rechtsmediziner. Er wird schon kommen.« Pia interessierte weder die offensichtliche Beschäftigung von Schwarzarbeitern auf der Baustelle noch der Zeitplan der Abbrucharbeiten. »Reißen Sie doch erst eine andere Halle ab.«
»Sie sagen das so einfach«, beschwerte sich der Mann und wies in Richtung der wartenden Bagger und Lkw. »Wegen so ’n paar Knochen kommen wir richtig in Verzug, das kostet ein Vermögen.«
Pia zuckte die Schultern und wandte sich um. Ein Auto holperte über den zerborstenen Beton. Unkraut hatte sich durch jede Fuge gefressen und aus der ehemals glatten Rollbahn eine wahre Buckelpiste gemacht. Seit der Stilllegung des Flugplatzes hatte die Natur eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Lage war, jedes von Menschenhand erschaffene Hindernis wieder zu überwinden. Pia ließ den Vorarbeiter lamentieren und ging auf den silbernen Mercedes zu, der neben den Polizeifahrzeugen angehalten hatte.
»Du hast dir ja ordentlich Zeit gelassen«, begrüßte sie ihren Exmann wenig freundlich. »Wenn ich eine Erkältung kriege, bist du schuld.«
Dr. Henning Kirchhoff, stellvertretender Leiter der Frankfurter Rechtsmedizin, ließ sich nicht hetzen. In aller Seelenruhe zog er den obligatorischen Einwegoverall über, tauschte seine blitzblanken schwarzen Lederschuhe gegen Gummistiefel und setzte die Kapuze auf.
»Ich hatte eine Vorlesung«, entgegnete er. »Und dann gab’s noch einen Stau an der Messe. Tut mir leid. Was haben wir?«
»Ein Skelett in einem der alten Bodentanks. Die Abbruchfirma hat es vor etwa zwei Stunden gefunden.«
»Ist es bewegt worden?«
»Ich glaube nicht. Sie haben nur den Beton und die Erde entfernt, dann den oberen Teil des Tanks aufgeschweißt, weil sie die Dinger nicht komplett abtransportieren können.«
»Gut.« Kirchhoff nickte, grüßte die Beamten der Spurensicherung und schickte sich an, in die Grube unter der Zeltplane zu klettern, in der sich der untere Teil des Tanks befand. Zweifellos war er der beste Mann für diese Aufgabe, denn er war einer der wenigen forensischen Anthropologen Deutschlands, und menschliche Knochen waren sein Spezialgebiet. Der Wind trieb den Regen nun beinahe horizontal über die freie Fläche. Pia fror bis ins Mark. Das Wasser tropfte vom Schirm ihrer Baseballkappe auf ihre Nase, ihre Füße hatten sich in Eisklumpen verwandelt, und sie beneidete die Männer des zur Untätigkeit verdammten Abrisstrupps, die im Flugzeughangar standen und heißen Kaffee aus Thermosflaschen tranken. Wie üblich arbeitete Henning sorgfältig; hatte er erst einmal irgendwelche Knochen vor sich, verloren Zeit und äußere Einflüsse für ihn völlig an Bedeutung. Er kniete auf dem Boden des Tanks, über das Skelett gebeugt, und betrachtete einen Knochen nach dem anderen. Pia bückte sich unter die Plane und hielt sich an der Leiter fest, um nicht abzurutschen.
»Ein komplettes Skelett«, rief Henning zu ihr hinauf. »Weiblich.«
»Alt oder jung? Wie lange liegt es schon hier?«
»Dazu kann ich noch nichts Genaues sagen. Auf den ersten Blick sind keine Gewebereste mehr zu sehen, also vermutlich schon ein paar Jahre.« Henning Kirchhoff richtete sich auf und kletterte die Leiter hinauf. Die Männer von der Spurensicherung begannen mit der vorsichtigen Bergung der Knochen und des umgebenden Erdreiches. Es würde eine Weile dauern, bis das Skelett in die Rechtsmedizin transportiert werden konnte, wo Henning und seine Mitarbeiter es gründlich untersuchen würden. Immer wieder wurden bei Tiefbauarbeiten menschliche Knochen gefunden; eine genaue Beurteilung der Leichenliegezeit war wichtig, da Gewaltverbrechen gegen das Leben, bis auf Mord, nach dreißig Jahren verjährten. Erst wenn Alter und Liegezeit des Skeletts feststanden, ergab ein Abgleich mit den Vermisstenfällen einen Sinn. Der Flugbetrieb auf dem alten Militärflughafen war irgendwann in den fünfziger Jahren eingestellt worden, ebenso lang lag wohl die letzte Befüllung der Tanks zurück. Das Skelett mochte das einer amerikanischen Soldatin aus dem US-Camp sein, das bis Oktober 1991 nebenan existiert hatte, oder gar das einer Bewohnerin des ehemaligen Asylantenheimes auf der anderen Seite des verrosteten Maschendrahtzaunes.
»Gehen wir noch irgendwo einen Kaffee trinken?« Henning setzte seine Brille ab und rieb sie trocken, dann schälte er sich aus dem durchnässten Overall. Pia blickte ihren Exmann überrascht an. Cafébesuche während der Arbeitszeit waren ganz und gar nicht seine Art.
»Ist irgendetwas passiert?«, fragte sie deshalb argwöhnisch. Er schürzte die Lippen, dann stieß er einen tiefen Seufzer aus.
»Ich sitze ganz schön in der Bredouille«, gab er zu. »Und ich brauche deinen Rat.«
Das Dorf kauerte im Tal, überragt von zwei hässlichen, mehrstöckigen Bausünden aus den Siebzigern, als jede Gemeinde, die etwas auf sich hielt, Hochhäuser genehmigt hatte. Rechts am Hang lag der »Millionenhügel«, wie die Alteingesessenen mit verächtlichem Unterton die beiden Straßen nannten, in denen die wenigen Zugezogenen in Villen auf großzügigen Grundstücken lebten. Er spürte, wie sein Herz aufgeregt klopfte, je näher sie dem Haus seiner Eltern kamen. Elf Jahre war es her, dass er zum letzten Mal hier gewesen war. Zur Rechten lag das Fachwerkhäuschen von Oma Dombrowski, das seit eh und je so aussah, als würde es nur noch stehen, weil es zwischen zwei anderen Häusern eingequetscht war. Ein Stück weiter kam links der Hof von Richters mit dem Laden. Und schräg gegenüber die Gaststätte seines Vaters, der Goldene Hahn. Tobias musste schlucken, als Nadja davor anhielt. Ungläubig wanderten seine Augen über die heruntergekommene Fassade, den abblätternden Putz, die geschlossenen Rollläden, die herabhängende Dachrinne. Unkraut hatte sich durch den Asphalt gefressen, das Hoftor hing schief in den Angeln. Beinahe hätte er Nadja gebeten weiterzufahren – schnell, schnell, nur weg hier! Doch er widerstand auch dieser Versuchung, bedankte sich knapp, stieg aus und nahm seinen Koffer von der Rückbank.
»Wenn du irgendetwas brauchst, ruf mich an«, sagte Nadja zum Abschied, dann gab sie Gas und düste davon. Was hatte er erwartet? Einen fröhlichen Empfang? Er stand allein auf dem kleinen asphaltierten Parkplatz vor dem Gebäude, das einmal der Mittelpunkt dieses traurigen Kaffs gewesen war. Der ehemals strahlend weiße Putz war verwittert und bröckelte ab, der Schriftzug »Zum Goldenen Hahn« war kaum noch zu erkennen. In der Eingangstür hing hinter einer gesprungenen Milchglasscheibe ein Schild. »Vorübergehend geschlossen«, stand da in verblasster Schrift. Sein Vater hatte ihm zwar irgendwann erzählt, dass er die Gaststätte aufgegeben hatte, und das mit seinen Bandscheibenproblemen begründet, aber Tobias ahnte, dass ihn etwas anderes zu dieser schweren Entscheidung veranlasst hatte. Hartmut Sartorius war in dritter Generation und mit Leib und Seele Gastwirt gewesen, er hatte selbst geschlachtet und gekocht, seinen eigenen Apfelwein gekeltert und die Gaststätte keinen einzigen Tag wegen Krankheit vernachlässigt. Wahrscheinlich waren die Gäste ausgeblieben. Niemand wollte bei den Eltern eines Doppelmörders essen oder gar feiern. Tobias holte tief Luft und ging zum Hoftor. Es bedurfte einiger Anstrengung, wenigstens einen der Torflügel zu bewegen. Der Zustand des Hofes versetzte ihm einen Schock. Dort, wo im Sommer einst Tische und Stühle unter den ausladenden Ästen einer mächtigen Kastanie und einer malerisch von wildem Wein überrankten Pergola gestanden hatten, wo Kellnerinnen geschäftig von einem Tisch zum anderen geeilt waren, herrschte traurige Verwahrlosung. Tobias’ Blick wanderte über Berge von achtlos abgestelltem Sperrmüll, zerbrochenen Möbeln und Unrat. Die Pergola war zur Hälfte eingestürzt, der wilde Wein verdorrt. Niemand hatte die herabgefallenen Blätter der Kastanie zusammengefegt, die Mülltonne war offenbar seit Wochen nicht mehr an den Straßenrand gestellt worden, denn die Müllsäcke stapelten sich daneben zu einem stinkenden Haufen. Wie konnten seine Eltern hier leben? Tobias spürte, wie ihn das letzte bisschen Mut, mit dem er hier angekommen war, verließ. Er bahnte sich langsam einen Weg bis zu den Stufen, die zur Haustür hinaufführten, streckte die Hand aus und drückte auf die Klingel. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, als die Tür zögerlich geöffnet wurde. Der Anblick seines Vaters trieb Tobias die Tränen in die Augen, gleichzeitig stieg Wut in ihm auf, Wut auf sich selbst und auf die Leute, die seine Eltern im Stich gelassen hatten, nachdem er ins Gefängnis gegangen war.
»Tobias!« Ein Lächeln flog über das eingefallene Gesicht von Hartmut Sartorius, der nur noch ein Schatten des vitalen, selbstbewussten Mannes von damals war. Sein ehemals volles, dunkles Haar war grau und schütter geworden, seine gekrümmte Körperhaltung verriet, wie schwer er an der Last trug, die das Leben ihm aufgebürdet hatte.
»Ich … ich hatte eigentlich noch etwas aufräumen wollen, aber ich habe nicht freibekommen und …« Er brach ab, hörte auf zu lächeln. Stand einfach nur da, ein gebrochener Mann, der dem Blick seines Sohnes beschämt auswich, weil ihm bewusst wurde, was dieser sah. Das war mehr, als Tobias ertragen konnte. Er ließ den Koffer fallen, breitete die Arme aus und umarmte unbeholfen diesen ausgemergelten, grauen Fremden, in dem er seinen Vater kaum noch erkannte. Wenig später saßen sie sich befangen am Küchentisch gegenüber. Es gab so viel zu sagen, und doch war jedes Wort überflüssig. Die grellbunte Wachstuchtischdecke war voller Krümel, die Fensterscheiben schmutzig, eine verdorrte Topfpflanze am Fenster hatte den Kampf ums Überleben vor langer Zeit verloren. Es war klamm in der Küche, es roch unangenehm nach saurer Milch und kaltem Zigarettenrauch. Kein Möbelstück war umgestellt, kein Bild von der Wand genommen worden, seitdem man ihn am 16. September 1997 verhaftet und er das Haus verlassen hatte. Aber damals war alles hell und freundlich und blitzsauber gewesen, seine Mutter war eine tüchtige Hausfrau. Wie konnte sie diese Verwahrlosung zulassen und ertragen?
»Wo ist Mama?«, brach Tobias schließlich das Schweigen. Er merkte, dass diese Frage seinen Vater in eine neue Verlegenheit stürzte.
»Wir … wir wollten es dir eigentlich sagen, aber … aber dann dachten wir, es sei besser, wenn du es nicht erfährst«, erwiderte Hartmut Sartorius schließlich. »Deine Mutter ist vor einer Weile … ausgezogen. Sie weiß aber, dass du heute nach Hause kommst, und freut sich, dich zu sehen.«
Tobias blickte seinen Vater verständnislos an.
»Was soll das heißen – sie ist ausgezogen?«
»Es war nicht einfach für uns, nachdem du … weggegangen bist. Das Gerede hörte nicht auf. Sie hat das irgendwann nicht mehr ausgehalten.« Es lag kein Vorwurf in seiner Stimme, die brüchig und leise geworden war. »Vor vier Jahren sind wir geschieden worden. Sie wohnt jetzt in Bad Soden.«
Tobias schluckte mühsam.
»Wieso habt ihr mir nie etwas gesagt?«, flüsterte er.
»Ach, es hätte doch nichts geändert. Wir wollten nicht, dass du dich aufregst.«
»Das heißt, du lebst hier ganz alleine?«
Hartmut Sartorius nickte und schob mit der Handkante die Krümel auf der Tischdecke hin und her, ordnete sie zu symmetrischen Formen und wischte sie wieder auseinander.
»Und die Schweine? Die Kühe? Wie schaffst du die ganze Arbeit?«
»Die Tiere habe ich schon vor vielen Jahren abgeschafft«, antwortete der Vater. »Ein bisschen Landwirtschaft mache ich noch. Und ich habe einen ganz guten Job in einer Küche in Eschborn gefunden.«
Tobias ballte die Hände zu Fäusten. Wie beschränkt war er gewesen, anzunehmen, nur er sei vom Leben bestraft worden! Er hatte nie richtig begriffen, wie sehr auch seine Eltern unter alldem gelitten hatten. Bei ihren Besuchen im Gefängnis hatten sie ihm eine heile Welt vorgespielt, die es in Wahrheit nie gegeben hatte. Wie viel Kraft musste sie das gekostet haben! Hilfloser Zorn legte sich wie eine Hand um seine Kehle und würgte ihn. Er stand auf, trat ans Fenster und starrte blicklos hinaus. Seine Absicht, nach ein paar Tagen bei seinen Eltern woanders hinzugehen, um weit entfernt von Altenhain einen neuen Start ins Leben zu versuchen, zerfiel zu Staub. Er würde hierbleiben. In diesem Haus, auf diesem Hof, in diesem verfluchten Kaff, in dem man seine Eltern hatte leiden lassen, obwohl sie gänzlich ohne Schuld waren.
Der holzgetäfelte Gastraum im Schwarzen Ross war brechend voll, der Geräuschpegel entsprechend hoch. An Tischen und Tresen hatte sich halb Altenhain versammelt, ungewöhnlich für einen frühen Donnerstagabend. Amelie Fröhlich balancierte dreimal Jägerschnitzel mit Pommes zu Tisch 9, servierte und wünschte guten Appetit. Normalerweise hatten Dachdeckermeister Udo Pietsch und seine Kumpels immer einen blöden Spruch parat, der auf ihr ungewöhnliches Äußeres abzielte, aber heute hätte Amelie wahrscheinlich nackt bedienen können, und man hätte sie nicht beachtet. Die Stimmung war so angespannt wie sonst höchstens bei der Übertragung eines Champions-League-Spieles. Amelie spitzte neugierig die Ohren, als sich Gerda Pietsch nun zum Nachbartisch hinüberbeugte, an dem die Richters saßen, die den Lebensmittelladen auf der Hauptstraße betrieben.
» … habe gesehen, wie er gekommen ist«, erzählte Margot Richter gerade. »So eine Unverschämtheit, hier wieder aufzutauchen, als wär nix gewesen!«
Amelie ging zurück zur Küche. An der Essensausgabe wartete Roswitha auf das Rumpsteak für Fritz Unger an Tisch 4, medium, mit Zwiebeln und Kräuterbutter.
»Was ist denn hier heute Abend eigentlich für ein Aufruhr?«, fragte Amelie die ältere Kollegin, die einen ihrer Gesundheitslatschen abgestreift hatte und sich unauffällig mit dem rechten Fuß die Krampfadern an der linken Wade rieb. Roswitha blickte sich zu ihrer Chefin um, die aber zu sehr mit den zahlreichen Getränkebestellungen beschäftigt war, als dass sie sich um ihr Personal kümmern konnte.
»Ei, der Bub vom Sartorius is heude aus’m Knast gekomme«, verriet Roswitha mit gesenkter Stimme. »Zehn Jahr hat der gesesse, weil er doch damals die zwaa Mädsche umgebracht hat!«
»Ach!« Amelie riss erstaunt die Augen auf. Sie kannte Hartmut Sartorius flüchtig, der allein auf seinem riesigen, verlotterten Hof unterhalb ihres Hauses wohnte, aber sie hatte nichts von einem Sohn gewusst.
»Ja.« Roswitha nickte mit dem Kopf Richtung Tresen, an dem Schreinermeister Manfred Wagner mit glasigen Augen vor sich hin stierte, in der Hand das zehnte oder elfte Glas Bier an diesem Abend. Normalerweise brauchte er zwei Stunden länger für dieses Pensum. »Dem Manfred sei Tochter, die Laura, die hat er umgebracht, der Tobias. Un die klaa Schneeberger. Bis heut hat er net verrade, was er mit dene gemacht hat.«
»Einmal Rumpsteak mit Kräuterbutter und Zwiebeln!« Kurt, der Beikoch, schob den Teller durch die Durchreiche, Roswitha schlüpfte in ihre Latschen und manövrierte ihre Leibesfülle geschickt durch den vollbesetzten Gastraum zu Tisch 4. Tobias Sartorius – Amelie hatte den Namen noch nie gehört. Sie war erst vor einem halben Jahr aus Berlin nach Altenhain gekommen, und das nicht freiwillig. Das Dorf und seine Bewohner interessierte sie so viel wie ein Sack Reis in China, und wäre sie nicht durch den Chef ihres Vaters an den Job im Schwarzen Ross gekommen, würde sie hier immer noch niemanden kennen.
»Drei Weizenbier, eine kleine Cola light«, rief Jenny Jagielski, die junge Chefin, die für die Getränke zuständig war. Amelie schnappte ein Tablett, stellte die Gläser darauf und warf einen kurzen Blick auf Manfred Wagner. Seine Tochter war vom Sohn von Hartmut Sartorius ermordet worden! Das war ja richtig spannend. Im langweiligsten Dorf der Welt taten sich ungeahnte Abgründe auf. Sie lud die drei Weizenbier an dem Tisch ab, an dem Jenny Jagielskis Bruder Jörg Richter mit zwei anderen Männern saß. Eigentlich sollte er an Jennys Stelle hinterm Tresen stehen, aber er tat nur selten das, was er tun sollte. Schon gar nicht, wenn der Chef, Jennys Mann, nicht da war. Die Cola light kam zu Frau Unger an Tisch 4. Ein kurzer Boxenstopp in der Küche. Alle Gäste waren mit Essen versorgt, und Roswitha hatte bei einer weiteren Runde durch den Gastraum neue Details in Erfahrung gebracht, die sie nun mit glühenden Wangen und bebendem Busen vor ihrer neugierigen Zuhörerschaft zum Besten gab. Außer Amelie spitzten Kurt und Achim, die Beiköche, und Wolfgang, der Küchenchef, die Ohren. Der Lebensmittelladen von Margot Richter – zu Amelies Verwunderung hieß es in Altenhain immer ›wir gehen bei die Margot‹, obwohl der Laden genau genommen ihrem Mann gehörte – lag schräg gegenüber vom ehemaligen Goldenen Hahn, und so waren Margot und die Friseurin Inge Dombrowski, die sich gerade zu einem Schwätzchen im Laden aufgehalten hatte, am Nachmittag Augenzeugen der Rückkehr von diesem Kerl geworden. Er war aus einem silbernen Luxusauto ausgestiegen und auf den Hof seiner Eltern gegangen.
»Des is schon ’ne Freschheit«, regte Roswitha sich auf. »Die Mädels sin tot, und der Kerl taucht hier wieder auf, als wär nix gewese!«
»Ei, wo soller denn aach hiegehe?«, bemerkte Wolfgang nachsichtig und nahm einen Schluck aus seinem Bierglas.
»Isch glaab, des du se net mehr alle hast!«, fuhr Roswitha ihn an. »Was tätst denn du saache, wenn der Mörder von deiner Tochter plötzlisch vor dir stehe tät?«
Wolfgang zuckte gleichgültig die Schultern.
»Und was weiter?«, drängte Achim. »Wo ist er hingegangen?«
»Ei, enei ins Haus«, sagte Roswitha. »Der werd sisch gewunnert habbe, als er gesehe hat, wie’s do jetzt aussieht.«
Die Schwingtür ging auf. Jenny Jagielski marschierte in die Küche und stemmte die Arme in die Seiten. Wie ihre Mutter Margot Richter war sie ständig in dem Glauben, ihr Personal würde hinter ihrem Rücken in die Kasse greifen oder über sie herziehen. Drei kurz aufeinanderfolgende Schwangerschaften hatten die Figur der ohnehin stämmigen Jenny vollends verdorben: Sie war so rund wie ein Fass.
»Roswitha!«, rief sie scharf der um dreißig Jahre älteren Frau zu. »Tisch 10 will zahlen!«
Roswitha verschwand gehorsam, und Amelie wollte ihr folgen, aber Jenny Jagielski hielt sie zurück.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du diese unappetitlichen Piercings rausnehmen und dir eine gescheite Frisur machen sollst, wenn du zur Arbeit kommst!« Die Missbilligung stand ihr in das aufgeschwemmte Gesicht geschrieben. »Außerdem wäre eine Bluse passender als dieses Leibchen! Da kannst du ja gleich in Unterwäsche bedienen! Wir sind eine anständige Gaststätte und keine … keine Berliner Untergrunddisko!«
»Den Männern gefällt’s aber«, erwiderte Amelie schnippisch. Jenny Jagielskis Augen verengten sich, rote Flecken erschienen wie flammende Male an ihrem fetten Hals.
»Das ist mir egal«, zischte sie drohend. »Lies dir mal die Hygienevorschriften durch!«
Amelie lag schon eine heftige Erwiderung auf der Zunge, aber sie beherrschte sich in der letzten Sekunde. Auch wenn ihr die Jagielski von ihrer verbrannten Billigdauerwelle bis zu den fleischigen Bratwurstwaden von Herzen zuwider war, so durfte sie es sich nicht mit ihr verscherzen. Sie brauchte den Job im Schwarzen Ross.
»Und ihr?« Die Chefin funkelte ihre Köche an. »Habt ihr nichts zu tun?«
Amelie verließ die Küche. Just in diesem Augenblick kippte Manfred Wagner mitsamt dem Barhocker um.
»Hey, Manni«, rief einer der Männer vom Stammtisch. »Es ist doch erst halb zehn!« Die anderen lachten gutmütig. Niemand regte sich sonderlich darüber auf, wiederholte sich dieses Schauspiel doch so oder ähnlich an beinahe jedem Abend, üblicherweise allerdings erst gegen elf. Man rief dann seine Frau an, die innerhalb weniger Minuten erschien, die Zeche bezahlte und ihren Mann nach Hause bugsierte. Heute Abend jedoch veränderte Manfred Wagner die Choreographie. Der sonst so friedfertige Mann rappelte sich ohne fremde Hilfe auf, wandte sich um, packte sein Bierglas und schmetterte es auf den Boden. Die Gespräche an den Tischen verstummten, als er auf den Stammtisch zuwankte.
»Ihr Arschlöcher«, nuschelte er mit alkoholschwerer Zunge. »Ihr sitzt hier und quatscht blödes Zeug, als wär nichts! Euch kann’s ja auch egal sein!«
Wagner hielt sich an einer Stuhllehne fest und blickte aus blutunterlaufenen Augen wild in die Runde. »Aber ich, ich muss dieses … Schwein … sehen und … dran denken …« Er brach ab und senkte den Kopf. Jörg Richter war aufgestanden und legte Wagner nun die Hand auf die Schulter.
»Komm, Manni«, sagte er. »Mach keinen Ärger. Ich ruf die Andrea an, und die …«
»Fass mich nicht an!«, heulte Wagner auf und stieß ihn so heftig weg, dass der jüngere Mann ins Taumeln geriet und stürzte. Im Fallen hielt er sich an einem Stuhl fest und riss den darauf Sitzenden mit zu Boden. Im Nu herrschte Chaos.
»Ich bring das Schwein um!«, brüllte Manfred Wagner immer wieder. Er schlug um sich, die vollen Gläser auf dem Stammtisch kippten um, ihr Inhalt ergoss sich über die Kleidung der Männer auf den Boden. Fasziniert verfolgte Amelie von der Kasse aus das Spektakel, während ihre Kollegin mitten im Getümmel ums Überleben kämpfte. Eine richtig fette Schlägerei im Schwarzen Ross! Endlich passierte mal etwas in diesem öden Kaff! Jenny Jagielski walzte an ihr vorbei in die Küche.
»Eine anständige Gaststätte«, murmelte Amelie spöttisch und erntete dafür einen finsteren Blick. Sekunden später kam die Chefin mit Kurt und Achim im Gefolge aus der Küche gestürmt. Die beiden Köche überwältigten den Betrunkenen im Handumdrehen. Amelie schnappte sich den Handfeger und die Kehrschaufel und ging zum Stammtisch, um die Scherben zusammenzukehren. Manfred Wagner wehrte sich nicht mehr und ließ sich widerstandslos abführen, aber in der Tür entwand er sich dem Zugriff der Männer und drehte sich um. Schwankend stand er da, die Augen blutunterlaufen. Speichel tropfte aus seinem Mundwinkel in den zerzausten Vollbart. Ein dunkler Fleck breitete sich auf der Vorderseite seiner Hose aus. Er muss ja richtig besoffen sein, dachte Amelie. Bisher hatte sie noch nicht erlebt, dass er sich vollpinkelte. Plötzlich empfand sie Mitleid für den Mann, über den sie sich bisher insgeheim immer lustig gemacht hatte. Ob der Mord an seiner Tochter der Grund für die beharrliche Regelmäßigkeit war, mit der er sich jeden Abend ins Koma soff? In der Gaststätte herrschte Totenstille.
»Ich krieg das Schwein!«, schrie Manfred Wagner. »Ich schlag ihn tot, dieses … dieses … Mörderschwein!«
Er senkte den Kopf. Und begann zu schluchzen.
Tobias Sartorius trat aus der Dusche und griff nach dem Handtuch, das er sich bereitgelegt hatte. Er wischte mit der Handfläche über den beschlagenen Spiegel und betrachtete sein Gesicht in dem schummerigen Licht, das die letzte funktionierende Glühbirne in dem Spiegelschrank spendete. Am Morgen des 16. September 1997 hatte er sich das letzte Mal in diesem Spiegel angesehen, wenig später waren sie gekommen, um ihn zu verhaften. Für wie erwachsen er sich damals gehalten hatte, in dem Sommer nach dem Abitur! Tobias schloss die Augen und lehnte die Stirn gegen die kalte Fläche. Hier, in diesem Haus, in dem ihm jeder Winkel so vertraut war, schienen die zehn Knastjahre wie ausgelöscht. Er erinnerte sich an jedes Detail der letzten Tage vor seiner Verhaftung, als sei alles erst gestern geschehen. Nicht zu fassen, wie naiv er gewesen war. Aber bis heute gab es die schwarzen Löcher in seiner Erinnerung, die ihm das Gericht nicht geglaubt hatte. Er öffnete die Augen, starrte in den Spiegel und war für eine Sekunde fast überrascht, das kantige Gesicht eines Dreißigjährigen zu sehen. Mit den Fingerspitzen berührte er die weißliche Narbe, die sich von seinem Kieferknochen bis zum Kinn zog. Diese Verletzung hatte man ihm in der zweiten Woche im Knast zugefügt, und sie war der Grund gewesen, weshalb er zehn Jahre lang in einer Einzelzelle gesessen und kaum Kontakt zu seinen Mithäftlingen gehabt hatte. In der strengen Knasthierarchie stand ein Mädchenmörder nur Millimeter über dem allerletzten Dreck, dem Kindsmörder. Die Tür des Badezimmers schloss nicht mehr richtig, ein kalter Luftzug traf seine feuchte Haut und ließ ihn erschauern. Von unten drangen Stimmen zu ihm herauf. Sein Vater musste Besuch bekommen haben. Tobias wandte sich ab und zog Unterhose, Jeans und T-Shirt an. Vorhin hatte er den deprimierenden Rest des großen Hofes besichtigt und festgestellt, dass der vordere Teil im Vergleich zum hinteren geradezu ordentlich aussah. Sein vages Vorhaben, Altenhain schnell wieder zu verlassen, hatte er aufgegeben. Unmöglich konnte er seinen Vater in dieser Verwahrlosung allein lassen. Da er ohnehin nicht so bald damit rechnen konnte, einen Job zu bekommen, würde er in den nächsten Tagen den Hof auf Vordermann bringen. Danach konnte er weitersehen. Er verließ das Bad, ging an der geschlossenen Tür seines ehemaligen Jugendzimmers vorbei und die Treppe hinunter, wobei er aus alter Gewohnheit die Stufen ausließ, die knarrten. Sein Vater saß am Küchentisch, der Besucher wandte Tobias den Rücken zu. Trotzdem erkannte er ihn sofort.
Als Oliver von Bodenstein, seines Zeichens Kriminalhauptkommissar und Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen bei der Regionalen Kriminalinspektion in Hofheim, um halb zehn nach Hause kam, traf er als einziges Lebewesen seinen Hund an, dessen Begrüßung eher verlegen als freudig ausfiel – untrügerisches Indiz für ein schlechtes Gewissen. Den Grund dafür roch Bodenstein, bevor er ihn sah. Er hatte einen stressigen Vierzehnstundentag hinter sich, mit einer öden Sitzung im LKA, einem Skelettfund in Eschborn, den seine Chefin, die Kriminalrätin Dr. Nicola Engel, mit ihrer Vorliebe für Anglizismen als »Cold Case« bezeichnete, und zu guter Letzt noch der Ausstandsfeier eines Kollegen vom K 23, der nach Hamburg versetzt wurde. Bodenstein knurrte der Magen, denn außer jeder Menge Alkohol hatte es nur ein paar Chips gegeben. Verstimmt öffnete er den Kühlschrank und erblickte dort nichts, was seine Geschmacksnerven hätte befriedigen können. Hätte Cosima nicht wenigstens mal einkaufen können, wenn sie ihm schon kein Abendessen vorbereitete? Wo war sie überhaupt? Er ging durch die Eingangshalle, ignorierte den stinkenden Haufen und die Pfütze, die dank der Fußbodenheizung schon zu einer klebrigen, gelblichen Lache getrocknet war, und ging die Treppe hinauf zum Zimmer seiner jüngsten Tochter. Sophias Bettchen war erwartungsgemäß leer. Cosima musste die Kleine mitgenommen haben, wohin auch immer sie gefahren war. Er würde sie nicht anrufen, wenn sie ihm noch nicht einmal einen Zettel mit einer Information hinterlassen oder ihm eine SMS schreiben konnte! Gerade als Bodenstein sich ausgezogen hatte und ins Badezimmer ging, um zu duschen, klingelte das Telefon. Natürlich befand sich das Gerät nicht in der Ladestation auf der Kommode im Flur, sondern lag irgendwo im Haus herum. Mit wachsender Verärgerung machte er sich auf die Suche und fluchte, als er im Wohnzimmer auf irgendein herumliegendes Kinderspielzeug trat. Gerade als er das Telefon auf der Couch gefunden hatte, brach das Läuten ab. Gleichzeitig drehte sich der Schlüssel in der Haustür, und der Hund begann aufgeregt zu bellen. Cosima kam herein, auf einem Arm das schlaftrunkene Kind, in der anderen Hand ein riesiger Blumenstrauß.
»Du bist ja zu Hause«, sagte sie als einzige Begrüßung zu ihm. »Warum gehst du nicht ans Telefon?«
Sofort war er in Harnisch.
»Weil ich es erst mal suchen musste. Wo warst du überhaupt?«
Sie gab ihm keine Antwort, ignorierte die Tatsache, dass er bis auf die Unterhose nackt war, und ging an ihm vorbei in die Küche. Dort legte sie den Blumenstrauß auf den Tisch und hielt ihm Sophia entgegen, die nun gänzlich wach war und unleidlich quengelte. Bodenstein nahm seine kleine Tochter auf den Arm. Er roch sofort, dass die Windel bis zum Rand voll sein musste.
»Ich hatte dir mehrere SMS geschrieben, dass du Sophia bei Lorenz und Thordis abholst.« Cosima zog ihren Mantel aus. Sie sah erschöpft aus und genervt, aber er fühlte sich unschuldig.
»Ich habe keine SMS gekriegt.«
Sophie wand sich in seinen Armen und begann zu weinen.
»Weil dein Handy aus war. Du hast doch seit Wochen gewusst, dass ich heute Nachmittag im Filmmuseum bin, bei der Eröffnung der Fotoausstellung über Neuguinea.« Cosimas Stimme klang scharf. »Eigentlich hattest du mir versprochen, heute Abend zu Hause zu sein und auf Sophia aufzupassen. Als du mal wieder nicht aufgetaucht bist und dein Handy ausgeschaltet war, hat Lorenz Sophia abgeholt.«
Bodenstein musste sich eingestehen, dass er Cosima tatsächlich versprochen hatte, heute Abend früh zu Hause zu sein. Er hatte es vergessen, und das verärgerte ihn noch zusätzlich.
»Sie hat die Windel voll«, sagte er und hielt das Kind ein Stück von sich weg. »Außerdem hat der Hund ins Haus gemacht. Du hättest ihn doch wenigstens rauslassen können, bevor du weggegangen bist. Und du könntest auch mal wieder einkaufen gehen, damit ich nach einem langen Arbeitstag etwas zu essen im Kühlschrank finde.«
Cosima antwortete nicht. Sie bedachte ihn stattdessen mit einem Blick unter hochgezogenen Brauen, der ihn richtig in Rage brachte, weil er sich sofort verantwortungslos und mies fühlte. Sie nahm ihm das weinende Kind ab und ging nach oben, um es trockenzulegen und ins Bett zu bringen. Bodenstein stand unentschlossen in der Küche. In seinem Innern tobte ein Kampf zwischen Stolz und Vernunft, schließlich siegte Letztere. Seufzend nahm er eine Vase aus dem Schrank, ließ Wasser einlaufen und stellte die Blumen hinein. Aus der Vorratskammer holte er einen Eimer und eine Rolle Kleenex und machte sich daran, die Hinterlassenschaften des Hundes in der Eingangshalle zu beseitigen. Das Letzte, was er eigentlich wollte, war ein Streit mit Cosima.
»Hallo, Tobias.« Claudius Terlinden lächelte freundlich. Er erhob sich von seinem Stuhl und streckte ihm die Hand hin. »Schön, dass du wieder zu Hause bist.«
Tobias ergriff kurz die dargebotene Hand, blieb aber stumm. Der Vater seines ehemals besten Freundes Lars hatte ihn mehrfach im Gefängnis besucht und ihm versichert, dass er seinen Eltern helfen würde. Tobias hatte sich die Beweggründe für seine Freundlichkeit nie erklären können, denn er hatte Terlinden durch seine Aussage während der Ermittlungen seinerzeit ziemliche Probleme bereitet. Das schien dieser ihm nicht nachgetragen zu haben, im Gegenteil, er hatte innerhalb kürzester Zeit einen der besten Strafanwälte Frankfurts für Tobias engagiert. Doch auch der hatte die Höchststrafe nicht abwenden können.
»Ich möchte euch nicht lange stören, ich bin nur gekommen, um dir ein Angebot zu machen«, sagte Claudius Terlinden nun und setzte sich wieder auf den Küchenstuhl. Er hatte sich kaum verändert in den letzten Jahren. Schlank und selbst jetzt, im November, braungebrannt, trug er das leicht ergraute Haar nach hinten gekämmt, seine früher scharf geschnittenen Gesichtszüge waren ein wenig schwammiger geworden. »Wenn du dich hier wieder eingewöhnt hast und nicht sofort einen Job findest, könntest du bei mir arbeiten. Was hältst du davon?«
Er blickte Tobias erwartungsvoll über den Rand seiner Halbbrille an. Obwohl er weder durch körperliche Größe noch durch ein besonders gutes Aussehen beeindrucken konnte, so strahlte er doch die gelassene Selbstsicherheit des erfolgreichen Unternehmers und eine angeborene Autorität aus, die andere Menschen dazu brachte, sich ihm gegenüber bescheiden, ja unterwürfig zu verhalten. Tobias setzte sich nicht auf den freien Stuhl, sondern blieb in den Türrahmen gelehnt stehen, die Arme vor der Brust verschränkt. Nicht dass es viele Alternativen zu Terlindens Angebot gegeben hätte, aber irgendetwas daran machte Tobias misstrauisch. In seinem teuren Maßanzug, dem dunklen Kaschmirmantel und den auf Hochglanz polierten Schuhen wirkte Claudius Terlinden in der schäbigen Küche wie ein Fremdkörper. Tobias spürte Ohnmacht in sich aufsteigen. Er wollte nicht in der Schuld dieses Mannes stehen. Sein Blick wanderte zu seinem Vater, der mit hochgezogenen Schultern dasaß und stumm auf seine gefalteten Hände starrte, wie ein devoter Leibeigener beim Besuch des Großgrundbesitzers. Dieses Bild gefiel Tobias überhaupt nicht. Sein Vater sollte es nicht nötig haben, sich vor jemandem ducken zu müssen, auch und erst recht nicht vor Claudius Terlinden, der das halbe Dorf mit seiner selbstverständlichen Großzügigkeit zu seinen Schuldnern gemacht hatte, ohne dass irgendjemand die Möglichkeit hatte, sich dafür zu revanchieren. Aber so hatte Terlinden es schon immer gehalten. Beinahe alle jungen Leute aus Altenhain hatten irgendwann einmal bei ihm gejobbt oder auf andere Art von ihm profitiert. Claudius Terlinden erwartete dafür keine andere Gegenleistung als Dankbarkeit. Da die Hälfte aller Altenhainer ohnehin bei ihm angestellt war, genoss er einen gottähnlichen Status in diesem Nest. Das Schweigen wurde unbehaglich.
»Na ja.« Terlinden erhob sich, und sofort sprang auch Hartmut Sartorius auf. »Du weißt ja, wo du mich findest. Sag mir einfach kurz Bescheid, wenn du dich entschieden hast.«
Tobias nickte nur und ließ ihn vorbeigehen. Er blieb in der Küche, während sein Vater den Gast zur Haustür begleitete.
»Er meint es nur gut«, sagte Hartmut Sartorius, als er zwei Minuten später zurückkehrte.
»Ich will nicht auf seine Gunst angewiesen sein«, erwiderte Tobias heftig. »Wie er hier auftritt, wie … wie ein König, der seinem Knecht die Gnade eines Besuches angedeihen lässt. Als wäre er etwas Besseres!«
Hartmut Sartorius seufzte. Er füllte den Wasserkessel und stellte ihn auf die Herdplatte.
»Er hat uns sehr geholfen«, sagte er leise. »Wir hatten ja nie etwas gespart, immer alles in den Hof und die Gaststätte gesteckt. Der Anwalt hat viel Geld gekostet, und dann blieben die Gäste weg. Irgendwann konnte ich die laufenden Kredite bei der Bank nicht mehr bedienen. Sie drohten mit Zwangsversteigerung. Claudius hat unsere Schulden bei der Bank abgelöst.«
Tobias starrte seinen Vater ungläubig an.
»Das heißt, der ganze Hof gehört eigentlich – ihm?«
»Genau genommen ja. Aber wir haben einen Vertrag. Ich kann ihm den Hof jederzeit wieder abkaufen und habe Einsitzrecht auf Lebenszeit.«
Diese Neuigkeit musste Tobias erst einmal verdauen. Er lehnte den Tee, den sein Vater ihm anbot, ab.
»Wie viel Geld schuldest du ihm?«
Hartmut Sartorius zögerte einen Moment mit seiner Antwort. Er kannte das hitzige Temperament seines Sohnes von früher. »Dreihundertfünfzigtausend Euro. Mit dem Betrag stand ich bei der Bank in der Kreide.«
»Allein das Grundstück ist mindestens das Doppelte wert!«, erwiderte Tobias mit mühsam beherrschter Stimme. »Er hat deine Notlage ausgenutzt und ein Schnäppchen gemacht.«
»Wir konnten nicht wählerisch sein.« Hartmut Sartorius hob die Schultern. »Es gab keine Alternative. Sonst hätte die Bank den Hof zwangsversteigert, und wir hätten auf der Straße gestanden.«
Plötzlich fiel Tobias noch etwas ein. »Was ist mit dem Schillingsacker?«, fragte er.
Sein Vater wich seinem Blick aus und betrachtete den Wasserkessel.
»Papa!«
»Mein Gott.« Hartmut Sartorius schaute hoch. »Das war doch nur eine Wiese!«
Tobias begann zu verstehen. In seinem Kopf fügten sich die Details zu einem Bild zusammen. Sein Vater hatte Claudius Terlinden den Schillingsacker verkauft, deshalb hatte die Mutter ihn verlassen! Es war nicht einfach nur eine Wiese gewesen, sondern die Mitgift, die sie mit in die Ehe gebracht hatte. Der Schillingsacker war eine Apfelbaumwiese gewesen mit einem rein ideellen Wert, erst nach der Änderung des Flächennutzungsplanes im Jahr 1992 war sie das wohl wertvollste Grundstück in der Altenhainer Gemarkung gewesen, denn sie lag mit beinahe 1500 m2 mitten im geplanten Gewerbegebiet. Terlinden war seit Jahren scharf darauf gewesen.
»Was hat er dir dafür bezahlt?«, fragte Tobias mit flacher Stimme.
»Zehntausend Euro«, gab sein Vater zu und ließ den Kopf hängen. Ein so großes Grundstück mitten im Gewerbegebiet war das Fünfzigfache wert! »Claudius hat es dringend gebraucht, für seinen Neubau. Nach allem, was er für uns getan hat, konnte ich einfach nicht anders. Ich musste es ihm geben.«
Tobias biss die Zähne aufeinander und ballte in hilflosem Zorn die Hände zu Fäusten. Er konnte seinem Vater keine Vorwürfe machen, denn er allein war schuld an der misslichen Lage, in die seine Eltern geraten waren. Plötzlich hatte er das Gefühl, in diesem Haus, in diesem verdammten Dorf ersticken zu müssen. Trotzdem würde er bleiben, und zwar so lange, bis er herausgefunden hatte, was vor elf Jahren wirklich geschehen war.
Amelie verließ das Schwarze Ross um kurz vor elf durch den Hinterausgang neben der Küche. Gerne wäre sie heute Abend länger geblieben, um noch mehr über das Thema des Tages zu erfahren. Aber Jenny Jagielski achtete streng auf die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes, da Amelie erst siebzehn Jahre alt war und sie keinen Ärger mit den Behörden riskieren wollte. Amelie war es egal, sie war froh, dass sie den Job als Kellnerin hatte und eigene Kohle verdiente. Ihr Vater hatte sich als der Geizhals erwiesen, als den ihre Mutter ihn immer beschrieben hatte, und verweigerte ihr das Geld für die Anschaffung eines neuen Laptops mit der Begründung, der alte tue es ja auch noch. Die ersten drei Monate in diesem elenden Dorf waren grausam gewesen. Da jedoch das Ende ihres unfreiwilligen Aufenthalts in Altenhain absehbar war, hatte sie beschlossen, sich für die fünf Monate bis zu ihrem 18. Geburtstag so gut wie möglich zu arrangieren. Spätestens am 21. April 2009 würde sie ohnehin in den erstbesten Zug zurück nach Berlin steigen. Hindern konnte sie dann niemand mehr daran. Amelie zündete sich eine Zigarette an und blickte sich in der Dunkelheit nach Thies um, der jeden Abend auf sie wartete, um sie nach Hause zu begleiten. Ihre enge Freundschaft war für die Tratschweiber im Dorf ein gefundenes Fressen. Die wildesten Gerüchte machten die Runde, aber das interessierte Amelie nicht. Thies Terlinden lebte mit dreißig Jahren noch immer bei seinen Eltern, weil er nicht ganz richtig im Kopf war, wie man im Dorf hinter vorgehaltener Hand erzählte. Amelie schulterte ihren Rucksack und lief los. Thies stand unter der Laterne vor der Kirche, die Hände in den Jackentaschen vergraben, den Blick auf den Boden gesenkt, und schloss sich ihr wortlos an, als sie an ihm vorbeiging.
»Heute Abend war richtig was los«, erzählte Amelie und berichtete Thies von den Ereignissen im Schwarzen Ross und was sie über Tobias Sartorius erfahren hatte. Sie hatte sich daran gewöhnt, von Thies so gut wie nie eine echte Antwort zu bekommen. Er sei dumm, hieß es, und er könne nicht sprechen, der Dorfdepp. Dabei stimmte das nicht. Thies war überhaupt nicht dumm, er war eben … anders. Amelie war auch anders. Ihr Vater mochte es nicht, dass sie ihre Zeit mit Thies verbrachte, aber er konnte nichts dagegen tun. Wahrscheinlich, so dachte Amelie hin und wieder mit zynischer Belustigung, hatte ihr spießiger Vater es längst bitter bereut, dass er auf Stiefmama Barbaras Drängen seine durchgeknallte Tochter aus seiner kurzen ersten Ehe bei sich aufgenommen hatte. Er war in ihren Augen nichts anderes als ein grauer konturloser Fleck ohne Ecken, Kanten und Rückgrat, der sich vorsichtig durch sein angepasstes Buchhalterleben lavierte, ständig darum bemüht, bloß nicht aufzufallen. Eine vorbestrafte, verhaltensauffällige siebzehnjährige Tochter, deren Gesicht ein halbes Pfund Metall schmückte, die ausschließlich schwarze Klamotten trug und, was Frisur und Make-up betraf, das Vorbild von Bill Kaulitz von Tokio Hotel hätte sein können, musste für ihn der blanke Horror sein. Gegen Amelies Freundschaft mit Thies hatte Arne Fröhlich sicherlich eine ganze Menge einzuwenden, ein Verbot hatte er allerdings nie ausgesprochen. Nicht dass es etwas genützt hätte. Über Verbote hatte Amelie sich ihr Leben lang hinweggesetzt. Den wahren Grund seiner schweigenden Duldung vermutete Amelie in der Tatsache, dass Thies der Sohn vom Chef ihres Vaters war. Sie ließ die Zigarettenkippe in einen Gully fallen und fuhr fort, laut über Manfred Wagner, Tobias Sartorius und die toten Mädchen nachzudenken.
Anstatt die beleuchtete Hauptstraße entlangzugehen, hatten sie den schmalen, düsteren Hohlweg eingeschlagen, der von der Kirche aus am Friedhof und den Gärten der Häuser vorbei quer durch den Ort bis hoch zum Waldrand führte. Nach zehn Minuten Fußmarsch erreichten sie die Waldstraße, in der ein Stück oberhalb des Dorfes auf großen Grundstücken nur drei Häuser standen: in der Mitte das Haus, in dem Amelie mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter und ihren beiden jüngeren Halbgeschwistern wohnte; rechts davon stand der Bungalow von Lauterbachs und ein Stück weiter links, umgeben von einem parkähnlichen Grundstück, die große alte Villa von Terlindens direkt am Waldrand. Nur wenige Meter vom schmiedeeisernen Tor des Terlinden-Anwesens entfernt befand sich die rückwärtige Toreinfahrt des Sartorius-Hofes, der sich den ganzen Hang hinunter bis zur Hauptstraße erstreckte. Früher war es ein richtiger Bauernhof gewesen, mit Kühen und Schweinen. Heute war der ganze Hof ein einziger Schweinestall, wie Amelies Vater abfällig zu sagen pflegte. Ein Schandfleck. Amelie blieb am Fuß der Treppe stehen. Üblicherweise trennten Thies und sie sich hier, er ging einfach weiter, ohne ein Wort zu sagen. Heute aber brach er sein Schweigen, als Amelie sich anschickte, die Treppe hochzugehen.
»Hier haben mal Schneebergers gewohnt«, sagte er mit seiner monotonen Stimme. Amelie drehte sich erstaunt um. Das erste Mal an diesem Abend sah sie den Freund direkt an, aber er erwiderte ihren Blick wie üblich nicht.
»Echt?«, vergewisserte sie sich ungläubig. »Das eine Mädchen, das Tobias Sartorius umgebracht hat, hat in unserem Haus gewohnt?«
Thies nickte, ohne sie anzusehen.
»Ja. Hier hat Schneewittchen gewohnt.«
Freitag, 7. November 2008
Tobias schlug die Augen auf und war für einen Augenblick verwirrt. Statt der weiß getünchten Decke seiner Zelle strahlte ihm Pamela Anderson von einem Poster entgegen. Erst da begriff er, dass er sich nicht mehr im Knast, sondern in seinem alten Zimmer im Haus seiner Eltern befand. Ohne sich zu regen lag er da und lauschte auf die Geräusche, die durch das schräggestellte Fenster drangen. Sechs Schläge der Kirchturmglocke verkündeten die frühe Uhrzeit, irgendwo bellte ein Hund, ein anderer fiel ein, dann verstummten beide wieder. Das Zimmer war unverändert: der Schreibtisch und das Bücherregal aus billigem Furnierholz, der Schrank mit der schiefen Tür. Die Poster von Eintracht Frankfurt, Pamela Anderson und Damon Hill im Williams Renault, der 1996 die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Die kleine Stereoanlage, die er im März 1997 von seinen Eltern bekommen hatte. Das rote Sofa, auf dem er … Tobias richtete sich auf und schüttelte unwillig den Kopf. Im Gefängnis hatte er seine Gedanken besser unter Kontrolle gehabt. Jetzt holten ihn die quälenden Überlegungen ein: Was wäre damals geschehen, wenn Stefanie nicht an jenem Abend mit ihm Schluss gemacht hätte? Würde sie heute noch leben? Er wusste, was er getan hatte. Das hatten sie ihm schließlich Hunderte Male erklärt – erst die Polizei, dann sein Anwalt, der Staatsanwalt und die Richterin. Es war schlüssig gewesen, es gab Indizien, es gab Zeugen, es gab das Blut in seinem Zimmer, an seiner Kleidung, in seinem Auto. Und doch fehlten in seiner Erinnerung volle zwei Stunden. Bis heute war da nichts als ein schwarzes Loch.
Er konnte sich genau an den 6. September 1997 erinnern. Der geplante Kerbeumzug war ausgefallen, aus Pietät, denn in London wurde an jenem späten Vormittag Prinzessin Diana zu Grabe getragen. Die halbe Welt hatte vor den Fernsehern gesessen und dabei zugesehen, wie der Sarg mit Englands tödlich verunglückter Rose durch die Straßen der englischen Hauptstadt gefahren wurde. Die ganze Kerb hatte man in Altenhain dennoch nicht ausfallen lassen wollen. Wären sie doch nur besser abends alle zu Hause geblieben!
Tobias seufzte und drehte sich auf die Seite. Es war so still, dass er seinen Herzschlag hören konnte. Für einen Moment gab er sich der Illusion hin, er wäre wieder zwanzig und das alles nicht passiert. Sein Studienplatz wartete in München auf ihn. Mit seinem Notendurchschnitt von 1,1 beim Abitur hatte er ihn ohne Probleme bekommen. In die glücklichen Erinnerungen mischten sich wieder schmerzliche. Auf der ausgelassenen Abifeier auf dem Gartengrundstück eines Klassenkameraden in Schneidhain hatte er Stefanie das erste Mal geküsst. Laura war vor Zorn beinahe geplatzt und hatte sich vor seinen Augen Lars an den Hals geworfen, um ihn eifersüchtig zu machen. Aber wie hatte er noch an Laura denken können, wenn er Stefanie im Arm hielt! Sie war das erste Mädchen, um das er sich wirklich hatte bemühen müssen. Das war eine gänzlich neue Erfahrung für ihn gewesen, liefen ihm die Mädchen üblicherweise doch, sehr zum Missfallen seiner Kumpels, in Scharen nach. Wochenlang hatte er um Stefanie geworben, bis sie ihn endlich erhört hatte. Die folgenden vier Wochen waren die glücklichsten seines Lebens gewesen – bis zur Ernüchterung am 6. September. Stefanie war zur Miss Kerb gekürt worden, ein alberner Titel, auf den eigentlich seit Jahren Laura abonniert gewesen war. Diesmal hatte Stefanie sie ausgestochen. Er hatte mit Nathalie und ein paar anderen am Getränkeausschank im Zelt gearbeitet und beobachten müssen, wie Stefanie mit anderen Typen flirtete, bis sie plötzlich verschwunden war. Vielleicht hatte er da schon mehr getrunken als gut für ihn war. Nathalie hatte gemerkt, wie sehr er litt. Geh sie schon suchen, hatte sie zum ihm gesagt. Er war aus dem Zelt gerannt. Lange hatte er nicht suchen müssen, und als er sie gefunden hatte, war die Eifersucht wie eine Bombe in seinem Innern explodiert. Wie hatte sie ihm das antun, ihn so vor allen Leuten kränken und verletzen können? Alles nur wegen dieser dämlichen Hauptrolle in dem noch dämlicheren Theaterstück? Tobias warf die Decke zurück und sprang auf. Er musste etwas tun, arbeiten, sich irgendwie ablenken von diesen quälenden Erinnerungen.
Amelie ging mit gesenktem Kopf durch den feinen Nieselregen. Das Angebot ihrer Stiefmutter, sie zur Bushaltestelle zu fahren, hatte sie wie jeden Morgen abgelehnt, aber nun musste sie sich sputen, wenn sie den Schulbus nicht verpassen wollte. Der November zeigte sich von seiner unfreundlichsten Seite, neblig und regnerisch, aber Amelie hatte etwas für die düstere Trostlosigkeit dieses Monats übrig. Sie mochte den einsamen Fußmarsch durch das schlafende Dorf. Über die Ohrstöpsel ihres iPod dröhnte trommelfellzerfetzend laut Musik von den ›Schattenkindern‹, einer ihrer bevorzugten Dark-Wave-Gruppen. Die halbe Nacht hatte sie wach gelegen und über Tobias Sartorius und die ermordeten Mädchen nachgedacht. Laura Wagner und Stefanie Schneeberger waren damals siebzehn Jahre alt gewesen, genauso alt, wie sie jetzt war. Und sie wohnte ausgerechnet in dem Haus, in dem früher einmal eines der Mordopfer gelebt haben sollte. Sie musste unbedingt mehr über das Mädchen erfahren, das Thies »Schneewittchen« genannt hatte. Was war damals in Altenhain vorgefallen?
Ein Auto bremste neben ihr. Sicher ihre Stiefmutter, die sie mit enervierender Freundlichkeit an den Rand des Wahnsinns zu treiben vermochte. Aber dann erkannte Amelie Claudius Terlinden, den Chef ihres Vaters. Er hatte das Seitenfenster auf der Beifahrerseite heruntergelassen und machte ihr ein Zeichen, näher zu kommen. Amelie schaltete die Musik aus.
»Soll ich dich mitnehmen?«, fragte er. »Du wirst ja ganz nass!«
Der Regen störte Amelie eigentlich nicht, aber sie fuhr gerne in Terlindens Auto mit. Sie mochte den fetten, schwarzen Mercedes mit den hellen Ledersitzen, er roch noch ganz neu, und sie war fasziniert von den technischen Raffinessen, die Claudius Terlinden ihr nur zu gerne vorführte. Aus unerfindlichen Gründen konnte sie den Nachbarn gut leiden, obwohl er mit seinen teuren Anzügen, den dicken Autos und seiner protzigen Villa eigentlich der Prototyp des dekadenten Geldsacks war, den sie und ihre Kumpels zu Hause von Herzen verachtet hatten. Dazu kam noch etwas anderes. Manchmal fragte Amelie sich, ob sie noch ganz normal war, denn bei jedem männlichen Wesen, das einigermaßen freundlich zu ihr war, dachte sie in letzter Zeit sofort an Sex. Wie Herr Terlinden wohl reagieren würde, wenn sie ihm die Hand aufs Bein legte und ihm ein eindeutiges Angebot machte? Schon beim Gedanken daran stieg ein hysterisches Kichern in ihr auf, das sie nur mit Mühe unterdrücken konnte.
»Na, komm schon!«, rief er und winkte mit der Hand. »Steig ein!«
Amelie stopfte die Ohrstöpsel in ihre Jackentasche und ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Die schwere Tür der Luxuskarosse schloss sich mit einem satten Schmatzen. Terlinden fuhr die Waldstraße hinunter und lächelte Amelie an.
»Was ist mit dir?«, fragte er. »Du siehst so grüblerisch aus.«
Amelie zögerte einen Moment. »Darf ich Sie was fragen?«
»Natürlich. Nur zu.«
»Die beiden Mädchen, die damals verschwunden sind. Haben Sie die gekannt?«
Claudius Terlinden warf ihr einen raschen Blick zu. Er lächelte nicht mehr. »Wieso möchtest du das wissen?«
»Ich bin halt neugierig. Es wird so viel geredet, seit dieser Mann wieder da ist. Irgendwie finde ich es spannend.«
»Hm. Das war eine traurige Sache damals. Und ist es bis heute«, erwiderte Terlinden. »Natürlich habe ich die beiden Mädchen gekannt. Stefanie war ja die Tochter unserer Nachbarn. Und Laura kannte ich auch, seit ihrer Kindheit. Ihre Mutter hat bei uns als Haushälterin gearbeitet. Es ist einfach schrecklich für die Eltern, dass die Mädchen nie gefunden wurden.«
»Hm«, machte Amelie nachdenklich. »Hatten sie Spitznamen?«
»Wen meinst du?« Claudius Terlinden schien verwundert über diese Frage.
»Stefanie und Laura.«
»Das weiß ich nicht. Warum … ach, doch. Stefanie hatte einen Spitznamen. Die anderen Kinder nannten sie Schneewittchen.«
»Und wieso?«
»Vielleicht wegen ihres Nachnamens. Schneeberger.« Terlinden runzelte die Stirn und verlangsamte die Fahrt. Der Schulbus stand schon mit eingeschaltetem Warnblinker an der Haltestelle und wartete auf die wenigen Schüler, die er nach Königstein transportieren sollte.
»Ach nein«, erinnerte sich Claudius Terlinden dann. »Ich glaube, das hing mit diesem Theaterstück zusammen, das in der Schule aufgeführt werden sollte. Stefanie hatte die Hauptrolle bekommen. Sie sollte das Schneewittchen spielen.«
»Sollte?«, fragte Amelie neugierig nach. »Hat sie es nicht getan?«
»Nein. Sie wurde ja vorher … hm … sie verschwand vorher.«