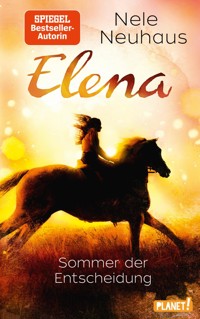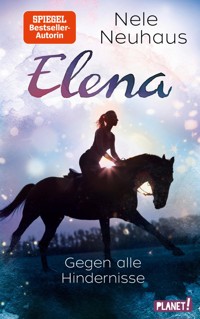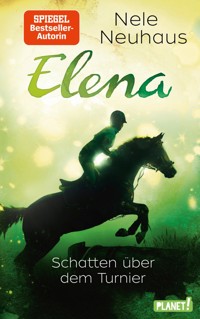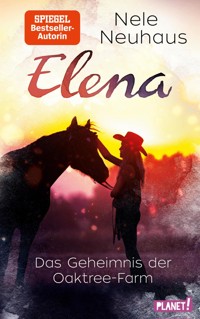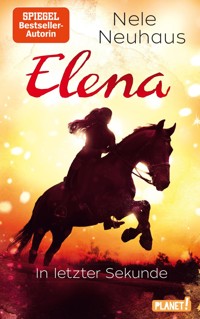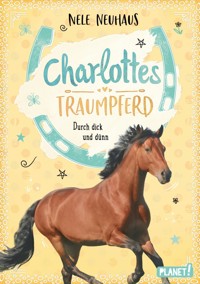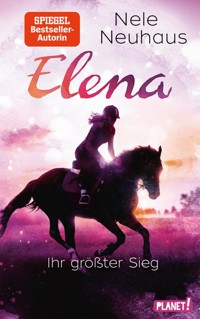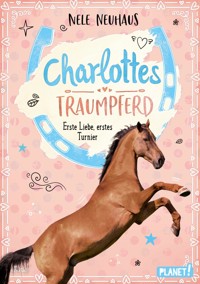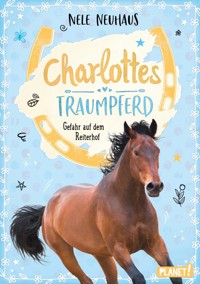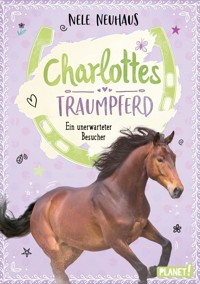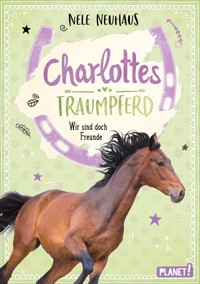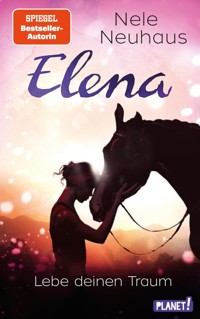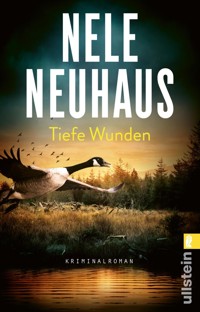
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Krimi-Bestsellerserie um Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein geht weiter und ist packender denn je! Der 92-jährige Holocaust- Überlebende David Josua Goldberg wird in seinem Haus im Taunus mit einem Genickschuss getötet. Bei der Obduktion macht der Arzt eine seltsame Entdeckung: Goldbergs Arm trägt die Reste einer Blutgruppentätowierung, wie sie bei Angehörigen der SS üblich war. Dann geschehen zwei weitere Morde, die Hinrichtungen gleichen. Welches Geheimnis verband die Opfer miteinander? Die Ermittlungen führen Hauptkommissar Oliver von Bodenstein und seine Kollegin Pia Kirchhoff weit in die Vergangenheit: nach Ostpreußen im Januar 1945 ... »Ein spannender Krimi aus dem Taunus, der sich mit unerwünschten Vergangenheiten und totgeschwiegenen Familiengeheimnissen beschäftigt.« Hallo-buch.de *** Absolute Suchtgefahr und ein Muss für alle Krimi-Fans: fesselnd, brutal und unberechenbar! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Tiefe Wunden
NELE NEUHAUS, geboren in Münster / Westfalen, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus und schreibt bereits ebenso lange. Ihr 2010 erschienener Kriminalroman Schneewittchen muss sterben brachte ihr den großen Durchbruch, heute ist sie die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands. Außerdem schreibt die passionierte Reiterin Pferde-Jugendbücher und Unterhaltungsliteratur. Ihre Bücher erscheinen in über 30 Ländern. Vom Polizeipräsidenten Westhessens wurde Nele Neuhaus zur Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber ernannt.
DREI MORDE UND EIN TÖDLICHES GEHEIMNISDer Mord gleicht einer Hinrichtung: Ein 92-jähriger Holocaust-Überlebender wird in seinem Haus im Taunus mit einem Genickschuss getötet. Bei der Obduktion macht der Arzt eine seltsame Entdeckung: Der Arm des Toten trägt die Reste einer SS-Blutgruppentätowierung. Dann geschehen zwei weitere Morde nach demselben Muster. Welches Geheimnis verband die Opfer miteinander? Bei ihren Ermittlungen stoßen Hauptkommissar Oliver von Bodenstein und seine Kollegin Pia Kirchhoff auf eine Familientragödie, die im Januar 1945in Ostpreußen begann …
Nele Neuhaus
Tiefe Wunden
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2009Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Silas Manhood / Trevillion Images und © FinePic®, MünchenAlle Rechte vorbehaltenAutorenfoto: © Andreas MalkmusE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-548-92091-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Samstag, 28. April 2007
Sonntag, 29. April 2007
Montag, 30. April 2007
Dienstag, 1. Mai 2007
Mittwoch, 2. Mai 2007
Donnerstag, 3. Mai 2007
Freitag, 4. Mai 2007
Samstag, 5. Mai 2007
Sonntag, 6. Mai 2007
Montag, 7. Mai 2007
Dienstag, 8. Mai 2007
Mittwoch 9. Mai 2007
Donnerstag, 10. Mai 2007
Freitag, 11. Mai 2007
Epilog September 2007
Danksagung
Leseprobe: Monster
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Niemand aus seiner Familie hatte seine Entscheidung, den Lebensabend in Deutschland zu verbringen, verstanden, am wenigsten er selbst. Ganz plötzlich hatte er gespürt, dass er in dem Land, das über sechzig Jahre so gut zu ihm gewesen war, nicht sterben wollte. Er sehnte sich nach der Lektüre deutscher Zeitungen, nach dem Klang der deutschen Sprache in seinen Ohren. David Goldberg hatte Deutschland nicht freiwillig verlassen, es war damals, 1945, lebensnotwendig gewesen, und er hatte das Beste aus dem Verlust seiner Heimat gemacht. Aber nun gab es nichts mehr, was ihn in Amerika hielt. Das Haus in der Nähe von Frankfurt hatte er kurz nach Sarahs Tod vor beinahe zwanzig Jahren gekauft, um nicht in anonymen Hotels übernachten zu müssen, wenn ihn seine zahlreichen geschäftlichen oder freundschaftlichen Verpflichtungen nach Deutschland führten.
Goldberg stieß einen tiefen Seufzer aus und blickte durch die großen Panoramascheiben auf die Ausläufer des Taunus, die von der untergehenden Sonne in ein goldenes Licht getaucht wurden. Er konnte sich an Sarahs Gesicht kaum mehr erinnern. Überhaupt waren die sechzig Jahre, die er in den USA gelebt hatte, oft aus seinem Gedächtnis wie weggewischt, und er hatte Mühe, sich an die Namen seiner Enkelkinder zu erinnern. Dafür war seine Erinnerung an die Zeit vor Amerika, an die er lange nicht mehr gedacht hatte, umso schärfer. Manchmal, wenn er nach einem kurzen Nickerchen aufwachte, brauchte er Minuten, um zu begreifen, wo er war. Dann betrachtete er mit Verachtung seine knotigen, zittrigen Greisenhände, die schorfige, altersfleckige Haut. Alt zu werden war keine Gnade, so ein Unsinn. Wenigstens hatte ihm das Schicksal erspart, ein sabbernder, hilfloser Pflegefall zu werden, wie so viele seiner Freunde und Weggefährten, die nicht das Glück gehabt hatten, rechtzeitig von einem Herzinfarkt dahingerafft zu werden. Er hatte eine stabile Konstitution, die seine Ärzte immer wieder erstaunte, war lange Jahre geradezu immun gegen die meisten Alterserscheinungen gewesen. Das verdankte er seiner eisernen Disziplin, mit der er jede Herausforderung im Leben gemeistert hatte. Nie hatte er sich gehen lassen, bis heute achtete er auf korrekte Kleidung und ein ordentliches Äußeres. Goldberg schauderte beim Gedanken an seinen letzten, unerfreulichen Besuch in einem Altersheim. Der Anblick der Alten, die in Bademänteln und Hausschlappen mit wirrem Haar und leerem Blick wie Geister aus einer anderen Welt durch die Gänge schlurften oder einfach sinnlos herumsaßen, hatte ihn abgestoßen. Die meisten waren jünger als er, trotzdem hätte er es sich verbeten, wenn man ihn mit ihnen in einen Topf geworfen hätte.
»Herr Goldberg?«
Er fuhr zusammen und wandte den Kopf. Die Pflegerin, deren Anwesenheit und Namen er bisweilen vergaß, stand im Türrahmen. Wie hieß sie noch gleich? Elvira, Edith … egal. Seine Familie hatte darauf bestanden, dass er nicht alleine lebte, und diese Frau für ihn organisiert. Fünf Bewerberinnen hatte Goldberg abgelehnt. Er wollte nicht mit einer Polin oder einer Asiatin unter einem Dach leben, außerdem spielte das Äußere für ihn eine Rolle. Sie hatte ihm sofort gefallen: groß, blond, energisch. Sie war Deutsche, examinierte Hauswirtschafterin und Krankenschwester. Für alle Fälle, hatte Goldbergs Ältester Sal gesagt. Er zahlte dieser Frau sicherlich ein fürstliches Gehalt, denn sie ertrug seine Schrullen und beseitigte die Spuren seiner zunehmenden Hinfälligkeit, ohne jemals mit der Wimper zu zucken. Sie trat neben seinen Sessel und blickte ihn prüfend an. Goldberg erwiderte ihren Blick. Sie war geschminkt, der Ausschnitt ihrer Bluse ließ den Ansatz ihrer Brüste sehen, von denen er gelegentlich träumte. Wohin sie wohl ging? Ob sie einen Freund hatte, mit dem sie sich an ihrem freien Abend traf? Sie war höchstens vierzig und sehr attraktiv. Aber er würde sie nicht fragen. Er wollte keine Vertraulichkeit.
»Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt gehe?« Ihre Stimme hatte einen leicht ungeduldigen Beiklang. »Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich habe Ihr Abendbrot und die Tabletten vorbereitet und …«
Goldberg schnitt ihr mit einer Handbewegung das Wort ab. Sie neigte bisweilen dazu, ihn wie ein zurückgebliebenes Kind zu behandeln.
»Gehen Sie nur«, sagte er knapp, »ich komme klar.«
»Morgen früh um halb acht bin ich wieder da.«
Daran zweifelte er nicht. Deutsche Pünktlichkeit.
»Ihren dunklen Anzug für morgen habe ich schon aufgebügelt, auch das Hemd.«
»Ja, ja. Danke.«
»Soll ich die Alarmanlage einschalten?«
»Nein, das mache ich später schon selbst. Gehen Sie nur. Viel Spaß.«
»Danke.« Das klang erstaunt. Er hatte ihr noch nie viel Spaß gewünscht. Goldberg hörte die Absätze ihrer Schuhe über den Marmorboden der Eingangshalle klappern, dann fiel die schwere Haustür ins Schloss. Die Sonne war hinter den Bergen des Taunus verschwunden, es dämmerte. Er starrte mit düsterer Miene hinaus. Da draußen machten sich Millionen junger Menschen auf den Weg zu Verabredungen, zu unbeschwertem Vergnügen. Früher einmal hatte er zu ihnen gehört, er war ein gutaussehender Mann gewesen, wohlhabend, einflussreich, bewundert. In Elviras Alter hatte er keinen Gedanken an die Greise verschwendet, die mit schmerzenden Knochen ständig fröstelnd in ihren Sesseln saßen, um mit einer Wolldecke über arthritischen Knien dem letzten großen Ereignis in ihrem Leben entgegenzudämmern: dem Tod. Kaum zu fassen, dass es ihn nun auch erwischt hatte. Jetzt war er ein solches Fossil, ein Überbleibsel aus grauer Vorzeit, dessen Freunde, Bekannte und Weggefährten ihm längst vorausgegangen waren. Drei Menschen gab es noch auf dieser Welt, mit denen er über früher sprechen konnte, die sich an ihn erinnerten, als er noch jung und stark gewesen war.
Der Klang der Türglocke riss ihn aus seinen Gedanken. War es schon halb neun? Wahrscheinlich. Sie war immer pünktlich, genau wie diese Edith. Goldberg erhob sich mit einem unterdrückten Stöhnen aus dem Sessel. Sie hatte vor der Geburtstagsfeier morgen noch einmal dringend mit ihm sprechen wollen, unter vier Augen. Kaum zu glauben, dass sie auch schon fünfundachtzig wurde, die Kleine. Er durchquerte mit steifen Schritten Wohnzimmer und Eingangshalle, warf einen kurzen Blick in den Spiegel neben der Tür und glättete mit den Händen sein immer noch ziemlich volles weißes Haar. Auch wenn er wusste, dass sie sich mit ihm streiten würde, so freute er sich, sie zu sehen. Er freute sich immer. Sie war der wichtigste Grund, weshalb er nach Deutschland zurückgekehrt war. Mit einem Lächeln öffnete er die Haustür.
Samstag, 28. April 2007
Oliver von Bodenstein nahm den Topf mit der heißen Milch vom Herd, rührte zwei Löffel Kakaopulver hinein und füllte das dampfende Getränk in eine Kanne. So lange Cosima stillte, verzichtete sie auf ihren geliebten Kaffee, und er zeigte sich gelegentlich solidarisch. Ein heißer Kakao war auch nicht zu verachten. Sein Blick begegnete dem von Rosalie, und er grinste, als er die kritische Miene seiner neunzehnjährigen Tochter sah.
»Das sind mindestens zweitausend Kalorien«, sagte sie und rümpfte die Nase. »Wie könnt ihr nur!«
»Da siehst du mal, was man seinen Kindern zuliebe alles tut«, erwiderte er.
»Auf meinen Kaffee würde ich sicher nicht verzichten«, behauptete sie und nahm demonstrativ einen Schluck aus ihrer Tasse.
»Abwarten.« Bodenstein nahm zwei Porzellanbecher aus dem Schrank und stellte sie neben die Kakaokanne auf ein Tablett. Cosima hatte sich noch einmal hingelegt, nachdem das Baby sie bereits um fünf Uhr aus dem Bett gescheucht hatte. Ihr aller Leben hatte sich seit der Geburt von Sophia Gabriela im vergangenen Dezember komplett verändert. Der erste Schreck über die Nachricht, dass Cosima und er noch einmal Eltern werden würden, war zuerst einer glücklichen Vorfreude, dann aber einiger Besorgnis gewichen. Lorenz und Rosalie waren dreiundzwanzig und neunzehn, längst erwachsen und mit der Schule fertig. Wie würde es sein, das alles noch einmal von vorne durchzumachen? Waren er und Cosima überhaupt dazu in der Lage? Würde das Kind gesund sein? Bodensteins heimliche Sorgen hatten sich als unbegründet erwiesen. Bis zum Tag vor der Niederkunft war Cosima ihrer Arbeit nachgegangen, das positive Ergebnis einer Fruchtwasseruntersuchung hatte sich bei Sophias Geburt bestätigt: Die Kleine war kerngesund. Und jetzt, nach knapp fünf Monaten, fuhr Cosima wieder täglich in ihr Büro, das Baby im MaxiCosi immer dabei. Eigentlich, dachte Bodenstein, war alles viel einfacher als bei Lorenz und Rosalie. Zwar waren sie damals noch jünger und robuster gewesen, aber sie hatten nur wenig Geld und eine kleine Wohnung gehabt. Außerdem hatte er gespürt, dass Cosima darunter litt, ihren heißgeliebten Beruf als Fernsehreporterin aufgeben zu müssen.
»Warum bist du eigentlich so früh auf den Beinen?«, fragte er seine ältere Tochter. »Heute ist doch Samstag.«
»Ich muss um neun im Schloss sein«, entgegnete Rosalie. »Wir haben heute eine Riesenveranstaltung. Champagnerempfang und danach Sechs-Gänge-Menü für dreiundfünfzig Leute. Eine von Omas Freundinnen feiert bei uns ihren 85. Geburtstag.«
»Aha.«
Rosalie hatte sich nach ihrem bestandenen Abitur im vergangenen Sommer gegen ein Studium und stattdessen für eine Lehre als Köchin im noblen Restaurant von Bodensteins Bruder Quentin und seiner Schwägerin Marie-Louise entschieden. Zur Überraschung ihrer Eltern war Rosalie voller Begeisterung bei der Sache. Sie beklagte sich weder über unchristliche Arbeitszeiten noch über ihren strengen und cholerischen Chef. Cosima argwöhnte, dass genau dieser Chef, der temperamentvolle Sterne-Koch Jean-Yves St. Clair, der eigentliche Grund für Rosalies Entscheidung gewesen sei.
»Die haben mindestens zehnmal die Menüfolge, die Weinauswahl und die Anzahl der Gäste geändert.« Rosalie stellte ihre Kaffeetasse in die Spülmaschine. »Bin mal gespannt, ob denen noch was Neues eingefallen ist.«
Das Telefon klingelte. An einem Samstagmorgen um halb neun verhieß das erfahrungsgemäß nichts Gutes. Rosalie ging dran und kam wenig später mit dem tragbaren Telefon zurück in die Küche. »Für dich, Papa«, sagte sie, hielt ihm das Gerät entgegen und verabschiedete sich mit einem kurzen Winken. Bodenstein seufzte. Aus dem Spaziergang im Taunus und einem gemütlichen Mittagessen mit Cosima und Sophia würde wohl nichts werden. Seine Befürchtungen bestätigten sich, als er die angespannte Stimme von Kriminalkommissarin Pia Kirchhoff hörte.
»Wir haben einen Toten. Ich weiß, ich habe heute Bereitschaft, aber vielleicht sollten Sie mal kurz herkommen, Chef. Der Mann war ein hohes Tier, außerdem Amerikaner.«
Das klang stark nach einem verdorbenen Wochenende.
»Wo?«, fragte Bodenstein knapp.
»Sie haben es nicht weit. Kelkheim. Drosselweg 39a. David Goldberg. Seine Haushälterin hat ihn heute Morgen um halb acht gefunden.«
Bodenstein versprach, sich zu beeilen, dann brachte er Cosima den Kakao und verkündete ihr die schlechte Nachricht.
»Leichen am Wochenende gehören verboten«, murmelte Cosima und gähnte herzhaft. Bodenstein lächelte. Noch nie in den vierundzwanzig Jahren ihrer Ehe hatte seine Frau verärgert oder missmutig reagiert, wenn er überraschend wegmusste und damit die Pläne eines Tages ruinierte. Sie setzte sich auf und ergriff den Becher. »Danke. Wo musst du hin?«
Bodenstein nahm ein Hemd aus dem Kleiderschrank. »In den Drosselweg. Ich könnte eigentlich zu Fuß gehen. Der Mann hieß Goldberg und war Amerikaner. Pia Kirchhoff befürchtet, dass es kompliziert werden könnte.«
»Goldberg«, überlegte Cosima und zog grüblerisch die Stirn in Falten. »Den Namen habe ich erst neulich irgendwo gehört. Aber ich weiß nicht mehr, wo.«
»Es heißt, er sei ein hohes Tier gewesen.« Bodenstein entschied sich für eine blau gemusterte Krawatte und schlüpfte in ein Jackett.
»Ah ja, ich weiß es wieder«, sagte Cosima. »Frau Schönermark vom Blumengeschäft war es! Ihr Mann liefert Goldberg jeden zweiten Tag frische Blumen. Er ist vor einem halben Jahr fest hierhergezogen, früher hat er das Haus nur gelegentlich bewohnt, wenn er zu Besuch in Deutschland war. Sie hat gesagt, sie habe gehört, er sei mal Berater von Präsident Reagan gewesen.«
»Na, dann muss er ja schon etwas älter gewesen sein.« Bodenstein beugte sich über seine Frau und küsste sie auf die Wange. Er war in Gedanken schon bei dem, was ihn erwarten würde. Wie jedes Mal, wenn er zum Fundort einer Leiche gerufen wurde, überfiel ihn diese Mischung aus Herzklopfen und Beklommenheit, die erst verschwand, wenn er die Leiche gesehen hatte.
»Ja, er war ziemlich alt.« Cosima nippte abwesend an ihrem nur noch lauwarmen Kakao. »Aber da war noch etwas …«
Außer ihm und dem Priester mit seinen beiden verschlafenen Messdienern waren nur einige alte Mütterchen, die entweder die Furcht vor dem nahenden Ende oder die Aussicht auf einen weiteren öden und einsamen Tag so früh in die Kirche getrieben hatte, zur Messe nach St. Leonhard gekommen. Sie saßen verstreut im vorderen Drittel des Kirchenschiffs auf den harten hölzernen Bänken und lauschten der leiernden Stimme des Priesters, der hin und wieder verstohlen gähnte. Marcus Nowak kniete in der hintersten Bank und starrte blicklos vor sich hin. Der Zufall hatte ihn in diese Kirche mitten in Frankfurt geführt. Hier kannte ihn niemand, und er hatte insgeheim gehofft, dass ihm der tröstlich vertraute Ablauf der heiligen Messe sein seelisches Gleichgewicht zurückgeben würde, aber dem war nicht so. Ganz im Gegenteil. Aber wie konnte er das auch erwarten, nachdem er jahrelang keine Kirche mehr betreten hatte? Es kam ihm vor, als müsste ihm jeder ansehen, was er in der vergangenen Nacht getan hatte. Das war keine jener Sünden, die man im Beichtstuhl loswerden und mit zehn Vaterunser wiedergutmachen konnte! Er war nicht würdig, hier zu sitzen und auf Gottes Vergebung zu hoffen, denn seine Reue war nicht echt. Das Blut stieg ihm ins Gesicht, und er schloss die Augen, als er daran dachte, wie sehr es ihm gefallen, wie sehr es ihn berauscht und beglückt hatte. Noch immer sah er sein Gesicht vor sich, wie er ihn angesehen hatte und schließlich vor ihm auf die Knie gegangen war. Mein Gott. Wie hatte er das nur tun können? Er legte seine Stirn auf seine gefalteten Hände und spürte, wie eine Träne über seine unrasierte Wange lief, als ihm die ganze Tragweite bewusst wurde. Nie wieder würde sein Leben so sein wie vorher. Er biss sich auf die Lippen, öffnete die Augen und betrachtete seine Hände mit einem Anflug von Abscheu. In tausend Jahren könnte er diese Schuld nicht abwaschen. Das Schlimmste jedoch war, dass er es wieder tun würde, sobald sich eine passende Gelegenheit ergeben sollte. Wenn seine Frau, seine Kinder oder seine Eltern je davon erfuhren – sie würden ihm nie verzeihen. Er stieß einen so abgrundtiefen Seufzer aus, dass sich zwei der alten Mütterchen aus den vorderen Reihen erstaunt nach ihm umsahen. Rasch senkte er den Kopf wieder auf die Hände und verfluchte seinen Glauben, der ihn zu einem Gefangenen seiner anerzogenen Moralvorstellungen machte. Aber wie er es auch drehen und wenden mochte, es gab keine Entschuldigung, solange er sein Tun nicht ehrlich bereute. Ohne Reue gab es keine Buße, kein Vergeben.
Der alte Mann kniete auf dem spiegelblanken Marmorboden in der Eingangshalle des Hauses, keine drei Meter von der Haustür entfernt. Sein Oberkörper war nach vorne gekippt, sein Kopf lag in einer Lache geronnenen Blutes. Bodenstein mochte sich nicht vorstellen, wie sein Gesicht aussah, oder das, was davon übrig war. Die tödliche Kugel war in den Hinterkopf eingetreten, das kleine dunkle Loch wirkte täuschend unscheinbar. Der Austritt der Kugel hingegen hatte beträchtlichen Schaden angerichtet. Blut und Hirnmasse waren durch den ganzen Raum gespritzt, klebten an der dezent gemusterten Seidentapete, an den Türrahmen, den Bildern und dem großen venezianischen Spiegel neben der Eingangstür.
»Hallo, Chef.« Pia Kirchhoff trat aus der Tür an der Stirnseite des Flures. Sie gehörte seit knapp zwei Jahren zum Team des K11 der Regionalen Kriminalinspektion in Hofheim. Obwohl sonst eine ausgesprochene Frühaufsteherin, sah sie an diesem Morgen ziemlich verschlafen aus. Bodenstein ahnte, weshalb, verkniff sich aber eine Bemerkung und nickte ihr zu: »Wer hat ihn gefunden?«
»Seine Haushälterin. Sie hatte gestern ihren freien Abend, kam heute Morgen gegen halb acht ins Haus.«
Die Kollegen vom Erkennungsdienst trafen ein, warfen von der Haustür aus einen kurzen Blick auf die Leiche und zogen sich draußen weiße Einwegoveralls und -überziehschuhe an.
»Herr Hauptkommissar!«, rief einer der Männer, und Bodenstein wandte sich zur Tür.
»Hier liegt ein Handy.« Der Beamte fischte mit seiner behandschuhten Rechten ein Mobiltelefon aus dem Blumenbeet neben der Haustür.
»Packen Sie es ein«, erwiderte Bodenstein. »Vielleicht haben wir Glück, und es gehört dem Täter.«
Er drehte sich um. Ein Sonnenstrahl, der durch die Haustür fiel, traf den großen Spiegel und ließ ihn für einen Moment aufleuchten. Bodenstein stutzte.
»Haben Sie das hier gesehen?«, fragte er seine Kollegin.
»Was meinen Sie?« Pia Kirchhoff kam näher. Sie hatte ihr blondes Haar zu zwei Zöpfen geflochten und nicht einmal die Augen geschminkt, ein sicheres Indiz dafür, dass sie es heute Morgen eilig gehabt hatte. Bodenstein deutete auf den Spiegel. Mitten in die Blutspritzer war eine Zahl gemalt worden. Pia kniff die Augen zusammen und betrachtete die fünf Ziffern eingehend.
»1–6-1–4-5. Was hat das zu bedeuten?«
»Ich habe keinen blassen Schimmer«, gab Bodenstein zu und ging vorsichtig, um keine Spuren zu zerstören, an der Leiche vorbei. Er betrat nicht sofort die Küche, sondern schaute in die Räume, die sich an den Eingangsbereich und den Flur anschlossen. Das Haus war ein Bungalow, aber größer, als es von außen den Anschein hatte. Die Einrichtung war altmodisch, wuchtige Möbel im Gründerzeitstil, Nussbaum und Eiche mit Schnitzereien. Im Wohnzimmer lagen verblichene Perserteppiche auf beigefarbenem Teppichboden.
»Er muss Besuch gehabt haben.« Pia wies auf den Couchtisch, auf dessen Marmorplatte zwei Weingläser und eine Rotweinflasche standen, daneben ein weißes Porzellanschälchen mit Olivensteinen. »Die Haustür war nicht beschädigt, und bei der ersten oberflächlichen Betrachtung gibt es keine Einbruchspuren. Vielleicht hat er mit seinem Mörder noch etwas getrunken.«
Bodenstein ging zu dem niedrigen Couchtisch, beugte sich vor und kniff die Augen zusammen, um das Etikett der Weinflasche zu lesen.
»Wahnsinn.« Er streckte schon die Finger nach der Flasche aus, als ihm gerade noch rechtzeitig einfiel, dass er keine Handschuhe trug.
»Was ist?«, fragte Pia Kirchhoff. Bodenstein richtete sich auf.
»Das ist ein 1993er Château Petrus«, antwortete er mit einem ehrfürchtigen Blick auf die unscheinbare grüne Flasche mit dem in der Weinwelt so begehrten roten Schriftzug in der Mitte des Etiketts. »Diese eine Flasche kostet ungefähr so viel wie ein Kleinwagen.«
»Nicht zu fassen.«
Bodenstein wusste nicht, ob seine Kollegin damit die Verrückten meinten, die so viel Geld für eine Flasche Wein bezahlten, oder die Tatsache, dass das Mordopfer kurz vor seinem Tod – vielleicht sogar mit seinem Mörder – einen solch edlen Tropfen getrunken hatte.
»Was wissen wir über den Toten?«, fragte er, nachdem er festgestellt hatte, dass die Flasche nur zur Hälfte geleert worden war. Er empfand echtes Bedauern bei dem Gedanken daran, dass man den Rest achtlos in die Spüle gießen würde, bevor die Flasche ins Labor wanderte.
»Goldberg lebte seit Oktober letzten Jahres hier«, sagte Pia. »Er stammte aus Deutschland, hat aber über sechzig Jahre in den USA gelebt, und da muss er ein ziemlich wichtiger Mann gewesen sein. Die Haushälterin meint, seine Familie sei wohlhabend.«
»Lebte er alleine? Er war doch ziemlich alt.«
»Zweiundneunzig. Aber sehr rüstig. Die Haushälterin hat eine Wohnung im Souterrain. Sie hat zweimal in der Woche einen freien Abend, am Sabbat und an einem Abend ihrer Wahl.«
»Goldberg war Jude?« Bodensteins Blick glitt durch das Wohnzimmer und blieb wie zur Bestätigung auf einem bronzenen siebenarmigen Leuchter hängen, der auf einer Anrichte stand. Die Kerzen der Menora waren noch nicht angezündet worden. Sie betraten die Küche, die im Vergleich zum Rest des Hauses hell und modern war.
»Das ist Eva Ströbel«, stellte Pia ihrem Chef die Frau vor, die am Küchentisch saß und sich nun erhob. »Die Haushälterin von Herrn Goldberg.«
Sie war groß, musste trotz flacher Absätze kaum den Kopf heben, um Bodenstein in die Augen sehen zu können. Er reichte ihr die Hand und musterte das blasse Gesicht der Frau. Der Schreck war ihr deutlich anzusehen. Eva Ströbel erzählte, sie sei vor sieben Monaten von Sal Goldberg, dem Sohn des Ermordeten, als Haushälterin für seinen Vater eingestellt worden. Seitdem wohne sie in der Souterrainwohnung und kümmere sich um den alten Herrn und den Haushalt. Goldberg sei noch sehr selbständig gewesen, geistig rege und überaus diszipliniert. Er habe großen Wert auf einen geregelten Tagesablauf und drei Mahlzeiten am Tag gelegt, das Haus habe er nur selten verlassen. Ihr Verhältnis zu Goldberg sei distanziert, aber gut gewesen.
»Hatte er häufig Besuch?«, wollte Pia wissen.
»Nicht häufig, aber gelegentlich«, erwiderte Eva Ströbel. »Einmal im Monat kommt sein Sohn aus Amerika und bleibt für zwei oder drei Tage. Außerdem hatte er hin und wieder Besuch von Bekannten, aber meistens abends. Namen kann ich Ihnen keine nennen, er hat mir seine Gäste nie vorgestellt.«
»Erwartete er gestern Abend auch Besuch? Im Wohnzimmer auf dem Tisch stehen zwei Gläser und eine Flasche Rotwein.«
»Dann muss jemand da gewesen sein«, sagte die Haushälterin. »Ich habe keinen Wein eingekauft, und es ist auch keiner im Haus.«
»Konnten Sie feststellen, ob irgendetwas fehlt?«
»Ich habe noch nicht nachgesehen. Als ich ins Haus kam und … und Herrn Goldberg da liegen sah, habe ich die Polizei angerufen und vor der Tür gewartet.« Sie machte eine unbestimmte Handbewegung. »Ich meine, da war das Blut, überall. Da war mir klar, dass ich nichts mehr hätte tun können.«
»Sie haben ganz richtig gehandelt.« Bodenstein lächelte sie freundlich an. »Machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Wann haben Sie gestern Abend das Haus verlassen?«
»Gegen acht. Ich habe noch das Abendessen und seine Tabletten vorbereitet.«
»Wann waren Sie wieder zurück?«, erkundigte Pia sich.
»Heute Morgen um kurz vor sieben. Herr Goldberg legte Wert auf Pünktlichkeit.«
Bodenstein nickte. Dann erinnerte er sich an die Ziffern auf dem Spiegelglas.
»Sagt Ihnen die Zahl 16 145 etwas?«, erkundigte er sich. Die Haushälterin blickte ihn erstaunt an und schüttelte den Kopf.
In der Halle wurden Stimmen laut. Bodenstein wandte sich zur Tür und stellte fest, dass Dr. Henning Kirchhoff – der stellvertretende Leiter des Zentrums für Rechtsmedizin in Frankfurt und Exmann seiner Kollegin – höchstselbst gekommen war. Früher, während seiner Zeit beim K11 in Frankfurt, hatte Bodenstein oft und gerne mit Kirchhoff zusammengearbeitet. Der Mann war eine Koryphäe in seinem Beruf, ein brillanter Wissenschaftler mit einer an Besessenheit grenzenden Arbeitseinstellung, außerdem einer der wenigen Spezialisten für forensische Anthropologie in Deutschland. Wenn sich herausstellte, dass Goldberg in seinem Leben tatsächlich eine wichtige Persönlichkeit gewesen war, würde das öffentliche und politische Interesse den Druck auf das K11 erheblich erhöhen. Umso besser, wenn ein anerkannter Spezialist wie Kirchhoff Leichenschau und Obduktion vornahm. Denn auf dieser würde Bodenstein bestehen, ganz gleich, wie offensichtlich die Todesursache auch sein mochte.
»Hallo, Henning«, hörte Bodenstein die Stimme von Pia Kirchhoff hinter sich. »Danke, dass du gleich selbst gekommen bist.«
»Dein Wunsch war mir Befehl.« Kirchhoff ging neben der Leiche Goldbergs in die Hocke und betrachtete sie prüfend. »Da hat der alte Knabe den Krieg und Auschwitz überlebt, um in seinem eigenen Haus hingerichtet zu werden. Unglaublich.«
»Kanntest du ihn?« Pia schien überrascht.
»Nicht persönlich.« Kirchhoff blickte auf. »Aber er war in Frankfurt nicht nur bei der Jüdischen Gemeinde hoch geschätzt. Wenn ich mich richtig erinnere, war er ein wichtiger Mann in Washington und über Jahrzehnte Berater des Weißen Hauses, sogar Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates. Er hatte mit der Rüstungsindustrie zu tun. Außerdem hat er viel für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel getan.«
»Woher weißt du das?«, hörte Bodenstein seine Kollegin misstrauisch fragen. »Hast du etwa eben noch schnell seinen Namen gegoogelt, um bei uns Eindruck zu schinden?«
Kirchhoff erhob sich und warf ihr einen gekränkten Blick zu.
»Nein. Das habe ich irgendwo gelesen und abgespeichert.«
Das ließ Pia Kirchhoff gelten. Ihr geschiedener Mann hatte ein fotografisches Gedächtnis und war überdurchschnittlich intelligent. In zwischenmenschlicher Hinsicht hingegen besaß er einige eklatante Schwächen, er war ein Zyniker und Misanthrop.
Der Rechtsmediziner trat zur Seite, damit der Beamte vom Erkennungsdienst die notwendigen Tatortfotos schießen konnte. Pia machte ihn auf die Zahl auf dem Spiegel aufmerksam.
»Hm.« Kirchhoff betrachtete die fünf Ziffern aus nächster Nähe.
»Was könnte das wohl bedeuten?«, fragte Pia. »Das muss der Mörder geschrieben haben, oder?«
»Ist anzunehmen«, bestätigte Kirchhoff. »Jemand hat sie in das Blut gezeichnet, als es noch frisch war. Aber was sie bedeuten – keine Ahnung. Ihr solltet den Spiegel mitnehmen und untersuchen lassen.«
Er wandte sich wieder der Leiche zu. »Ach ja, Bodenstein«, sagte er leichthin. »Ich vermisse Ihre Frage nach dem Todeszeitpunkt.«
»Üblicherweise frage ich frühestens nach zehn Minuten«, entgegnete Bodenstein trocken. »Für einen Hellseher halte ich Sie bei aller Wertschätzung dann doch nicht.«
»Ich würde ganz unverbindlich behaupten, dass der Tod um zwanzig nach elf eingetreten ist.«
Bodenstein und Pia blickten ihn verblüfft an.
»Das Glas seiner Armbanduhr ist gesplittert«, Kirchhoff deutete auf das linke Handgelenk des Toten, »und die Uhr ist stehengeblieben. Tja, es wird wohl hohe Wellen schlagen, wenn bekannt wird, dass Goldberg erschossen wurde.«
Das fand Bodenstein noch ziemlich zurückhaltend ausgedrückt. Die Aussicht, dass eine Antisemitismusdiskussion die Ermittlungen in den Fokus des öffentlichen Interesses rücken könnte, behagte ihm überhaupt nicht.
Die Momente, in denen sich Thomas Ritter vorkam wie ein Schwein, gingen immer schnell vorbei. Der Zweck heiligte schließlich die Mittel. Nach wie vor glaubte Marleen an einen puren Zufall, der ihn an jenem Novembertag in das Bistro in der Goethepassage geführt hatte, wo sie immer zu Mittag aß. Das zweite Mal waren sie sich »zufällig« vor der Praxis des Physiotherapeuten an der Eschersheimer Landstraße begegnet, bei dem sie immer donnerstags um 19:30 Uhr trainierte, um das Handicap ihrer Behinderung auszugleichen. Eigentlich hatte er sich auf eine lange Zeit des Werbens eingestellt, aber es war erstaunlich schnell gegangen. Er hatte Marleen zum Abendessen in Erno’s Bistro eingeladen, obwohl das seine finanziellen Möglichkeiten weit überstiegen und den großzügigen Vorschuss des Verlags beängstigend verringert hatte. Behutsam hatte er erkundet, inwieweit sie über seine momentane Situation Bescheid wusste. Zu seiner Erleichterung war sie vollkommen ahnungslos und freute sich nur, einen alten Bekannten wieder getroffen zu haben. Sie war schon immer eine Einzelgängerin gewesen; der Verlust ihres Unterschenkels und die Prothese hatten sie noch zurückhaltender werden lassen. Nach dem Champagner hatte er einen sensationellen 1994 Pomerol Château L’Eglise Clinet bestellt, der ungefähr das kostete, was er seinem Vermieter schuldete. Geschickt hatte er sie dazu gebracht, von sich zu erzählen. Frauen redeten gerne über sich, so auch die einsame Marleen. Er erfuhr von ihrem Job als Archivarin bei einer deutschen Großbank und von ihrer maßlosen Enttäuschung, als sie herausgefunden hatte, dass ihr Ehemann während ihrer Ehe mit seiner Geliebten zwei Kinder gezeugt hatte. Nach zwei weiteren Gläsern Rotwein hatte Marleen jede Zurückhaltung verloren. Hätte sie geahnt, wie viel ihm ihre Körpersprache verriet, so hätte sie sich ganz sicher geschämt. Sie war ausgehungert nach Liebe, nach Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit, und spätestens beim Dessert, das sie kaum anrührte, hatte er gewusst, dass er sie noch am selben Abend ins Bett kriegen würde. Geduldig hatte er darauf gewartet, dass sie den Anfang machen würde. Und tatsächlich, eine Stunde später war es so weit gewesen. Ihr atemlos geflüstertes Geständnis, sie habe sich schon vor fünfzehn Jahren in ihn verliebt, hatte ihn nicht überrascht. In der Zeit, in der er im Hause Kaltensee ein und aus gegangen war, hatte er sie, die Lieblingsenkelin ihrer Großmutter, oft genug gesehen und ihr die Komplimente gemacht, die sie von keinem anderen zu hören bekam. Damit hatte er schon damals ihr Herz erobert, als ob er geahnt hätte, dass er es eines Tages brauchen würde. Der Anblick ihrer Wohnung – geschmackvoll eingerichtete hundertfünfzig Quadratmeter Stilaltbau mit Stuckdecken und Parkettfußboden im vornehmen Frankfurter Westend – hatte ihm schmerzlich vor Augen geführt, was er durch die Ächtung der Familie Kaltensee verloren hatte. Er hatte sich geschworen, sich alles zurückzuholen, was sie ihm genommen hatten, und noch viel mehr dazu.
Das war nun ein halbes Jahr her.
Thomas Ritter hatte seine Rache mit Weitsicht und viel Geduld geplant, jetzt ging die Saat auf. Er drehte sich auf den Rücken und streckte träge seine Glieder. Im benachbarten Badezimmer rauschte schon zum dritten Mal hintereinander die Klospülung. Marleen litt unter heftiger Morgenübelkeit, aber für den Rest des Tages fühlte sie sich wohl, so dass ihre Schwangerschaft bisher niemandem aufgefallen war.
»Geht es dir gut, Liebling?«, rief er und unterdrückte ein zufriedenes Grinsen. Für eine Frau mit ihrem scharfen Verstand hatte sie sich überraschend leicht reinlegen lassen. Sie ahnte nicht, dass er gleich nach der ersten Liebesnacht ihre Pille durch wirkungslose Placebos ersetzt hatte. Als er an einem Abend vor etwa drei Monaten nach Hause gekommen war, hatte sie in der Küche gesessen, verheult und hässlich, vor sich auf dem Tisch der positive Schwangerschaftstest. Es war wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Allein die Vorstellung, wie sie toben würde, wenn sie herausfand, dass ausgerechnet er ihre geliebte Kronprinzessin geschwängert hatte, war für ihn das reinste Aphrodisiakum gewesen. Er hatte Marleen in die Arme genommen, zuerst ein wenig konsterniert, dann aber hellauf begeistert getan und sie schließlich auf dem Küchentisch gevögelt.
Marleen kehrte aus dem Bad zurück, blass, aber lächelnd. Sie kroch zu ihm unter die Bettdecke und schmiegte sich an ihn. Obwohl ihm der Geruch von Erbrochenem in die Nase stieg, zog er sie enger an sich. »Bist du dir sicher, dass du das tun willst?«
»Aber natürlich«, antwortete sie ernsthaft. »Wenn es dir nichts ausmacht, eine Kaltensee zu heiraten.«
Offenbar hatte sie tatsächlich mit niemandem aus ihrer Familie über ihn und ihren Zustand gesprochen. So ein braves Mädchen! Übermorgen, am Montag, um Viertel vor zehn hatten sie einen Termin beim Standesamt im Römer, und spätestens um zehn gehörte er offiziell zu der Familie, die er aus ganzem Herzen hasste. Oh, wie er sich darauf freute, ihr als Marleens angetrauter Ehemann gegenüberzutreten! Er spürte, wie er bei seiner Lieblingsphantasie unwillkürlich eine Erektion bekam. Marleen bemerkte es und kicherte.
»Wir müssen uns beeilen«, flüsterte sie. »In spätestens einer Stunde muss ich bei Omi sein und mit ihr …«
Er verschloss ihren Mund mit einem Kuss. Zum Teufel mit Omi! Bald, bald, bald war es so weit, der Tag der Rache war zum Greifen nahe! Aber sie würden es erst dann offiziell verkünden, wenn Marleen einen ordentlich dicken Bauch hatte.
»Ich liebe dich«, flüsterte er ohne den Hauch eines schlechten Gewissens. »Ich bin verrückt nach dir.«
Dr. Vera Kaltensee saß, eingerahmt von ihren Söhnen Elard und Siegbert, auf dem Ehrenplatz in der Mitte der prächtig gedeckten Tafel im großen Saal von Schloss Bodenstein und wünschte, dieser Geburtstag wäre endlich vorüber. Selbstverständlich war die gesamte Familie ausnahmslos ihrer Einladung gefolgt, aber das bedeutete ihr wenig, denn ausgerechnet die beiden Männer, in deren Gesellschaft sie diesen Tag gerne gefeiert hätte, fehlten in der Runde. Und daran hatte sie selbst Schuld. Mit dem einen hatte sie sich erst gestern wegen einer Lappalie gestritten – kindisch, dass er ihr das nachtrug und deswegen heute nicht gekommen war –, den anderen hatte sie vor einem Jahr aus ihrem Leben verbannt. Die Enttäuschung über Thomas Ritters hinterhältiges Verhalten nach achtzehn Jahren vertrauensvoller Zusammenarbeit schmerzte noch immer wie eine offene Wunde. Vera mochte es sich nicht eingestehen, aber in Momenten der Selbsterkenntnis ahnte sie, dass dieser Schmerz die Qualität echten Liebeskummers hatte. Peinlich in ihrem Alter und doch war es so. Thomas war achtzehn Jahre lang ihr engster Vertrauter gewesen, ihr Sekretär, ihr Kummerkasten, ihr Freund, aber leider nie ihr Liebhaber. Kaum einen der Männer in ihrem Leben hatte Vera so vermisst wie diesen kleinen Verräter. Etwas anderes war er schließlich nicht. Im Laufe ihres langen Lebens hatte sie feststellen müssen, dass der Spruch »Jeder ist ersetzbar« nicht stimmte. Niemand war einfach so ersetzbar, Thomas schon gar nicht. Nur selten gestattete Vera sich einen Blick zurück. Heute, an ihrem fünfundachtzigsten Geburtstag, erschien es ihr aber durchaus legitim, wenigstens kurz all derer zu gedenken, die sie nach und nach im Stich gelassen hatten. Von einigen Weggefährten hatte sie sich leichten Herzens getrennt, bei anderen war es ihr schwerer gefallen. Sie seufzte tief.
»Geht es dir gut, Mutter?«, erkundigte sich Siegbert, ihr Zweitältester, der zu ihrer Linken saß, sofort besorgt. »Du hast kaum etwas gegessen!«
»Mir geht’s gut.« Vera nickte und zwang sich zu einem beruhigenden Lächeln. »Mach dir keine Sorgen, mein Junge.«
Siegbert war immer so bemüht um ihr Wohlergehen und ihre Anerkennung, manchmal tat er ihr deswegen beinahe leid. Vera wandte den Kopf für einen kurzen Seitenblick auf ihren Ältesten. Elard wirkte abwesend, wie so häufig in letzter Zeit, und schien dem Tischgespräch nicht zu folgen. In der vergangenen Nacht hatte er wieder einmal nicht zu Hause übernachtet. Vera war das Gerücht zu Ohren gekommen, er habe eine Affäre mit der talentierten japanischen Malerin, die derzeit von der Stiftung gefördert wurde. Das Mädchen war Mitte zwanzig, fast vierzig Jahre jünger als Elard. Aber im Gegensatz zu dem rundlichen fröhlichen Siegbert, der schon mit fünfundzwanzig Jahren kein Haar mehr auf dem Kopf gehabt hatte, war das Alter mit Elard gnädig gewesen, ja, er sah jetzt, mit dreiundsechzig, beinahe besser aus als früher. Kein Wunder, dass Frauen jeden Alters noch immer auf ihn flogen! Er gab sich stets als Gentleman alter Schule, eloquent, kultiviert und angenehm zurückhaltend. Undenkbar, sich Elard in Badehose am Strand vorzustellen! Selbst im heißesten Sommer kleidete er sich bevorzugt schwarz, und diese anziehende Mischung aus Nonchalance und Melancholie machte ihn seit Jahrzehnten für alle weiblichen Wesen in seiner Umgebung zum Objekt der Begierde. Herta, seine Ehefrau, hatte schon früh resigniert und bis zu ihrem Tod vor einigen Jahren klaglos akzeptiert, dass sie einen Mann wie Elard nie für sich alleine haben würde. Vera indes wusste, dass es hinter der schönen Fassade, die ihr Ältester der Welt präsentierte, ganz anders aussah. Und seit einer Weile glaubte sie, eine Veränderung an ihm festzustellen, eine Unruhe, die sie nie zuvor an ihm bemerkt hatte.
Sie spielte gedankenverloren mit der Perlenkette, die sie um den Hals trug, und ließ ihren Blick weiter schweifen. Links von Elard saß Jutta, ihre Tochter. Sie war fünfzehn Jahre jünger als Siegbert, eine Nachzüglerin und eigentlich nicht mehr geplant gewesen. Ehrgeizig und zielstrebig, wie sie war, erinnerte sie Vera an sich selbst. Jutta hatte nach einer Banklehre Volkswirtschaft und Jura studiert und war vor zwölf Jahren in die Politik gegangen. Seit acht Jahren hatte sie ein Landtagsmandat, war mittlerweile Fraktionsvorsitzende und würde aller Voraussicht nach im nächsten Januar als Spitzenkandidatin für ihre Partei in die Landtagswahlen gehen. Ihr langfristiger Plan war, über den Posten der hessischen Ministerpräsidentin in die Bundespolitik zu gelangen. Vera zweifelte nicht daran, dass ihr das auch gelingen würde. Der Name Kaltensee würde ihr dabei von beträchtlichem Nutzen sein.
Ja, eigentlich konnte sich Vera rundum glücklich schätzen, mit ihrem ganzen Leben, ihrer Familie und ihren drei Kindern, die alle ihren Weg gemacht hatten. Wenn da nicht diese Sache mit Thomas gewesen wäre. Seit sie denken konnte, hatte Vera Kaltensee überlegt gehandelt und geschickt taktiert. Sie hatte ihre Emotionen im Griff gehabt, wichtige Entscheidungen stets mit kühlem Kopf getroffen. Immer. Bis auf dieses eine Mal. Sie hatte die Konsequenzen nicht bedacht, aus Zorn, aus verletztem Stolz und aus Panik völlig überstürzt gehandelt. Vera griff nach dem Glas und trank einen Schluck Wasser. Das Gefühl der Bedrohung verfolgte sie seit jenem Tag, an dem es zur endgültigen Trennung von Thomas Ritter gekommen war, es lag über ihr wie ein Schatten, der sich nicht vertreiben ließ.
Immer war es ihr gelungen, gefährliche Klippen in ihrem Leben mit Weitsicht und Mut zu umsegeln. Sie hatte Krisen gemeistert, Probleme gelöst, Angriffe erfolgreich abgewehrt, aber jetzt fühlte sie sich plötzlich verwundbar, verletzlich und einsam. Sie empfand die gewaltige Verantwortung für ihr Lebenswerk, für die Firma und die Familie mit einem Mal nicht mehr als Lust, sondern als eine Last, die ihr das Atmen schwermachte. War es nur das Alter, das ihr allmählich zusetzte? Wie viele Jahre hatte sie noch, bis ihre Kraft sie gänzlich im Stich ließ und ihr unweigerlich die Kontrolle entglitt?
Ihr Blick schweifte über ihre Gäste, über fröhliche, sorglose, lächelnde Gesichter, sie hörte das Summen der Stimmen, das Klirren von Besteck und Geschirr aus weiter Ferne. Vera betrachtete Anita, ihre liebe Freundin aus Jugendzeiten, die leider gar nicht mehr ohne Rollstuhl auskam. Nicht zu fassen, wie gebrechlich die resolute, lebenshungrige Anita geworden war! Vera schien es, als sei es erst gestern gewesen, dass sie gemeinsam in der Tanzschule gewesen waren und später dann beim BDM, wie beinahe alle Mädchen damals. Nun kauerte sie in ihrem Rollstuhl wie ein zartes, blasses Gespenst, die glänzende dunkelbraune Haarpracht von einst nur noch weißer Flaum. Anita war eine der Letzten von Veras Freunden und Gefährten aus Jugendzeiten; die allermeisten hatten schon ins Gras gebissen. Nein, es war nicht schön, alt zu werden, zu verfallen und einen nach dem anderen wegsterben zu sehen.
Milde Sonne im Laub, gurrende Tauben. Der See so blau wie der endlose Himmel über den dunklen Wäldern. Der Geruch nach Sommer, nach Freiheit. Junge Gesichter, die mit glänzenden Augen aufgeregt die Regatta verfolgen. Die Jungs in ihren weißen Pullovern schießen als Erste mit ihrem Boot über die Ziellinie. Sie strahlen stolz, winken. Vera kann ihn sehen, er hat das Steuer in der Hand, er ist der Kapitän. Ihr schlägt das Herz bis zum Hals, als er mit einem geschmeidigen Satz auf die Kaimauer springt. Hier bin ich, denkt sie und winkt mit beiden Armen, ich hab dir die Daumen gedrückt, schau mich an! Zuerst glaubt sie, er lächelt sie an, ruft ihm einen Glückwunsch zu und streckt die Arme nach ihm aus. Ihr Herz macht einen Satz, denn er kommt direkt auf sie zu, lächelnd, strahlend. Die Enttäuschung schmerzt wie ein Messerstich, als sie begreift, dass sein Lächeln nicht ihr gilt, sondern Vicky. Die Eifersucht würgt in ihrer Kehle. Er umarmt die andere, legt seinen Arm um ihre Schulter, verschwindet mit ihr in der Menschenmenge, die ihn und seine Mannschaft begeistert feiert. Vera spürt die Tränen in den Augen, die grenzenlose Leere in ihrem Innern. Diese Kränkung, die Zurückweisung vor allen anderen, ist mehr, als sie ertragen kann. Sie wendet sich ab, beschleunigt ihre Schritte. Enttäuschung wird zu Zorn, zu Hass. Sie ballt die Fäuste, läuft den sandigen Weg am Ufer des Sees entlang, nur weg, nur weg!
Erschrocken zuckte Vera zusammen. Woher kamen so plötzlich diese Gedanken, die unerwünschten Erinnerungen? Mit Mühe verkniff sie sich einen Blick auf die Armbanduhr. Sie wollte nicht undankbar erscheinen, aber der ganze Trubel, die stickige Luft und die vielen Stimmen machten sie ganz benommen. Sie zwang sich, ihre Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu richten, so, wie sie es seit sechzig Jahren gehalten hatte. In ihrem Leben hatte es immer nur ein Vorwärts gegeben, kein nostalgisch-verklärtes Zurückblicken auf Vergangenes. Auch aus diesem Grund hatte sie sich niemals vor den Karren irgendeines Vertriebenenbundes oder einer Landsmannschaft spannen lassen. Die Freifrau von Zeydlitz-Lauenburg war spätestens am Tage ihrer Hochzeit mit Eugen Kaltensee für immer verschwunden. Das ehemalige Ostpreußen hatte Vera nie wieder besucht. Wieso auch? Es stand für einen Lebensabschnitt, der für immer vorbei war.
Siegbert klopfte mit einem Messer an sein Glas, das Stimmengewirr verstummte, die Kinder wurden auf ihre Plätze geschickt.
»Was ist?«, fragte Vera ihren zweitältesten Sohn verwirrt.
»Du wolltest vor dem Hauptgang doch eine kurze Ansprache halten, Mutter«, erinnerte er sie.
»Ach ja.« Vera lächelte entschuldigend, »ich war ganz in Gedanken.«
Sie räusperte sich und erhob sich von ihrem Stuhl. Es hatte sie einige Stunden gekostet, die kurze Rede vorzubereiten, aber nun verzichtete Vera auf ihre Notizen.
»Ich freue mich, dass ihr heute alle hierhergekommen seid, um mit mir diesen Tag zu feiern«, sagte sie mit fester Stimme und blickte in die Runde. »Die meisten Menschen schauen an einem Tag wie heute zurück auf ihr Leben. Aber ich möchte euch die Erinnerungen einer alten Frau ersparen, ihr wisst ja sowieso schließlich alles, was es über mich zu wissen gibt.«
Wie erwartet brandete kurzes Gelächter auf. Doch ehe Vera weitersprechen konnte, ging die Tür auf. Ein Mann trat ein und blieb diskret an der hinteren Wand stehen. Vera konnte ihn ohne Brille nicht richtig erkennen und spürte zu ihrer Verärgerung, wie ihr der Schweiß ausbrach und ihre Knie weich wurden. War das etwa Thomas? Besaß er wirklich die Frechheit, heute hier aufzutauchen?
»Was hast du, Mutter?«, fragte Siegbert leise.
Sie schüttelte heftig den Kopf, griff hastig nach ihrem Glas. »Schön, dass ihr alle heute mit mir feiert!«, sagte sie, während sie gleichzeitig krampfhaft überlegte, was sie tun sollte, wenn es sich bei dem Mann tatsächlich um Thomas handeln sollte. »Zum Wohl!«
»Ein Hoch auf Mama!«, rief Jutta und erhob ihr Glas. »Alles Gute zum Geburtstag!«
Alle hoben ihre Gläser und ließen die Jubilarin hochleben, gleichzeitig blieb der Mann neben Siegbert stehen und räusperte sich. Vera wandte mit klopfendem Herzen den Kopf. Es war der Inhaber von Schloss Bodenstein, nicht Thomas! Sie war erleichtert und enttäuscht zugleich und ärgerte sich über ihre heftigen Gefühle. Die Flügeltüren des großen Saales öffneten sich, und die Kellner des Schlosshotels marschierten ein, um den Hauptgang zu servieren.
»Entschuldigen Sie, dass ich störe«, hörte Vera den Mann leise sagen. »Ich soll Ihnen diese Nachricht übergeben.«
»Danke.« Siegbert ergriff das Papier und faltete es auseinander. Vera beobachtete, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich.
»Was ist?«, fragte sie alarmiert. »Was hast du denn?«
Siegbert blickte auf.
»Eine Nachricht von Onkel Jossis Haushälterin.« Seine Stimme klang tonlos. »Es tut mir so leid, Mutter. Ausgerechnet heute. Onkel Jossi ist tot.«
Kriminaldirektor Dr. Heinrich Nierhoff hielt sich nicht damit auf, Bodenstein in sein Büro zu beordern, um wie üblich seine Autorität und seine übergeordnete Position zu betonen, sondern kam in den Besprechungsraum des K11, in dem Kriminaloberkommissar Kai Ostermann und Kriminalassistentin Kathrin Fachinger Vorbereitungen für eine kurzfristig anberaumte Besprechung trafen. Sie hatten nach Pias morgendlichem Rundruf alle privaten Wochenendpläne hintenangestellt und waren ins K11 gekommen. Auf die noch leere Tafel im großen Besprechungsraum hatte Fachinger mit ihrer korrekten Schrift GOLDBERG geschrieben, daneben die geheimnisvolle Zahl 16 145.
»Was gibt es, Bodenstein?«, fragte Nierhoff. Auf den ersten Blick wirkte der Leiter der Regionalen Kriminalinspektion unscheinbar: ein untersetzter Mann Mitte fünfzig mit grauem Seitenscheitel, einem kleinen Schnauzbart und weichen Gesichtszügen. Aber dieser erste Eindruck täuschte. Nierhoff war ausgesprochen ehrgeizig und besaß ein sicheres politisches Gespür. Seit Monaten kursierten Gerüchte, er werde über kurz oder lang seinen Chefsessel in der Regionalen Kriminalinspektion mit dem des Regierungspräsidenten in Darmstadt tauschen. Bodenstein bat seinen Chef in sein Büro und berichtete ihm in knappen Worten vom Mord an David Goldberg. Nierhoff hörte schweigend zu und sagte auch nichts, als Bodenstein geendet hatte. Im Kommissariat war bekannt, dass der Kriminaldirektor das Rampenlicht mochte und gerne Pressekonferenzen in großem Stil abhielt; seit dem medienwirksamen Selbstmord von Oberstaatsanwalt Hardenbach vor zwei Jahren hatte es im Main-Taunus-Kreis kein so prominentes Mordopfer mehr gegeben. Bodenstein, der eigentlich angenommen hatte, Nierhoff würde von der Aussicht auf ein Blitzlichtgewitter begeistert sein, war von der zurückhaltenden Reaktion seines Chefs ein wenig überrascht.
»Das könnte eine heikle Angelegenheit werden.« Die unverbindliche Freundlichkeit, die Kriminaldirektor Nierhoff sonst immer zur Schau trug, war aus seiner Miene gewichen, zum Vorschein kam der gewiefte Taktierer. »Ein amerikanischer Staatsbürger jüdischen Glaubens und Überlebender des Holocaust mit einem Genickschuss hingerichtet. Wir sollten Presse und Öffentlichkeit vorerst da raushalten.«
Bodenstein nickte zustimmend.
»Ich erwarte bei den Ermittlungen äußerstes Fingerspitzengefühl. Keine Pannen«, sagte er zu Bodensteins Verärgerung. Seit es das K11 in Hofheim gab, konnte sich Bodenstein an keine Ermittlungspanne in seinem Zuständigkeitsgebiet erinnern.
»Was ist mit der Haushälterin?«, erkundigte sich Nierhoff.
»Was soll mit ihr sein?« Bodenstein verstand nicht ganz. »Sie hat die Leiche heute Morgen gefunden und stand unter Schock.«
»Vielleicht hat sie etwas damit zu tun. Goldberg war wohlhabend.«
Bodensteins Verstimmung wuchs. »Für eine examinierte Krankenschwester gibt es sicher unauffälligere Möglichkeiten als einen Genickschuss«, bemerkte er mit leichtem Sarkasmus. Nierhoff war seit fünfundzwanzig Jahren mit seiner Karriere beschäftigt und hatte ebenso lange keine Ermittlungen mehr geführt; dennoch fühlte er sich immer wieder bemüßigt, seine Meinung kundzutun. Seine Augen huschten hin und her, während er nachdachte und Nutzen und Nachteile, die aus diesem Fall erwachsen konnten, gegeneinander abwog.
»Goldberg war ein sehr prominenter Mann«, sagte er schließlich mit gesenkter Stimme. »Wir werden äußerst vorsichtig vorgehen müssen. Schicken Sie Ihre Leute heim, und sorgen Sie dafür, dass vorerst keine Information dieses Haus verlässt.«
Bodenstein wusste nicht recht, was er von dieser Strategie halten sollte. Die ersten 72 Stunden waren bei einer Ermittlung immer die wichtigsten. Spuren wurden sehr schnell kalt, das Erinnerungsvermögen von Zeugen immer schwächer, je mehr Zeit verging. Aber natürlich fürchtete Nierhoff genau das, was Dr. Kirchhoff heute Morgen prophezeit hatte: negative Publicity für seine Behörde und diplomatische Verstrickungen. Politisch mochte die Entscheidung durchaus sinnvoll sein, aber Bodenstein hatte kein Verständnis dafür. Er war Ermittler, wollte den Mörder finden und dingfest machen. Ein hochbetagter Greis, der in Deutschland Schreckliches erlebt hatte, war brutal in seinem eigenen Haus ermordet worden, und es widersprach Bodensteins Auffassung von guter Polizeiarbeit völlig, aus taktischen Gründen wertvolle Zeit zu vergeuden. Insgeheim ärgerte er sich darüber, dass er Nierhoff überhaupt eingeschaltet hatte. Der allerdings kannte seinen Dezernatsleiter besser, als dieser angenommen hatte. »Denken Sie nicht einmal darüber nach, Bodenstein.« Nierhoffs Stimme klang warnend. »Eigenmächtigkeiten könnten einen sehr nachteiligen Einfluss auf Ihre weitere Karriere haben. Sie wollen doch wohl nicht für den Rest Ihres Lebens in Hofheim sitzen und Mördern und Bankräubern hinterherjagen.«
»Wieso nicht? Das ist der Grund, weshalb ich überhaupt Polizist geworden bin«, entgegnete Bodenstein, verärgert über Nierhoffs versteckte Drohung und die beinahe verächtliche Abqualifizierung seiner Arbeit.
Mit seinen nächsten Worten machte es der Kriminaldirektor noch schlimmer, auch wenn es versöhnlich gemeint war. »Ein Mann mit Ihrer Erfahrung und Ihren Begabungen sollte sich der Verantwortung stellen und eine leitende Position übernehmen, Bodenstein, auch wenn es unbequem ist. Denn das ist es, das kann ich Ihnen sagen.«
Bodenstein bemühte sich, die Fassung zu wahren. »Meiner Meinung nach gehören die besten Leute in die Ermittlung«, sein Tonfall grenzte an Insubordination, »und nicht hinter irgendeinen Schreibtisch, wo sie ihre Zeit mit politischem Geplänkel vergeuden müssen.«
Der Kriminaldirektor hob die Augenbrauen und schien zu überlegen, ob diese Bemerkung als Beleidigung gemeint war oder nicht.
»Manchmal frage ich mich, ob es nicht ein Fehler von mir war, Ihren Namen beim Innenministerium im Bezug auf die Entscheidung um meine Nachfolge ins Gespräch zu bringen«, sagte er kühl. »Wie mir scheint, fehlt es Ihnen ganz und gar an Ehrgeiz.«
Das verschlug Bodenstein für ein paar Sekunden die Sprache, aber er war zu eiserner Selbstbeherrschung fähig und hatte viel Übung darin, seine Gefühle hinter einer unbeteiligten Miene zu verbergen.
»Machen Sie jetzt keinen Fehler, Bodenstein«, sagte Nierhoff und wandte sich zur Tür. »Ich hoffe, wir haben uns verstanden.«
Bodenstein zwang sich zu einem höflichen Kopfnicken und wartete, bis sich die Tür hinter Nierhoff geschlossen hatte. Dann griff er zu seinem Handy, rief Pia Kirchhoff an und schickte sie direkt nach Frankfurt in die Rechtsmedizin. Er hatte nicht vor, die bereits genehmigte Obduktion abzusagen, egal, wie Nierhoff reagieren würde. Bevor er sich selbst auf den Weg nach Frankfurt machte, schaute er im Besprechungsraum vorbei. Ostermann, Fachinger und die inzwischen eingetroffenen Kriminalkommissare Frank Behnke und Andreas Hasse blickten ihm mehr oder weniger erwartungsvoll entgegen.
»Sie können wieder nach Hause gehen«, sagte er knapp. »Wir sehen uns Montag. Sollte sich etwas ändern, werde ich Sie informieren.«
Damit wandte er sich ab, bevor einer seiner verblüfften Mitarbeiter eine Frage stellen konnte.
Robert Watkowiak trank das Bier aus und wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab. Er musste pinkeln, aber er hatte keine Lust, an den halbstarken Idioten vorbeizugehen, die neben der Tür zu den Klos seit einer Stunde Dart spielten. Erst vorgestern hatten sie ihn blöd angemacht und ihm seinen Stammplatz am Tresen streitig machen wollen. Er warf einen Blick in Richtung Dartscheibe. Nicht dass er nicht mit ihnen fertig geworden wäre, aber er war einfach nicht in Stimmung für einen Krach.
»Mach mir noch eins.« Er schob das leere Glas über den klebrigen Tresen. Es war halb vier. Jetzt hockten sie alle zusammen, herausgeputzt wie die Pfingstochsen, soffen Champagner und taten so, als seien sie überglücklich, den Geburtstag der alten Schlange feiern zu dürfen. So ein verlogenes Pack! Eigentlich hatten sie alle nicht viel füreinander übrig, aber bei solchen Anlässen spielten sie die große glückliche Familie. Ihn hatte man nicht eingeladen, klar. Davon abgesehen wäre er sowieso nicht hingegangen. In seinen Tagträumen hatte er sich genussvoll ausgemalt, wie er ihr die Einladung verächtlich vor die Füße geworfen und in ihr entsetztes und schockiertes Gesicht gegrinst hätte. Erst gestern hatte er begriffen, dass man ihm diese Genugtuung verwehrt hatte, indem er überhaupt nicht eingeladen wurde.
Die Bedienung schob ihm ein frisches Pils hin und machte einen Strich auf seinem Deckel. Er griff nach dem Glas und bemerkte verärgert, dass seine Hand zitterte. Scheiße! Die ganze bescheuerte Bagage war ihm so was von egal! Sie hatten ihn schon immer wie den letzten Dreck behandelt und ihn spüren lassen, dass er nicht richtig zu ihnen gehörte, weil er ein unerwünschter Bastard war. Sie würden hinter vorgehaltener Hand über ihn tuscheln, sich vielsagende Blicke zuwerfen und die Köpfe schütteln, diese selbstgerechten Spießer! Robert, der Versager. Schon wieder der Führerschein weg wegen der Sauferei. Zum dritten Mal? Nein, schon das vierte Mal! Jetzt geht er wohl wieder ins Gefängnis. Geschieht ihm nur recht. Hat doch alle Chancen gehabt, der Junge, und nichts draus gemacht. Robert schloss seine Hand fest um das Glas und beobachtete, wie seine Fingerknöchel weiß hervortraten. So würden seine Hände aussehen, wenn er sie um ihren faltigen Hühnerhals legte und zudrückte, bis ihr die Augen aus dem Kopf quollen.
Er nahm einen tiefen Schluck. Der erste war immer der beste. Die kalte Flüssigkeit rann durch seine Speiseröhre, und er stellte sich vor, wie sie zischend über diesen glühenden, brennenden Klumpen von Eifersucht und Verbitterung in seinem Inneren floss. Wer behauptete eigentlich, dass Hass kalt war? Viertel vor vier. Verdammt, er musste aufs Klo. Er fingerte eine Zigarette aus dem Päckchen und zündete sie an. Kurti würde schon irgendwann auftauchen. Er hatte es ihm versprochen, gestern Abend. Wenigstens hatte er ihm die Schulden zurückzahlen können, nachdem er Onkel Jossi ein bisschen unter Druck gesetzt hatte. Immerhin war er sein Patenonkel, für irgendetwas musste das ja gut sein.
»Noch eins?«, fragte die Bedienung geschäftsmäßig. Er nickte und blickte in den Spiegel, der hinter dem Tresen an der Wand hing. Der Anblick seines vernachlässigten Äußeren, die fettigen Haare, die ihm auf die Schultern fielen, die glasigen Augen und die Bartstoppeln machten ihn sofort wieder wütend. Und seit dieser Schlägerei mit den Scheißtypen am Höchster Bahnhof fehlte ihm auch noch ein Zahn. Das sah ja total asozial aus! Das nächste Bier kam. Das sechste heute. Allmählich erreichte er Betriebstemperatur. Sollte er Kurti dazu überreden, ihn rüber zu Schloss Bodenstein zu fahren? Bei der Vorstellung, wie sie alle glotzen würden, wenn er lässig reingehen, sich auf den Tisch stellen und in aller Ruhe seine Blase entleeren würde, musste er grinsen. Das hatte er mal in einem Film gesehen, und es hatte ihm gefallen.
»Kannste mir mal dein Handy leihen?«, fragte er die Bedienung und merkte, dass es ihm schwerfiel, deutlich zu sprechen.
»Du hast doch selber eins«, erwiderte sie schnippisch und zapfte ein Bier, ohne ihn anzusehen. Er hatte leider keins mehr. Pech aber auch. Irgendwo musste es ihm aus der Jacke gerutscht sein.
»Hab’s verloren«, nuschelte er. »Stell dich nicht so an. Los.«
»Nee.« Sie wandte sich einfach ab und wackelte mit einem vollen Tablett zu den Prolls an der Dartscheibe. Im Spiegel sah er, wie die Tür aufging. Kurti. Na endlich.
»Hey, Alter.« Kurti schlug ihm auf die Schulter und setzte sich auf den Barhocker neben ihm.
»Bestell dir was, ich lad dich ein«, sagte Robert großzügig. Die Kohle von Onkel Jossi würde für ein paar Tage reichen, dann musste er sich nach einer neuen Geldquelle umsehen, und er hatte schon eine gute Idee. Er hatte den lieben Onkel Herrmann schon lange nicht mehr besucht. Vielleicht sollte er Kurti in seine Pläne einweihen. Robert verzog das Gesicht zu einem boshaften Lächeln. Er würde sich schon holen, was ihm zustand.
Bodenstein untersuchte im Büro von Henning Kirchhoff den Inhalt des Kartons, den Pia aus dem Hause Goldberg mit ins Rechtsmedizinische Institut gebracht hatte. Die beiden benutzten Gläser und die Weinflasche waren schon auf dem Weg ins Labor, ebenso der Spiegel, sämtliche Fingerabdrücke und alles, was die Spurensicherung sonst sichergestellt hatte. Unten, im Keller des Instituts, nahm währenddessen Dr. Kirchhoff in Anwesenheit von Pia und einem blutjungen Staatsanwalt, der wie ein Jurastudent im dritten Semester aussah, die Obduktion der Leiche von David Josua Goldberg vor. Bodenstein überflog einige Dankesbriefe von verschiedenen Institutionen und Personen, die Goldberg gefördert und finanziell unterstützt hatte, betrachtete flüchtig einige Fotos in silbernen Rahmen, blätterte ausgeschnittene Zeitungsartikel durch, die sorgfältig gelocht und penibel abgeheftet waren. Eine Taxiquittung vom Januar, ein abgegriffenes Büchlein in hebräischer Schrift. Nicht besonders viel. Offenbar hatte Jossi Goldberg den größten Teil seiner persönlichen Habe woanders aufgehoben. Unter all den Dingen, die für ihren ursprünglichen Besitzer eine Bedeutung gehabt haben mochten, war für Bodenstein nur ein Terminkalender von Interesse. Goldberg hatte eine für sein hohes Alter erstaunlich klare Handschrift besessen, ohne verzitterte, unsichere Buchstaben. Neugierig blätterte Bodenstein zur letzten Woche, in der sich zu jedem Tag Notizen fanden, die ihm aber nicht weiterhalfen, wie er enttäuscht feststellte: ausnahmslos Namen, die fast alle auch noch abgekürzt waren. Lediglich am heutigen Tag war ein Name ganz ausgeschrieben. Vera 85, stand da. Bodenstein trug den Terminkalender trotz der mageren Ergebnisse zum Kopierer im Sekretariat des Instituts und begann, sämtliche Seiten seit Januar zu kopieren. Just als er bei der letzten Woche im Leben Goldbergs angelangt war, summte sein Handy.
»Chef«, Pia Kirchhoffs Stimme klang ein wenig verzerrt, weil der Empfang im Keller des Instituts nicht optimal war, »Sie müssen mal herkommen. Henning hat hier etwas Eigenartiges entdeckt.«
»Ich habe dafür keine Erklärung. Absolut nicht. Aber es ist eindeutig. Vollkommen eindeutig«, sagte Dr. Henning Kirchhoff kopfschüttelnd, als Bodenstein den Sektionsraum betrat. Seine professionelle Gelassenheit und aller Zynismus waren ihm abhandengekommen. Auch sein Assistent und Pia wirkten ratlos, der Staatsanwalt kaute aufgeregt an seiner Unterlippe.
»Was haben Sie denn gefunden?«, fragte Bodenstein.
»Etwas Unglaubliches.« Kirchhoff bedeutete ihm, näher an den Tisch zu treten, und reichte ihm eine Lupe. »Mir ist etwas an der Innenseite seines linken Oberarms aufgefallen, eine Tätowierung. Ich konnte es schlecht erkennen, wegen der Leichenflecke am Arm. Er hatte mit der linken Seite auf dem Boden gelegen.«
»Jeder, der in Auschwitz war, hatte doch eine Tätowierung«, erwiderte Bodenstein.
»Aber nicht so eine.« Kirchhoff deutete auf den Arm des Toten. Bodenstein kniff ein Auge zu und betrachtete die bezeichnete Stelle durch das Vergrößerungsglas.
»Sieht aus wie … hm … wie zwei Buchstaben. Frakturschrift. Ein … A und ein B, wenn ich mich nicht täusche«
»Sie täuschen sich nicht«, Kirchhoff nahm ihm die Lupe aus der Hand.
»Was hat das zu bedeuten?«, wollte Bodenstein wissen.
»Ich gebe meinen Beruf auf, falls ich mich irren sollte«, erwiderte Kirchhoff. »Es ist unglaublich, schließlich war Goldberg Jude.«
Bodenstein begriff nicht, was den Rechtsmediziner so aufregte.
»Jetzt spannen Sie mich nicht auf die Folter«, sagte er ungeduldig. »Was ist denn so außergewöhnlich an einer Tätowierung?«
Kirchhoff blickte Bodenstein über den Rand seiner Halbbrille an.
»Das«, er senkte seine Stimme zu einem konspirativen Flüstern, »ist eine Blutgruppentätowierung, wie sie die Mitglieder der Waffen-SS hatten. Zwanzig Zentimeter über dem Ellbogen auf der Unterseite des linken Oberarms. Weil diese Tätowierung ein eindeutiges Erkennungszeichen war, haben nach dem Krieg viele ehemalige SS-Leute versucht, sie loszuwerden. Dieser Mann hier auch.«
Er holte tief Luft und begann, den Sektionstisch zu umrunden.
»Üblicherweise«, dozierte Kirchhoff wie bei einer Erstsemestervorlesung im Hörsaal, »werden Tätowierungen durch Stechen mit einer Nadel in die mittlere Hautschicht, die sogenannte Dermis, eingebracht. In unserem Fall hier ist die Farbe aber bis in die Subcutis eingedrungen. Oberflächlich war nur noch eine bläuliche Narbe zu erkennen, aber jetzt, nach der Entfernung der obersten Hautschichten, ist die Tätowierung wieder deutlich zu sehen. Blutgruppe AB.«
Bodenstein starrte die Leiche Goldbergs an, die im grellen Licht mit geöffnetem Brustkorb auf dem Sektionstisch lag. Er wagte kaum, daran zu denken, was Kirchhoffs unglaubliche Enthüllung bedeuten und was sie nach sich ziehen konnte.
»Wenn Sie nicht wüssten, um wen es sich hier auf Ihrem Tisch handelt«, sagte er langsam, »was würden Sie vermuten?«
Kirchhoff blieb abrupt stehen.
»Dass der Mann in jüngeren Jahren ein Mitglied der SS gewesen ist. Und zwar ziemlich von Anfang an. Später wurden die Tätowierungen in lateinischer Schrift vorgenommen, nicht in altdeutscher.«
»Kann es sich nicht um eine andere harmlose Tätowierung handeln, die sich im Laufe der Jahre irgendwie … hm … verändert hat?«, fragte Bodenstein, obwohl er in dieser Hinsicht keine Hoffnung hegte. Kirchhoff irrte sich so gut wie nie, zumindest konnte Bodenstein sich an keinen Fall erinnern, bei dem der Rechtsmediziner sein Urteil hätte revidieren müssen.
»Nein. Schon gar nicht an dieser Stelle.« Kirchhoff war durch Bodensteins Skepsis nicht gekränkt. Er war sich der Tragweite seiner Entdeckung ebenso bewusst wie jeder der Anwesenden. »Ich habe diese Art der Tätowierung selbst schon auf dem Tisch gehabt, einmal in Südamerika und mehrmals hier. Es gibt für mich keinen Zweifel.«