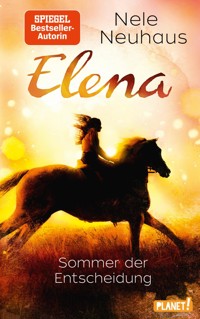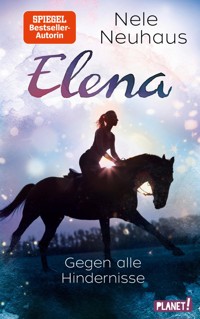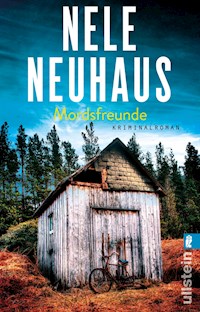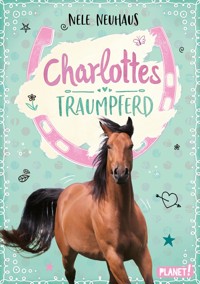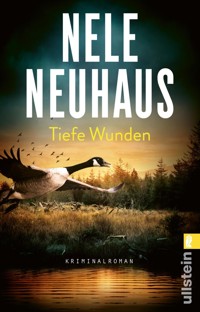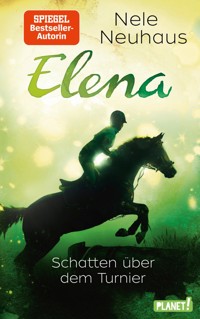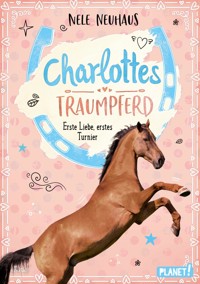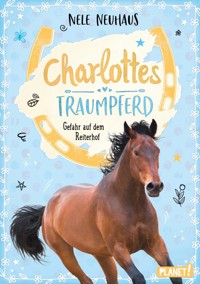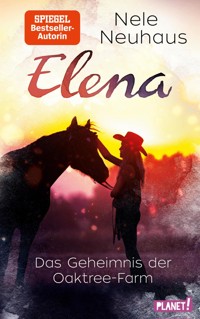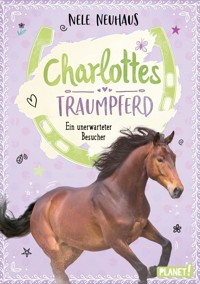10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung der Bestseller-Trilogie rund um Sheridan Grant: absolut spannend und zum Mitfiebern! »Nele Neuhaus ist für mich ein Garant für spannende Romane, nicht nur bei Taunus-Krimi! Unbesehen kann man wirklich jeden Roman lesen und wird nicht enttäuscht. Auch bei der Sheridan Grant Reihe ist das so: Spannung pur, überraschende Wendungen, schlüssige Folgen und man will wissen, wie es weitergeht. Absolut lesenswert!« Amazon Kundin Eine junge Frau auf der Suche nach ihren Wurzeln und eine schicksalhafte Reise quer durch Amerika Nach einem heftigen Familienstreit verlässt die 17-jährige Sheridan Grant ihre Heimat in Nebraska, um in New York eine Karriere als Sängerin zu starten. Doch als ihr Bruder Esra einen blutigen Amoklauf begeht, zerplatzen ihre Träume. Auf der Flucht vor der Presse und den bitteren Vorwürfen ihrer Adoptivmutter Rachel reist Sheridan quer durch Amerika, immer auf der Suche nach einem neuen Anfang. Gleichzeitig bringt Detective Jordan Blystone ein 30 Jahre altes Familiengeheimnis ans Licht, das Rachel Grant vor Gericht stellt. Sheridan steht vor der schweren Wahl: Soll sie sich ihrer Vergangenheit stellen und in die Heimat zurückkehren, oder alles hinter sich lassen und endlich frei sein? *** Ein Muss für den nächsten Urlaub, verregnete Nachmittage und lange Bahnfahrten! Dieses Buch werden Sie verschlingen! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
»Im Zusammenhang mit einer Familientragödie, die sich in den frühen Morgenstunden auf einer Farm in der Nähe von Fairfield im Madison County in Nebraska ereignet hat, sucht die Polizei nach der siebzehnjährigen Sheridan Grant …«
Sheridan, die wenige Stunden zuvor heimlich von der Farm ihrer Eltern in ein neues Leben aufgebrochen ist, kann nicht fassen, was sie in den Nachrichten sieht: Ihr Bruder Esra hat vier Menschen getötet und ihren Vater schwer verletzt – und sie wird gesucht. Zurück auf der Willow Creek Farm, kann Sheridan zwar dem ermittelnden Detective Jordan Blystone helfen, die Hintergründe der schrecklichen Tat zu verstehen. Aber für die Medien und die Einwohner von Madison ist Sheridan diejenige, die ihre Familie zerstört hat, und ihre Adoptivmutter Rachel Grant lässt nichts unversucht, Sheridans Namen in den Schmutz zu ziehen. Als Sheridan klarwird, dass auch von dem Mann, den sie liebt, keine Hilfe zu erwarten ist, trifft sie eine Entscheidung: Sie verlässt die Willow Creek Farm für immer. Ohne zu ahnen, welcher Schmerz und welches Glück auf sie warten …
Die Autorin
Nele Neuhaus, geboren in Münster / Westfalen, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus. Sie ist die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands, ihre Bücher erscheinen außerdem in über 30 Ländern. Neben den Taunuskrimis schreibt die passionierte Reiterin auch Pferde-Jugendbücher und Unterhaltungsliteratur, die sie zunächst unter ihrem Mädchennamen Nele Löwenberg veröffentlichte. Ihre Saga um die junge Sheridan Grant stürmte auf Anhieb die Bestsellerlisten.
Von Nele Neuhaus sind in unserem Haus bereits erschienen:
In der Serie »Ein Bodenstein-Kirchhoff-Krimi«:
Eine unbeliebte Frau • Mordsfreunde • Tiefe Wunden • Schneewittchen muss sterben • Wer Wind sät • Böser Wolf • Die Lebenden und die Toten • Im Wald • Muttertag
Außerdem: Unter Haien
In der »Sheridan-Grant«-Serie:
Sommer der Wahrheit
Straße nach Nirgendwo
Zeiten des Sturms
Nele Neuhaus
Straße nach Nirgendwo
Roman
Ullstein
Dieses Buch ist ursprünglich unter dem Autorennamen Nele Löwenberg erschienen.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2325-1
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014Umschlaggestaltung: zero-media.net, München (Haus); Getty Images / John Finney Photography (Feld, Himmel)
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für GabySummer of’86
Alles, was man sich im Leben wünschen sollte,ist ein Ort, wo man hingehört. Wo man geliebtwird, ohne beurteilt zu werden.Bedingungslos.
Nebraska,
25. Dezember 1996
»Wir sind da. Da unten muss es sein, Sir.«
Detective Lieutenant Jordan Blystone von der Nebraska State Patrol schrak aus seinen Gedanken auf, als er die Stimme des Hubschrauber-Piloten über seinen Kopfhörer hörte, und blickte nach unten. Blystone bemerkte zwei pulsierende rote Punkte, die im Schnee glühten, und nickte. Während des knapp vierzigminütigen Fluges durch dichtes Schneetreiben über eine schier endlose weiße Fläche, die nur gelegentlich von einsam gelegenen Farmen und kleinen Baumgruppen unterbrochen wurde, hatten sie nicht viel gesprochen, erst recht nicht über das, was Blystone am Ziel des Fluges erwarten mochte. Der Dispatcher hatte eine ganze Flut von Ten-Codes durchgegeben – 10-32, 10-52 und 10-79, die alles Mögliche bedeuten konnten, doch der letzte, ein 10-35, war derjenige gewesen, der Jordan Blystone die Aussicht auf ein gemütliches Weihnachtsessen mit seinen Eltern und den Familien seiner Schwestern vermasselte. Ein Gewaltverbrechen erforderte die Anwesenheit eines Detectives vom Major Crime Unit am Tatort, und da die Mordkommission der Nebraska State Patrol für Tötungsdelikte im ganzen Staat zuständig war, saß Blystone nun im Helikopter und stellte sich innerlich auf das Schlimmste ein. Man hatte einen bewaffneten Mann gemeldet und mehrere Krankenwagen und den Medical Examiner angefordert. Das ließ darauf schließen, dass sich am frühen Weihnachtsmorgen auf der entlegenen Farm eine Schießerei mit Verletzten und mindestens einem Toten ereignet hatte.
Der Pilot, der mehr als sein halbes Leben in Alaska verbracht hatte, hatte keine Probleme mit einem Flug bei diesen Wetterverhältnissen. Er zog die dreißig Jahre alte Bell-47G in einem sanften Bogen nach links und ging nach unten. Blystone konnte durch die Plexiglaskuppel des Helikopters den Streifenwagen erkennen, dessen Besatzung wohl in diesem Augenblick auch den Hubschrauber bemerkt hatte, denn die roten Blinkleuchten auf dem Dach wurden eingeschaltet. Weiter nördlich lag die Farm am Ende einer langen Baumreihe, dort blinkten rot und blau die Lichter mehrerer Krankenwagen. 10:42 Uhr. Seit dem Anruf vom Sheriff des Madison County bei der Zentrale der Nebraska State Patrol waren knapp anderthalb Stunden vergangen, und Jordan Blystone verspürte einen Anflug von Stolz auf die Effizienz seines Teams, selbst an einem Weihnachtsmorgen. Der Hubschrauber landete sanft zwischen den Lichtern der Warnfackeln, und der Polizeibeamte, der aus dem Streifenwagen gestiegen war, um Blystone in Empfang zu nehmen, wandte sein Gesicht ab und hielt seinen Hut fest, damit der nicht mit dem Schnee, den die Rotorblätter aufwirbelten, davon geweht würde.
»Soll ich hier warten, Sir?«, erkundigte sich der Pilot.
»Ich fürchte, es wird länger dauern«, antwortete Jordan Blystone. »Am besten fliegen Sie zur Polizeistation nach Madison rüber und warten dort.«
»Okay.« Der Pilot nickte. »Der Wind hat schon nachgelassen. Ich kann Sie dann später wieder abholen.«
»Danke.« Blystone stülpte die Kapuze seines Daunenparkas über den Kopf, zog die Handschuhe an und öffnete die Tür der verglasten Pilotenkanzel. Wie erwartet raubte ihm die eisige Kälte für ein paar Sekunden den Atem. Minus 23 Grad, gefühlt war es noch zwanzig Grad kälter. In gebückter Haltung stapfte er durch den tiefen Neuschnee zum Streifenwagen hinüber und wartete, bis der Hubschrauber wieder abhob und in östlicher Richtung abdrehte, bevor er den Polizisten begrüßte.
»Steigen Sie ein, Sir«, rief der Deputy, um das Knattern des Hubschraubers zu übertönen. Blystone öffnete die Beifahrertür, setzte sich und klopfte den Schnee von den Schuhen, bevor er einstieg. Die Heizung lief auf vollen Touren, prompt brach ihm der Schweiß aus.
»Detective Jordan Blystone vom NSP Homicide Unit aus Lincoln«, stellte er sich vor und öffnete den Reißverschluss des Parkas.
»Deputy Ken Schiavone vom Madison County Sheriff’s Department.« Der Polizist wischte sich die Eiskristalle aus dem Gesicht und schob den Wählhebel der Automatik in »D«. Der Motor heulte auf, die Schneeketten fraßen sich in den Schnee, und der Crown Victoria setzte sich schlingernd in Bewegung.
»Was genau ist passiert?«, erkundigte sich Blystone.
»Um sieben Uhr kam der Notruf«, antwortete der Deputy. »Schießerei auf der Willow Creek Farm. Der Diensthabende hat zwei Jungs von der Bereitschaft rausgeschickt, als sie hier draußen eintrafen, war schon alles vorbei. Es gab mehrere Tote. Aber was genau passiert ist, kann ich Ihnen nicht sagen, Sir.«
Schiavone war noch jung, Mitte bis höchstens Ende zwanzig. Das Grauen stand ihm in sein blasses Gesicht geschrieben. Wahrscheinlich war es das erste Mal, dass der Mann einen Toten gesehen hatte; hier draußen hatte die Polizei hauptsächlich mit harmloseren Delikten wie Trunkenheitsfahrten, Körperverletzung bei Schlägereien, Diebstahl, Drogenbesitz und dem einen oder anderen Verkehrsunfall zu tun. Gewaltverbrechen waren auf dem Land selten, die Fälle von Mord- und Totschlag konzentrierten sich in Nebraska laut Statistik auf Städte wie Lincoln, Omaha oder Grand Island.
»Wem gehört die Farm?«, wollte Blystone wissen.
»Die Willow Creek gehört den Grants«, entgegnete Schiavone und verstummte wieder, als sei das Erklärung genug. Er blickte konzentriert durch die verschmierte Windschutzscheibe.
»Kennen Sie die Familie?«
»Ja. Natürlich. Jeder hier kennt die Grants.« Der junge Deputy presste die Lippen zusammen und kämpfte plötzlich mit den Tränen. »Ich war mit Joe zusammen in der Highschool und im Footballteam. Wir waren gute Kumpel. Gestern hab ich ihn noch an der Tankstelle getroffen und … jetzt ist er … tot.«
»Das tut mir leid.«
Diese vier Worte mochten sich wie eine Floskel anhören, aber sie waren keine. Es tat Jordan Blystone tatsächlich um jeden Toten, mit dem er durch seinen Beruf zu tun hatte, leid. Mehr noch, er empfand jedes Verbrechen, dem ein Mensch zum Opfer fiel, als persönliche Kränkung. Nicht zuletzt deshalb hatte er sich vor ein paar Jahren dazu entschlossen, Mordermittler zu werden.
Der Deputy hatte sich rasch wieder im Griff. Es schien ihm peinlich zu sein, einem Fremden seine Gefühle gezeigt zu haben.
»Ich hab eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut«, sagte er verlegen und drosselte das Tempo. Sie hatten das Ende der Zufahrt, die zu beiden Seiten von hohen Bäumen und einer Windschutzhecke vor Schneeverwehungen geschützt war, erreicht, und rollten durch ein weit geöffnetes Tor. Ein anderer Deputy nickte Schiavone zu, öffnete das gelbe Absperrband und ließ sie durchfahren.
»Machen Sie sich deswegen keine Vorwürfe«, erwiderte Blystone. »Kein Mensch, der mit einem Mord zu tun hatte, ist danach noch derselbe. Erst recht nicht, wenn man das Opfer kannte. Erlauben Sie sich, um Ihren Freund zu trauern. Das ist das Letzte, das Sie für ihn tun können.«
Der junge Mann biss sich auf die Unterlippe und nickte. Er brachte das Auto auf dem weitläufigen, verschneiten Hof neben zwei weiteren Streifenwagen zum Stehen.
»Danke«, murmelte er.
»Keine Ursache.« Blystone klopfte ihm leicht auf die Schulter, stieg aus und blickte sich um.
Das große Wohnhaus war mehr als ungewöhnlich für ein Farmhaus im Mittleren Westen, wo man bei Gebäuden erheblich mehr Wert auf Funktionalität und Zweckmäßigkeit legte als auf Schönheit. Dieses aus rotem Backstein erbaute Haus mit seinen zahlreichen Türmchen und Schornsteinen, den verschieden hohen Spitzdächern, Veranden und Balkonen war jedoch alles andere als zweckmäßig, es war wunderschön und beeindruckend. Einen Moment lang bestaunte Blystone die weiß eingefassten Sprossenfenster und die kunstvollen Holzverzierungen an der Fassade und fragte sich, wer wohl auf die bizarre Idee gekommen sein mochte, ein solches Haus mitten in die Weite Nebraskas zu bauen. Vor dem Haus stand ein weißer Ford Pick-up mit geöffneten Türen, zersplitterter Windschutzscheibe und Einschusslöchern im rechten Kotflügel und der Beifahrertür. Blystone registrierte Blutspritzer am Blech des Autos und erkannte die Konturen eines menschlichen Körpers unter einer Rettungsdecke aus Aluminium, die eigentlich dazu gedacht war, Unfallopfer vor Unterkühlung, Nässe und Wind zu schützen. Nur ein paar Meter weiter, an der nordöstlichen Hausecke, lag eine zweite Leiche in blutdurchtränktem Schnee, ebenfalls mit einer goldfarbenen Folie abgedeckt.
Blystone wurde bewusst, was aus der Luft unter den Schneemassen nicht zu erkennen gewesen war: Die Ausmaße der Farm waren gigantisch. Auf der anderen Seite des Hofes, dem Wohnhaus gegenüber, befanden sich mehrere große, rechteckige Gebäude mit Flachdächern und Rolltoren, wahrscheinlich Maschinen- oder Lagerhallen. Dahinter ragten Getreidesilos auf. Ein Stück weiter links hinter einer Reihe blattloser Pappeln erblickte er die Stirnseite einer riesigen Halle, in der Stille konnte er das leise Surren von Ventilatoren hören.
Der quadratische, von einer mächtigen Zeder dominierte Hof verjüngte sich auf zwölf Uhr zu einer baumbestandenen Allee, die eine geometrisch exakte Spiegelung der Auffahrt bildete. Vier mit Holz verkleidete Häuser standen etwas zurückgesetzt in einer Reihe nebeneinander, jedes jeweils etwa zwanzig Meter vom anderen entfernt. Der Schnee im Hof war zertrampelt und von Reifenspuren übersät, eine Katastrophe für das Team von der Kriminaltechnik, das auf dem Weg hierher war, aber nicht zu ändern. Die Rettung von Menschenleben hatte oberste Priorität, selbst wenn dabei wichtige Spuren zerstört wurden.
Ein Officer vom Madison County Sheriff’s Department stapfte durch den Schnee auf ihn zu, er hatte den Hut, der normalerweise zur Uniform gehörte, gegen eine Mütze mit Ohrenklappen aus Kaninchenfell getauscht und trug einen schwarzen Daunenparka mit Rangabzeichen, die ihn als den Sheriff selbst auswiesen.
»Hallo, Sheriff.« Blystone nickte dem Mann zu und präsentierte ihm seine Marke.
Über das feiste, von der arktischen Kälte gerötete Gesicht huschte ein erstaunter Ausdruck. Flinke, helle Augen musterten ihn prüfend.
»Detective.« Der Sheriff tippte mit zwei Fingern an seine Mütze. »Sheriff Lucas Benton aus Madison.«
»Was ist hier passiert?«
»Fünf Tote, zwei Schwerverletzte. Ich bin seit 23 Jahren Sheriff. So ein verdammtes Massaker wie das hier hab ich noch nie gesehen.«
»Wer war der Schütze?«
»Einer der Grant-Söhne. Wir wissen noch nicht, warum.«
»Konnten Sie ihn festnehmen?«
»Negativ.« Der Sheriff schüttelte den Kopf. Wie die meisten Polizisten, die Blystone kannte, verbarg auch Sheriff Benton sein Entsetzen hinter einer undurchdringlichen Miene. »Jemand hat ihn erschossen, sonst hätte es wohl noch mehr Tote gegeben. Der Junge war bewaffnet wie Rambo.«
»Junge?« Blystone war überrascht.
»Esra Grant war erst siebzehn.« Sheriff Benton wandte sich um und Blystone folgte ihm zu der Leiche an der Hausecke. Der Sheriff bückte sich ächzend und zog die Folie ein Stück zur Seite. Schnee rieselte auf das, was vom Gesicht des Toten übrig geblieben war.
»Kaliber .308 Winchester aus ungefähr hundert Fuß Entfernung.« Er wies auf das vorderste der Holzhäuser. »Von der Veranda dort wurde er erschossen.«
»Von wem?«
»Einem indianischen Farmarbeiter.«
Der tote Junge trug einen Tarnanzug und Armeestiefel. Um den Oberkörper hatte er sich zwei Patronengürtel geschnallt, halb unter seinem Körper lag ein Gewehr. Blystone kniete sich in den Schnee und runzelte die Stirn.
»Eine Ithaca Mag-10 Shotgun mit abgesägtem Lauf«, stellte er fest und blickte den Sheriff an. »Wie kommt ein Siebzehnjähriger an eine so üble Waffe?«
»Keine Ahnung. Auf ’ner Farm gibt’s jede Menge Waffen«, erwiderte der Sheriff. Sein Atem kondensierte in der kalten Luft zu einer weißen Wolke. »Zuerst hat er übrigens mit ’ner Pistole geschossen, einer Smith & Wesson 44 Magnum Modell 29.«
Das Funkgerät des Sheriffs krächzte, er ging dran und gab ein paar Befehle. Blystone betrachtete eingehend die Leiche des Jungen und bemerkte eine Tätowierung am Hals des Toten, der für einen Siebzehnjährigen erstaunlich groß und kräftig gewesen war und schätzungsweise an die zweihundertdreißig Pfund gewogen hatte. Das Wort »HATE«, das in altmodischen Lettern in die blasse Haut tätowiert worden war, ließ erste Rückschlüsse auf den Gemütszustand des Täters zu. War es purer Hass gewesen, der den Jungen dazu veranlasst hatte, am frühen Morgen bis an die Zähne bewaffnet loszuziehen um seine Familie auszulöschen? Ob Alkohol oder Drogen bei diesem Amoklauf eine Rolle gespielt hatten, würde später bei einer Obduktion geklärt werden. Auch hier, auf dem flachen Land, war es heutzutage nicht mehr sonderlich schwer, an Alkohol, Crystal Meth oder Crack zu kommen.
»Die Presse hat schon Wind von der Sache hier gekriegt«, teilte der Sheriff Blystone mit und deckte die Leiche des Amokläufers wieder zu. »Wir sollten die Leichen abtransportieren, bevor die Bluthunde vom Fernsehen hier mit ’nem Hubschrauber aufkreuzen und aus der Luft filmen.«
»Tut mir leid, das geht nicht.« Blystone klopfte sich den Schnee von den Hosenbeinen. »Der Tatort muss so bleiben, bis wir alles fotografiert und kriminaltechnisch untersucht haben.«
»Hören Sie, Junge, ich will keine Bilder von Leichen in meinem County im Fernsehen sehen«, erwiderte Benton hitzig. »Und ich hab nicht genügend Leute, um hier alles abzuriegeln.«
Blystone war mit seinen 33 Jahren alles andere als ein »Junge«, aber er ignorierte die respektlose Anrede. Benton und seine Männer befanden sich in einer extremen emotionalen Ausnahmesituation und ihnen fehlten das psychologische Training und die Erfahrung, um innerlich Distanz wahren zu können.
»Aus Norfolk ist Verstärkung unterwegs«, sagte er, wohl wissend, wie wenig diese Nachricht dem Sheriff passen würde. »Und die Kriminaltechniker sind auf dem Weg aus Omaha. Bis sie eintreffen, wird hier nichts mehr verändert.«
Der Sheriff schnaubte zornig, und Blystone wusste, dass das letzte bisschen Bereitschaft zu einer vernünftigen Zusammenarbeit dahin war. Auch das kannte er leider nur zu gut. Die örtlichen Sheriffs reagierten nicht selten empfindlich wie Highschool-Prinzessinnen, wenn es um ihr Hoheitsgebiet ging. Kein Sheriff gestand sich gern ein, von einer Situation überfordert zu sein und die State Troopers zu Hilfe rufen zu müssen.
»Wer sind die anderen Toten?«
»Fragen Sie doch Ihre Kriminaltechniker«, knurrte der Sheriff beleidigt, und es fehlte nur noch, dass er Blystone vor die Füße spuckte. »Wir verschwinden hier. Meine Jungs haben Familien, und heute ist Weihnachten.«
Drohungen und Befehle würden nichts nützen, ebenso wenig würde es den Sheriff beeindrucken, wenn Blystone auf seinen höheren Rang pochte oder ihm mit irgendwelchen Paragraphen kam. Hier waren Fingerspitzengefühl und Sachlichkeit gefragt. Über beides verfügte Blystone, der lange genug selbst Uniform getragen hatte, um zu wissen, wie der Sheriff tickte.
»Sheriff«, sagte er deshalb versöhnlich. »Sie und Ihre Männer machen einen großartigen Job, und ich kann mir gut vorstellen, wie schwer das hier für Sie alle ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiterhin unterstützen. Aber es gibt leider nun mal Vorschriften bei Mordermittlungen, die ich nicht umgehen darf, ohne dass es Ärger gibt.«
Der Sheriff kämpfte einen Moment mit seinem gekränkten Stolz, er trat mit der Stiefelspitze in den Schnee wie ein trotziger Junge, dann zuckte er schließlich die Schultern.
»Da vorne am Pick-up, das ist Joe, der drittälteste Sohn«, brummte er zu Blystones Erleichterung. »Außerdem hat der Junge drei Farmarbeiter erschossen und seinen Vater und seinen zweitältesten Bruder schwer verletzt.«
Er schob die behandschuhten Hände in die Taschen seiner Jacke und bedeutete Blystone mit einer herrischen Kopfbewegung, ihm zu folgen. Sie gingen an dem ersten der vier Häuser vorbei. Auf der Veranda des zweiten Hauses, dem größten in der Reihe, lagen zwei Tote.
»Leroy und Carter Mills. Ihr Vater George ist der Vorarbeiter auf der Willow Creek«, sagte der Sheriff. »Die Jungs wohnten noch bei ihren Eltern und arbeiteten auch auf der Farm.«
Auf einen Wink von ihm zogen zwei seiner Leute die Decken weg, damit Blystone die Leichen betrachten konnte. Er hatte an den Schauplätzen von Unfällen, Mord und Totschlag schon schreckliche Dinge gesehen, aber der Anblick der beiden jungen Männer traf ihn mit Urgewalt. Die Brüder waren beide höchstens zwanzig Jahre alt gewesen und trugen noch ihre Schlafanzüge. Der Schütze hatte sie offenbar erschossen, als sie, aufgeschreckt durch die Schüsse im Nachbarhaus, aus der Haustür getreten waren.
Mitten auf dem Weg zwischen dem Mills-Haus und Haus Nummer 3 lag eine weitere Leiche.
»Lyle Patchett«, erklärte Sheriff Benton. »Ein Farmarbeiter, der im Gesindehaus hinten bei den Stallungen wohnt. Hat über zwanzig Jahre hier gearbeitet.«
Blystone nickte. Keiner der drei Männer war bewaffnet gewesen, und keiner von ihnen hatte versucht, sich vor dem Schützen in Sicherheit zu bringen. Sie hatten ihren Mörder gut gekannt und offenbar geglaubt, ihn aufhalten zu können. Diese Fehleinschätzung hatten sie mit ihren Leben bezahlt.
»Angefangen hat’s wohl hier drüben, in der Nummer 3«, sagte der Sheriff und ging weiter. »Esra muss die Tür eingetreten haben und direkt in das Zimmer gegangen sein, in dem sein Vater geschlafen hat. Auf dem Flur hat er dann seinen Bruder Hiram niedergeschossen.«
»Was ist mit den Angehörigen der Opfer?«
»Die Eltern der Mills-Jungs sind bei Verwandten in Colorado. Sie sind schon informiert.«
»Und die Mutter beziehungsweise Ehefrau von Mr Grant?«
»Mrs Rachel Grant. Eine starke Frau, die so schnell nichts umhaut«, sagte Benton. »Sie hatte einen Nervenzusammenbruch, kann man ihr wohl nicht verdenken. Ich hab sie nach Madison ins Krankenhaus bringen lassen, genauso wie den verletzten Sohn. Vernon Grant ist nach Omaha geflogen worden. Um ihn steht’s schlecht. Er hat einen Kopf- und einen Bauchschuss abgekriegt. Der älteste Sohn und seine Frau sind unverletzt geblieben.«
Jordan Blystone betrachtete das gesplitterte Türschloss, betrat das Haus und sah sich um. Überall war Blut: an den Wänden, auf dem Boden, an der Haustür. Er folgte dem Sheriff den Flur entlang zum hintersten der drei Zimmer.
»Hier hat’s Vernon erwischt.« Benton blieb im Türrahmen stehen, Blystone ging an ihm vorbei und blickte sich um. Wieso hatte der Vater des Amokschützen nicht in seinem Haus geschlafen, sondern in einem der Arbeiterhäuschen?
Blystone bemerkte Schulbücher auf dem Schreibtisch, einen Plüschteddybär, der ein Herz mit dem Schriftzug Vergiss mich nicht in den Tatzen hielt, Poster von Madonna und Bruce Springsteen an den Wänden. Das von Blut durchtränkte Bettzeug war rosaweiß kariert, auf dem Fußboden lagen rosa Kissen. Hier stimmte etwas nicht. Blystones Blick wanderte über die schlichten Möbel, er öffnete eine Tür des Kleiderschrankes. Mädchenklamotten. Bücher stapelten sich auf dem Boden und auf jeder freien Fläche, auf der kleinen Stereoanlage lagen CDs von Bryan Adams, John Mellencamp und Whitney Houston. Über der Lehne des Schreibtischstuhls hing die Kleidung eines erwachsenen Mannes: Hemd, Pullover, Hose mit Gürtel. Darunter ein Paar Schuhe und Socken.
Was hatte Vernon Grant hier zu suchen gehabt, im Zimmer eines jungen Mädchens? Hatte er etwa ein Verhältnis gehabt?
»Wer wohnt in diesem Zimmer?«, fragte Blystone.
»Keine Ahnung.« Der Sheriff setzte seine Fellmütze ab und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn, dann blickte er sich um, und seine Miene wurde finster.
»Die Einzige, die wir übrigens bisher nicht finden konnten, ist die Tochter. Sheridan. Sie muss sich aus dem Staub gemacht haben.« Seine flinken hellen Augen wanderten zu dem Bett. »Würde mich nicht wundern, wenn die was mit der ganzen Sache zu tun hätte. Ist’n richtiges Früchtchen und gehört eigentlich nicht mal zur Familie.«
»Ach?« Blystone horchte auf.
»Ist’n Adoptivkind. Sind anständige Leute, die Grants. Sie haben dem elternlosen Ding ein ordentliches Zuhause gegeben, aber das Mädchen hat eine Vorliebe für zwielichtige Gestalten. Hat Vernon und Rachel nichts als Ärger gemacht, das kleine Flittchen.«
»Wie alt ist die Tochter?«
»Sechzehn, siebzehn.« Der Sheriff zog vielsagend die Augenbrauen hoch. »Äußerst hübsches Ding.«
Es war eindeutig, worauf er anspielte und wem seine Sympathien galten, aber Jordan Blystone neigte nicht dazu, sich vorschnell eine Meinung zu bilden, schließlich war es bisher nur eine Vermutung, dass dies das Zimmer von Sheridan, der Adoptivtochter, war. Allerdings wäre dies nicht der erste Amoklauf, der sich als Familiendrama entpuppte. War Vernon Grant, ein Mann in den besten Jahren, etwa den Reizen seiner hübschen, minderjährigen Adoptivtochter erlegen? Hatte sein jüngster Sohn die heimliche Beziehung entdeckt und aus Loyalität zu seiner Mutter auf seinen Vater geschossen? Der Verdacht war nicht von der Hand zu weisen und womöglich ein Motiv für die Tat. Noch war das zwar reine Spekulation, aber die Details würden irgendwann ein Gesamtbild ergeben.
25. Dezember 1996
Irgendwo in Illinois
Eine Entscheidung zu treffen bedeutet, sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Deshalb sollte man Entscheidungen von großer Tragweite auch nicht übereilt, sondern mit kühlem Kopf und einem durchdachten Plan treffen. Genau das hatte ich jedoch nicht getan. Als ich mich gestern Morgen in mein Auto gesetzt hatte und losgefahren war, war ich mir wie eine Heldin vorgekommen, fest davon überzeugt, es sei das Beste und Klügste, Fairfield, der Willow Creek Farm und Horatio Burnett für immer den Rücken zu kehren und alle Brücken hinter mir abzubrechen. Theoretisch mochte das auch so sein, aber die Realität war indes eine völlig andere. In meinen Träumen von der Freiheit hatte ich nie wirklich bedacht, was es bedeutete, mit siebzehn Jahren völlig auf sich selbst gestellt mit knapp tausend Dollar in der Tasche ins Unbekannte zu fahren. Ganz ähnlich hatte meine leibliche Mutter gut dreißig Jahre zuvor auch gehandelt, allerdings hatte meine Mum Fairfield damals aus gänzlich anderen Motiven und mit der Hoffnung auf ein Happy End verlassen.
Bis vor ein paar Monaten hatte ich noch an eine tragische Fügung des Schicksals geglaubt, dass ich, nachdem ich im Alter von knapp drei Jahren durch einen Unfall zur Vollwaise geworden war, ausgerechnet in diesem öden Nest im Nordosten Nebraskas gelandet und von Vernon Grant und seiner Frau Rachel adoptiert worden war. Es hätte mich durchaus schlechter treffen können. Die Grants waren eine hochangesehene Familie und in ganz Nebraska bekannt, denn der Urahn meines Adoptivvaters war vor hundertfünfzig Jahren als einer der ersten Siedler in diesen Landstrich gekommen. Die Männer der Grants waren immer kluge und besonnene Farmer gewesen und in den Zeiten der großen Depression hatten sie gewaltige Landkäufe getätigt, so dass die Willow Creek Farm bis heute eine der größten Farmen im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten war. Ich hatte immer gewusst, dass ich adoptiert worden war, aber das hatte mich nicht weiter gestört. Mir hatte es in meiner Kindheit an nichts gefehlt, abgesehen von Mutterliebe, denn meine Adoptivmutter hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie mich nicht leiden konnte. Ihre Ungerechtigkeiten hatten jedoch durch meinen Adoptivvater, der mir ehrlich zugetan war, lange Zeit einen Ausgleich gefunden.
Alles hatte sich geändert, als ich im vorletzten Sommer zufällig meine Adoptionspapiere gefunden und festgestellt hatte, dass der angebliche Unfalltod meiner Eltern ein Märchen gewesen war. Mit Beharrlichkeit, Glück und detektivischem Spürsinn hatte ich eine schier unglaubliche Geschichte von Lügen und Intrigen aufgedeckt, die die ganze Familie Grant in ihren Grundfesten erschüttern sollte. Meine leibliche Mutter war Carolyn, die jüngere Schwester meiner Adoptivmutter gewesen, deren Name niemals in unserer Familie erwähnt worden war. Durch puren Zufall hatte ich Carolyns Tagebücher entdeckt, und dieser Fund war das Steinchen gewesen, das eine wahre Lawine ausgelöst hatte. Vorgestern Abend war schließlich alles eskaliert, und in einem Erdrutsch von wahrhaft apokalyptischen Ausmaßen war das komplizierte Lügenkonstrukt, das meine Adoptivmutter über dreißig Jahre hinweg eisern aufrechterhalten hatte, in sich zusammengestürzt. Für die hartherzige Rachel Grant und meinen verhassten Bruder Esra würde nach dieser Stunde der Wahrheit nichts mehr so sein wie vorher, und sie würden mir auf immer die Schuld daran geben, obwohl die verhängnisvollen Lügen lange vor meiner Geburt ihren Anfang genommen hatten.
Derart überrumpelt von den Ereignissen, hatte ich mich dazu entschlossen, die Farm und Fairfield auf der Stelle zu verlassen. Der wahre Grund meiner Flucht war jedoch meine Angst vor den Konsequenzen, die die erbarmungslose Aufdeckung der Wahrheit nach sich ziehen würde.
Ich öffnete die Augen und starrte an die Decke des Motelzimmers, in dem ich gestern Abend zufällig gelandet war. Das Motel, dessen beste Tage Jahrzehnte zurücklagen, befand sich ein paar Meilen von der Interstate 80 entfernt inmitten eines heruntergekommenen Industriegebiets. Bis auf zwei Trucks war der Parkplatz leer gewesen – auch die LKW-Fahrer verbrachten Weihnachten lieber bei ihren Familien als in einem hässlichen Motel irgendwo in Illinois – , und es hatte ein paar Minuten gedauert, bis eine mürrische Frau mit verquollenen Augen und strähnigen Haaren aus einem Hinterzimmer aufgetaucht war. Sie hatte mich weder nach einem Ausweis oder Führerschein gefragt, noch hatte sie mir ein Anmeldeformular hingelegt. Stumm hatte sie die achtunddreißig Dollar kassiert, mir einen Schlüssel hingeknallt und gemurmelt, die Kaffeemaschine sei kaputt, und Frühstück würde es auch nicht geben. Ich hätte das Geld für ein Zimmer gern gespart, aber für eine Übernachtung im Auto war es eindeutig zu kalt.
»Keine Männerbesuche«, hatte sie mir noch nachgerufen. »Wir sind kein Puff.«
Ich war mit meinem Auto bis vor die Tür von Zimmer 32 gefahren, hatte meine Tasche von der Rückbank gezerrt, die Kisten aber im Kofferraum gelassen. Nur ein völlig Verrückter würde einen zwanzig Jahre alten Honda aufbrechen, um Bücher zu klauen. Das Zimmer mit dem abgetretenen Teppichboden, der ursprünglich einmal grasgrün gewesen sein mochte, stank nach einem süßlichen Raumspray, das den muffigen Geruch von altem Schweiß und Zigarettenrauch kaum überdeckte. Die Handtücher im Badezimmer waren ausgefranst und papierdünn, der Spiegel hatte einen Sprung. Doch nach zehn Stunden Fahrt, in denen ich 500 Meilen durch Schneefall und Dunkelheit zurückgelegt hatte, war ich zu erschöpft gewesen, als dass mich Haare im Waschbecken, ein defekter Röhrenfernseher oder die kratzige, viel zu dünne Bettdecke gestört hätten.
Ich hatte zwölf Stunden tief und traumlos geschlafen und verspürte nicht die geringste Lust, aufzustehen und weiter nach Osten zu fahren. Niemals in meinem Leben hatte ich mir vorstellen können, dass ich eines Tages einmal Heimweh nach ausgerechnet dem Ort bekommen könnte, den ich immer hatte hinter mir lassen wollen, aber jetzt sehnte ich mich so sehr nach meinem Pferd, nach Mary-Jane und Paradise Cove, dass mir die Tränen in die Augen stiegen und mich der Mut verließ. Noch schmerzlicher war meine Sehnsucht nach Horatio, nach seinen samtgrauen Augen, seiner Stimme und der tröstlichen Geborgenheit, die ich in seiner Gegenwart empfunden hatte. Ob Mary-Jane ihm wohl schon meinen Abschiedsbrief gegeben hatte? Die ganze gestrige Fahrt über hatte ich mir ausgemalt, wie er reagieren würde, wenn sie ihm den Brief gab. Würde er nach Paradise Cove fahren und ihn dort lesen, in seinem Auto, auf dessen Rückbank wir uns zum letzten Mal geliebt hatten? Die Vorstellung, wie er seine Stirn auf das Lenkrad pressen und von Weinkrämpfen geschüttelt voller Dankbarkeit und Hochachtung erkennen würde, wie selbstlos und stark ich gehandelt hatte, hatte mir eine gewisse Befriedigung verschafft. Aber was, wenn es völlig anders war? Was, wenn er die zwei engbeschriebenen Seiten trockenen Auges in seinem Büro überflog, Erleichterung verspürte, dass ich sein Problem so elegant gelöst hatte, und den Brief im Reißwolf verschwinden ließ? Die Zweifel, die ich in seiner Gegenwart nie gehabt hatte, waren mit jeder Meile, die ich mich von ihm entfernt hatte, stärker geworden, und jetzt fraßen sie mich fast auf. Damit, dass Tante Rachel oder Esra über mein Verschwinden froh waren, konnte ich leben, aber von Horatio wünschte ich mir denselben Schmerz, den ich empfand. Die Wahrheit war jedoch, dass ich mit seiner Liebe etwas verloren hatte, auf das ich nie ein Recht gehabt hatte, und diese Gewissheit war weitaus bitterer als der Verlust selbst. Ich schauderte bei der Erinnerung an die letzten Tage meines alten Lebens, das so unvermittelt vorbei gewesen war. Ganz sicher wäre ich in Fairfield geblieben, wenn Esra mich und Horatio nicht zusammen im Auto gesehen hätte. Egal, was ich mir einreden wollte: Ich hatte nicht etwa edelmütig auf meine große Liebe verzichtet, wie der Held in einem Westernfilm, sondern ich war ohne Abschied zu nehmen auf eine ziemlich jämmerliche Art und Weise geflüchtet.
Schluchzend rollte ich mich unter der Bettdecke zusammen und gab mich dem Selbstmitleid hin. Lag es wirklich nur an Horatio, dass ich plötzlich an meiner Entscheidung zweifelte, die mir gestern noch so vernünftig wie alternativlos erschienen war? Vor mir lag meine Zukunft, über die ich endlich selbst bestimmen konnte! In New York wartete der Musikproduzent Harry Hartgrave auf mich, der professionelle Probeaufnahmen in seinem Studio mit mir machen wollte, und damit bot sich mir die Chance, von der ich immer geträumt hatte! Fühlte ich mich vielleicht nur deshalb so verzagt, weil Weihnachten war? Zwar hatte es in meiner Familie nie fröhliche Weihnachten gegeben – das war mit einer Frau wie Tante Rachel einfach nicht möglich – , aber gestern war mir zum ersten Mal schmerzlich bewusst geworden, was mir all die Jahre gefehlt hatte. Den ganzen Tag waren im Radio Weihnachtslieder gespielt worden. Egal, in welchen Sender ich geschaltet hatte, überall hatten die Leute davon geschwärmt, was sie mit ihren Familien an Weihnachten unternehmen, was sie essen und was sie einander schenken würden, während ich allein in meinem Auto gesessen und mir die Augen aus dem Kopf geheult hatte. Die Versuchung, Dad anzurufen, mich zu ihm zu flüchten und ihn um Hilfe zu bitten, erschien mir plötzlich weitaus verlockender als die Freiheit, die mir Angst einjagte.
Im Zimmer war es kühl, die Heizung knackte und gluckerte geschäftig, brachte aber keine wirkliche Wärme zustande. Im Badezimmer war es noch ungemütlicher. Die verrostete Elektroheizung neben der Toilette gab keinen Mucks von sich, und ich beschloss zähneklappernd, auf eine Dusche zu verzichten. Nach einer schnellen Katzenwäsche schlüpfte ich in meine Kleider, schnappte meine Tasche, warf den Schlüssel auf das Bett und verließ das schäbige Zimmer. Den Weg zur Rezeption sparte ich mir. Für achtunddreißig Dollar konnte sich die mürrische Rezeptionistin ihren Schlüssel selbst holen.
Über Nacht waren die Temperaturen noch einmal deutlich gefallen. Es hatte aufgehört zu schneien, dafür war es zu kalt, und der Himmel war von einem stumpfen Grau, wie erstarrt vor Kälte. Das Schloss an der Fahrertür meines Autos war zugefroren und ich musste über den Beifahrersitz hinters Lenkrad klettern, um den Motor zu starten. Wenigstens hatte ich daran gedacht, das Pappschild, das Hiram in den Kofferraum gelegt hatte, hinter die Scheibenwischer zu klemmen, sonst hätte ich sicherlich eine Viertelstunde gebraucht, um die dicke Eisschicht von der Windschutzscheibe zu kratzen.
Der alte Honda sprang sofort an, der Motor brummelte im Leerlauf vor sich hin. Die Nadel der Tankanzeige stand bedrohlich knapp über der Reserve, ich würde tanken müssen, bevor ich weiterfuhr. Und irgendetwas zu essen brauchte ich auch, denn mein Magen knurrte. Das Hühnchensandwich, das ich gestern beim letzten Tankstopp in Iowa gekauft und dummerweise im Auto vergessen hatte, war steinhart gefroren, genauso wie die Tafel Schokolade. Die Heizung brauchte eine halbe Ewigkeit, bis sie endlich warme Luft produzierte, deshalb war ich bis auf die Knochen durchgefroren, als ich nach fünfzehn Meilen auf der Interstate endlich eine Tankstelle fand.
Der Verkaufsraum war leer bis auf zwei Männer vom Schneeräumdienst in gelben Warnwesten, die mit dampfenden Kaffeebechern in der Hand auf den stummen Fernseher an der Wand starrten.
»Fröhliche Weihnachten!«, rief die Kassiererin freundlich. Ich war so streng zur Höflichkeit erzogen worden, dass ich den Gruß automatisch erwiderte, obwohl mir nicht danach zumute war.
»Kriege ich bei Ihnen auch etwas zu essen?«, fragte ich, nachdem ich die Tankfüllung bezahlt hatte.
»Oh, natürlich! Wir haben ein Restaurant, gleich da vorne links«, erwiderte die Kassiererin und lächelte herzlich. »Du siehst richtig durchgefroren aus, Schätzchen. Geh nur rüber, da kannst du dich aufwärmen.«
Das Mitgefühl dieser Fremden tat mir gut. Ich lächelte dankbar und ging hinüber in das Restaurant. Ein geschmückter Weihnachtsbaum, Girlanden aus künstlichen Tannenzweigen an den Wänden und der Decke und die zu Rentieren geformten Lichtschläuche an den Fenstern sollten dem nüchternen Autobahnrestaurant mit seinen grellroten Kunstlederbänken, den Resopaltischen und dem grauen Fliesenboden wohl die Atmosphäre eines heimeligen Wohnzimmers verleihen. Ich blickte mich um und entschied mich für einen Tisch in einer Nische, zog meine Jacke aus und rieb meine Hände aneinander, um das Blut wieder zum Zirkulieren zu bringen.
»Hi!« Eine gelangweilte Frau mit schlaffen, aufgeschwemmten Gesichtszügen, die ihre Uniform – einen formlosen roten Overall und eine alberne Weihnachtsmannmütze – sicherlich hasste, tauchte an meinem Tisch auf. »Fröhliche Weihnachten. Was darf’s sein?«
Mein Magen knurrte, und ich beschloss, ein paar Dollars in Kaffee, einen Donut und Rührei mit Speck zu investieren, auch wenn ich mir das eigentlich nicht leisten konnte.
Der Kaffee war stark und schwarz und weckte meine Lebensgeister, das Rührei schmeckte köstlich, und ich verputzte die Riesenportion bis auf den letzten Krümel. Meine Hände und Füße tauten auf und begannen zu kribbeln.
»Noch mehr Kaffee?« Schon fünf Minuten später starrte mich die Kellnerin wieder aus ihren rotgeränderten Kaninchenaugen an, die Glaskanne schwebte über meiner Tasse. Offenbar war sie froh über einen Gast, der ihr die Zeit vertrieb, und hatte Lust auf ein Schwätzchen, aber mir war nicht danach zumute. Nachdem ich ihre Versuche, ein Gespräch anzufangen, mit wortkargen Antworten im Keim erstickt hatte, nahm sie den leeren Teller mit und schlurfte davon. Ich kramte die Straßenkarte aus meinem Rucksack, faltete sie auseinander und suchte den Ort Joliet. Gestern war ich weitaus besser vorangekommen, als ich gedacht hatte. Ich war 530 Meilen gefahren, hatte Iowa und Illinois durchquert und befand mich nun nur noch wenige Meilen von der Staatsgrenze zu Indiana entfernt. Mit etwas Glück konnte ich es heute bis nach Ohio schaffen, dann hatte ich schon mehr als die Hälfte der Strecke nach New York City bewältigt. Nachdenklich biss ich in den Schokoladen-Donut. Bisher hatte ich 124 Dollar und 68 Cents für Tanken, Essen und das Motelzimmer ausgegeben. Wenn ich weiterhin so verschwenderisch mit meinem Geld umging, war ich in spätestens einer Woche pleite. Ich musste unbedingt Harry Hartgrave anrufen und ihm mitteilen, dass ich auf dem Weg zu ihm war, denn mir fiel mit Schrecken ein, dass er ja erst im Januar mit mir rechnete. Aber selbst wenn er nicht in der Stadt sein und mir das Geld ausgehen würde, so konnte ich mir immer noch irgendwo einen Job suchen, denn Arbeit war ich schließlich gewohnt.
Aus unsichtbaren Lautsprechern rieselte kitschige Weihnachtsmusik, ich war satt, mir war warm, und zum ersten Mal seit meinem überstürzten Aufbruch aus Fairfield verspürte ich so etwas wie zaghaften Optimismus. Mein Blick wanderte zu dem Fernsehbildschirm, der an der Wand neben dem Tresen angebracht war. Gelbe Absperrbänder vor weißem Schnee, Polizeiautos mit eingeschalteten Blinklichtern, dann Filmaufnahmen, die wohl aus einem Hubschrauber gemacht worden waren und verschneite Farmgebäude aus der Vogelperspektive zeigten. Eine Reporterin mit rot gefrorener Nase, Fellmütze und Daunenjacke erschien auf dem Bildschirm und sprach in ein Mikrophon, dann wurde ins Studio zu einem Nachrichtensprecher-Duo mit ernsten Gesichtern umgeschaltet.
Irgendwo auf dieser Welt war etwas Schlimmes passiert, Katastrophen machten vor Weihnachten nicht halt. Gerade als ich von meinem Donut abbeißen und mich wieder der Straßenkarte widmen wollte, wurde das Bild einer jungen Frau eingeblendet, und ich erstarrte. Das Foto war im letzten Sommer in der Schule aufgenommen worden, es stammte aus dem Jahrbuch der Madison Senior High School und es zeigte – mich! Entsetzt starrte ich auf den Bildschirm, ich las meinen Namen und die Schlagzeile. Das Willow Creek Massaker – Familientragödie in Nebraska am Weihnachtsmorgen – fünf Tote, zwei Schwerverletzte.
Der Donut fiel mir aus den Fingern, als ich begriff, was ich am liebsten gar nicht begriffen hätte.
»Schrecklich, was? So’n irrer Hinterwäldler hat seine ganze Familie abgemurkst. Und das an Weihnachten!« Die Kellnerin stand plötzlich neben mir, ich hatte sie gar nicht kommen sehen.
Wirre Gedankenfetzen wirbelten durch meinen Kopf wie Puzzlestücke, bis sie wie von selbst zu einem grauenvollen Ganzen zusammenfanden. Fünf Tote! Fünf Menschen, die ich mit Sicherheit kannte, waren tot! Was, um Himmels willen, war passiert, nachdem ich die Farm verlassen hatte? Ein dunkelhaariger Mann erschien auf dem Bildschirm, und für den Bruchteil einer Sekunde durchströmte mich ein heißes Gefühl der Erleichterung, denn ich dachte, es sei Dad, doch dann wurde ein Name eingeblendet, der mir nichts sagte: Detective Lieutenant Jordan Blystone von den Nebraska State Troopers.
»Woll’n Sie noch’n Kaffee?« Die Kellnerin stand noch immer mit der Kaffeekanne in der Hand vor meinem Tisch. Ich blickte irritiert auf. Es waren nur ein paar Sekunden vergangen, seitdem ich die Schlagzeile und mein Bild im Fernsehen gesehen hatte, aber es hatte sich viel länger angefühlt.
»Ich … ich, nein danke. Ach, bitte, können Sie den Fernseher lauter stellen?«, stammelte ich und stand auf.
»Klar.« Sie zuckte die Achseln und verschwand hinter dem Tresen. Wenig später verstummte die Weihnachtsmusik, stattdessen erklang die Stimme der Reporterin, die vor dem geschlossenen Hoftor der Willow Creek Farm stand. Im Hintergrund konnte ich das Haus sehen, Malachys weißen Pick-up, Streifenwagen und Polizisten. Das Blut pochte in meinen Schläfen, eine Gänsehaut kroch mir über Arme und Rücken hoch bis ins Genick.
»… hat sich in den frühen Morgenstunden auf der Farm in der Nähe von Fairfield im Madison County in Nebraska offenbar eine Familientragödie ereignet«, sagte die Reporterin mit der roten Nase. »Ein Siebzehnjähriger hat nach Angaben der Polizei vier Menschen getötet und mehrere schwer verletzt, bevor er selbst erschossen wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der ebenfalls siebzehnjährigen Sheridan Grant, die derzeit als vermisst gilt. Bisher geht die Polizei davon aus, dass auch sie ein Opfer des Amokläufers wurde …«
Ein Siebzehnjähriger. Esra! Mein Magen ballte sich zusammen, mir wurde übel. Eine Hand legte sich auf meine Schulter. Ich zuckte erschrocken herum und blickte in die Augen der freundlichen Kassiererin.
»Ist alles okay, Schätzchen?«, fragte sie besorgt.
»Nein«, flüsterte ich. »Nein, nichts ist okay. Das da sind meine Leute. Kann ich … kann ich hier irgendwo telefonieren?«
»Oh mein Gott, das ist ja furchtbar!« Die Frau riss schockiert die Augen auf. »Aber natürlich! Komm mit, Liebes.«
Ich holte meine Jacke und meinen Rucksack und folgte ihr einen schmalen Flur entlang, vorbei an Regalen, in denen sich Kartons mit Kühlerfrostschutzmittel, Motoröl und anderes Autozubehör stapelten, in ein Büro. Durch eine Glasscheibe konnte man in den Verkaufsraum blicken, mehrere Monitore zeigten unscharfe Schwarzweißbilder der Überwachungskameras. Ich konnte mein Auto sehen, das noch immer als Einziges zwischen den Zapfsäulen stand. Der LKW mit dem vormontierten Schneeschieber parkte auf der Rückseite des Gebäudes.
»Hier kannst du in Ruhe telefonieren, Schätzchen. Soll ich dir noch etwas bringen? Einen Kaffee oder ein Glas Wasser?«
»Danke, nein.« Ich schüttelte den Kopf und setzte mich auf die vorderste Kante des Stuhls. Auf dem Schreibtisch stand das Telefon, und ich griff nach dem Hörer. Aber wen sollte ich anrufen? Dad? Malachy? Was, wenn ich nun erfahren musste, dass sie tot waren, von Esra erschossen? Meine Finger zitterten so sehr, dass ich kaum unsere Telefonnummer wählen konnte. Nie zuvor hatte mich eine eigentlich alltägliche Handlung so viel Überwindung gekostet. Das Freizeichen ertönte, ich wartete mit ängstlich pochendem Herzen, aber niemand nahm ab. Waren sie alle tot? Ich stellte mir vor, wie das Schrillen des Telefons durch das Haus schallte, in dem Männer in weißen Overalls und Kapuzen die von Schüssen zerfetzten Leichen meiner Familie fotografierten, und mir brach der kalte Angstschweiß aus.
Vor der Tür flüsterte die Kassiererin leise mit einem dürren, graubärtigen Mann, dabei warf sie mir besorgte Blicke zu. Sie schienen zu beratschlagen, was sie nun mit diesem Mädchen, das von der Polizei gesucht wurde und in ihrem Büro saß, anfangen sollten. Ich hörte gedämpft ihr aufgeregtes Flüstern. Hinter den beiden erschien die Kellnerin und linste neugierig zur Tür herein. Die Tragödie, die sich am frühen Morgen sechshundert Meilen entfernt abgespielt hatte, wurde für sie alle durch mich unversehens dreidimensional und real.
Ich legte auf und versuchte es mit der Nummer von Malachy und Rebecca, aber vergeblich. Sicherlich hatten mein Bruder und seine Frau jetzt etwas Besseres zu tun, als ans Telefon zu gehen. Falls sie überhaupt noch am Leben waren! Es gab noch eine dritte Telefonnummer, die ich auswendig kannte. Kurz scheute ich mich davor, sie zu wählen, doch dann überwand ich meine Bedenken und tippte die vertrauten Zahlen ein. Ich schloss die Augen, wartete voller Anspannung.
»Hallo?«
Die warme, dunkle Stimme, von der ich befürchtet hatte, sie niemals wieder zu hören, erklang dicht an meinem Ohr. Mich überwältigten die Tränen.
»Horatio!«, schluchzte ich. »Ich kann bei uns niemanden erreichen!«
»Sheridan!«, rief er. »Wo bist du? Wie geht es dir?«
»Ich … ich bin an einer Tankstelle, irgendwo in … in Illinois, glaube ich.«
»In Illinois.« Das klang erleichtert. »Großer Gott, Sheridan, ich habe schon befürchtet, du wärst … er hätte dich auch … oh, mein Gott. Hast du gehört, was passiert ist?«
»Ja. Ich habe es gerade im Fernsehen gesehen«, erwiderte ich zittrig. »Was ist mit Dad? Und mit meinen Brüdern?«
»Ich weiß auch nicht viel mehr als das, was sie im Fernsehen sagen.« Horatio sprach plötzlich sehr schnell und sehr leise. »Hör zu, Sheridan: Die Polizei sucht dich! Deine Mutter muss dem Sheriff und den Detectives aus Lincoln erzählt haben, du und ich, wir hätten Esra in eine Falle gelockt und versucht, ihn am Paradise Cove zu ertränken, weil er uns auf die Schliche gekommen sei! Und du seiest schuld daran, dass er durchgedreht ist. Die Polizei war eben bei mir, denn sie haben Notizen von Esra gefunden, in denen es um dich und um mich geht, aber sie verstehen die Zusammenhänge nicht. Sie vermuten, du hättest auch ein Verhältnis mit deinem Adoptivvater gehabt, weil er in deinem Bett lag, als Esra auf ihn geschossen hat! Oh Gott, Sheridan, sie wissen über uns Bescheid!«
Ich hörte die Panik in seiner Stimme, und mir wurde schwindelig, als ich nach und nach die Tragweite seiner Worte erfasste. »Was?«, flüsterte ich fassungslos. »Aber … aber das stimmt doch alles nicht. Ich … ich bin gestern Morgen weggefahren, ich habe dir …«
Ich habe dir einen Brief geschrieben. Ich habe Fairfield verlassen, um dich zu schützen.
Ich verstummte, biss mir auf die Unterlippe. Hätte ich Esra aufhalten können? Er hatte auf Dad geschossen, weil der in meinem Bett gelegen hatte, also hatte er es eigentlich auf mich abgesehen! Vielleicht wäre er damit zufrieden gewesen, mich zu erschießen, und alle anderen, die gestorben waren, könnten jetzt noch leben! Tante Rachel hatte recht: Ich war schuld an allem. Schließlich hatte ich ein über 30 Jahre altes Geheimnis aufgedeckt und ihr und Esras Leben damit zerstört. Genau das war es, was zu dieser Tragödie geführt haben musste. Esra, der erfahren hatte, dass er nicht Dads Sohn und damit kein Grant war, hatte heute Morgen vier Menschen getötet! Joseph, Hiram, Malachy, Dad – lebten sie noch?
»Was soll ich denn jetzt tun?«, krächzte ich verzweifelt. Insgeheim hoffte ich, er würde sagen, ich solle auf der Stelle zu ihm kommen, aber zu meiner Enttäuschung sagte er etwas völlig anderes.
»Verschwinde so schnell du kannst!«, flüsterte Horatio eindringlich. »Setz dich ins Auto, und fahr irgendwohin, bis sich hier alles etwas beruhigt hat. Meide am besten die Interstates und Highways. Und … bitte, Sheridan, ruf mich nicht mehr an, okay?«
Er hängte ein, ohne eine Antwort von mir abzuwarten.
Ich saß für ein paar Sekunden wie betäubt da, den Hörer in der Hand und unfähig zu begreifen, was da gerade passiert war. Die Polizei suchte mich. Nicht etwa wegen einer lächerlichen Kleinigkeit wie damals, als Sheriff Benton meine Freunde und mich in der alten Getreidemühle beim Musikhören erwischt hatte. Und Horatio Burnett, der mir noch vor ein paar Tagen ins Ohr geflüstert hatte, er habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt wie mich, hatte mich gerade gebeten, ihn nicht mehr anzurufen!
»Und? Hast du jemanden erreichen können, Schätzchen?« Die Stimme der Kassiererin riss mich aus meiner Erstarrung.
»Ja.« Ich legte den Telefonhörer auf die Gabel, stand auf und ergriff den Rucksack.
Setz dich ins Auto, und fahr irgendwohin, bis sich alles etwas beruhigt hat. Und bitte ruf mich nicht mehr an.
Hatte Horatio das gerade wirklich gesagt, oder hatte ich mir das eingebildet?
»Danke, dass ich Ihr Telefon benutzen durfte«, sagte ich. »Was bekommen Sie von mir?«
»Nichts. Ist schon okay.« Alle Freundlichkeit und jedes Mitgefühl waren gespielt, in den Augen der Kassiererin glitzerte pure Sensationslust.
»Aber … der Kaffee und die Rühreier …«
Aus den Augenwinkeln nahm ich den Mann und die Qualle von Kellnerin mit ihrer Weihnachtsmannmütze wahr, sie standen im Flur und wechselten verstohlene Blicke. Durch die Glasscheibe sah ich die beiden Männer vom Schneeräumdienst, die wie zufällig Position vor der Tür des Verkaufsraumes bezogen hatten. Etwas Unheilvolles braute sich zusammen. Ein flaues Gefühl machte sich in meinem Magen breit. Ich wandte mich zu den Monitoren um und sah, dass mein einsames Auto Gesellschaft bekam. Vier oder fünf Streifenwagen von der Illinois State Police bremsten direkt vor den Türen des Verkaufsraumes. Die Cops sprangen heraus, stürmten durch die Glastüren und drängten die Schneeräumleute unsanft zur Seite. Ein Regal stürzte krachend um, etwas ging zu Bruch.
»Hierher!«, hörte ich die schrille Stimme der Kellnerin, die Kassiererin stürzte sich unvermittelt auf mich und packte mein Handgelenk, als ob sie mich an einer Flucht hindern wollte.
»Hier! Hier ist sie!«, schrie sie.
»Lassen Sie mich los. Ich laufe schon nicht weg«, sagte ich zu ihr, aber sie beachtete mich nicht. Sekunden später drängten sich drei Cops in das kleine Büro und fuchtelten aufgeregt mit ihren Waffen herum, so als hätten sie einen lang gesuchten Serienmörder gestellt. Einer von ihnen brüllte mich an, ich solle die Hände heben und mich auf den Boden legen, ich sei verhaftet. Wilde Entschlossenheit verzerrte sein breites Pfannkuchengesicht, Speichel sprühte von seinen Lippen. Die ganze Situation war beängstigend und trotzdem derart grotesk, dass ich bei aller Verzweiflung und Angst einen hysterischen Lachanfall bekam. Hätte ich in diesem Moment geahnt, dass mich die Presse deswegen später als eiskaltes, gefühlloses Monster darstellen würde, das bei seiner Festnahme nur gelacht hatte, so hätte ich mir in diesem Moment wohl auf die Zähne gebissen und geweint. Aber an so etwas dachte ich nicht. Mir war überhaupt nicht klar, was auf mich zukommen und welche Folgen das, was an diesem Weihnachtstag in der Tankstelle in Illinois geschah, für mich und meine Zukunft haben sollte.
Als ich in Handschellen aus der Tankstelle gezerrt und zu einem Streifenwagen geführt wurde, flammten Blitzlichter auf, und jemand rief meinen Namen, doch ich reagierte nicht. Wo kamen die Reporter so schnell her? Einer der Cops leierte einen Spruch herunter, dass ich das Recht hätte, zu schweigen oder einen Anwalt zu nehmen, aber er sagte nicht, worüber ich schweigen sollte oder weshalb ich einen Anwalt brauchte. Während die Polizisten noch beratschlagten, was sie jetzt mit mir anfangen sollten, beobachtete ich durch die schmutzigen Fenster des Streifenwagens die Qualle mit der Weihnachtsmannmütze und die Kassiererin, die, eifrig gestikulierend, erste Interviews gaben. Von diesem Augenblick würden sie wahrscheinlich bis ans Ende ihres erbärmlichen Lebens zehren.
* * *
Innerhalb von vierundzwanzig Stunden hatte sich mein Leben in einen einzigen Alptraum verwandelt. Die Polizisten aus Illinois behandelten mich ohne ersichtlichen Grund wie eine gemeingefährliche Schwerverbrecherin. Sie hatten meinen Rucksack durchwühlt, und als ich bei einem kurzen Tankstopp zur Toilette musste, zwangen sie mich, bei offener Tür zu pinkeln, danach legten sie mir sofort wieder die Handschellen an. Keine meiner Fragen wurde beantwortet, ich wusste nicht, wohin sie mich brachten und was mit meinem Auto und den Kisten im Kofferraum des Honda passierte, in denen sich meine gesamte persönlichen Habe, die Noten und Texte meiner Lieder und die beiden letzten Rock my life-CDs befanden.
Schon vor drei Jahren war mein Vertrauen in die Polizei schwer erschüttert worden, als ich mich plötzlich der Willkür von Sheriff Benton ausgeliefert gesehen hatte, doch nun wurden aus Freunden und Helfern endgültig Feinde. Als Esra heute Morgen um sich geschossen hatte, war ich fünfhundert Meilen von der Willow Creek entfernt in einem Motel gewesen und hatte geschlafen. Ich hatte gegen kein einziges Gesetz verstoßen und fand keine vernünftige Erklärung dafür, dass die Polizisten so grob mit mir umsprangen. Zum ersten Mal seit langer Zeit dachte ich wieder an Jerry Brannigan, den ersten Jungen, in den ich jemals verliebt gewesen war. Er hatte Fairfield damals verlassen müssen, weil der Sheriff ihm das Leben schwergemacht hatte, und das nur deshalb, weil er Jerrys Vater nicht hatte leiden können. Und dann kamen mir wieder Horatios Worte in den Sinn: Deine Mutter muss dem Sheriff und den Detectives aus Lincoln erzählt haben, du und ich, wir hätten Esra in eine Falle gelockt und versucht, ihn am Paradise Cove zu ertränken, weil er uns auf die Schliche gekommen sei! War diese Lüge von Tante Rachel der Grund, weshalb ich jetzt in diesem Streifenwagen saß, der Richtung Westen brauste? Wollte man mir einen Mordversuch an meinem Bruder anhängen, oder hatte ich mich strafbar gemacht, weil ich Horatio zum Ehebruch verführt hatte?
Bitte ruf mich nicht mehr an. Bitte ruf mich nicht mehr an. Bitte ruf mich nicht mehr an. Horatios Worte wiederholten sich in einer Endlosschleife in meinem Kopf, und ihre Bedeutung, die mir erst ganz allmählich klarwurde, verdrängte die Angst. Ich hatte Fairfield nicht zuletzt deshalb verlassen, weil ich wusste, dass unsere Liebe keine Zukunft hatte und es für Horatio schlimme Folgen haben würde, wenn jemand von uns erfuhr, schließlich war ich noch minderjährig. Und jemand hatte davon erfahren, nämlich Esra, der uns am Paradise Cove im Auto beobachtet und sogar fotografiert hatte. Wie ein Film lief die Szene, als ich Esra durch die beschlagene Fensterscheibe von Horatios Auto bemerkt hatte, vor meinem inneren Auge ab. Ich hörte mich selbst flüstern, erstarrt vor Schreck und voller Angst vor einer Entdeckung, aber Horatio hatte nur ganz ruhig »Dann soll es so sein« geantwortet. Dann soll es so sein! In meinen Ohren hatte das so geklungen, als würde es ihm nichts ausmachen, wenn jemand von uns erfuhr, ja, als ob ich ihm wirklich etwas bedeuten würde – mehr als seine Frau und seine Familie! Er liebte mich, das glaubte ich mit Bestimmtheit zu wissen, denn er hatte es mir in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt. Also hatte ich in meiner Verwirrung seine letzten Worte am Telefon vielleicht falsch interpretiert! Vor Erleichterung wurde mir ganz flau. Horatio wollte mich nur schützen! Die Polizei war schon bei ihm gewesen, möglicherweise hörte man sein Telefon ab, und Horatio wollte einfach verhindern, dass man mich auf diese Weise ausfindig machte.
Meine Angst ließ etwas nach. Ich schloss die Augen und rief mir die vielen wunderbaren Stunden in Erinnerung, die wir geteilt hatten: unsere zufällige Begegnung am Paradise Cove, als ich Horatio beim Angeln überrascht hatte, unser erster Kuss in der Kirche, das erste Mal, dass wir miteinander geschlafen hatten. Ich vertraute ihm, und er vertraute mir. Er hatte mir so viele Dinge von sich erzählt, vom Tod seiner ersten Frau, von seinen Zweifeln, Ängsten und Sorgen – das hätte er niemals getan, wenn er mich nicht lieben würde! Nicht einmal als ich ihm von den schlimmen Dingen erzählt hatte, die ich getan hatte und die mir widerfahren waren, hatte Horatio sich von mir abgewendet, ganz im Gegenteil! Er hatte mich in seine Arme genommen und mir den Trost gespendet, den ich so dringend gebraucht hatte. Nein, ich zweifelte nicht an seiner Liebe. Er hatte es eben am Telefon nur gut gemeint, hatte mir helfen wollen und mir eine Antwort gegeben, weil ich ihn um Rat gebeten hatte.
Aber wieso rät er dir, dass du verschwinden sollst?, flüsterte eine hartnäckige Stimme in meinem Kopf. Du hast doch überhaupt nichts getan! Du bist unschuldig, warst fünfhundert Meilen entfernt, als das passiert ist!
Vielleicht weiß Horatio mehr, als er mir sagen konnte, widersprach ich der Stimme. Ja, ganz sicher tut er das. Er will das Beste für mich.
Und plötzlich war ich fast sogar ein bisschen froh, dass ich nicht mehr nach New York unterwegs war, sondern wieder auf dem Weg in Richtung Westen. Dahin, wo Horatio war. Der Mann, den ich über alles liebte.
Am späten Nachmittag erreichten wir Davenport. Die Interstate 80 führte quer durch die Stadt, und auf der anderen Seite des Mississippi wartete auf einem Parkplatz eine Abordnung der Polizei von Iowa. Im grauen Zwielicht der Abenddämmerung wurde ich aus dem Streifenwagen gezerrt, man nahm mir die Handschellen ab, und ich hatte kurz die Gelegenheit, mir die schmerzenden Handgelenke zu reiben, bevor die Handschellen des Staates Iowa zuschnappten. Die eisige Luft roch metallisch, der Himmel zeigte am Horizont einen bedrohlichen schwefelgelben Streifen. Ein Schneesturm zog auf, vielleicht sogar ein Blizzard.
Ich atmete ein paar Mal tief durch, denn ich fürchtete, dass der nächste Streifenwagen genauso riechen würde wie der, in dem man mich hierhergebracht hatte: nach altem Schweiß, nach Essen, Fürzen und Angst. Einer der Cops, ein massiver Fettkloß, dessen Doppelkinn direkt in bullige Schultern überging, stieß mich auf den Rücksitz des Autos, und ich zog schnell meinen Kopf weg, bevor er mit seiner fleischigen Hand mein Haar berühren konnte.
»Wir fahren direkt in einen Schneesturm rein«, warnte ich ihn, aber er schleuderte mir nur kommentarlos meinen Rucksack in den Schoß und knallte die Tür zu.
Meine neuen Bewacher entpuppten sich als Abziehbilder ihrer Kollegen aus Illinois: genauso grimmig, schnauzbärtig und feindselig. Wie ich es prophezeit hatte, begann es ungefähr dreißig Meilen hinter Davenport heftig zu schneien, und wir kamen bald nur noch im Schneckentempo vorwärts. Durch die Windschutzscheibe waren im Scheinwerferlicht nichts als wirbelnde Schneeflocken zu sehen, die Scheibenwischer bewältigten die Schneemassen kaum noch, und die Laune der Cops wurde noch etwas schlechter. Der Wagen schlingerte und rutschte, dann blieb er stehen. Der Halslose stieg fluchend aus, sein Kollege schaltete das Blinklicht auf dem Dach ein und sprach irgendetwas in sein Funkgerät. Ich hörte, wie der Kofferraum geöffnet und wieder geschlossen wurde. Vor den Fenstern war nichts zu erkennen außer Schnee und Dunkelheit. Nach einer Weile kehrte Cop Halslos zurück und warf seine nasse Jacke neben mich auf die Rücksitzbank, dann ließ er sich in den Vordersitz plumpsen und klemmte dabei meine Knie ein. Das Auto setzte sich wieder in Bewegung, Schneeketten rasselten. Es war sieben Uhr abends. Falls die beiden tatsächlich vorhatten, bis nach Fairfield zu fahren, so lagen noch ungefähr dreihundertsechzig Meilen vor uns. Bei diesen Straßenverhältnissen würde das bis morgen früh dauern. Im Auto war es warm, und mir fielen plötzlich die Augen zu. Ich schob die Jacke des Cops in den Fußraum, zog die Beine hoch, bettete meinen Kopf auf den Rucksack und schlief ein.
Riverview Cottage,
Nebraska
»Wenn hier alles für Sie und Ihre Leute in Ordnung ist, dann würde ich jetzt gehen«, sagte die Frau, deren Anwesenheit Blystone beinahe schon vergessen hatte, mit leiser Stimme. Sie hatte reglos in der Ecke des Raumes neben der Tür gestanden und stumm dem hektischen, wenn auch wohlorganisierten Durcheinander zugesehen, mit dem die Leute vom Kriminallabor und Blystones Mitarbeiter aus Lincoln das Häuschen in eine provisorische Einsatzzentrale verwandelt hatten: Telefone und Faxgeräte waren installiert worden, man hatte Whiteboards, Schreibtische und Computer aus den Trucks ausgeladen und ins Haus geschleppt. Blystone hatte schnell erkannt, dass er so bald nicht nach Hause zurückkehren würde, und sich deshalb nach einem Hotel in Fairfield erkundigt. Mary-Jane Walker, die Frau des indianischen Farmarbeiters John White Horse, der Esra Grant erschossen und damit das Gemetzel beendet hatte, hatte ihm zu seiner Verwunderung stattdessen dieses Häuschen angeboten, das sich nur zwei Meilen von der Farm entfernt befand und leer stand. Riverview Cottage bot Platz für ein Behelfsbüro und einen Besprechungsraum, und im Obergeschoss gab es zwei Zimmer und ein Bad, so dass Blystone hier übernachten konnte und nicht in das Motel am Highway oder ins 23 Meilen entfernte Madison fahren musste wie seine Leute.
»Oh, Mrs Walker, entschuldigen Sie bitte«, sagte er. »Wie unhöflich von mir, Sie einfach hier stehenzulassen. Es ist alles perfekt. Vielen Dank, dass Sie uns das Haus zur Verfügung stellen.«
Er lächelte freundlich und glaubte, dass sie nun gehen werde, aber das tat sie nicht. Ihr Blick ruhte unverwandt auf seinem Gesicht.
»Wollen Sie mir noch etwas sagen?«, erkundigte er sich. »Soll einer meiner Leute Sie zurück nach Hause fahren?«
»Danke, das ist nicht nötig.« Der ruhige, prüfende Blick brachte tief in seinem Innern eine Saite zum Schwingen, was ihn ein wenig irritierte. »Hier, in diesem Haus, hat vor vielen Jahren alles, was heute zu Ende gegangen ist, seinen Anfang genommen. Sie sind ein guter Mann, Lieutenant, und ich habe das Gefühl, dass man Ihnen vertrauen kann. Sie werden den richtigen Leuten Glauben schenken.«
»Was wollen Sie mir damit sagen, Mrs Walker?« Blystone sah in die tiefschwarzen Augen der alten Frau, in denen er für einen Moment all den Kummer und Schmerz erkennen konnte, den sie in ihrem Leben durchlitten hatte und der sie dennoch nicht hatte bitter werden lassen. Mary-Jane Walker strahlte natürliche Würde und innerliche Gelassenheit aus, die Blystone beeindruckte. Als junges Mädchen musste sie außergewöhnlich schön gewesen sein, und obwohl das Alter seine Spuren in ihrem ebenmäßigen Gesicht hinterlassen hatte, waren die Jahre gnädig mit ihr gewesen.
»Dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint«, antwortete sie. »Sheridan ist ein gutes Mädchen. Aber das werden Sie selbst merken, wenn Sie morgen mit ihr sprechen.«
»Woher wissen Sie, dass sie hierherkommen wird?«, fragte er überrascht.
»Ich weiß es eben. Ich weiß oft mehr als andere Menschen«, erwiderte Mary-Jane Walker achselzuckend, als sei so etwas völlig normal, und Blystone fiel ein, dass sie eine Sioux vom Stamm der Oglala war, die sich Lakota nannten. Er selbst hatte bisher nur selten mit den Nachfahren der Ureinwohner, deren Anteil an der Bevölkerung Nebraskas nur knapp 10 Prozent ausmachte, zu tun gehabt. Doch ein älterer Kollege, der dreißig Jahre lang in South Dakota gearbeitet hatte, erzählte des Öfteren von seltsamen Erlebnissen mit den Leuten aus der Yankton Sioux Reservation. Blystone und seine jüngeren Kollegen hatten seine Geschichten von Geistern, Träumen und Flüchen bisher für überspannte Indianermärchen gehalten, aber in diesem Moment war ihm ganz und gar nicht nach Lachen zumute.
Mrs Walker lächelte nur angesichts seiner Verblüffung.
»Guten Abend, Lieutenant«, sagte sie und verschwand, bevor er noch etwas sagen konnte. Jordan Blystone trat an das Fenster und beobachtete, wie die alte Frau leichtfüßig den tief verschneiten Hof überquerte. Im nächsten Moment verschluckte die Dunkelheit zwischen den Bäumen ihre schmale Gestalt.
»Seltsam«, murmelte er und wandte sich kopfschüttelnd wieder den Unterlagen auf seinem Tisch zu. Im Nachbarraum klingelten die Telefone, er hörte die vertrauten Stimmen seiner Leute und das Klappern von Computertastaturen, roch frisch aufgebrühten Kaffee. Alles schien wie immer bei einer Außenermittlung, und dennoch fühlte es sich plötzlich anders an, ohne dass er hätte sagen können, weshalb.
»Boss?« Es klopfte an der offen stehenden Tür des Zimmers, das Blystone für die Dauer der Ermittlungen zu seinem Büro gemacht hatte, und Detective Sergeant Greg Holdsworth erschien im Türrahmen. Aufgeregt wedelte er mit einem Blatt. »Gerade kam ein Fax von den Kollegen aus Illinois. Die State Troopers haben das Mädchen an einer Tankstelle in der Nähe von Joliet, Illinois, aufgegriffen und festgenommen.«
»Nicht zu fassen.« Blystone streckte die Hand aus und überflog die Faxnachricht.