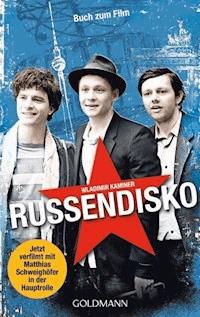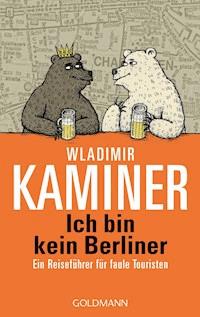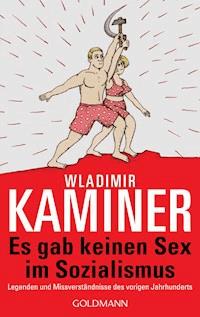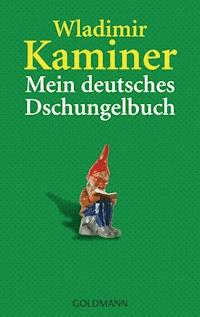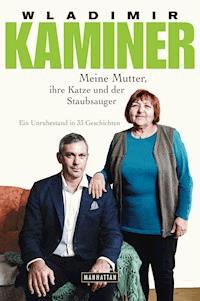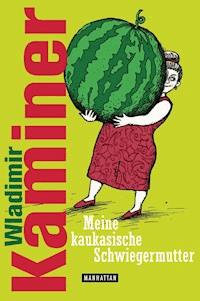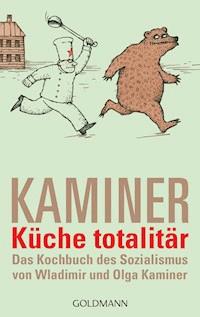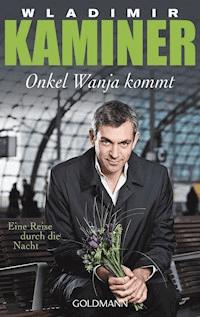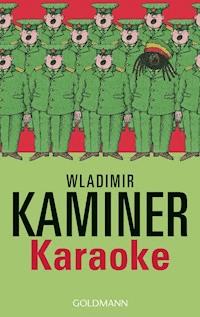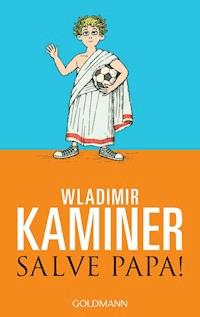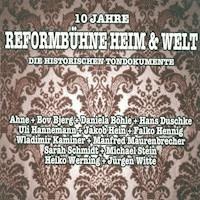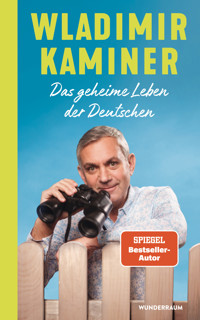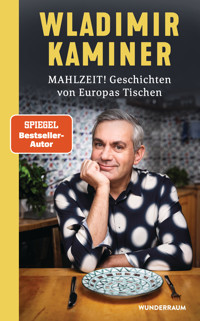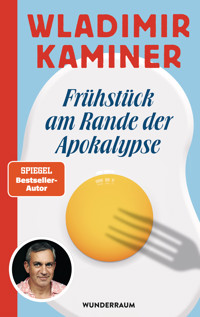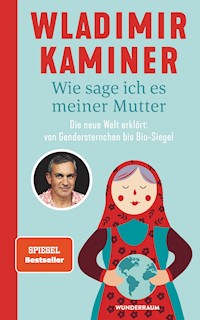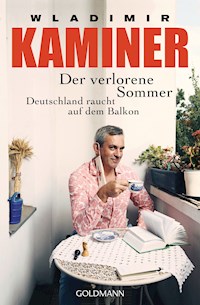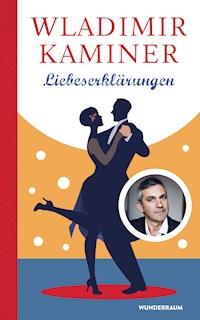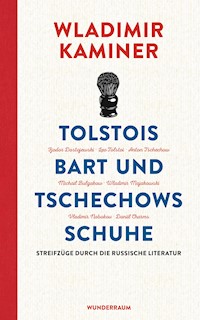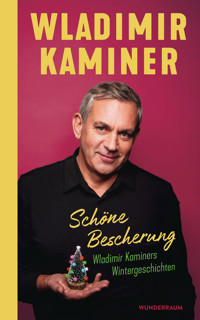
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wintergeschichten mit Herz und Humor – mit drei bisher unveröffentlichten Geschichten!
Wie könnte man die kalte Jahreszeit besser genießen als mit herzerwärmenden Geschichten von Wladimir Kaminer! Sie reichen von Begegnungen mit dem Kremlweihnachtsmann über die russische Variante eines Stollenrezepts bis zu den Verwandtschaftsbeziehungen von Nikolaus und Väterchen Frost. Außerdem geht es um 57 Haselnüsse für Aschenbrödel, die Rettung des Christkinds, Schwanensee, Wintersport und vieles mehr. Dieser Band versammelt Wladimir Kaminers schönste Erzählungen rund um den Winter – das perfekte Mittel gegen kurze Tage und lange Nächte weit über Weihnachten und Silvester hinaus ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Der Winter kann kommen! Und wie könnte man ihn besser genießen als mit herzerwärmenden Geschichten von Wladimir Kaminer. Hier sind seine schönsten Erzählungen rund um die kalte Jahreszeit versammelt und um einige neue ergänzt. Sie reichen von Begegnungen mit dem Kremlweihnachtsmann über die russische Variante eines Stollenrezepts bis zu den Verwandtschaftsbeziehungen von Nikolaus und Väterchen Frost. Außerdem geht es um 57 Haselnüsse für Aschenbrödel, die Rettung des Christkinds, Schwanensee, Wintersport und vieles mehr. Mit Humor und Augenzwinkern beschert uns Wladimir Kaminer das perfekte Mittel gegen kurze Tage und lange Nächte – weit über Weihnachten und Silvester hinaus …
Quellenhinweise zu den Geschichten, die bereits in früheren Publikationen erschienen sind, finden Sie am Ende des Buches.
Autor
Weitere Informationen zu Wladimir Kaminer sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches sowie unter www.wladimirkaminer.de.
Wladimir Kaminers Wintergeschichten
Inhalt
Der Weihnachtsbaum aus Berlins Kifferwald
Was taugen junge Weihnachtsmänner von heute gegen das alte Väterchen Frost?
Stirb langsam
Deutscher Stollen russischer Prägung
Überstunden in Berlin
Der Kremlweihnachtsmann
Der Schneeberg
Mein Vater als Geschäftsmann
Stille Weihnacht
Freche Früchtchen unterwegs
Russische Weihnacht
90 Sekunden vor dem Weltuntergang – Tschaikowsky
Sankt Martin
Wie Russen Weihnachten feiern
Menschen unter Tannenbäumen
Das Christkind retten
57 Haselnüsse für Aschenbrödel
Wintersport
Unser Schwanensee
Ewiges Weihnachten
Quellenhinweise
Der Weihnachtsbaum aus Berlins Kifferwald
Im sowjetischen Sozialismus erzogen und später nach Deutschland übergesiedelt, konnten wir nicht wirklich etwas mit dem Weihnachtsfest in Berlin anfangen. Wir stellten zwar immer einen Weihnachtsbaum in die Wohnung, wobei mein Sohn Sebastian jedes Jahr penibel darauf achtete, dass der Baum größer und höher war, als er sein sollte. Und wir veranstalteten jedes Jahr in der Volksbühne eine Russendisko, damit alle Berlinerinnen und Berliner, die keine Lust auf Entenessen hatten und Ende Dezember nicht zu ihren Familien nach Bielefeld oder Mannheim gefahren waren, einen Ort zum Tanzen hatten. Als Russland über die Ukraine herfiel, überlegte sich die Leitung der Volksbühne, den Titel unserer Veranstaltung zu ändern. Das Feuer des Krieges warf einen mächtigen Schatten auf alles Russische, das R-Wort bekam auf einmal eine merkwürdige Doppelbedeutung. Russendisko? Die Russen fuhren mit ihren Panzern ins Nachbarland, töten dort Menschen und zerschossen ukrainische Städte zu Staub, in ihrer Freizeit aber tanzten sie auch noch.
»Wie können wir deine Party umbenennen?«, fragte mich die Theaterleitung.
»Nennt sie von mir aus ›Ukrainedisko‹«, antwortete ich. Wir hatten sowieso schon immer viel ukrainische Musik im Programm. Doch für eine Ukrainedisko verkaufte das Theater nicht genug Karten. Niemand wusste, was das sein sollte, alle kannten nur die Russendisko. Also beschlossen wir, gar keine Disko zu veranstalten und ausnahmsweise Weihnachten auf Deutsch zu feiern. Zu diesem Zweck fragte ich in meinem Freundeskreis, was eigentlich der Sinn und Zweck dieses Festes war. Was machte man den ganzen Abend, außer Ente zu essen?
Der Sinn und Zweck des Festes sei es, einander zu beschenken, die Geschenke auszupacken und mit ihnen anzugeben, klärte mich mein Freund Markus auf: »Wir sind eine fünfköpfige Familie und geben uns Mühe, dass zu Weihnachten jeder mindestens zehn gut verpackte Geschenke bekommt. Dann dauert allein das Auspacken schon den halben Tag«, erzählte er. »Dabei versucht man, für jeden etwas Überraschendes zu finden, was der Beschenkte nicht unbedingt braucht. Auf diese Weise sind die Familienmitglieder den Rest der Zeit damit beschäftigt, Geschenke, mit denen sie nichts anfangen können, gegen passendere zu tauschen.«
Mir gefiel dieses Konzept. Auch wir waren eine fünfköpfige Familie, und keiner von uns wusste, was er wirklich brauchte, außer Sebastian, der alles brauchte. Aber schon bald geriet ich ins Grübeln. Woher die Geschenke nehmen? Bei uns wurden sämtliche Familienmitglieder auch während des Jahres dauernd beschenkt, als würde in Berlin ein unsichtbarer Weihnachtsmann die ganze Zeit durch die Gegend laufen und ständig an unsere Tür klopfen. Oft mit überraschenden Gaben im Gepäck. Über Berlin sagt man, es sei eine Stadt im Wandel, manchmal fliegen hier Geschenke durch die Gegend, deren wahre Natur man erst später erkennt.
In unserem speziellen Fall hatte das Geschenk mit dem Wind der Veränderung zu tun, der permanent in Berlin weht. Vielleicht sind Menschen hier auch seinetwegen so oft erkältet, weil sie permanent und schutzlos dem Wind der Veränderung ausgesetzt sind. Was waren wir hier nicht schon alles: »arm, aber sexy«, »Partystadt«, »Dönerhochburg« und »Kiffer-Metropole«. Berlin hört auf viele Namen, und die Bürger passen sich an. Zuerst meckern sie natürlich – »Was soll das mit dem ›arm und sexy‹! ›Reich und sexy‹ ginge doch auch. Und wozu diese Partys? Da gehen doch sowieso hauptsächlich Touristen hin. Die Döner sind viel zu teuer, und kiffen brauchst du in Berlin gar nicht. Du musst nur auf die Straße gehen und einmal tief einatmen, dann hast du schon den Kick.« Aber die Berliner meckern immer. Der Wandel ist unaufhaltsam, der Wind weht.
Eines Tages im Frühling wehte der Wind der Veränderung uns eine neue Pflanze auf den Balkon. Etwas Seltsames hob sich zwischen Mamas Geranien in die Höhe und drückte sie mit einer solchen Selbstverständlichkeit zur Seite, als wollte die Pflanze sagen: »Hallöchen, da bin ich!« Sie kam uns in der Tat bekannt vor. Mein Sohn studierte das Gewächs aufmerksam, und der Form der Blätter nach zu urteilen, war es eine Cannabispflanze. Wir gaben ihr den russischen Namen Marihuana Ivanna. Mein Sohn, der sich nie groß für die Pflanzenwelt interessiert hatte und auch zu Menschen und Tieren eine eher kritische Haltung einnahm, entwickelte auf einmal eine unglaublich innige Beziehung zu der Pflanze. Er kaufte ihr extra einen Topf, düngte die Erde, kam jeden Tag zwei Mal zum Gießen und unterzog sie einer Wurzelbehandlung. Noch nie hatte ich Sebastian dermaßen an einem anderen Wesen interessiert gesehen. Er las im Internet jede Menge Texte, besorgte sich Ratgeber über den richtigen Umgang mit Cannabis, schnitt Marihuana Ivannas überflüssige Triebe und tränkte ihre Blätter mit einem vitaminreichen Stoff, den er extra im Internet bestellt hatte. Es war eine Liebe auf Gegenseitigkeit. Die Pflanze wuchs wie verrückt und verwandelte sich langsam in einen Baum. Bald war ihr auch der neue Topf zu klein, und Sebastian kaufte den größten, den er finden konnte. Im Herbst war Marihuana Ivanna schon einen Kopf größer als mein Sohn. Sie sah supergut aus. Sebastian blühte auf. Wir wunderten uns nicht schlecht über seinen Wandel. War das die Liebe? Er hatte zwar schon ab und zu eine Freundin gehabt, doch zu keiner hatte mein Sohn jemals eine solch innige Beziehung voller Zärtlichkeit und Verständnis entwickelt.
Mitte Oktober sollte Marihuana Ivanna dann Blüten bilden, es passierte aber nichts. Sebastian machte sich Sorgen. In seiner Verzweiflung lud er einen Cannabis-Experten zu uns auf den Balkon ein. Der untersuchte unsere Marihuana Ivanna eingehend und erklärte dann, sie sei ein Männchen. Für meinen Sohn war das ein harter Schlag. Verständlich. Wie fühlte sich jemand, der ein halbes Jahr bemüht war, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen, etwas Ernsthaftes mit weitreichenden Zukunftsplänen, um dann plötzlich festzustellen, dass die Angebetete ein Männchen war. Mich erinnerte diese Situation an den Film Manche mögen’s heiß, wo die Braut ihrem Hals über Kopf verliebten Freund am Ende offenbart: »Ich bin ein Mann.« Was sagt man dazu? Nobody is perfect, wie der Freund im Film. Sebastian ließ sich nichts anmerken, und wir haben auch keine Witze über unseren Sohn gemacht. Wir wollten seine Gefühle nicht verletzen.
»Nichts für ungut«, sagte Sebastian. »Dafür haben wir jetzt einen eigenen Weihnachtsbaum.«
Doch in seinen Augen sah ich, die Liebe war erloschen.
Was taugen junge Weihnachtsmänner von heute gegen das alte Väterchen Frost?
Ob Väterchen Frost und der Weihnachtsmann verwandt beziehungsweise zwei unterschiedliche Leute seien, fragten mich meine Kinder neulich. Auf diese Frage hatte ich keine einfache Antwort parat. Soweit ich mich erinnern konnte, war das Väterchen – oder auf gut Russisch »Opa Frost« – trinkfester als sein europäischer Kollege. In der Sowjetunion schaute er zusammen mit seiner Freundin Schneeflöckchen einmal im Jahr bei uns vorbei, nämlich am Abend des einunddreißigsten Dezembers. Die beiden waren vom Betrieb meines Vaters beauftragt, allen Mitarbeitern, die Kinder hatten, einen Besuch abzustatten und eine Tüte mit Schokolade und anderen Süßigkeiten zu überreichen. Außerdem musste Opa Frost einen auf das Wohl der Familie trinken. Das Schneeflöckchen hatte die Aufgabe, auf Opa Frost aufzupassen, damit er gerade stand und nicht herumtorkelte.
Als Erstes besuchten die beiden die Familie des Direktors, dann seines Stellvertreters, anschließend die des Buchhalters und schließlich die Familie des Leiters der Parteizelle. Mein Vater war als stellvertretender Leiter der Abteilung Planwesen ein ziemlich wichtiger Mann im Betrieb. Unsere Familie stand also auch ganz oben auf der Liste von Opa Frost, auf jeden Fall unter den ersten zwanzig Adressen. Trotzdem konnte er bei uns schon kaum noch sprechen. Wir wohnten im fünften Stock in einem Haus ohne Fahrstuhl, und man hörte Opa Frost schon im Treppenhaus fluchen, wie er mit seinem Sack gegen die eine oder die andere Tür knallte.
»Na, Boris, geht’s noch?«, fragte ihn mein Vater.
Opa Frost hatte eine Plastiknase ohne Nasenlöcher, sein Bart war schräg um den Hals gewickelt, ein Teil davon steckte in seinem Mund.
»Viel Freude für Ihre Familie«, flötete Schneeflöckchen bei ihrer Ankunft.
»Ich glaube, ich muss mich erst mal setzen«, sagte Opa Frost und nahm im Korridor auf unserem Schuhschrank Platz. Das Herumsitzen in der warmen Wohnung tat Opa Frost aber nicht gut. Er sprang auf und rief: »Wo ist das Kind?«
Meine Eltern schoben mich nach vorne.
»Na du, Junge, wie heißt du? Sehr gut, Wladimir. Hier ist etwas zum Knabbern für dich!«
Opa Frost übergab mir eine zerknitterte Tüte aus seinem halb leeren Sack, trank mit meinem Vater im Stehen einen Wodka, rülpste, drehte sich um und lief die Treppe wieder runter. Schneeflöckchen hinter ihm her.
»Nicht so schnell, Boris, ich möchte nicht, dass wir wieder im Krankenhaus landen wie letztes Jahr«, schrie sie.
»Scheiß drauf, die Kinder warten«, röchelte Opa Frost.
Ich hielt ihn damals für einen Beamten, einen weiteren Diener des Staates, der wie die Polizisten auf der Straße oder die Lehrer in der Schule zwar unangenehm, aber unvermeidlich war.
Hier in Europa ist alles viel komplizierter organisiert. Im Dezember sind hier gleich mehrere Männer mit Säcken unterwegs. In Holland zum Beispiel sind es drei: Am fünften Dezember wird der Sinterklaas zusammen mit dem Zwarten Piet, dem Schwarzen Mann, erwartet. Letzterer spielt die Rolle des Schneeflöckchens. Früher mussten sich die holländischen Pieter ihr Gesicht extra mit Ruß einschmieren, um realistisch zu wirken; seitdem sie viele Mitbürger aus Surinam haben, ist das jedoch nicht mehr nötig. Beide kommen laut der Legende aus Madrid, sie sammeln Stroh und Mohrrüben für ihre Rentiere, und der Zwarte Piet wirft den artigen Kindern die Geschenke durch den Kamin. Die unartigen Kinder werden dafür zur Bestrafung nach Madrid verschleppt. Ihre Eltern ziehen dann freiwillig nach. Zu Weihnachten kommt noch der Weihnachtsmann, Santa Claus, der aber in Holland keine Geschenke verteilt und nur so durch die Gegend fliegt, manchmal fährt er den Coca-Cola-Truck.
In Deutschland sind Sankt Nikolaus und Santa Claus fast Klone. Sie haben oft die gleichen Geschenke und sind deswegen im kollektiven Bewusstsein der Kinderbevölkerung zu einer Figur verschmolzen: der des Weihnachtsmannes. In Berlin werden die meisten Weihnachtsmänner von der studentischen Arbeitsvermittlung engagiert. An manchen Dezemberabenden kann man zwei bis drei gleichzeitig in einem U-Bahn-Waggon erwischen, wie sie hin und her durch die Stadt pendeln. Einige rülpsen laut in den Sack. Wenn diese junge Weihnachtsmänner lange genug unterwegs sind, können sie sogar dem alten Opa Frost Paroli bieten.
Stirb langsam
Am späten Heiligen Abend, im Grunde war es bereits die Heilige Nacht, kurz nach Mitternacht, gab das Handy meiner Frau Olga ein kleines Klingeltonkonzert. Sie ging ran, und ihre beste Freundin, ebenfalls eine Olga, schluchzte in den Hörer, ihr Kater sei nach seiner langen Krankheit so etwas wie fast ganz tot.
Olga wohnte in Friedrichshain zusammen mit ihrer Tochter Melanie und einem sehr alten Kater namens Johann Wolfgang. Seinen Namen hatte er wegen der angeblichen Ähnlichkeit mit dem größten deutschen Dichter aller Zeiten bekommen, ich konnte allerdings diese Ähnlichkeit nicht erkennen. Der Kater war die letzten hundert Jahre seines Lebens schwer krank und lag wegen fortschreitender Altersschwäche, Epilepsie und Diabetes permanent im Sterben. Es war jedem schon lange klar, Johann starb, aber er tat es sehr langsam. Er lag nicht einmal richtig im Sterben, sondern wackelte im Sterben von Zimmer zu Zimmer, kippte an jeder Ecke um, rappelte sich hoch, erbrach sich auf den Teppich und machte für Katzen ungewöhnliche Geräusche. Er pfiff, kicherte und grunzte. Zweimal am Tag bekam er von seiner Besitzerin Olga eine Insulinspritze und versuchte dabei, mit letzter Kraft die heilende Hand zu beißen.
Das langsame Sterben von Johann Wolfgang war ein trauriger Anblick und bescherte Olga und ihrer Tochter große seelische Schmerzen. Wie Bruce Willis im gleichnamigen Film inszenierte sich der Kater als Held und wollte in der Öffentlichkeit leiden. Anstatt sich eine dunkle Ecke in der Wohnung zu suchen, das Maul zur Wand zu drehen, dort nach »Mehr Licht!« zu rufen oder bloß ein letztes Mal zu miauen und in Würde die Augen zu schließen, ging Johann Wolfgang auf Olga und ihre Tochter zu, schaute beiden Frauen mit seinen großen dunklen Augen direkt in die Seele, kotzte dabei und pinkelte unter sich. Die Tierärzte, die den Kater jeden Monat untersuchten, verdienten sich dumm und dämlich an ihm.
Am späten Heiligen Abend packte der Tod den Kater aber schließlich am Kragen, berichtete Olga. Plötzlich rannte Johann Wolfgang kreuz und quer durch die ganze Wohnung wie verrückt, versuchte, aufs Fensterbrett zu springen, fiel um, stand auf, ging in die Küche und fiel dort erneut um, mit dem Gesicht in die Schale mit Trockenfutter. Danach stand er nicht wieder auf, atmete aber noch. Olga konnte diesen Anblick nicht ertragen. Dabei konnte sie nicht einmal die diensthabende notärztliche Tierarztpraxis ausfindig machen, die am Heiligen Abend in Berlin geöffnet hatte. Ihr Internetanschluss war ausgefallen. Sie bat also meine Frau um Hilfe. In einer solchen Notsituation kann niemand Nein sagen. Also ermittelte meine Frau den tierärztlichen Notdienst – er befand sich am Ende der Welt, in Marzahn –, nahm sich ein Taxi, fuhr nachts zu ihrer Freundin nach Friedrichshain, lud sie und den Kater in den Wagen, und weiter ging es nach Marzahn.
In der tierärztlichen Praxis herrschte eine frohweihnachtliche Stimmung. Das Wartezimmer war überfüllt mit Tieren, die typische weihnachtsbedingte Unfälle und Verletzungen hatten. Zwei niedliche Kätzchen, die vom Weihnachtsbaum genascht hatten und denen nun große bunte Bündel von Lametta aus den Hintern raushingen. Wenn aber die Besitzerin ihren Kätzchen das Lametta aus dem Arsch ziehen wollte, fingen beide sofort an, elendig zu jodeln. Anscheinend hatte sich das Lametta im Inneren der Katzen um irgendwelche wichtigen Organe gewickelt.
Außer den Katzen gab es Papageien, die sich an Weihnachtskerzen verbrannt hatten, und runde Meerschweinchen, die allem Anschein nach etwas Großes, Flaches und Quadratisches gefressen hatten und nun geröntgt werden mussten. Ich tippte auf Adventskalender. Neben den Meerschweinchen saß ein gut gewachsener Hund mit gebrochenem Bein, der wahrscheinlich in den Tannenbaumhalter getappt war.
Die lange Fahrt nach Marzahn hatte Johann Wolfgang gutgetan. Wie so vielen Patienten ging es auch ihm beim Anblick des Arztes plötzlich besser. Die Tierärztin untersuchte ihn kurz und meinte, es sei alles gar nicht so schlimm, der Zucker spiele ein wenig verrückt, aber mit der richtigen Behandlung, am besten stationär, würde der Kater problemlos noch weitere hundert Jahre schaffen. Die Untersuchung kostete hundertfünfzig Euro, die Medikamente hundertvierzig, und jeder Tag auf der Station zusätzlich fünfzig Euro.
»Können Sie dem Kater nicht vielleicht eine Erlösungsspritze geben?«, erkundigte meine Frau sich unverblümt bei der Ärztin, als ihre beste Freundin einmal kurz mit dem Kater rausgegangen war. »Das Tier zieht das letzte nicht vorhandene Geld aus der Familie und macht mit seinem langsamen Sterben alle Menschen in seiner Umgebung unglücklich, traurig und depressiv. Es ist eine Qual für seine Besitzer und sich selbst geworden