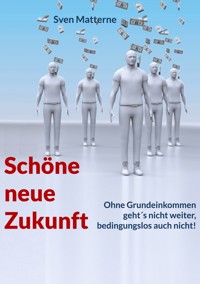
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Drastisch steigender sozialer Unmut ist längst zu einem Aushängeschild der etablierten Parteien geworden. Schleichend entsteht unter dem Deckmantel eines sogenannten "Sozialstaates" etwas ganz Neues, was an die vergangene Feudalzeit erinnert. Altersarmut, Pflegenotstand, unbezahlbare Mieten und Steuergerechtigkeiten. Wie lange soll das noch gutgehen, was Städte und Kommunen längst öffentlich beklagen? Veränderungen sind für viele Deutsche jedoch einfach zu unbequem, weshalb der Status quo einfach aufrechterhalten wird. Interessant - Aufklärend - Visionär. Reisen Sie mit den Autoren durch die Zeit. Von der jüngeren Vergangenheit, in der Missstände unseren Wohlstand bedrohten, in die Gegenwart, in der Sie vermutlich Parallelen zur sozialen Realität erkennen werden, bis in eine entfernte Zukunft und lernen eine ganz neue Form des Sozialstaates kennen. Fachkundige des Instituts für Wirtschaftsforschung meinen: Ein empfehlenswertes Erzähl- und Sachbuch über eine ganz neue Form des Sozialstaates mit vielen Lösungen für bevorstehende finanzielle Probleme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wegen unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt haben sich die Autoren dazu entschlossen, das Buch fast ausschließlich online zu vertreiben, weshalb es immer nur dann gedruckt wird, wenn es auch bestellt wurde.
Folgen Sie uns auf unserer Webseite.www.schoeneneuezukunft.wordpress.com
Inhalt
Vorwort
Teil 1 – Was bisher geschah
Einleitung
Kapitel 1 Warum dieses Buch entstand
Kapitel 2 Immer mehr, immer größer, immer schneller
Kapitel 3 Gefahren für unseren Wohlstand
Aufgeheizte Stimmung
Und plötzlich stand alles still
Alles versinkt im Chaos
Die Welt hält den Atem an
Die Schuldfrage
Kapitel 4 Armes Deutschland
Teil 2 - Im hier und jetzt - Von der Geburt bis zum Tod
Kapitel 5 Das Sozialstaatsversprechen
Kapitel 6 Die Geburt
Kapitel 7 Kinderbetreuung
Die Rolle der Frau im Kapitalismus
Kapitel 8 Familiäre Betreuung
Der Pflegekapitalismus
Kapitel 9 Schule und Bildung
Kapitel 10 Berufsstarter
Kapitel 11 Erwerbsleben mit Hürden
Der Nahrungsmittelkapitalismus
Kapitel 12 Die künftige Rente
Kapitel 13 Der Ruhestand
Der Rentenkapitalismus
Kapitel 14 Wir füttern diesen Vielfraß selbst
Teil 3 – Alles nur eine Fiktion oder bereits Realität?
Kapitel 15 Geldschöpfung statt Wertschöpfung
Kapitel 16 Schillernde neue Ideen
Über Fürsorge und Barmherzigkeit
Die erste Feldversuche und Sozialsysteme
Moderne Schützenhilfe für das Grundeinkommen
Ideologien und Meinungen
Teil 4 - Schöne neue Zukunft
Kapitel 17 Der Sprung in die fiktive Zukunft
Der Schulweg, eine ganz eigene Reise für sich
Schulbeginn mit der Allgemeinlehre
Die soziale Mindestsicherung in der Zukunft
Das Arbeitseinkommen in der Zukunft
Der Solidarismus
Teil 5 – Wegweisend in die Zukunft
Kapitel 18 Von einer Fiktion zur Wahrhaftigkeit
Ein neues Sozialstaatsversprechen
Wertschöpfung gegen den Klassenkampf
Bidirektionale Gerechtigkeit
Kapitel 19 Die einen wollen, die anderen wollen nicht
Kapitel 20 Wohin mit dem ganzen Geld
Kapitel 21 Das Grundeinkommen als sozialökologische Antwort
Danksagung
Autoren-Vita
Anhang
Vorwort
Einsteins Definition von Wahnsinn lautet: "immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten." Daraus folgt, dass der Sozialstaat nicht so bleiben kann wie bisher.
Seit den 2000ern leben wir in der Zeit des Spätkapitalismus. Nach dem Abflauen des Wirtschaftswunders in Deutschland seit den 70er Jahren haben sich Wirtschaftskrisen in immer kürzeren Abständen wiederholt und der Wohlstand wurde durch politische Entscheidungen zerstört. Seit Jahrzehnten tragen neoliberale Denkweisen dazu bei, dass wir unbewusst zu einer neuen und hochmodernen Form des Feudalsystems zurückkehren. Menschen ohne finanzielle Mittel haben es zunehmend schwerer eigenständig zu überleben, was zu einer Reaktivierung von Relikten des Mittelalters wie Suppenküchen führt. Die Mittelschicht verliert ebenso immer mehr Wohlstand, während einige wenige Menschen mittlerweile so viel Vermögen besitzen wie der Großteil der restlichen Weltbevölkerung zusammen.
Es ist paradox, denn der Kapitalismus der Neuzeit hat nach der Feudalzeit mehr Wohlstand und eine längere Lebenserwartung hervorgebracht. Jetzt drohen uns jedoch gleich mehrere gigantische Finanzblasen in Form eines ökonomischen Worst-Case-Szenarios, das die Finanzkrise von 2009 vergleichsweise mild erscheinen lässt. Obwohl wir derzeit nur die Vorboten einer kommenden Armutskrise spüren, welche durch noch größere Herausforderungen wie Klimawandel, demografischer Wandel und Digitalisierung von Arbeit verstärkt wird, hat sich bisher zu wenig verändert. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer.
Ein schönes neues Deutschland mit einem Grundeinkommen kann das wirklich Realität werden? Ohne eine Form des Grundeinkommens geht’s nicht weiter, bedingungslos aber auch nicht. Reisen Sie in unseren Erzählungen von der Vergangenheit über die Gegenwart, in der Sie vermutlich Parallelen zur heutigen Zeit erkennen werden, bis in eine fiktive Zukunft, in der unsere Ansätze ein arbeitsabhängiges Grundeinkommen zu einer sozialökologischen Lösung für alle macht.
Teil 1 Was bisher geschah
„Wenn es den Banken heute schlecht geht oder die Kurse ein bisschen abstürzen, dann schreien alle: "Oh, was für eine Tragödie, was sollen wir jetzt tun?" Wenn aber Menschen und Kinder hungern oder krank sind, dann passiert nichts. Das ist die Krise, die wir heute haben.“
Papst Franziskus
Einleitung
2022 deklarierte die Regierung in Deutschland eine Zeitenwende, welche für viele Menschen jedoch schon weitaus früher begann. Bereits 2005 begann einer der größten Paradigmenwechsel der Nachkriegszeit, nicht bei der Außen- und Sicherheitspolitik für Deutschland, wie es 2022 der Fall war, sondern bei der sozialen Mindestsicherung für die deutsche Bevölkerung, was eine echte Zeitenwende darstellte von der sich viele Politiker mit einer nachfolgenden langjährigen Denkblockade umgarnen ließen. Bis zu den 2000ern galt Deutschland besonders in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als sogenanntes Wirtschaftswunder, wo die soziale Marktwirtschaft für steigenden Wohlstand und gesicherte Vermögensverhältnisse sorgte.
Die Sozialreform Agenda 2010 hingegen, welche durch die Parteien „SPD" und „Die Grünen" eingeführt wurde1, zerbrach im Grunde diese Wohlstandsgesellschaft und brachte von da an ganze Bevölkerungsteile gegeneinander auf. Wobei die SPD damals jene Partei war, welche die Agenda maßgeblich zu verantworten hatte. Der damals entstandene Unmut von Erwerbstätigen gegenüber Sozialhilfe-Empfängern spitzte sich über Jahre hinweg immer weiter zu, wodurch sich linke wie rechte Gruppierungen zunehmend radikalisierten. Im späteren Verlauf der Diskussionskultur muss man die Evolution des Gedankengutes darum sogar so beschreiben, dass es eigentlich keine richtige Mitte mehr gab, sondern nur noch schwarz-weißes Denken in der Sozialpolitik. Menschen wie Florida Rolf2, Verkäufer von Versicherungsverträgen bei Tchibo3oder sogenannte “Ein-Euro-Jobs"4 heizten die Stimmung dabei nur noch weiter auf.
Die Geschwindigkeit dieser Radikalisierung konnte im Grunde durch das Internet noch schneller vorangetrieben, falls nicht sogar erst gelingen, welches die Vernetzung von Gruppierungen und die Verbreitung von Unwahrheiten im Schutze der Anonymität rasend schnell zuließ. Eine Anonymität, deren ausnutzende Täter eine neue europaweite Datenschutzverordnung unverhältnismäßig schützt. Ebenso wie die Agenda-Politik urplötzlich Kapitalisten beflügelte, wodurch nun recht zügig eine unsoziale Marktwirtschaft zum Sinnbild eines neoliberalen Politikstils wurde. Klammheimlich boten müde Sozialreformen und unzureichende Anstrengungen gegenüber dem Osten Deutschlands einen ausreichenden Nährboden für radikales Gedankengut, was eine heimliche Verschiebung der gesamten politischen Landschaft in Deutschland zur Folge hatte.
Die Offenbarung dieser ideologischen Verschiebung manifestierte sich dann mithilfe einer Flüchtlingskrise5 endgültig 2017 durch einen politischen Rechtsruck im Deutschen Bundestag. Die Meinungen über das Fördern und Fordern6 spaltete die Politik und die Bevölkerung dann letztendlich sogar so sehr auf, dass die Politik gezwungen war Abstand von ihren bisherigen Denk- und Handlungsweisen zu nehmen. So kam es 2022 zu einer weiteren Reform, dem Bürgergeld7, dass eigentlich das alte stigmatisierende System Hartz IV überwinden sollte, was nüchtern betrachtet bis heute nie wirklich geschah.
Nun werden Sie sich womöglich gerade sagen, nicht schon wieder eines dieser üblichen Bücher, die über ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Tun wir auch nicht, versprochen. Aktuell und das werden sie vielleicht gerade innerlich selbst erleben, neigt man direkt zu einem schwarz-weißen Denken bei dem Thema Grundeinkommen und man ist entweder sofort dafür oder dagegen. Aus Diskussionen weiß man mittlerweile, dass für die einen gleich der gesamte Staatsapparat abgeschafft werden muss und es für die anderen nichts wirtschaftsfeindlicheres gibt als ein bedingungsloses Grundeinkommen, das BGE. Diese Befürchtung möchten wir Ihnen aber gerne nehmen, da wir von einem arbeitsabhängigen beziehungsweise bedingten Grundeinkommen berichten wollen, was einige, jedoch nicht alle Eigenschaften des BGE imitiert. Unsere Denkweise über eine weitere Evolutionsstufe des Grundeinkommens scheint bis heute für die meisten Menschen noch unbekannt zu sein.
In unserem Buch soll es jedoch nicht wie in anderen, vielleicht bereits bekannteren Büchern von Ulrike Hermann, Raj Patel und Jason W. Moore oder Götz Werner und anderen Vorreitern ausschließlich um Abhandlungen des Kapitalismus oder ein bedingungsloses Grundeinkommen gehen, da unser Buchinhalt nicht homogen ist. Ganz im Gegenteil, wir möchten sogar ab und zu eine kleine Dosis geschichtlicher Hintergründe beimischen, damit man die Gründe für die Einführung eines Grundeinkommens besser nachvollziehen kann. So werden wir also in dem einen oder anderen Kapitel, insbesondere wenn es im zweiten Teil um unsere Sozialsysteme und im dritten Teil um die eigentliche Geschichte des Grundeinkommens geht, auf die Details des Kapitalismus zurückgreifen müssen, um ökonomische oder ökologische Sachverhalte mit unserem Konzept eines Grundeinkommens zu verbinden.
Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie von unserer Idee überzeugen könnten. Selbst wenn nicht, dann leisten wir oder in diesem Fall Sie, einen Beitrag zu einem besseren Deutschland, da Sie aktiv darüber nachdenken, was verbessert werden könnte. Fortschritt entsteht nur durch diese Art von Denkprozessen. Also lassen Sie uns denken, denn die Gedanken sind frei.
Daher soll dieses Buch für uns vor allem zu einer Brücke für Befürworter und Kritiker eines Grundeinkommens werden, welches mithilfe unserer Herangehensweise auch überschritten wird, damit es nach den unzähligen Diskussionen zu einem ersten breiten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsens kommen kann. Recherchen zu dem Thema, die mit den Jahren unserer beruflichen oder politischen Arbeit, dem Lesen von Studien, Teilnahmen an Veranstaltungen zur Armut oder anhand der vielen Diskussionen um die Einführung einer Grundrente und des Bürgergeldes in Deutschland einhergingen.
Allerdings halten wir diese These einer allzu abrupten Einführung für nicht zielführend, weil man dadurch möglicherweise Ängste vor dem Unbekannten forciert. Ängste, die meist zu einer Ablehnung führen, wie wir an den immer noch zu vielen Gegnern eines Grundeinkommens bereits heute schon registrieren. Persönlich glaube ich nach all unseren Recherchen allerdings mittlerweile fest daran, dass ein Grundeinkommen noch in diesem Jahrhundert, wenn nicht sogar schon bis 2040 eingeführt wird.
Sie werden es in diesem Buch auch des Öfteren erleben, dass wir uns den einen oder anderen, etwas eingeschobenen, Kommentar nicht verkneifen können. Und auch längere Erzählungen und Geschichten mit einer etwas anderen Schrift für Sie kenntlich machen. So auch jetzt, wo Walter Benda, mein Co-Autor, plötzlich stöhnte:
„Bis 2040? Ich weiß ja nicht. Aber ich bin ja auch eher der Pessimist von uns beiden!“
Kapitel 1 Warum dieses Buch entstand
Wenn man als junger Autor beginnt ein Buch zu schreiben, dann weiß man noch gar nicht so recht, wo und wie man eigentlich beginnen soll. Deshalb fange ich einfach mal mit dem Grund an, warum dieses Buch überhaupt entstanden ist. Bevor ich in die eigentliche Thematik um soziale Missstände und das Bedürfnis nach einem Grundeinkommen eintauche, möchte ich zunächst über Meinungen, Erfahrungen und Voraussetzungen berichten.
Sicherlich hat der ein oder andere Leser schon einmal von einem Grundeinkommen gehört, sich damit bereits beschäftigt oder gar darüber debattiert. Während heutzutage viele die soziale Absicherung als Normalzustand ansehen, sah es im Mittelalter allerdings noch ganz anders aus, da ein erheblicher Teil der Bevölkerung von Armut betroffen war und mit dem nackten Überleben zu kämpfen hatte. So beschäftigten sich damals meist nur Theologen, Theoretiker und Philosophen mit jenen Themen, die für uns heutzutage nicht mehr allzu weltbewegend sind, was gleich mehrere Ursachen mit sich zieht.
Erstens ist der Wohlstand weiterverbreitet als noch im Mittelalter. Denn die soziale Marktwirtschaft verhalf sehr vielen Menschen in Deutschland zum Wohlstand, bis es nun zu einem sozialen Umbruch in unserer Neuzeit kam. Zweitens beschäftigen sich gegenüber den wenigen Philosophen und Theoretikern des Mittelalters heutzutage viel mehr Menschen mit der sozialen Mindestabsicherung und dem Thema Armut, als es früher der Fall war. Sei es durch eigene Erfahrungen, Erzählungen oder aufgrund des inneren Drangs. Drittens folgten bereits mehrere Generationen in der Nachkriegszeit, welche recht unbekümmert mit sehr viel Wohlstand aufgewachsen sind und nie wirklich Armut, Hunger oder Krieg erlebt haben. Weshalb die meisten heutzutage Mittellosigkeit eher als nebensächlich abstempeln, weil es ihnen selbst sehr gut ergeht. Und viertens, weil es schlichtweg tagein und tagaus durch die Medien läuft und so seit Jahrzehnten eine Art Überreizung der eigenen Sensibilität gegenüber Bedürftigen stattfindet, wodurch Hilfsbedürftigkeit immer weiter verkümmert.
Es ist nicht schlimm, wenn Sie sich noch gar nicht mit diesen ganzen Themen beschäftigt haben, da Sie deswegen womöglich am besten zu diesem Buch passen, weil sie zunächst einmal frei von Vorurteilen sind. Anders sieht es jedoch aus, wenn man sich wie ich konkrete Gedanken darüber macht, wie man zum Beispiel Gegner eines Grundeinkommens davon überzeugen kann, es zu unterstützen oder wie man Neo-Kapitalisten dazu bringen kann, es zu finanzieren. Ich persönlich finde, dass es immer dann zu einem unmöglichen Unterfangen wird, solange man selber noch in bestimmten Ideologien gefangen ist. So unterstelle ich, dass man sich erst dann ganz neuen Denkweisen gegenüber öffnen kann, welche ja schließlich viele unserer gewohnten Gebräuche und Lebensweisen maßregeln würden, wenn man auch dazu bereit ist, genügend gedanklichen Freiraum dafür zu schaffen. Denn für die Einführung eines echten und realen Grundeinkommens wird man meiner Meinung nach mehrere Varianten kombinieren müssen, was weitestgehend nur ideologiefrei geschehen kann.
Soweit die Freiheit von Ideologie selbst kein ideologisches Paradoxon ist, wie jenes von der Alternativlosigkeit, die so oft beschworen wird.
Mit mir und meinem Co-Autor, der das ein oder andere zu diesem Buch beitrug haben sich Charaktere zusammengefunden, die von Beginn an miteinander harmonierten und sich dieser ideologiefreien Denkweise zugewandt haben. Was Walter naturgemäß nicht ganz so sieht und ich direkt mit folgendem Einwand zu spüren bekommen sollte:
„Von wegen! Als sei bei uns immer nur Friede, Freude, Eierkuchen."
Dass wir aber so denken, liegt daran, dass unsere Lebensläufe bis heute sehr reich an schwierigen Erfahrungen waren wobei wir natürlich, wie viele andere auch, verschiedene Schicksalsschläge durchleben mussten. Um sich also gegenüber neuen Denkweisen möglichst weit ideologiefrei öffnen zu können, benötigt man meiner Auffassung nach somit gewisse Grundvoraussetzungen, damit die innerliche Transformation der eigenen Definitionen von Gemeinwohl, Solidarität, Gerechtigkeit, Verzicht und Egoismus dann auch ernsthaft vollzogen werden kann. Dies können Erfahrungen anhand bestimmter Lebensereignisse sein, die man anderen ersparen möchte oder man versucht sie daran teilhaben zu lassen. Des weiteren sind es vielfältige Lebensabschnitte, die man durchlebte, die einem die unterschiedlichsten Lebensbedingungen selber vor Augen führten. Oder es sind die Erfahrungen mit der Politik selbst. Ich persönlich glaube sogar, dass man alle drei Elemente benötigt, bevor man sich wirklich den Denkweisen gegenüber öffnet, die ein anderer als utopisch und als Angriff auf seine Lebensweise empfindet und deswegen alles ablehnt, ja teils verteufelt, was gegen die eigenen Prinzipien verstößt. Was sind also diese Erfahrungen, die wir machten, um bis hierher zu gelangen?
Wir waren bzw. sind immer noch überwiegend als selbstständige erwerbstätig. Beruflich selbstständig zu sein, bringt zwar viele Vorteile, aber auch viele Nachteile mit sich. Jeder Selbstständige, der dieses Buch gerade liest, weiß von welcher finanziellen Höhe er jederzeit auch wieder in die Tiefe fallen kann, in denen ihm größere Hilfen in Deutschland zumindest verwehrt werden. Denn finanziell in Not geratene Selbstständige werden im deutschen Finanz- und Bankensystem größtenteils leider ignoriert, wenn es nicht gerade systemrelevante Berufe sind, also Bänker statt Bäcker und man steht mit seinen Problemen allein da. An dieser Stelle in seinem Leben macht man dann auch mit einer gewissen Amtsbrutalität Bekanntschaft. Entweder beendet man dann die Selbstständigkeit, was durch Angestellte in der Firma jedoch zu einem innerlichen negativen Konflikt führen kann, oder man geht gestärkt aus diesem meist tiefen Tal hervor. Wenn man jedoch auf dem Zenit seines Erfolges steht, wird ein Selbstständiger von Banken nahezu hofiert, das erworbene Kapital und Vermögen doch nur bei ihr und bloß bei keiner anderen Bank anzulegen und zu investieren. Geld, womit Banken dann neues Geld erwirtschaften können. Aber vermutlich haben Sie auch schon Unternehmer kennengelernt, die die Bank hat hängen lassen, als diese deren Hilfe am dringendsten benötigten. Wir haben es am eigenen Leibe erlebt und ja auch überlebt. Anderen erging es schlechter, nicht alle von ihnen haben überlebt, wortwörtlich.
Auch die Zeit ist ein ebenso wertvolles wie auch begrenztes Gut für viele Selbstständige, die sich dabei in zwei Gruppen aufteilen. Wenn man besonders erfolgreich sein möchte, hat man ständig erreichbar zu sein und vorrangig der Firma zur Verfügung zu stehen, worunter größtenteils das Familienleben leidet. Für Einzelselbstständige oder Kleinunternehmern gibt es hingegen eine gewisse Freizügigkeit bei der eigenen Zeiteinteilung. Sicherlich spielen hier auch gewisse Vorteile bei den Sozialversicherungen eine Rolle, was für den Inhalt dieses Buches und für uns allerdings eher nebensächlicher ist. Natürlich waren wir während unseres Erwerbslebens nicht immer nur selbstständig, sondern zwischenzeitlich Arbeitnehmer in einem Betrieb oder einer Firma, was Sicherheit und soziale Absicherung versprach, dafür aber weniger berufliche Freiheit bot.
Und letztendlich blieben auch persönliche Schicksalsschläge nicht aus, welche uns im späteren Lebenslauf allerdings dazu befähigen sollten, vielleicht ein wenig ideologiefreier als der ein oder andere denken zu können. So machten wir mit Todesfällen, Arbeitslosigkeit oder auch der häuslichen Pflege unsere einschlägigen Erfahrungen und zogen unsere Lehren aus den Problemen der jeweiligen Sozialsysteme. Vor allem dann, wenn es um die Beantragung von Pflegeleistungen oder Rentenansprüchen für die Zeit der Pflege von Angehörigen ging. Oder darum, wie viel Freizeit bzw. beruflichen Erfolg man durch die häusliche Pflege verlieren kann. Gegebenheiten, die wir entweder privat erlebten oder in der Versicherungsbranche mit unseren Kunden durchlebten, in der Walter Benda und ich seit vielen Jahren aktiv sind. Dinge, die uns aber auch genau deswegen zunehmend Nachdenklicher über die Sozialsysteme in Deutschland machten.
Und nicht nur das, wie Walter ergänzt: „Ich lebe überwiegend in Lateinamerika und Asien. Das schärft den Blick für Probleme noch einmal deutlich".
Richtig nachdenklich wurde ich allerdings erst, als ich in die Politik ging, um diese sozialen Missstände zum Positiven zu verändern. In der Politik angekommen, agierte ich dann mit vielen Gleichgesinnten bei sozialen Projekten und Veranstaltungen um die Welt zu verändern. Wobei Carsten Bielefeld einer meiner größten Unterstützer innerhalb der SPD war. Er ließ mich gewähren und zeigte mir immer dann den richtigen politischen Weg, wenn ich auf emotionale Abwege geriet. Im späteren politischen Werdegang stieß dann auch Walter Benda dazu, zwar immer nur kurzzeitig, dafür aber immer wieder sehr verlässlich, wenn ich um seine Mitarbeit bat. Mit den Jahren der politischen Arbeit empfand ich dann allerdings die Politik als immer unzuverlässiger. So leben heutige Politiker für mich in einer derart großen Blase aus fehlender Bodenständigkeit und Käuflichkeit, dass ich es nur damit begründen kann, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, Politiker in einer viel zu heilen Welt und mit allzu großem Wohlstand aufgewachsen sind, als dass sie die realen Probleme der Bürger ohne Hilfe von außen wirklich erkennen oder gar bewerten könnten.
Wie sie sicherlich jetzt schon herauslesen können, machte ich also Bekanntschaft mit einer viel zu unwilligen Politik, etwas am Status quo ändern zu wollen. Wodurch ich mich dazu entschloss von der Politik abzulassen, was bei Carsten auf, sagen wir einmal, nicht gerade viel Zustimmung traf. Weshalb ich allerdings letztendlich dieses Buchprojekt ins Leben gerufen habe. Denn durch meine politische Laufbahn weiß ich jetzt, wo ich das Buch schreibe, dass große Teile der politischen Landschaft gegen ein Grundeinkommen sind. Das hängt auch sehr viel mit einer erblindeten Politik und einem sehr frechen Kapitalismus zusammen, was ich in diesem Buch näher erläutern werde. Dennoch bleibt “Macht” eine politische Grundvoraussetzung für mich, um überhaupt etwas verändern zu können. Die Frage lautet nur, ob es Politiker auch wollen?
„Nein, verdammt. Was ich in der Politik sowie in diversen Projekten mehrheitlich erlebt habe, geht auf keine Kuhhaut mehr." Womit Walter bereits mit erhitztem Gemüht lautstark beipflichtet.
Demnach wollen wir mit diesem Buch versuchen, Veränderungen bei jenen Denkweisen herbeizuführen, welche sich mit der sozialen Mindestabsicherung auseinandersetzen, zumindest aber den Diskurs zu eröffnen. Was haben Sie zu verlieren? Ein weiter so geht nicht, denn der bisherige Fortschritt hat uns an den Abgrund geführt, an dessen Rand wir jetzt über die Klippe schauen und uns fragen müssen, ob wir springen oder nicht besser in eine andere Richtung gehen? So sind die Inhalte aus diesem Buch also auch das Ergebnis der zuvor investierten Zeit in die politische Arbeit um das Thema Sozialstaat der Zukunft und einer jahrzehntelangen Berufserfahrung. Nun denke ich aber, dass ich genug über Hintergründe und Beweggründe erzählt habe und möchte mit Ihnen in die eigentliche Thematik des Buches eintauchen, indem ich mit der Globalisierung beginne.
Kapitel 2 Immer mehr, immer größer, immer schneller
Immer mehr Umsatz, immer größere Renditen und immer schnellerer Warenhandel. Mehr, mehr, mehr! Verführerische Anreize, die von der globalisierten Welt selbst geschaffen wurden. Eine Globalisierung, die erst in den letzten einhundert Jahren überwiegend durch den technologischen Fortschritt an Geschwindigkeit zunehmen konnte und so äußerst verheißungsvoll für den Kapitalismus der Neuzeit war. Die Globalisierung sind Waren und Gelder, welche in einem Zusammenspiel von Wirtschaft und Handel weltweit getauscht werden. Dass die Globalisierung immer rasanter voranschritt, ist aber im Grunde unseres technologischen Fortschritts geschuldet. So reist nicht nur die heutige Weltbevölkerung sehr viel agiler als noch vor der Zeit des 2. Weltkriegs, sondern auch Güter werden heutzutage sehr viel rapider bewegt und selbst Geld eilt hastig über tausende Kilometer hinweg von dem einen auf das andere Konto. Die industrielle Revolution war der große Beschleuniger des letzten Jahrtausends, die Industrie 4.0 die Herausforderung der Neuzeit.
Da wäre zum Beispiel die Sache mit dem Fliegen: Während man früher also noch sehr lange für einen Flug über den Atlantik benötigte, hat sich die Flugdauer für dieselbe Route längst um ein Vielfaches verkürzt. Man muss auch sagen, dass es damals eher die Zeit der Abenteurer war, welche recht tollkühn und heldenhaft, aber meist sehr leidenschaftlich, sechzehn Stunden und mehr über den Atlantik flogen. Dennoch startete die
Fluggesellschaft Pan American World Airways am 28. Juni 1939 den weltweit ersten Linienflug von den USA nach Europa, worauf zunächst noch weitere zivile Linienflüge folgten. Diese mussten jedoch wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs solange ausgesetzt werden, bis man sie erst nach dem Krieg wieder fortsetzen konnte. Dann allerdings bereits mithilfe weiterentwickelter Technologien wie der Druckkabine von Boeing, mit der man nur noch zwölf Stunden für den Flug über den Atlantik benötigt. Und so kam es, dass nun immer mehr Menschen fliegen wollten, wodurch die Kosten für einen Flug immer günstiger wurden, weshalb sich die zunehmende Kommerzialisierung des transatlantischen Flugverkehrs letztendlich ab 1950 etablierte.
„Dass wir dafür immer mehr Menschen, wie Sardinen, in eine fliegende Blechbüchse quetschen müssen, ist nur ein Preis, der persönlichen Freiheit, wie es so schön heißt.“, ächzte der Meckerkopf Walter mit seinen 1,90 m Körpergröße von der Seite zu mir rüber.
Durch den darauffolgenden Bau ganzer Flugzeugflotten, mit denen man in kürzester Zeit an jeden Ort der Welt gelangte, ließ sich von nun an auch sehr viel Geld verdienen, als es noch früher der Fall war. Die Lufthansa, die größte Fluggesellschaft Deutschlands, hat zum Beispiel im dritten Quartal 2022 bereits einen Gewinn von rund 10 Mrd. € erwirtschaftet. Heutzutage sind die größten Flugzeuge zum Beispiel ein Airbus A-380, der bis zu 835 Passagiere befördern kann oder militärische Großraumflugzeuge wie die Antonow An-225 „Mrija und die amerikanischen Scaled Composites Model 351 Stratolaunch. Nicht zu vergessen ist hier der
Überschallflieger Concorde, der Flüge über den Atlantik in weniger als vier Stunden bewältigte oder in knapp zweiunddreißig Stunden gleich um die ganze Welt flog. Am 25. Juli 2000 stürzte der legendäre Überschallflieger allerdings in Paris ab, wobei 113 Menschen ums Leben kamen. Mit dem Unglück durch eine kleine technische Panne verging auch ein Mythos darum, da Flüge mit ihr eingestellt wurden.
Hier kommen mir gerade, wo ich diese Zeilen schreibe, wieder Bilder in den Sinn, die den Absturz im Fernsehen zeigten. Abends in den Nachrichten sah man das Heck der Concorde deutlich brennen, was wohl in direkter Nähe mit einer Kamera aufgenommen wurde. Danach sah man noch wie die Maschine am Boden zerschellte und das Kurzvideo war beendet. Heute würde vermutlich jemand, nein sehr viele sogar, einfach ein Reel oder eine Story dazu machen. Die Schattenseite unserer immer schnelleren Welt.
Oder diese Sache mit den Containerschiffen: Der technologische Fortschritt des letzten Jahrhunderts brachte nicht nur Flugzeuge der Superlative hervor, sondern auch Schiffe. Durch immer bessere und leistungsfähigere Schiffsantriebe konnten nun immer mehr Waren oder Passagiere befördert werden und das binnen kürzester Zeit. Spitzenreiter bei dem Bau von Superfrachtern sind heutzutage chinesische Werften, die zum Beispiel die Ever A Lot entwarfen. Dieser weltweit bis dato unübertroffene Frachter ist über 400 Meter lang, 61 Meter breit und transportiert bis zu 24.000 TEU (Twenty-Foot Equivalent Units). Damit sie sich das einmal besser vorstellen können, sind das rund 24.000 Container auf einem Schiff mit einer Höhe von ca. 6m, die während einer einzigen Überfahrt transportiert werden können. Das Schwesterschiff, die Ever Given, kennen Sie vielleicht sogar noch aus den Medien. Auch sie wurde von einer chinesischen Rederei gefertigt, sie gehört aber der Leasingfirma Shoei Kisen Kaisha, einem Tochterunternehmen der größten japanischen Werft Imabari Shipbuilding und transportiert ca. 20.000 Container pro Fahrt.
Wie bitte? Sie kennen die Kurzgeschichte der Ever Given nicht? Sie legte am 7. März 2021 im Hafen von Shenzhen in China ab und fuhr nach einem Zwischenstopp in Malaysia in Richtung Rotterdam in den Niederlanden weiter. Anfang April 2021 sollte sie in Hamburg anlaufen, was jedoch nie geschah. Denn diese Tour wurde durch die Havarie der Ever Given am 23. März 2021 im Suezkanal durchkreuzt, da der Superfrachter wegen eines Sandsturmes auf Grund lief. Mein Co-Autor Walter Benda berichtete direkt in einer unserer Buchrunden darüber:
„Ein Ever Green zum Thema weltweite Wirtschaftsverflechtungen? Leider ja. Ich reise viel in der Welt herum, daher warte ich auch viel in Flughäfen oder Häfen. Das Warten macht allerdings mit Musik mehr Spaß. Mein treuer Sony Walkman, der nichts mit dem Kassettenmonster aus den Achtzigern gemein hat, hat mir lange treue Dienste geleistet. Leider ging er kaputt. Ersatz musste her. Und woher kann man Technik-Schrott besser beziehen als im Ursprung in Asien. Kurz auf Alibaba.com1 gesucht, das gewünschte Modell gefunden und das dreiste beinahe Plagiat gekauft. Natürlich nur auf Rechnung, weil der Zoll solche Geräte gerne abfängt und die
Plagiate vernichtet. Zurecht in meinen Augen. Auf alles andere wird Einfuhrumsatzsteuer gezahlt. 17,5% seinerzeit. Rechnen tut sich das trotzdem. Üblicherweise brauchen solche Geräte zwei bis vier Wochen, bis sie über die chinesische oder schwedische Post geliefert werden. Die Schweinereien in diesem Zusammenhang kann der geneigte Leser online recherchieren. Aber nach sechs Wochen wurde ich doch ungeduldig, fragte beim Händler nach und bekam den Sendebeleg samt Information, dass sich der Klimperkasten leider in einem Container befand, der in einem berüchtigten Kanal auf einem berüchtigten Schiff feststeckte. Immerhin zehn Wochen später als geplant kam das Ding trotzdem bei mir an. Lieber spät als nie, oder nicht?
Was für mich als kleiner Endverbraucher nur eine Unannehmlichkeit darstellt, ist global betrachtet ein riesiges Problem. Wenn Lieferketten zerbrechen, Produktionen ins Stocken geraten und ganze Industrien lahmgelegt werden, gehen im Zweifel fragwürdige Regime den Bach runter, was man noch bedingt bejubeln könnte, oder eigentlich solide Volkswirtschaften geraten ins Straucheln und reißen eine ganze Union mit. Nicht schön, aber auch nur bedingt zu ändern. Solange wir den günstigsten Bezug um jeden Preis wünschen, indem wir uns durch unzureichende Gesetze die Sklavenarbeit in Südost-Asien schützen, so lange schaffen wir diese Abhängigkeiten, wo ein Husten zu einer weltweiten finanziellen Lungenentzündung führen kann.
Nicht jeder Verbraucher kann oder will sich die Ware vor Ort leisten. Ist ja auch zu verlockend, für das gleiche Geld woanders die doppelte, dreifache oder gar vierfache Menge Waren zu erhalten. Und wenn nun wieder ein Schiff quer liegt, ein Despot den Kanal bewusst blockiert, Piraten die Lieferketten stören oder die neue Seidenstraße von ihrem Patron politideologisch als Wirtschaftswaffe eingesetzt wird, was dann? Weder können wir noch sollten wir auf den weltweiten Handel verzichten. Aber Lieferketten und Versorgung als störungsfreien Normalzustand zu betrachten, ist eine Naivität, die spätestens seit der Ever-Green kein Dauergrün mehr sein sollte." Keinesfalls wollen wir Sie zu Verschwörungstheorien auffordern!
Dennoch sollten Sie sich fragen, ob der aktuelle Normalzustand normal ist. Was, wenn er sich ändert? Was dann? Was ist normal und wollen Sie diesen Zustand dann?“
Der Suezkanal auf der Grenze zwischen Afrika und Asien hat durch den damaligen Bau der ägyptischen Regierung den Welthandel verändert. Durch seine Eröffnung 1869 konnten Schiffe den Weg zwischen Nordatlantik und Indischem Ozean deutlich schneller zurücklegen, da sie nicht mehr die Route um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas nehmen mussten. Womit die Streckenersparnis zwischen Europa und Asien bei rund 7.000 Kilometern liegt. Der Suezkanal gehört neben dem Panamakanal und dem Nordostseekanal zu den wichtigsten künstlichen Wasserstraßen im internationalen Frachtverkehr. Nun, auf jeden Fall blieben wegen der Havarie der Ever Given Waren auf 400 weiteren Schiffen abrupt stehen, weil die Ever Given jenen Kanal blockierte, den alle durchfahren wollten. Die ägyptische Regierung benötigte bis zu einer Woche, bis der Kanal für die Schifffahrt wieder freigegeben werden konnte, was bereits die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zog. Technologien wie Computerchips wurden plötzlich nicht mehr weiter transportiert und an ihre Zielorte befördert. Technik, die jedoch für Europa und vor allem den Exportmeister Deutschland dringend benötigt wurde. So sank das Angebot an Spielekonsolen wie der damals noch neuen PlayStation 5 und anderen elektronischen Geräten oder sogar an Autos, was für viele sehr unerwartet kam und das auch noch in der Vorweihnachtszeit.
Und was ist mit diesen ganzen Kreuzfahrten? Selbst Kreuzfahrten wurden irgendwann für jedermann erschwinglich und somit auch kommerziell flächendeckend nutzbar für den Kapitalismus. Während früher Kreuzfahrten nur der sogenannten Oberklasse vorbehalten waren, sollten nun diese neuen Schiffe der Neuzeit Jedermann dienen. So begann eine Ära der weltweiten Schiffsreisen, welche nicht nur die Umwelt mit ihren Schwerölantrieben verschmutzen, sondern auch noch durch benötigte Langstreckenflüge zu den Häfen dieser Kreuzer, um die Reise dort anzutreten. Einmal Schwerdieselluxus für alle bitte. Damit man sich von den heutigen Superkreuzern ein Bild machen kann, sollte man sich einmal die technischen Daten einer Wonder of the Seas verinnerlichen. Sie kann mit 363 Metern Länge, 62 Metern Breite und sage und schreibe einer Höhe von
70 Metern bis zu 7.000 Passagiere befördern. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn die Titanic konnte nämlich nur 2.400 Passagiere befördern.
Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, wie ich einmal ganz früher durch Kiel, die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands lief. In dem Schaufenster eines Reisebüros erblickte ich dieses Schiff und blieb damals sehr verwundert stehen. Ich zeigte diesen Koloss, den man in einen kleinen Fernseher gezwängt hatte, umgehend meiner Freundin, die allerdings weniger Interesse aufwies, denn sie drängelte weiterzugehen.
Ach ja, nicht zu vergessen die Sache mit dem Neuland! Damit ist natürlich das Internet gemeint, das ur-deutsche Neuland, wie die damalige Kanzlerin Dr. Angela Merkel es entdeckte. Und somit ist es für mich nicht verwunderlich, dass beim technologischen Fortschritt auch noch eine ganz andere und völlig neue Technologie entstanden ist. Während man bislang bestehende Technologien immer wieder nur effizienter machte, gelang es Menschen eine ganz neue Technologie zu erschaffen, nämlich das Internet. Mit der Einführung des Vorgängers, dem Apernet2, in den späten 60ern, konnte die Welt noch nicht so viel mit anfangen.
Erst ab den Neunzigern begann das Internet zu boomen, wodurch die weltweite Wirtschaft neben dem flinken Warenhandel auch noch in die Lage versetzt wurde sehr viel schneller kommunizieren zu können. Die Kombination aus beschleunigtem Handel und Kommunikation führte in den letzten drei Jahrzehnten zu einer derart schwungvollen Globalisierung, dass benötigte Sozialreformen kaum noch mithalten konnten. Wir erleben daher einen Kapitalismus, welcher sich durch zu langsame politische Handlungsweisen und ohne größere Hindernisse zu einem Spätkapitalismus entwickeln konnte.
Denn anders als zur Zeit der Industrialisierung3, welche eher Wohlstand verbreitete, steht heutzutage das Streben nach maximalen Renditen im Vordergrund der Wirtschaft, was bereits erneut zu Wohlstandsverlusten und steigender Armut führt. Und es brachte noch etwas mit sich, ein neues Vorbild für die Jugend, die reinsten Paradiesvögel, die sogenannten Influencer, worauf wir später noch einmal genauer eingehen werden.
Und zu guter Letzt natürlich die neuen asiatischen Handelsstraßen: Es bildet sich mittlerweile sogar eine ganz neue Weltordnung ab, welche die globalisierte Welt sehr geschickt in Szene setzt. Mit der Wiederbelebung der Seidenstraße machte sich China eine der größten und ältesten Welthandelsrouten des Mittelalters zu Eigen. Aber was ist die Seidenstraße und wie ist sie bekannt geworden? Es war Marco Polo4, der im 13. Jahrhundert auf dieser sogenannten Seidenstraße nach China reiste. Allerdings bekam die Seidenstraße nicht von ihm seinen Namen, sondern erst im 19. Jahrhundert von dem deutschen Geografen Ferdinand von Richthofen. Zwar legt dieser sehr eindrucksvolle Name auch nahe, dass es sich um eine durchgehende Straße handeln könnte, was so aber nicht richtig ist. In Wirklichkeit bestand sie nur aus einem vielfach verzweigten und sich immer wieder ändernden Wegenetz, das den Mittelmeerraum mit Zentral- und Ostasien verbinden sollte. Kernstück war das heute als mittlere Seidenstraße bezeichnete Gebiet zwischen der ostiranischen Hochebene im Westen und der Wüste Gobi im Osten. Die daran anschließende östliche Seidenstraße verband die damals wichtigsten Städte innerhalb Chinas mit dem Mittelmeer und dem südlichen Indien.
Zu Beginn war sie allerdings nur für diplomatische Zwecke ausgelegt, später diente sie auch dem Transport von Waren, wozu sich jedoch auch Gelehrte und sogar ganze Armeen gesellten.
Man könnte nun vermuten, dass Händler die gesamte Seidenstraße bereisten, um ihre Waren zu verkaufen. Dem war allerdings nicht so, denn damals reisten die Händler meist nur in Etappen, also nur einen Teil der Strecke, und verkauften dann ihre Waren an den Händler der nächsten Etappe weiter. Aber welche Waren sind das gewesen, die die Händlerkarawanen mit ihren Kamelen auf den teils sehr gefährlichen Routen beförderten? Zum einen war es natürlich die namensgebende Seide selbst, die in unterschiedlichster Qualität produziert und gehandelt wurde. Daneben gab es unzählige andere Handelsgüter wie Edelsteine, Pelze, Metalle, Glas, Gewürze, Früchte und Arzneien. Auch Sklavinnen und Sklaven, ja selbst Pferde und Waffen wurden über die Seidenstraßen gehandelt. Größtenteils bezahlten die Händler die Waren mit anderen Waren, was also ein Tauschhandel ohne Gold oder Silbermünzen war. In einem bis heute erhaltenen Vertrag wurde sogar der Kauf eines Mädchens gegen Seide besiegelt und auch Kaurimuscheln waren als Zahlungsmittel akzeptiert. Münzen und später auch Geldscheine kursierten vorwiegend nur im lokalen Handel und in chinesischen Garnisonen entlang der Strecke.
Neben dem Landweg nutzten die Händler außerdem auch noch die Flüsse für den Transport ihrer Waren. Schiffe hatten damals den großen Vorteil, dass sie deutlich mehr Waren transportieren konnten als Kamele oder Pferde. So passten zum Beispiel in einen einzigen Dau-Segler so viele Waren, wie auf tausend Kamele zusammen. Über diese einzigartigen Handelsverbindungen verbreiteten sich zum Beispiel auch Erfindungen wie Papier und Schwarzpulver. Zudem tauschten die Menschen unterwegs Geschichten und Lieder sowie philosophische, politische und religiöse Ansichten aus. Allerdings trugen die Fortschritte im Schiffbau damals wesentlich dazu bei, dass zunächst der Handel über den Landweg zunehmend unattraktiver wurde. Später, als dann Flüsse rund um die beiden chinesischen Wüsten Lop Nor und Taklamakan versiegten, schien das Ende der Seidenstraßen vorerst besiegelt zu sein. Während viele der alten Handelswege deswegen verfielen und Handelsstädte entlang der Route zugrunde gingen, blieb jedoch das immaterielle Erbe der Seidenstraße bis heute erhalten. Diese alten Handelsrouten lässt nun das heutige China seit Jahren wieder aufleben, denn die Volksrepublik baute den Schienenverkehr auf den alten Kamelrouten aus und wird auch dadurch zu einer der größten Wirtschaftsmacht der Welt. Allerdings ist das heutige China noch einen Schritt weitergegangen und bemüht sich zudem um den Anschluss des afrikanischen Kontinentes an die Seidenstraße. Denn in Afrika wird ein großer Teil wichtiger Metalle und besonderer Erden abgebaut, welche für unsere heutige Technologie unverzichtbar und unersetzlich sind. China strebt mit diesem logistischen Geniestreich die ultimative Weltherrschaft im wirtschaftlichen Bereich an, womit China auch höchstwahrscheinlich Erfolg mit haben wird. Denn der technologische Fortschritt in Kombination mit der Globalisierung bietet die besten Voraussetzungen dafür und die Weltgemeinschaft schaut nicht nur zu, nein sie möchte sogar davon profitieren.
Schiffe, Flugzeuge, Lokomotiven und LKWs mit moderneren Antrieben erreichten trotz zunehmender Transportlasten immer schneller und effektiver ihre Zielorte. So führte die Globalisierung zu einer Beschleunigung von Handel und Vergnügen, die man sich im Mittelalter so noch nicht hätte vorstellen können und befriedigte gleichzeitig den erneuten Drang des Kapitalismus, sich weiter ausbreiten zu müssen. Ein weiterer Zwang für den Kapitalismus, welcher jedoch erst nach der Zeit der Industrialisierung erneut entstanden war. Mittlerweile denkt man sogar darüber nach, den Hamburger Hafen mit seiner Fläche von 43.31 km2 oder den Nord-Ostseekanal tiefer auszubaggern, damit noch größere Schiffe noch mehr Waren transportieren können.
„Leider führt das teils zu absurden Stilblüten“, urteilt Walter. „Aktuell bin ich in Puebla in Mexiko und bekomme mit, wie die Gringos Lokalslang für Amerikaner, mal wieder drohen. Hintergrund ist, dass China ein Dutzend Häfen über zehntausende Kilometer entlang Lateinamerikas baut, da es günstiger ist den ganzen Kontinent zu umschiffen, statt die Gebühren des Panamakanals zu zahlen, der in US-Besitz ist. Damit geht viel Profit bei den US-Umschlaghäfen verloren. Wie schade! Ökonomisch, vor allem, aber auch ökologisch ist das der pure Wahnsinn, der nicht sein sollte!"
Es wird auch gleich in mehreren Dokumentationen über das wirkliche Ausmaß der Ausbeutung des afrikanischen Kontinentes berichtet. In einer ZDF-Dokumentation „Die neue Seidenstraße" wird darüber berichtet, wie China den Bau der Route über Kreditvergaben zu seinem eigenen finanziellen Vorteil ausnutzt und ortsansässige Arbeiter und Firmen dadurch ausbeutet. Joko Winterscheidt, ein bekannter deutscher Fernsehmoderator und Schauspieler berichtet in seiner Amazon-Prime Dokumentation darüber, wie China dieselben Ausbeutungsmechanismen in Afrika betreibt. Für mich eine neue, allerdings hoch moderne Form, der Sklavenarbeit, worauf ich im späteren Verlauf des Buches noch einmal zurückkommen werde.
Der technologische Fortschritt ist dabei ganz im Sinne von immer mehr Renditen bei möglichst geringen Ausgaben. Und so wurden die Zeit und der technologische Fortschritt zu den wertvollsten Ressourcen des Kapitalismus der Neuzeit. Je schneller Waren verkauft werden können, desto schneller steigen auch die Gewinne, unabhängig davon, ob die körperliche Belastbarkeit der Arbeitskraft, welche Dienstleistungen anbietet oder Waren und Produkte herstellt, angemessen ist oder nicht. Dabei zeichnet sich bereits heute schon die nächste Evolutionsstufe für den Kapitalismus in diesem Jahrhundert ab, die der Digitalisierung von Arbeit, wodurch er erneut auf unsagbare große Weiden von Geld stößt. Und so wirkt die Politik für mich dabei „wie ein Gebrechlicher in einem Stummfilm, der von dem Kapitalismus gepflegt und gehegt werden muss, damit Menschen durch Maschinen ersetzt werden können, um so erneut Gewinne größtmöglich zu maximieren."
Kamelroute auf der Seidenstraße
Kapitel 3 Gefahren für unseren Wohlstand
Die Krisen der letzten Jahrzehnte offenbarten der Weltbevölkerung Gefahren, welche für viele Profiteure des heutigen Spätkapitalismus1, für mich einer neuen Art der Goldgräberstimmung, lieber unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit geblieben wäre. So hielten fortwährende Krisen, eine ständige Bedrohungslage für die angesparten Geld- und Immobilienvermögen recht plagend aufrecht, was oftmals auch die Altersvorsorge des kleinen Mannes war.
„Na klar.“, ruft Walter. „ Wer kennt sie nicht, die vielen vermögenden Immobilienbesitzer in München, die nicht außerhalb des Speckgürtels pendeln, weil nicht Großkonzerne einen Mietwucher verursachten, der ehemaligen mittleren Einkommen das Wohnen in der Stadt unbezahlbar machte.“
Krisen, welche durch Spekulanten, Naturkatastrophen und einer erstaunlichen Beharrlichkeit an politischen Fehlentscheidungen ausgelöst wurden und somit den errungenen Wohlstand plötzlich wieder verringert. Breitflächiger Wohlstand, der doch nach der Zeit des Feudalsystems im Mittelalter durch die Industrialisierung gerade erst entstanden ist. Ja, es ist paradox, denn Wohlstand konnte sich überhaupt nur mithilfe des Kapitalismus der Neuzeit auf größere Teile der Gesellschaft ausbreiten. Zum Wechsel der Systeme, welcher die gesamte Welt verändern sollte, trugen zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch jene Gewerkschaften ihren Teil bei, welche damals noch recht tatkräftig mitwirkten und sich mit der Zeit zum Handlanger der Politik verkümmerten.
So möchte ich mit einer Krise beginnen, wo es 2009 wegen eines zu gierigen Strebens nach Gewinn zu einer weltweiten Finanz- und Bankenkrise kam, die nach langer Zeit des Wohlstandes eine ernstzunehmende Bedrohung für etablierte Geldströme und bisher bekannte Verhaltensweisen darstellte. An dieser Stelle möchte ich daher wieder meinen Co-Autor Walter Benda zu Wort kommen lassen, der die Zusammenhänge recht anschaulich und plastisch darstellt. Was ist also eigentlich im Jahr 2009 passiert, als die Finanzmarktkrise ausbrach, Walter?
„Die korrekte Frage müsste lauten, was vor 2009 eigentlich dahin geführt hat? Wer mehr Hintergründe erfahren mag, die sowohl humoristisch als auch verstörend dargestellt werden, dem sei der Film „The Big Short“ empfohlen. Auch ohne tiefgründige Finanzkenntnisse offenbart der Film erschreckende Zustände, die in der Finanzdienstleistungsbranche gelten, speziell bei Banken. Stellen Sie sich also zunächst ein Dorf mit 100 Menschen vor, was ich gerne einmal Colonia-Dorf nennen möchte. Dort ist ein Bewohner des Dorfes sehr viel wohlhabender als alle anderen zusammen, zehn sind vermögend, weitere fünfzehn von Armut betroffen und 74 befinden sich in der guten Mitte dazwischen. Was auch in etwa unseren heutigen Vermögensverhältnissen in Deutschland entspricht.
In unserem Colonia-Dorf konnte sich auch jeder ein Haus leisten, da jeder einen Kredit für den Kauf dieser Immobilie von dem dortigen Colonia-Geldinstitut erhielt. Wieso fragen Sie? Na das ist recht einfach, weil für diese Kredite Sicherheiten von unseren
Colonia-Dorfbewohnern für die Bank hinterlegt wurden, was die Häuser selbst waren und zudem von der Bank bewertet wurden. Die zuvor ermittelten Werte der Häuser waren reine Zahlen auf einem Stück Papier und diese Zahlen wurden dann von der Bank als -Bewertungssumme- betitelt. Diese Summen, also aller hinterlegten Sicherheiten, floss dann in eine weitere, ganz andere Bewertung ein, welche allerdings von einer sogenannten -Ratingagentur- der Nachbarstadt übernommen wird. Denn diese Agentur stellte wiederum den Wert der Bank an sich fest. Allerdings sollten Sie an dieser Stelle dazu wissen, dass die Colonia-Bank diese Ratingagentur für diese Bewertungen auch jedes Mal bezahlt. Auf dem Papier waren es also alle Saubermänner mit weißen Westen.
Kredite wurden also wohlwollend vergeben und Häuser wechselten die Besitzer wie die Menschen ihre Unterwäsche, wobei die vorherigen Eigentümer immer mit Gewinn verkaufen konnten, was wiederum die nachfolgenden Kreditsummen für die Käufer erhöhte. Dieser nachfolgende Käufer konnte allerdings die verteuerte Immobilienfinanzierung nun damit begründen, da der gestiegene Immobilienwert als neue Sicherheit bei der Bank hinterlegt wurde2. Dieses Spiel ging munter weiter, bis einer, der auch meist „bombastische" Finanzierungsangebote bekam, seine Raten nicht mehr bezahlen konnte wie der Dorfbewohner Karl.
Karl ist ein Donut liebender Migrant, weshalb er leider nur als Pförtner in einem Colonia-Werk arbeitet und daher zu den fünfzehn Armen in unserem Colonia-Dorf zählt.
Sein Einkommen als Pförtner stieg bedauerlicherweise nicht so schnell an wie das Gehalt anderer Dorfbewohner mit besser bezahlten Berufen in dem Werk. Somit konnte Karl irgendwann seinen Kredit nicht mehr bezahlen, sondern musste aus der finanziellen Not heraus sein Haus leider wieder verkaufen. Er musste es deswegen tun, da die Colonia-Bank, nennen wir sie einmal Gruber-Bank, ihm eine Grube grub. Denn seine Konditionen für den Kreditvertrag sahen vor, dass die Bank ihm den Vertrag auch jederzeit kündigen sowie die Immobilie zwangsversteigern konnte, wenn er seine Raten nicht mehr bezahlen kann. Und so kam es auch leider dann für Karl. Die Gruber Bank löste seinen Traum vom Eigenheim in Luft auf.
Was geschah nun mit Karl? Karl hat viele Freunde, unter anderem seinen Kumpel John, der Polizist ist und damit zur Mittelschicht im Colonia-Dorf zählt. Dem ging es zwar monetär schon immer besser als Karl, aber auch sein Einkommen stieg nicht so schnell wie die Immobilienpreise und Kreditraten es taten. Und so erging es den Kumpels Lenny, Barney und Joe ebenfalls wie Karl. Sie konnten ihm deshalb weder Geld leihen noch ihm sein Haus abkaufen. Das konnte nur der böse Montgomery B. aus unserem Dorf, denn als einziger Wohlhabender war er nicht im gleichen Umfang von der finanziellen Not betroffen.
Aber warum sollte Montgomery B. den vollen Preis bezahlen, wenn Karl es doch aus der Not heraus verkaufen musste, fragt sich Montgomery B.? Denn eine Bank bewertete eine Immobilie ja schließlich auch nur mit vielleicht fünfzig Prozent des ursprünglichen Wertes als Sicherheit.
Wenn Mr. B. also dem armen Karl nur die Hälfte des eigentlichen Wertes für sein Haus gibt, dann hat dieser keinen Stress mehr mit der Bank und Mr. B. macht obendrein ein sehr gutes Geschäft. Geschäfte lagen „Monty“ B. nämlich, denn sonst wäre er ja nicht so wohlhabend geworden. Der arme Karl hatte allerdings hier leider kein einziges Wort mitzureden, denn er konnte keinen besseren Käufer präsentieren als Mr. B und die Bank wollte unbedingt das Risiko offener Raten loswerden, weshalb der Verkauf letztendlich besiegelt wurde.
Karl verlor also sein Eigenheim und hatte dennoch die Hälfte der damaligen Kreditbelastung als Restschuld zu tragen, obwohl er jetzt wieder zur Miete wohnen musste. Mr. B. dagegen hatte eine weitere Immobilie günstig erhalten, oder wie man im Fachjargon sagt „geschossen", die er vermieten konnte.
Der geneigte Leser mag an dieser Stelle erkennen, dass sich hier ein Teufelskreis in Gang setzte und so war es auch. Allerdings gefiel es den Colonia-Banken nach einiger Zeit ganz und gar nicht mehr, denn sie wollten ja schließlich den Kredit immer weiterverkaufen und mit den Kreditzinsen neues Geld einnehmen. Außerdem fand die Bank, das sähe in den eigenen Bilanzen ja wohl eher schlecht aus für sie. Was würde wohl die Ratingagentur über einen sagen? Nicht auszudenken. Die Ratingagentur hingegen sagte einfach, dass Karl und seine Freunde tragische Einzelfallschicksale seien, mit denen man nicht auf den Gesamtmarkt schließen könne, der jedoch finanziell immer überspannt wurde. Daher wäre es nur logisch, dachte sich die Bank, wenn man die paar faulen Eier versteckt, indem man sie unter den Teppich kehrt. Anstatt also jeden Kredit einzeln zu bewerten, hat man diese als Paket geschnürt, wobei der Herausgeber des Pakets die Colonia-Bank selbst war.
Da die Bank allerdings ja durch die Ratingagentur super bewertet war und die Immobilien ebenfalls, würden die paar faulen Eier im Gesamtpaket nicht größer ins Gewicht fallen. So dachte man es sich zumindest. Leider hat sich unsere Bank dabei dann wohl ein wenig bei der Risikoeinstufung vertan. Karl war nämlich in diesem geschnürten Paket offensichtlich, seine Freunde aber leider nicht. Und so fiel für die Colonia-Bank und Ratingagentur enttäuschender Weise nicht nur Karl aus, sondern plötzlich auch noch seine Freunde John, Lenny, Barney und Joe. Aber wer könnte deren Häuser kaufen? Genau, Mr. B., freuten sich erleichtert die Bank und die Ratingagentur.
Doch Mr. B. dachte, dass irgendwas nicht stimmen kann, wenn auf einmal ganz viele Häuser ganz billig verkauft würden. Also ging er auf Nummer sicher und kaufte nicht weiter ein, um eine potenzielle Marktkorrektur erst einmal abzuwarten.
Die Colonia-Bank verstand es plötzlich so gar nicht mehr, denn sie wollte doch eigentlich dieses Risiko, welches jetzt noch größer wurde für sie, eigentlich mit tollkühnen Tricksereien aus dem Weg gehen. Die Kunden mussten Kredite zahlen, die zu hoch waren, die Häuser konnten nicht weiter oder nur weit unter Wert verkauft werden und die vermeintlich sicheren Pakete hatten nun reihenweise Zahlungsausfälle. Die Colonia-Bank, die ja noch in dem Schlamassel mit dem Risiko steckte, wurde diese Pakete nicht mehr an andere Banken los, während die Kredite für die alten Pakete zurückgezahlt werden mussten. Mit Geld, das sie zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr hatten, für Kredite, die nicht bezahlt wurden, für Immobilien, die nur unzureichend zu Geld gemacht werden konnten.
Wer nun glaubt, dass meine Geschichte über das Colonia-Dorf frei erfunden wäre, dem sei versichert, sie bildet leider die ernste Realität ab. Denn genau so, wenn auch stark vereinfacht verlief es mit der Lehman Brothers Pleite im Jahr 20093."
Aufgeheizte Stimmung
Womit ich auch direkt zu der nächsten, wenn nicht sogar zu der größten Bedrohung für unseren Wohlstand und die Menschheit in diesem Jahrhundert kommen möchte. Denn kurz nach der Bankenkrise gestand sich die Staatengemeinschaft nach langer Zeit der Ignoranz öffentlich ein, dass die Weltbevölkerung von einer globalen Klima- und Umweltkatastrophe bedroht wird. Einer selbst verschuldeten globalen Krise, die wegen unüberschaubaren Folgeschäden des Klimawandels eine weitaus größere Gefahr für unseren Wohlstand darstellt als viele andere Krisen zuvor. Eine Bedrohung, die unlängst begonnen hat, da sich mittlerweile schwerste Naturkatastrophen recht periodisch auf der Erde ereignen.
Forscher hingegen machten uns seit zwei Jahrhunderten auf diese drohende Klimakatastrophe aufmerksam, welche von der Politik zu lange viel zu wenig beachtet wurde, was womöglich einer allzu ängstlichen Stille bei den Warnungen geschuldet war. So beschrieb zum Beispiel schon Joseph Fourier 1824 als Erster den Treibhauseffekt, ohne den ein eisiges, lebensfeindliches Klima auf der Erde herrschen würde. Die Amerikanerin Eunice Foote stelle nach ihren Experimenten in den 1850er Jahren mit Wasserdampf und Kohlendioxid fest, dass letzteres die Temperatur der Erde steigen lässt, worauf der schwedische Forscher Svante Arrhenius 1906 den Menschen eine Mitschuld daran gab, dass sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre erhöhen würde. Während des Zweiten Weltkriegs beschäftigte sich dann der junge deutsche Meteorologe Hermann Flohn im Reichsamt für Wetterdienst mit der Frage, wie Menschen das Klima verändern. So erforscht er die Wirkung von Städten, Stauseen und Wäldern auf das lokale Mikroklima und die Emissionen der Industrie. Allerdings sollten es erst Staub und Ruß sein, die 1941 offiziell vor klimaverändernden Folgen warnten. Wer das Ruhrgebiet der Nachkriegszeit besucht oder Bilder davon gesehen hat, bekommt vielleicht eine Vorstellung von den uns möglicherweise bevorstehenden Zerstörungen.
Und dennoch blieb bis dato so ziemlich jede Warnung von Forschern so lange weitestgehend ungehört, bis ein erster weltweiter Klimagipfel im Februar 1979 stattfand, damals noch unter der Leitung der World Meteorological Organisation WMO, woran jedoch nur Wissenschaftler beteiligt wurden. Die fehlende Beteiligung der Politik bei dieser Konferenz war jedoch einer unserer größten Fehler, wie ich persönlich finde, denn erst im vierten
Sachstandbericht des Klimareportes (IPCC)





























