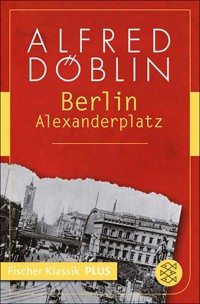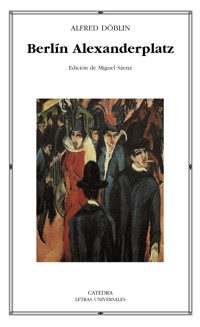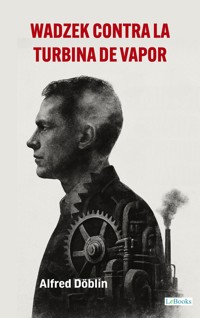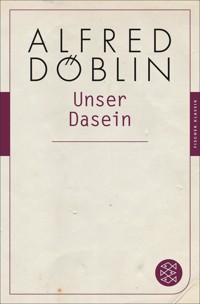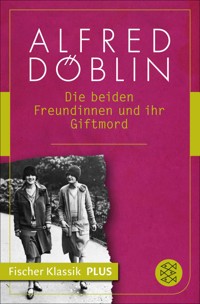9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit einem Nachwort von Erich Kleinschmidt. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk. Alfred Döblins wichtigste Schriften über Kunst und Literatur Ob er gegen den Futurismus oder die Psychologie des Romans polemisiert, ob er mehr »Tatsachenphantasie« oder größere politische Verantwortung fordert – stets ist Döblin auch auf dem Feld der ästhetischen Reflexion ein radikal gegenwärtiger Autor, der sich aus der Dynamik der eigenen literarischen Praxis heraus einmischt und sich bei keiner These beruhigen kann. Diesem unorthodoxen, engagierten Grundzug seiner Essays verdankt sich ihre Lebendigkeit bis heute, und ihre produktive Unruhe macht sie zu wichtigen Impulsgebern auch für gegenwärtiges Nachdenken über Kunst, Musik und Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 901
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alfred Döblin
Schriften zu Ästhetik, Poetik und Literatur
Über dieses Buch
Wie kaum ein anderer Autor der Moderne war Döblin von einer grenzenlosen Experimentierlust getrieben, die sich die Regeln des eigenen Schreibens immer wieder neu vom jeweiligen Stoff vorgeben ließ. Eine ähnliche Offenheit und Experimentierlust kennzeichnet auch Döblins Texte zu ästhetischen und poetologischen Fragen: Ob er gegen den Futurismus oder gegen die Psychologie des Romans polemisiert, ob er mehr »Tatsachenphantasie« oder größere politische Verantwortung fordert – stets ist Döblin auch auf dem Feld der ästhetisch-poetologischen Reflexion ein radikal gegenwärtiger Autor, der sich aus der Dynamik der eigenen literarischen Praxis heraus einmischt und sich bei keiner These beruhigen kann. Diese Unruhe – das zeigt der vorliegende Band auf beeindruckende Weise – zieht sich durch das gesamte Werk Döblins und macht seine Schriften zu bis heute lebendigen Impulsgebern für eine literarische Praxis und Reflexion, die gegen erstarrte Konventionen ebenso aufbegehrt wie gegen jede Form von Esoterik.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bilekjaeger, Stuttgart
Veröffentlicht als E-Book 2013.
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402291-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Gespräche mit Kalypso. Über die Musik (1910)
Erstes Gespräch: Die Verzauberten unter sich
Zweites Gespräch: Flötentöne und Geschrei
Drittes Gespräch: Auf purpurnen Decken
Viertes Gespräch: Die Meerfahrt
Fünftes Gespräch: Die Fischpredigt
Sechstes Gespräch: Hohn und Schwermut der Verliebten
Siebentes Gespräch: Gießt Wein in meinen Becher
Achtes Gespräch: Indes die Göttin krankliegt
Neuntes Gespräch: Sie tragen schwarze Mäntel
Zehntes Gespräch: Aufatmen der Verzauberten
Letztes Gespräch: Abgesang
Futuristische Worttechnik (März 1913)
An Romanautoren und ihre Kritiker (Mai 1913)
Bemerkungen zum Roman (März 1917)
Von der Freiheit eines Dichtermenschen (Juni 1918)
Reform des Romans (Juni 1919)
Der Schriftsteller und der Staat (Mai 1921)
[Über deutschen Prosastil] (1922)
Der Geist des naturalistischen Zeitalters (Dezember 1924)
Wissenschaft und moderne Literatur (Februar 1926)
Kunst, Dämon und Gemeinschaft (Mai 1926)
Schriftstellerei und Dichtung [Konzeptfassung] (März 1928)
Schriftstellerei und Dichtung [Redefassung] (März/April 1928)
Dichtung und Seelsorge (Juli/August 1928)
[Die Arbeit am Roman] (November 1928)
Der Bau des epischen Werks (Dezember 1928)
I Das epische Werk berichtet von einer Überrealität
II Das epische Werk lehnt die Wirklichkeit ab
III Die Epik erzählt nichts Vergangenes, sondern stellt dar
IV Der Weg zur zukünftigen Epik
V Unterschied der heutigen individualistischen Produktionsweise von der früheren kollektiven
VI Schilderung des Inkubationsstadiums im heutigen epischen Produktionsprozeß
VII Details vom Produktionsprozeß
a) Das epische Werk liegt in statu nascendi vor
b) Das epische Werk ist von Konstitution unbegrenzt
c) Dynamik und Proportion als Formgesetze und Mitschöpfer des Inhalts
VIII Die Sprache im Produktionsprozeß
Kunst ist nicht frei, sondern wirksam: ars militans (Mai 1929)
I
II
III
Literatur und Rundfunk (September 1929)
Die Aufgabe des Dichters in der Zeit (November/Dezember 1929)
Vom alten zum neuen Naturalismus (Januar 1930)
Nutzen der Musik für die Literatur (Mai 1930)
Krise des Romans? (um 1930)
Alles hat sich geändert (November 1932)
Blick auf die heutige deutsche Literatur (Januar/Februar 1933)
Vornotiz
1. Absatz. Wie verhält sich die Literatur zur Realität[?]
2. Absatz. Beschreibung der Art dieses Eigengewächses Kunst (literarische Kunst).
3. Absatz. Welche Rolle spielt die Literatur in Deutschland, in wessen Dienst steht sie, welche Funktion übt sie[?]
[1.] Hauptteil
[2.] Hauptteil
Historie und kein Ende (Januar 1936)
Der historische Roman und wir (Juni 1936)
I Jeder Roman hat einen Fonds Realität nötig
II Die Allgemeinheit der Realität im Roman
III Der historische Roman ist erstens Roman und zweitens keine Historie[.]
IV Was ist Historie? Mit Historie will man was[.]
V Die neue Funktion des Romans: Bericht von der Gesellschaft und von der Person. Jeder gute Roman ist ein historischer Roman[.]
VI Der Autor ist eine besondere Art Wissenschaftler. Dichtung ist niemals eine Form der Idiotie[.]
VII Der sonderbare Entstehungsprozeß eines historischen Romans
VIII Die beiden widersprüchlichen Triebkräfte des heutigen Romans und ihre Träger
IX Der historische Roman in der Literatur unserer Emigration. Welches ist heute die Parteilichkeit des Tätigen?
Die deutsche Literatur (im Ausland seit 1933) (1938)
I
Stand der deutschen Literatur vor 1933
Das Zerreißen der Literatur 1933
Im Krieg schweigen die Musen
Keine Emigrationsliteratur, sondern deutsches Schrifttum im Ausland.
Das schwere Schicksal des deutschen Schrifttums im Ausland
Angriff der Politiker Dialog zwischen dem Künstler und dem Mann von der Straße
In die tiefste Einsamkeit nimmt der Künstler die Gesellschaft mit.
Des Pudels Kern
Der Kurzschluß in die Mystik
Der Kurzschluß in die Politik
Die leise große Macht der Kunst
II Revue der Auswanderer
Lyrik
Das fehlende Drama
Die Allerweltsform des »Romans«
Einige ältere Humanisten im Ausland
Stilprobe aus Jakob Wassermann »Kerkhoven«
(Stilprobe aus »Jugend und Vollendung des Königs Henri IV.«)
(Thomas Mann »Joseph und seine Brüder«, der dritte Roman: »Joseph in Ägypten.«)
(Stefan Zweig »Erasmus«)
Pêle-mêle
(Stilprobe aus Alfred Döblin »Die Fahrt ins Land ohne Tod«)
(Aus Georg Hermann »Der etruskische Spiegel«)
(Stilprobe aus Emil Ludwig »Cleopatra«)
Jüngere Autoren
(Aus Joseph Roth »Das falsche Gewicht«)
(Hermann Kesten »Der Gerechte«)
(Klaus Mann »Vergittertes Fenster«)
(Anna Seghers »Die Rettung«)
(Gustav Regler »Die Saat«)
(B. v. Brentano »Prozeß ohne Richter«)
(Irmgard Keun »Nach Mitternacht«).
Die beiden deutschen Literaturen (Januar 1946)
Die deutsche Utopie von 1933 und die Literatur (Oktober/November 1946)
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
[6.] Kapitel
[7.] Kapitel Rückblick und Ausblick
[8.] Kapitel
[9.] Kapitel
Die Gegenwarten der Literatur (August 1947)
Die literarische Situation (1947)
Teil I Natur und Anspruch der Utopie von 1933
1. Entstehung der sozialistischen und biologischen Utopie
2. Der Weg der biologischen Utopie
3. Das Jahr 1933
4. Die drei deutschen literarischen Gruppen
5. Die utopische Macht siebt die Literatur[.]
Teil II Die Literatur während der zwölf Jahre
6. Die Schriftsteller im Land und die Exilierten
7. Die Exilierten
Teil III Nach 1945
8. Allgemeine Lage und Zustand der Literatur
9. Die Anregung neuen Wachstums
10. Die Endzeitlehre als Symptom einer Massenerkrankung
11. Die Behandlung des Leidens
12. Die notwendige Eigenbewegung des Landes
13. Formen von Verweltlichung
14. Zum Verständnis der Deutschen
Teil IV
15. Exkurs über Personen und Völker
16. Exkurs über das Ich und die Gesellschaft
17. Nach dem letzten Experiment
18. Bemerkungen über die Zukunft
Die Dichtung, ihre Natur und ihre Rolle (März 1950)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Die Phantasie
Vom Einfall zur Dichtung Die Rolle der Sprache
Der Übergang zur Sprache
Die Sprachebenen und ihre Gefahr
Vom Kitt der Welt
Die neue Erde, der neue Himmel
Die Person des Dichters
Dichtertypen
Die Gesellschaft greift nach ihnen
König David, Schutzpatron der Dichter
Was ist Formalismus? (um 1952)
Mireille oder zwischen Politik und Religion (1953)
Präambel
Eine Tabelle und eine Anklage
Tabelle
Veränderung ihrer Struktur nach 1871
Verteilung der Bevölkerung auf
Einer sitzt in der Klemme
Erschütterung einer unsicheren Position
Die Literaturliste
Was wir der Liste entnahmen
Einsamkeit und Armut
Anhang
Editorische Notiz
Einzelnachweise:
Daten zu Leben und Werk
Alfred Döblin
Nachwort
Literaturhinweise
1. Texte von Alfred Döblin
2. Texte über Alfred Döblin und sonstige Literatur
Gesammelte Werke im Taschenbuch
Gespräche mit Kalypso
Über die Musik
Erstes Gespräch:Die Verzauberten unter sich
(Strand einer Insel, darauf gelbes kraftvolles Sonnenlicht vom dunkelblauen Himmel. Der Morgenwind reibt die leichten Steinchen aneinander, fegt sie von den Dünenerhebungen herunter, klatscht das Meerwasser gegen die weit vorspringenden Klippen. Das graugrüne Meer, draußen mit zahllosen purpurnen Lichtblitzen, vor dem Gestade mit brillantener Gischt, rollt satt. Öfter züngeln Wellen mit Surren weit über den Sand, belecken rasch die braunen Schiffstrümmer, die Türen, Masten, Blöcke, Balken, Tonnen, Seile, die das Meer erbrochen hat. Zwischen dem Gewirr springen zwerghafte Männer und Frauen, vom Leib abwärts Vogelkörper mit schwarzem, struppigen Gefieder und sehnigen Klauen, spitze gelbbraune Gesichter, schwarzäugig mit Flügelstümpfen am Rücken; schleppen die Trümmer auseinander, hüpfen in die Tonnen, daß oft nur ihr strähniges Schwarzhaar herlugt. Das Volk, bald kreischend, bald lautlos tätig, hat verbissene faltige Fratzen; ihre unruhigen Glieder sind von gieriger Magerkeit. Sie schnarren Menschensprache.)
EIN ALTER (sich auf einen Balken setzend)
Wir finden nichts mehr.
EIN ANDERER
Er ist satt, er hat genug.
EIN DRITTER
Es hat nichts mehr; lauter Plunder.
DER ALTE
Kinder, laßt gut sein; es ist nichts mehr da. Wir wollen heim vor der [F]lut. (Das Volk schlägt noch Holz zusammen, belädt sich mit Körben. Während sie sich sammeln und landeinwärts ziehen, gegen das Meer gewendet, bitter, für sich.) Ich möchte einen von diesen gesehen haben. Sie trugen Kettchen, Amulette, seltene Steine mit sich, Vasen, geschnitzte Truhen, Seidenstoffe, zart geknüpfte Decken; Zithern, Lauten und Schellen hatten sie auf dem Schiff; wie zur Hochzeit sind sie ausgefahren. Von meinem Lande müssen sie gewesen sein. Aber das Wasser schluckt jedes, jedes herunter, das dickwanstige Ungeheuer, wie wenn nichts leben dürfte als das Meer.
EIN JÜNGERER (Volles, nur leicht braunes Gesicht; geht mit Tränen neben dem Alten.)
Wurdest du so alt und hast noch nichts vergessen?
DER ALTE
Du quälst dich schon?
DER JUNGE
Bald ertrag ich es nicht.
DER ALTE
Mein Kind, es gibt Krankheiten, die wie Ratten am Mark unserer Glieder nagen. Denk dir einen so kranken Menschen, dem die Glieder immer wieder wachsen, die ihm abgefressen sind von jenen Ratten, und dann kennst du uns. Du bist hier auf der Hochschule für Sentimentalität.
DER JUNGE
Es wächst ein Kraut, das heißt Mord. Damit speis ich sie, wenn anders ich Hände hab.
DER ALTE (Lacht gutmütig, fährt ihm über das Haar.)
Was schwatzt du? Ich dulde, was in den Knien der Göttin ruht. Keiner unter uns, der nicht eines Nachts mit berauschtem Hirn aufgestanden, in ihre Grotte geschlichen wäre und den Dolch an ihren Hals gesetzt hätte. Sie ist unsterblich. Kaum, daß sie eine Schramme hat, so brennt der Dolch auf, wie ein Stück Zunder, von ihrem Blute angesteckt; und mit Blasen in Händen und Gesicht laufen sie fort von ihr, jammernd von ihr, die nicht einmal aufgewacht ist[,] und kühlen sich die Wunden und weinen vor Bitternis und Schmerz. Ein Weib wollte sie einmal erwürgen, die der Göttin dienen mußte; ihre langen Zöpfe schnürte sie der Göttin um die Kehle; es war hier am hellen Strande. Von hinten sprang die Bestie an und warf die Unsterbliche auf die Stirn, während wir jubelten. Aber die Haut der Unsterblichen rollt und biegt sich elastisch wie Stahl. Kalypso richtete sich langsam auf, nahm die Kreischende in die Arme, löste der Gefangenen langsam die Zöpfe auf und wies sie von sich fort; aber von dem Kopfe der Ärmsten klapperten von da ab Eisenkettchen herab, eins um das andere, jedes Haar ein Kettchen, das auf den Rücken und die Schultern peitscht. Man erzählt sich: Ein Tollkopf, wie Du, wollte sie in Schande stürzen, sie, während sie schlief, vergewaltigen. Sie wehrte sich gar nicht, während er bei ihr lag; sie genoß seiner in Ruhe, er gefiel ihr. Aber man sah ihn nicht wieder; eine Schildkröte kroch am Morgen aus ihrer Grotte, schläfrig die Lider senkend, auf der sie mittags sitzt, wenn sie ins Bad steigt.
DER JUNGE
Nimm mir etwas ab.
DER ALTE
(Packt sich von dem Holz des Jüngeren auf; sie gehen stumm nebeneinander.)
DER JUNGE
Meine Eltern warten auf mich; ich habe Vogelklauen! – Dies ist unglaublich, ist unglaublich. Ich hatte die Besinnung verloren, als unser Bremer Schiff brach; seit diesem Augenblick bin ich nicht, nicht, nicht erwacht, sag’ ich, – ich träume. Ich bin untergegangen, faule auf dem Meeresboden.
DER ALTE (Stumm nickend)
Ja, ja, es ist ein Geheimnis um uns. Glaub’ mir, ich habe schon oft zu Kalypso gebetet und ihr gedankt, daß sie mich dieses Geheimnisvolle lehrte. Aber auch um die Göttliche ist ein finsteres Rätsel. Sie soll, als die alten Götter starben, die leichtherzigen, verschwenderischen Olympier, vergessen sein; der eine neue Gott, der die andern alle unter Felsen und Bergen begrub, vergaß sie in seiner Siegeswonne, die hier flötend und leise singend, umging auf einem Inselchen im Weltmeere. Nun ist die Welt so glatt und blank geworden, überall und an jedem Ende, – nur hier verfinstert es sich, brausen unheimliche blaue und graue Schatten auf, wird noch einmal hinter stillen Mauern der entsetzliche Zorn der Götterschlacht aufzucken, bis auch sie vertilgt ist. (Flüsternd) Sie wird sterben, wir mit ihr. Kindisch und schwach wird sie, mehr von Tag zu Tag. Die süße Versonnene gärt jetzt von Haß und Ekel; sie weiß, ihre Tage sind gezählt. Einen Mann schleppt sie mit sich, der aus dem Hochzeitsschiff sich gerettet hat; sie pflegt ihn, schwatzt mit ihm. Nur Blumen und Flöten waren sonst ihre Gespielen; ja sie ist krank.
DER JUNGE
Ich will zu Gott beten; meine Not ist arg.
DER ALTE
Hilft nichts; kein Gebet dringt zu Gott durch; leg dich schlafen, mein Kind.
Zweites Gespräch:Flötentöne und Geschrei
(Flötentöne hinter der Düne. Eine Sänfte, überwölbt vom dunkelblauen Baldachin, taucht hinter einem Hügel auf, bewegt sich sehr langsam gegen das graugrüne Meer zu. Die Stangen der Bahre ruhen auf den Rücken von vier Riesenschildkröten, die sich gemächlich fortschieben. Auf der Decke des Baldachins sitzt ein weißbärtiger, greiser Pavian, lenkt mit zwei goldenen Ketten die vorderen Schildkröten. In der Sänfte liegt ein Weib, halb aufgesetzt, die Hände hinter der schweren Haarpracht des Kopfes gefaltet. Volle regelmäßige kalte Züge; ernster leerer Blick, elfenbeinfarbene Haut. Unter der blauen Tunika, die breit mit schwarzer Seide durchwirkt ist, tritt die Reife des Leibes hervor. Um den bloßen Hals hängen Perlenschnüre, deren Weiße der starblinder Augen gleicht. Goldgelbe Sandalen der Füße; eine Kette um den Knöchel des linken Fußes. Dies ist Kalypso Δῖα ϑεάων. Hinter der Sänfte taumelt ein Mann, zerlumptes Maskenkostüm, vielleicht hellenisch; stumpfer Gesichtsausdruck, verwildertes Haar, hängender Schnurrbart. Durch die Nase ein Eisenring, daran hängt frei bis auf den Boden ein Strick. Von dem Vogelvolk folgen einige mit Flöten. Lange auf- und absteigende Flötentöne; bisweilen eine Art Abschluß mit Triller. Sie sind dicht am Wellenschlag. Kalypso klatscht in die Hände. Die Sänfte hält. Die Schildkröten ziehen sich in ihre Schale zurück. Die übrigen hüpfen zur Seite, legen sich hinter Balken und Sandhaufen. Der Mann, der Musiker, bleibt unbeweglich, ohne aufzusehen, stehn.)
KALYPSO (Ihn betrachtend, lächelt.)
Wie nennst du dich?
MUSIKER (Unbewegt, schweigt.)
KALYPSO
Sprich doch zu mir.
MUSIKER
Wo ist meine blonde Freundin? Wo sind meine Freunde?
KALYPSO
Ich kenne sie nicht.
MUSIKER (Steht wieder abwesend da.)
KALYPSO (Nimmt den Strick lächelnd in die Hand, spielt mit ihm.)
MUSIKER (Zuckt, beißt die Zähne zusammen; vor sich hinsprechend.)
Ich frage nichts, ich will es ja gut meinen mit meinem Kopf; ich will es ja gut – meinen.
KALYPSO (Dozierend)
Unser Strand ist ein weitoffenes Maul. Was ihm zufällig nah kommt, schlürft er ein. Sind es Menschen, so drehen wir ihnen teils den Hals um, teils plaudern wir vorher mit ihnen.
MUSIKER (Stürzt sich aufglühend auf sie, die ihn gewähren läßt, ihn mit halboffenen Augen kalt beobachtet.)
KALYPSO
Nun leg dich wieder in den Sand.
MUSIKER (Verzweifelt)
Ich will es gut meinen mit meinem Kopf.
KALYPSO
Nun? Du bist auf der Insel der Kalypso.
MUSIKER
Laß mich heim, ich fleh’ dich an. Wenn nur ein Hauch von Mitleid in deiner Brust weht, du Unbegreifliche, laß mich fort von deiner Insel. Du fühlst nicht, was mir geschah. Laß mich fort, jetzt oder bald, bald. Ich will geduldig warten, was du über mich verhängst.
KALYPSO (Aufbrausend)
Geduld, du? Oh, ich will dich schweigen lehren. (Klatschend, laut rufend) Ho, ho! In die Tore. Du kommst, ich schone dich, und schon wimmerst du? Hund, Hund. (Die Vogelleute[,] aufgescheucht, machen sich an einer niedrigen Klippe zu schaffen, an der ein schwarzes Eisentor angebracht ist. Sie flüstern sich zu: – »[V]erspielt. Gönn’ es ihm. Ist brav, Freundchen, gehst hinein, hüpfst hinaus. –«) An der Qual sollst du dein Heimweh stillen. Deine Mutter, die Pein und Angst, soll dich streicheln. (Schüttelt ihn mit bitterem Munde. Aus dem offenen Tor dringt nun schwerer Qualm. Der Musiker wirft sich auf die Erde. Die Vogelleute, einige mit schmerzlichem Murren, andere mit höhnischem Grinsen, zerren ihn, binden ihn auf den Rücken einer Schildkröte fest, die ihn bis an das Tor trägt. Kurz vor dem Tor reißt er sich los und folgt aufrecht Kalypso. Die Tiere und Begleiter sträuben sich am Eingang, stellen sich auf, werfen sich halb erstickt an dem Tore hin, bleiben dort liegen. Kalypso geht hinein, das Seil des Mannes um den rechten Arm gewunden. Die Flöten blasen von neuem. Ein kurzes Schreien aus dem Tore verstummt bald.)
Drittes Gespräch:Auf purpurnen Decken
Von der Frage der Musik
(Die Grotte der Kalypso. Ein bläuliches Schimmern und Aufleuchten. Der Boden feine Steinmosaik. Dicht am hohen, aber sehr engen Eingang ein brennender Altar. In einer seitlichen Vertiefung der Grotte zwei Ruhelager, purpurbedeckt; davor ein niedriger Tisch. Neben dem Altar Hörner, Flöten, Trommeln, Lauten. Vor ihm betet Kalypso, die Hehre der Göttinnen, in den Schnee der Priesterin gehüllt, mit breiter Stirnspange und Gehängen, verbrennt murmelnd Fleisch, betrachtet die Eingeweide. Weißbekleidete Vogelfrauen bedienen sie. Nun geht Kalypso langsam zur Nische hinüber, an das Lager, gegenüber dem des Musikers. Ihn umhüllt eine schwere, altgriechische Tracht, schwarzblau und ohne Schmuck. Sie ruhen stumm [einander] gegenüber.)
KALYPSO
Du sagst, Du seiest Musiker. Erzähl mir von der Musik.
MUSIKER
Wir feierten ein heiteres bräutliches Spiel auf unserem Schiff. In meiner Trunkenheit nannte ich mich Odysseus, der nach Kalypsos Gestaden fortverlangte, wollte den reichsten Kranz von ihren Händen. Oh, unsrer Lustfahrt, unsrer Wehfahrt! Ich hasse Dich, daß Du mich nicht verstehst. Wir haben nichts gemein. Sieh, dies muß ich dulden, daß viele Dinge Herr über mich sind, aber daß dir meine Seele verfallen will –
KALYPSO (Gleichg[ü]ltig)
Du wolltest von Musik sprechen.
MUSIKER
Ich verachte sie. Es gibt viele Arten des Todes wie des Sterbens. Aber daß Du, auf der der starrste Tod liegt –
KALYPSO (Klatscht in die Hände.)
Feuer schüren!
MUSIKER (Beißt sich auf die Lippe.)
Mißversteh mich nicht, Kalypso.
KALYPSO (Lächelt)
Ich versteh dich. (Pause)
MUSIKER
– Du wolltest von der Musik hören.
KALYPSO
Oft wollen wir von ihr sprechen. Du sollst mir alles von ihr sagen, was Du weißt. –
MUSIKER
– Es spricht sich schwer von ihr. Sie ist, fast scheint mir, eine Brücke zwischen Sein und Nichtsein. – Sie ist auch mehr etwas Unnennbares, Unwirkliches, als irgend etwas anderes Wirkliches. Es läßt sich schwer begreifen, wenn man einen Stein, einen Baumstamm, einen Tierleib sieht, was sein Leben ist – wie dies lebt, was bewirkt, daß es lebt, die Augen öffnet, wächst. An der Musik begreift man es vielleicht. Das formlos Regsame, das Unsichtbare, Durchsichtige, Blasse ist – sie selbst.
Wirklicher, wirksamer ist sie, als etwas Wirkliches. Ein Mensch kann schlafen, erstarren, sterben; sie schwimmt dahin, unablässig, wird nimmer etwas als schäumen, schimmern, glimmern. Sie zeigt, was Unsterblichkeit ist. – Willst du mir gefällig sein?
KALYPSO
Nein.
MUSIKER
Laß deine Flötenbläser kommen.
KALYPSO
– Wenn mein Lehrer mir nicht grollt, fahre ich fort.
MUSIKER
Ich aber will dich fragen: Was lockt Dich zur Musik? Lockt Dich etwas zu ihr?
KALYPSO
Sieh, ich denke gern an Musik. Wir sind hier einsam, »wir«, »der starrste Tod«. Und es ist, wie Du sagst. Sie ist mehr wirklich, als irgend etwas Wirkliches. Ich kann an einer Bildsäule vorübergehen, eine farbige Wand nicht beachten; aber die Musik ist aufdringlicher, sie verlangt mich, sie will. Sie faßt mich bei den Händen und wühlt sich in mein Haar ein. Das Gehör muß ein geselligerer Sinn sein, als das Gesicht; kürzer mag der Weg zur Seele sein durch das Ohr, als durch das Auge. Und so macht Stille die Einsamkeit einsamer als Leere. Wo Musik ist, erfüllt sie die Gegenwart, daß ein lachendes Bild zur blöden Grimasse wird vor einem Trauergesang; sie kann alles zur Lüge machen und zaubert wahrhaft, daß ich Eifersucht fühle. Sie verdunkelt jede Landschaft, verteilt Gewitter, ist Herrin über Sonne, Mond und Gestirne. Und eine fürstliche Kunst ist sie. Ich muß die Schweigsamkeit lieben, aber wenn es mich nach einer Stimme verlangt, zu wem soll ich sprechen, wer soll zu mir sprechen?
Ich lasse die Menschen nur in der Musik an mich herankommen. Sie redet in großem, feierlichen Ton von ihnen, ohne Umschweif, sachlich, streng überlegen, ohne Wort für das Bestimmte, Kleinliche, Peinliche. Ein vielsagendes Mienenspiel geht über ihr Gesicht.
MUSIKER (Schweigt)
– – Ich bitte Dich um Verzeihung, wenn ich dich im Stillen unterschätzte.
KALYPSO (lacht)
Ihr betet zu einem Gott, einem einzigen, ihr Sparsamen, der die Kraft besessen hätte, glaubt Ihr, die ganze Unermeßlichkeit der Welt zu schaffen, die doch von Urbeginn war und keines Schöpfers bedurfte. Nun, was sich euer Meistergott am köstlichen Vorabend des ersten Schöpfungstages dachte – der dunkle Plan der Schöpfung – das Brüten über dem Riesenei – mag wohl von Art der Musik gewesen sein –.
MUSIKER
Du redest so fein. Aber du redest in Bildern, Kalypso. (Kalypso sieht ihn an.) Ich sage, dies ist eine rätselvolle Kunst und ein Land, dessen Schluchten und Pfade keiner kennt, mag er auch wochenlang vom Morgen bis zum Abend drin gewandert sein.
KALYPSO
Wir wandern viel, aber immer führt uns ein Weg und immer der Weg.
MUSIKER
Doch träumen wir zuviel, wir lassen unsern Geist in [Farben] sprechen. Wie ist dies möglich, wie ist die Musik gleichsam wirklichkeitsschwanger, wie kann sie gleichsam sprechen, die keines Wortes mächtig ist? Töne gehen hin und her. Wie saugt sie sich schwellend voll mit Leben, daß sie als Vorform der Welt erscheint und als Mutter und zeugender Gott? Dieses »Gleichsam« ist eine Schlucht, in die ich oft gestiegen bin.
KALYPSO
Setz dich zu mir. – Sollen meine Flöten blasen?
MUSIKER
Bitte. – Ich frage nicht ins Leere hinein. Die Musik ist wohl die freieste aller Künste. In jeder Kunst wachsen Pflanzen, die nicht in der Erde wurzeln, schlagen Kobolde, die keine Mutter gebar, einen Purzelbaum. Wirres Fabeltier waltet da, verschlungene Begebenheiten, die dämonisch durch geballte Nebel fratzen. Man nennt die Herrichter solcher Werke Phantasten und schilt sie, daß sie sündigen Umgang mit Wolken trieben. Gibt es ein Tier, das so wirr gestaltet, ohne Gleichnis wäre, wie ein Lied? Ist ein Phantast so phantastisch wie ein Musiker? Seine Arbeit spottet der Wirklichkeit und ihres Reichtums. Du kennst die Freunde der Weisheit, die Herrlichen, die dein Land einmal trug. Einer unter ihnen nannte die Nachahmung die nährende Erde der Kunst. Viele dachten seine Gedanken nach. Die Kunst sollte die Natur nicht treffen, sondern übertreffen. Allen irdischen Dingen sollte im Künstler eine zweite Hebeamme erstehen. Er sollte ihr Wesen, ihr halb von der Umwelt erdrücktes Wesen ans Licht heben.
KALYPSO
Ich bin nicht stolz auf sie, meine allzuklugen Landsleute, die naseweisen. Sie hielten unsere Erde für ein Krüppelhaus. Nichts auf Erden verirrt und verfehlt sich, denk ich. Die Trauer, die Armut, die Schwäche täuscht sich damit.
MUSIKER
Nun möchte ich Deine anmaßlichen Weltweisen fragen, – sie wissen auf vieles eine Antwort, zum wenigsten ein Wort[,] und können auch Hohn ertragen –: Welcher Natur spielt Musik, die gleichnislose, beispiellose, die hilfreiche Freundin in den Geburtswehen? Ist Musik dann noch Kunst in ihrem Sinn und nicht vielmehr weniger oder ganz anderes als Kunst? Die Musiker haben sich stolz die Werkzeuge selbst gerichtet; eigenherrlich wandeln die Töne ab. Nun stimmt die Musik mit nichts überein.
Woher, wenn sie prahlend über die Wirklichkeit haust, nimmt die Musik den Sinn und bleibt nicht, was sie ist, ein krankes Auf und Ab? Sie saugt sich schwellend voll mit Leben? Was macht sie zu diesem Gleichsam fähig? Oder ist das Gleichsam geträumt? Und doch will, wie Du fühlst, dieses Wirrste des Wirren einen Hellblick in die Welt und unter ihren Boden tun, begreifender als die Sprache, gebärdet sich gar als Auftakt der Schöpfung.
Nun siehst Du, Kalypso, die beiden Punkte, die ich male. –
KALYPSO
Fast auch die Linie zwischen ihnen.
Viertes Gespräch:Die Meerfahrt
Von den Tönen und Geräuschen
(Die Meerfahrt. Das offene graugrüne Meer. Starker Wind. In einem Vielruderer mit schlagendem Segel lugt Kalypso am Steuer. Der Musiker hält ein Tau, springt lavierend herum; er ist jetzt ohne Nasenkette.)
MUSIKER (Kalypso zujubelnd)
Kalypso, Δῖα ϑεάων!
[KALYPSO]
– Die nun, welche dem jähen Verderben entronnen waren, –
MUSIKER
Krochen auf der Erde herum und holten sich den Tod.
KALYPSO
Und taten gut daran.
MUSIKER (In gleichem Ton)
Andere aber wandelten sich in Getier, in Vögel und Kröten.
KALYPSO (Gelassen)
Liebes Kind, Du bist noch nicht reif dazu. – Gestern Abend soll einer stundenlang am Strand gestanden, die Hände gerungen haben; er schluchzte und predigte – den Fischen.
MUSIKER (Wirft sich auf die Steuerbank.)
So laß ihn predigen. Ich glaube Dir nicht mehr und Deinem Gesicht. Du wärst mir zwar schuldig, zu verraten, was um Dich und so um mich ist. Aber nun beginnt mich dein Schweigen zu beruhigen. Ich habe manchmal Lust, dich zu trösten.
KALYPSO
Weil dich Narren nichts vor dem Grabe des Olympiers anpackte, in der Klippe, weil ich noch immer deiner schone, um – mit Dir zu plaudern.
MUSIKER
Die Säule auf dem Grabe dröhnte, der Rauch stieg zwischen den Steinquadern auf.
KALYPSO
Er brennt unten, nichts verbrennt ihn, nichts erstickt ihn. Wohl dir, daß du vor ihm betetest.
MUSIKER
Der Mund seines Bildes auf der Säule war in schrecklicher Wut verzogen. Aber Du sahest auch die lange Schmerzfalte, die sich zwischen den weitoffenen Augen aufstellte; und darum, Kalypso, weintest Du und wandtest Dich wortlos.
KALYPSO (Kalt)
Du Weiser. (Legt sich, die scharfe Seeluft einziehend, weit zurück.) Es gibt größere Rätsel als Deines der Musik. (Steht auf, ruft hart in den Schiffsraum.) Zieht an! Ihr schlaft! Wind, Wind[,] oh, Meer, Meer! (Sie reckt sich.) Die Fische beneide ich, die Algen auf dem Wasser; am meisten die Sturmmö[w]en. Ich möchte ein Segel sein, oder ein scharfes Schiffskiel. Nicht sachte und hündisch vorwärts traben, durch die fließenden Wellen drängen, den bittren Wind zerschneiden. (Über das Deck hinjauchzend.) Kastor, steh mir nimmer bei, reiß meine Masten in Stücke, leg die Bretter aufs Wasser. Kastor! Kastor[,] mein Schwesterkind! (Sie sitzt wieder lachend am Steuer, zum Musiker.) Auf der der starrste Tod ruht.
MUSIKER (Küßt inbrünstig ihre Füße.)
KALYPSO
Sieh dieses steife, schwere Rot dort. Es gibt Sturm.
MUSIKER
Was brauche ich Musik?
KALYPSO (Nachdem sie lange geschwiegen haben, schweratmend.)
So sprechen wir. Ich war nicht immer so wie jetzt; ich schwamm sonst meines Wegs, wie am glatten Himmel ein federleichtes Wölkchen. Nur zu wissen gelüstete mich schon sonst. Wenn die Masten sich biegen, die Segel heulen und scharren, mein Gewand sich wie ein Hengst wirft und aufbäumt, bebt in mir die Lust, vieles zu begreifen, und die Sucht, mich in die Dinge einzufinden. Aber manchmal glaubte ich: [Der,] in dessen Knien alle Bestimmung ruht, habe eifersüchtig und furchtsam alles für sich behalten; in kleine Gärtchen habe er uns gesperrt.
MUSIKER
Das Ungeheuer, das diese Welt ist, hat ein gar weiches Fell; wir sinken ein und können über kein Härlein schauen. (Das Schiff schlingert stark. Ein auf- und abschwellendes Rollen, Pfeifen und Brüllen geht über das Meer.)
KALYPSO (Freudig lauschend)
Meine Festmusik! Verstehst Du sie? – Wer kann sprechen von ihr, wer muß nicht singen? – Wer ist es, der so wild über mein Meer jauchzt?!
MUSIKER
Kalypso, ja, es jauchzt!
KALYPSO
Oh, meine Festmusik. Das Meer singt. Es sind die Töne des Meeres, die herüberkommen.
MUSIKER
– Auch ich habe nie ohne Erschütterung dem Meere zugehört. Um dieses, um das Singen der Dinge bin ich schon manchmal geschlichen. Aber die Dinge enthüllen sich nicht gern. – Wie unendlich sie verbreitet sind, die Töne in der Welt. An Masten, Giebeln, scharfen Halmen, Dachfenstern hängen die Töne wie Schwalbenscharen; die Luft scheucht sie da auf. Die Luft ist eine schamlose Diebin, wo sie sich durch Spalten stiehlt, erhebt sie noch laut ihre Stimme. Die Luft steigt auf und schwimmt mit den Meeresströmen. Wärme und Kälte sind ihre Herrinnen; sie führen sie, heben, senken sie; im Rollen der Erde wird sie umgeschleudert und gleitet fort. Wärme und Schwingen der Erde wirft die Luft herum und gegen Masten[,] Giebel, scharfe Halme, scheucht die Schwalben auf.
Letzten Endes muß ich den heißen Stern, die Sonne, Mutter der Töne nennen.
KALYPSO
Wohl gleitet die Luft hin; die schweren Gemische schüttern, die die Unrast treibt. Sie schlitzen sich wie Haifische an Korallen den Leib auf, an Schiffen und Klippen[,] ringen noch mit sich und wimmern vor Schmerz. Während wir sitzen, geht die Luft, die riesige Wanderin, über das Weltmeer, mit bloßen Füßen, naß schleppenden Gewändern. – Aber vergißt Du nicht das Kind über der Mutter? Vielleicht klingt kein Ton ohne die Luft, aber der Ton ist etwas anderes, als die Luft. Wenn meine Perlen zusammenschlagen, so klirren sie; die Barke dröhnt vom Ruderschlag. Die Dinge sind es, die an der Luft tönen. Eines ist der Ton, das andere das Ding, das tönt. Wo die Dinge rasch gegeneinander dringen, »entsteht« der Ton, – das Geräusch, wie Du es nennen magst. Und kein Laut fällt, wenn sie ruhen. Vielleicht sogar, daß auch das Ruhende tönt, daß alles tönt, weil alles gegeneinander drängt – wenn auch zu fein für unser Ohr. Das müssen seltsame Geräusche sein, in denen das wachsende Gras erklingt. Ach, was mag hören, wessen Ohr sich stark bewaffnete, also wie das Auge mit scharfen Linsen.
MUSIKER
Wir hören wenig. Du nanntest das Gehör einen geselligen Sinn; so nenn ich ihn, darum weil er ein beschränkter, enger Sinn ist, der sich in nahen Grenzen ergeht. Es muß verschiedene weite und enge Gehörsbezirke geben, gleich Terrassen, die trichterförmig in die Tiefe führen; und so erscheinen auf jeder Stufe aufwärts größere umfassendere Klänge und breitere dickere Töne, vielfach eigentümliche Musiken auch, unfaßbare, fremde Musiken.
KALYPSO
Der Ton ist etwas anderes als die Luft und die Dinge. Wie aber sind die Töne mit den Dingen verbunden? Die Dinge bewegen einander, drängen einander; da summt der Ton auf, aber er – er bewegt nichts; eine Todgeburt, aus der Vermählung des Lebendigen erzeugt. Er ändert nichts, ist ohnmächtig. Die Luft dreht Mühlen, der Ton leistet nichts. Ich dachte mir einmal, ein Teil der Kraft, mit dem ich das Ruder auf den Bord schlage, geht in das Dröhnen auf, aber der Ton paßt in keine Rechnung, keine Kraft wird in den Tönen frei. So können die kraftvollen, rüstigen Dinge, schloß ich, wenn auch verbunden mit den Tönen, nicht Ursache der Töne sein. Wenngleich sie so innig unlöslich mit den Dingen verbunden sind, wenngleich es doch die Dinge sind, die tönen. Die Wellen schlagen gegen die Bretter, es klatscht, meine Ketten klirren, wo ich mich erhebe; ich stoße mit der Faust auf das Steuer; nun dumpft es. Mit also erstaunlichen Gaben sind die Dinge ausgestattet; wunderbares lauert hinter ihnen. –
(Die Schiffer im Bug des Vielruderers singen eine kurze sich unendlich wiederholende Tonreihe im Takt der Ruder. Die Windbewegung läßt nun nach. Kalypso und der Musiker lauschen eine lange Zeit. Kalypso sinnt mit rückwärts geworfenem Kopf.) Weit trägt ein Ton; löst die Enge des Raums, sprengt eherne Mauern. Regsam ist er, ein Feind des Todes, haucht seinen Geist kühl hin über die Landschaft, ehe er versinkt in das Leblose des ungeheuren Schweigens. – Ich will mich nicht daran verlieren. Wo eine Kraft gegen die andere sich spannt, reißt sich der Laut los. Nichts tönt selbstwillig aus sich heraus. Nur in Wehr und Gegenwehr; der Laut ist ein Begleiter des Kampfes. Der Schlegel hämmert gegen das Fell, der Bogen sägt und reißt an der Saite, die Luft schüttelt an den Stäbchen; und wo die Zerstörung sich rüstig ans Werk gibt, spreizt sich der Laut. Er wächst nicht mit der Wut des Kampfes. Das machtlose Blech lärmt, schwere Taten geschehen lautlos. So lose also bindet sich Ton an Kampf. –
Die Kämpfer selbst, ja das ist es, der Stoff, der Stoff, er tönt. Das Meer tönt in seiner Art, der Stein, das Holz, das Silberblech. Es ändert nichts am Ton, ob der Olympier auf dem Metall gezeichnet ist, oder Sophokles oder ein Räuber. Wie für das Auge nur Farbe und Form gilt, so für das Ohr nur der Stoff – und seine Bewegung. Der Ton zeigt hinter das Sichtbare, das Fühlbare, enthüllt ohne Scham tief Verborgenes. Verrät uns nicht die Stimme, erröten wir nicht, wenn wir uns hören? Einbegriffen, hineingerissen in das Zeitliche und Geschehen ist der Stoff selbst, hineingerissen ist unser Wesen selbst und kann sich nicht zurückhalten. Wir liegen hell bestrahlt an der Sonne, gestreckt und nackt liegen wir da; gefordert, gejagt aus unseren Hütten und Höhlen. Blühen geschehend in das Geschehen hinein. – Das Formlose, Ungestaltete, die Wasser, die Steine, die Lüfte haben kein Werkzeug zum Tönen, sie tönen selbst und ganz hingegeben. Nur das formvoll Lebendige, Weiche, hält sich zurück; nun hat sich sein Eigenton in eigenen Ort geflüchtet und schwingt in der Stimme. Soll ich staunen, daß die unirdischste der Künste, die Musik, die Kunst auch der plumpen, rohen Stoffe ist? Das Selbstgeständnis der Stoffe höre ich aus den Tönen. –
Sieh, mein Freund, ich glaube, daß viele Rätsel der Musik auch leicht wiegen gegen dies: das Tönen der Dinge, und sind wenige lockender. – Wir hören den Eigenton der Dinge nicht, denn zwischen zwei Dingen lallt er auf, und immer ist jedes Bewegte zugleich tönend und tonerzeugend. Alles Stoffliche ist tonbegabt; aber die Einsamkeit hat keine Stimme; immer ist der Ton das Zeichen der Gemeinsamkeit. Wir hören nie einen Ton, sondern einen Tonverband. Und dies besagt, daß der Stoff und die Einsamkeit nicht ist, daß das Tote nicht ist; gut und licht sind die Wege, die der Ton uns führt. In der Bewegung, im Kampf, in der Beziehung erweisen die Stoffe ihre Wirklichkeit, da lallt der Ton auf, flattern die Schwalben. Der Stoff ist nicht und die Kraft, es sei denn der Stoff als Kraft, das heißt im Kampf; das sagt der Ton.
MUSIKER
Aber wie wenig wünschen wir zu hören. Wir sinnen mehr über die Sinne, als über die Dinge. Wir suchen das Wissen auf so wenigen Wegen. Das Leben huscht an uns vorüber, ein süßer köstlicher Knabe, nach dem niemand gegriffen hat.
KALYPSO
Seh ich recht, so sind es auch nicht diese zwei allein, die sich berühren, zwischen denen der Ton aufhaucht, nicht Einsamkeit, nicht Zweisamkeit ist der Boden, auf dem Töne blühen. Ein gestoßenes Blech tönt anders, wenn es an einem Faden hängt, anders, wenn meine Hand auf ihm liegt, anders, wenn es platt gegen die Erde drückt. All diese Umwelt stimmt und bestimmt den Ton.
Er ist ein großer Realist, der alle Umstände und Nebendinge in Betracht zieht. Wie scharf er viele Beziehungen aufdeckt. Kürzer begreift der Ton, als der Begriff. Streng und fein geben die Dinge über sich Auskunft. Unbestechlich, ohne zu irren, sprechen sie die Wahrheit. Man nennt zwar die Dinge stumm, und weniger sprechen sie freilich als die Weisen, aber eindeutiger, klar hallt ihre Sprache. Nicht wahr, ich verstehe Eure Musik; Ihr Musiker sucht jedem Lebendigen, das Euch lockt, Hörbarkeit; was Euch bewegt, sucht Ihr in Töne zu fassen. Nun sieh, ein Wort bezeichnet die Bewegung, doch hat der Wortton nichts mit der Bewegung zu tun; ein Lied folgt einer Lebensweise, doch bezeichnet, begreift es nichts; ein Geräusch ist beides: Wort und Lied zugleich; Geräusche, so seltsam es klingt, – sind vollendete Musik.
MUSIKER
Wohl, der Blütenkranz und die Krone der Musik sind sie. Das ist die weiteste und tiefste Musikantin, die Welt. – Ja, es ist die Lebendigkeit selber, die den Ton bildet. Im Ton erscheint Beziehung nicht als Begriff, sondern leibhaftig. Was zwischen den Dingen ist, tritt selbst als Ding auf: Mehr von Gedankenart ist das Tönen, als von Dingart. Die Art des Dinges ist nicht Art des Lebens und nicht der Wirklichkeit. Dies sah ich noch nie so zuvor. »In Tönen denkt die Welt.« Noch kann ich nicht fassen, wie viel aus diesem Satze folgt. Doch lächelst Du so ernst[,] und so ahne ich manches. Und wenn die Dinge tausendfach, streng in sich gezogen, abgequadert gegeneinanderstoßen, so nicht der Ton, der nie von einem stammt: er philosophiert, erkennt die Grenzen an, doch blickt er drüber weg; sagen die Dinge, Formen, Farben und Gestalten: »Ich«, so der Ton: »Du«, »Wir« und »Sie«, und höhnt jener kindlichen Besessenheit.
KALYPSO
Ich mühe mich zu wissen, wie die Töne sich mit den Dingen verbinden. Doch wie verstehe ich diese Bindung, und was will diese Bindung? Was bedeutet das Tönen der Dinge? Und das Tönen in der Welt? Keine Kraft der bewegten Dinge geht in ihnen auf, sie leisten nichts, heben keine Lasten. Wenn ich müde träume und meine Hände mit den Steinen spielen, wie mit kleinen Tieren, und sie klirren und lärmen, drängt es mich unsäglich zu fragen: »Was wollt ihr, kleines Volk?« Kraftlos ist auch die Farbe. Die Farbe hängt auf allen Dingen, ein fadenscheiniger dünner Mantel; die Dinge wissen kaum, wie sie zu ihnen kommt; Lug, Bosheit ist in ihr; sie flattert ratlos und spöttisch. Doch der Ton nicht so; streng und fein spricht er die Wahrheit, beichtet. Was soll dies? Warum, warum? Der farbige, tönende Punkt, der in keine Rechnung paßt! Warum seufzen wir Körper, singen, warum jubeln wir? Wenn ich dies weiß, so weiß ich vielleicht, was das Tönen der Dinge, das Tönen in der Welt soll. Dinge gibt es, die beben glücklich auf, wenn ich sie berühre, andere scharren, murren und grunzen, manche schreien schmerzlich gell, manche ducken sich widerwillig mit den Schultern und bleiben unzugänglich stumm; und einige rascheln auf, als warteten sie nur auf die Berührung. Verschieden ist die Empfindlichkeit der Dinge. Kaum vermöchte es einer, dies zu deuten, hinter das Geheimnis der Töne zu kommen. – Wie vielfach ist die Welt, wie quälend tief ihre Rätselhaftigkeit.
MUSIKER
Oh, Kalypso, dies wirst Du nicht rasch lösen. In diesen Garten läßt uns Zeus nicht gern ein. Vielfach ist die Welt und seltsam ausgestattet. Das Ineinander des Vielfältigen, Gereihten, die Wurzel der Verflochtenheit ist gut verschüttet, kein Dichter hat sie je berührt. –
(Das Schiff hat gewendet und rudert langsam dem Lande zu; die Schiffer singen noch immer.)
Kalypso, ich will froh sein, daß ich Dir von meiner Kunst sprechen darf. – Oft wollte ich Dich Märchenerzählerin schelten und Fabulantin. Doch ich täte Dir Unrecht; Du gehst ja aufrecht, wo ich stolpern müßte. Man verlernt zu denken, wenn man, wie ich, über das Denken denkt, und sieht nichts. Du sahest gar nicht den Balken, mit dem meinesgleichen sich den Weg breit verlegt. Nicht Deine Frage nach der Verbindung der Töne mit den Dingen hätte mich gequält, sondern nach der Verbindung mit – mir. O der endlosen Wirrnis und Falten, in die fällt, wer sich hier des Mutes begibt. Ich und die Töne! Sieh, ich sage: Der Ton ist nichts dem »Ich« Fremdes; er gehört zu meiner Lebendigkeit. Ich bewege die Glieder, ich rufe in die Luft, ich höre den Donner: dies ist alles einerlei und – ich. Die Weisen, die sich um die Frage quälten, was den Dingen gehört und was mir, haben den Dingen alles geraubt und alle Herrlichkeit der Welt über das Ich gehäuft. Aber es ereignete sich da etwas Wunderbares. Es machte einer das Maul auf, einer, das Ich, sie sättigten es, immer mehr; es schluckte mit tiefen Zügen die ganze Welt ein; die füllte es bald bis auf die Haut aus, so daß das Ich nur noch eine dünne Schale um [ihren] Magen war; gespannt platzte sie; die Welt sprang wieder heraus, leckte die armseligen Reste mit der Zunge auf. – Was lebendig an mir ist, ist in der Welt; wenn alles in dies Ich gezogen wird, so wird wohl alles Empfindung des Ich; das Ich sitzt dann auf dem Schemel und bläst die Soloflöte – wie einst im Mai. Aber dann wird schließlich auch das Empfindende selber empfunden. Dann ist auch der Mensch kein denkendes Wesen, sondern selber ein Gedachtes. Und hier hört der Sinn auf. Das Empfindende kann nicht das Empfundene zugleich sein, weil dies heißt: Empfindungen sind da, ehe sie da sein können; erst das Empfindende macht ja etwas zur Empfindung. Es war vorauszusehen, wohin der übertriebene Hochmut führen würde, sich in dem Andern, statt im Ich das Andere zu erkennen; das Schauspiel mußte sich vollenden, in dem das Ich Stufe um Stufe erstieg, die Welt in die Luft blasend, keinen anderen Gott zurücklassend, als diesen einen: »Ich«, den düsteren Selbstherrscher, den Gott von eigenen Gnaden, den betrogensten aller Betrüger und den stummen folgerichtigen Selbstmörder. Jenes denkende, das formende Ich ist zerschlagen, aufgelöst in einen ungeheuren schimmernden Spiegel. Nun sättigt sich die ganze Welt an dem alten Ich, das Umwelt und Mitwelt geworden ist, jetzt nicht mehr Überwelt. Wir sind von dieser Welt, sie ist mit ihren Formen kein Lug und kein Schein, sie ist nicht nur unsere Welt. Vom Ich bleibt nichts zurück als das Wort und vielleicht ein Gedanke, ein gedachter Standpunkt über das Leben. Dir, Kalypso, hängen nicht solche Ketten an den Knöcheln. Du gehst schwesterlich unter den Tönen und Dingen, dem Anderen, und furchtbarer, rätselhafter erscheint dir das Andere dieses Anderen, das Eine, das Ich.
KALYPSO
Du verzeihst mir: nicht ganz konnte ich Dir folgen. Auch höre [nur,] wie schön und trauervoll die Ruderer singen. – Was sprachst Du von den Tönen und jenem Ich?
MUSIKER
Vielmehr muß ja ich Dich um Verzeihung bitten. Aber nicht leichte Worte finden sich für die strengen Meinungen. Laß mich lieber einfach fragen: Was ist eher: das Hören oder der Ton? Offenbar das Hören; denn man wüßte nichts vom Ton, wenn man nichts hörte. Aber doch denkt wohl zu kurz, wer so denkt; denn das Hören erweist sein Vorhandensein doch erst am Gehörten. Ohne daß ich ein Etwas höre, ohne den Ton – höre ich nicht. Das Tönen ist alles, was wir haben; das Hören haben wir nicht, sondern machen wir. Das Gehör ist nicht eher als das Gehörte. Denn das Hören ist – überhaupt nicht. Es gibt keine Empfindungen. Der Ton ist alles. –
KALYPSO
Und wie nützt ihr solche Kenntnis, die ich nur schwer durchschaue; denn ich weiß nichts von den Kämpfen, aus denen sie sich erhob?
MUSIKER
Wir sind bald am Land. So ist unsere schöne Fahrt zu Ende. Auch mir und Dir bedeutet diese Kenntnis etwas; und du bist, wenn du nicht auf deinen Reisen meinem Pärchen »Hören« und »Tönen« begegnet bist, einem Andern begegnet, aus demselben Geschlechte, wallfahrend gemeinsam, mächtiger anzusehen als jene, und auch reicher gekleidet, fesselnd in jedem Schritt; dem Menschen und der Musik. Dies ist die Erkenntnistheorie der Musik.
KALYPSO (Lächelnd)
So werde ich noch den Wert so unterirdischer Maulwurfsarbeit begreifen. (Erhebt sich und äugt über das fast glatte Meer.) Jetzt ist die schamlose Diebin, die Wanderin mit den bloßen Füßen von uns gegangen.
MUSIKER (Auch lächelnd)
Unsere Segel hängen schlaff. Die Schwalben sind eingeschlafen.
Fünftes Gespräch:Die Fischpredigt
Von der Tonleiter
(Der MUSIKERam Strande, allein. Es ist morgens.) Ich weiß nicht, was sie jetzt schaffen mag, ob sie betet, singt oder im Arm eines ihrer sonderbaren Freunde liegt. Sie ist zwar göttlich, aber sie ist ein Weib, und ich – ich fange an, alles Menschliche von mir abzulegen; die Unsterbliche färbt auf mich ab. Ich bete nicht, doch ich singe, pfeife und liege, wenn ich mag, im Sand. Ich spiele ihren Hofnarren und Verlustierer. Was nützt auch das Greinen! Ich stelle mich sacht und fest auf meine zwei Beine und erwarte, wie ein alter Mann, das Ende.
Liebe Fische, seid gut zu mir, laßt uns die letzte Zeit miteinander vertreiben. Ein neuer, sehr unheiliger Antonius, will ich Euch predigen. Ihr seid taub und stumm; herzlich gewogen bin ich Euch. Ihr seid ja Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, denn Ihr habt meine Freunde gefressen. Ich weiß, Ihr liebt mich nicht, weil ich Euch entgangen bin, und war doch so schmackhaft, wie Kalypso findet. Nun, ich will mir Eure Liebe erwerben, indem ich zu Euch rede, von Dingen, die Euer Innerstes treffen; zu Euren Fischherzen rede ich von dem Zusammenhang der Töne. Ihr seid taub und stumm; Euch sage ich etwas Neues, Befremdliches, innig Rührendes.
Ein Ton, seht, das ist vieles auf einmal. Ich will Euch nicht sagen, wie er zu den Dingen steht, denn das weiß nur Kalypso. Aber er ist eine bestimmte Höhe, eine bestimmte Stärke, von einem bestimmten Stoffklang, von einer bestimmten Länge. Vielleicht weiß einer unter Euch noch etwas. Ihr mögt mich unterbrechen, denn ich ertrage ruhig jeden Widerspruch von Euch, meine Freunde und Totengräber. Was eine bestimmte Länge, eine bestimmte Stärke ist, wißt Ihr. Ich kann Euch aber nicht sagen, was eine Höhe und Stoffklang ist – und so habt Ihr zu staunen. »Was ist blau?« – Und solch Unbeschreibliches sind auch die Töne. Da sperrt Ihr die Mäuler auf; ja, lauscht meiner Märe, werft Eure Beschränktheit von Euch, geht in Euch! Ach, in Euch, da ruhen meine Freunde; grüßt sie auch herzlich, wenn Ihr sie trefft.
Dies melde ich von einem Ton; ganz anders steht es mit zweien und vielen. Ein Ton, ein Pfiff hängt einen Augenblick lang in der Luft, stürzt im Moment haltlos, wie getroffen zur Erde. Doch sind viele, so beginnt der Reigen der Töne, und wie der Ton aufhört, hebt schon der nächste an, folgt der dritte, und so drängen sie sich und schlüpfen eng beieinander, daß des Steigens und Sinkens kein Ende ist, und ein Strömen entsteht, ein sicheres Fliegen. Was bindet die Töne aneinander, die vielen Töne, wie kommen sie zusammen? Denn sie folgen nicht fremd aufeinander, sonst würde jeder wie der einzelne ohne Halt leblos zur Erde stürzen. Ich frage nach der Ordnung und Fesselung der Töne, die den Namen Musik führt. Wenn ich davon sprach, wie lebensnah dieses tönende Ab und Auf sei, wie es sich fast gebärde als Auftakt der Schöpfung, so stelle ich die bestimmte Frage, die Vorfrage: Was reiht die Töne aneinander? Wie werden Töne zu Musik? –
Es gibt Bilder und Vorbilder des Zusammenhanges in der Zeit. Das Leben selbst tritt machtvoll hervor. Die Zeit, die Bewegung, das Werden kommt nicht von außen zu den Dingen hinzu; kein Punkt im Dasein, keine Gegenwart läßt sich vereinzeln. Die Gegenwart ist unvollständig, die Dinge sind lebendig. Das Wirken und Verursachen drängt niemand den Dingen auf. Es ist die Wirksamkeit und Ursächlichkeit dem Wesen der Dinge so wenig fremd, daß das Wesen sich vielmehr erst im Ablauf erweist, die Beziehungen es bestimmen. Darum darf ich jener Lehre lachen, die von der Unfreiheit in der Welt, von Zwang und Notwendigkeit spricht. Das Wesen bestimmt sich in den zeitlichen Beziehungen, in Ursachen und Wirkungen, wird nicht bestimmt. Niemand tut uns Gewalt an; von Ewigkeit her sind wir davor geschützt. Nichts kann uns geschehen. Wie soll ich trennen: Leiden und Tun? Schnellzüngige meinen, eins zwinge das andere, töte es, bereichere sich. Ich habe schon viele Menschen, Tier und Pflanzen welken sehn; aber war ihr Vergehen etwas anderes als eine Lebensweise? Der Tod ist eine Lebensäußerung, nicht unterschieden von jeder früheren, von Essen, Springen, Lachen. Ich leide Tod? Ich tue Tod. Aber diese Worte haben Schnellzüngige erfunden. Es gibt nur ein Geschehen. Keins greift in die Sphäre des andern störend ein; nichts ist, jedes erweist sich erst. Sie laufen alle glatt wie geölte Scheiben nebeneinander. Das »Größte« und »Kleinste« ist gleich. Keine Sklaven leben und keine Herren. Es gibt keine Macht über das Andere, und deshalb gibt es keinen Kampf in der Welt und keinen Frieden. Denn wie soll Kampf und Frieden sein zwischen dem, was sich nie berührt[?] [D]ie Welt ist nicht aufzuhalten, sie ist nicht fertig, immer unwirklich; sie wächst. Während ich hier stehe, lodert die Welt, eine grelle Brandfackel, durch alle Räume. –
Jedem zeitlichen Zusammenhang dient das Leben zum Vorbild. Doch wenn in der Welt die Dinge sich selbst lebendig entwickeln, so nicht die Töne in der Musik. Der Ton ist fertig, rund, glatt, aufzuhalten; er klingt auf, vergeht und ist spurlos verschwunden; er ist satt, eine leblose Masse, weist nicht hin auf Vergangenheit noch Zukunft, hat weder Eltern noch Kinder. Der Ton ist ein Atom. Die Aufgabe, mit der sich Weise quälen, wie aus gleichartigen ruhenden Atomen die buntscheckige, rastlose Welt sich bilde, erwächst darum dem Schöpfer der Tonwelt. Ist der Ton verklungen, so hat er ausgelebt, spurlos: die Musik muß den Tod des Tones aufheben, um zu sein; der Spur des Lebens folgend, muß sie ihn mit Wirksamkeit und Ursächlichkeit ausstatten, ihn seiner Einsamkeit entreißen. –
Etwas Seltsames, höchst Erstaunliches begibt sich hier; denn im Ton ist, wie mich Kalypso lehrte, das Zueinander der Dinge leibhaftig geworden; der Ton stellt selber Lebendigkeit dar; darum eben unterliegt er nicht mehr den Ursachen und Wirkungen, darum hebt er keine Lasten, dreht keine Mühlenräder. Und so begibt sich das Erstaunliche, doch Begreifliche, daß er, der Träger der Beziehlichkeit und des Lebens, selbst tot erscheint, weil kraftlos und kein Packträger. Die Musik muß aber, will sie ihn lebendig machen, ganz mißverstehen, zurückbilden, unter die Dinge stoßen! – Au[s] dem Zwang zu diesem Mißverständnis wächst die Musik. Es gilt, die Unvollständigkeit des gegenwärtigen Tones zu erzeugen. Echte Unvollständigkeit, nämlich das Wesen entwickelnde, bleibt dem Ton versagt, dem fertigen, runden, glatten. Die falsche Unvollständigkeit preist das Volk überall: sie tritt auf in der Ursache als in einer wirklichen Sache, welche wesensfremd, das andere Ding von außen stößt und bewegt; »Ursache«: das ist schon »erste Sache«.
Wie nun kann ein Ton gleich einem Ding mit solcher äußeren Ursächlichkeit ausgestattet werden? Ich will mir solchen Versuch erdenken. Es »bewegt« der Ton, der die andern übertönt und beendet: dies erweckt nämlich den Anschein, als hätte er sie zum Schweigen gebracht, zum Schweigen bewegt. Ein Nach-Bild, ein Schein des Zusammenhangs muß geschaffen werden. Denn da die echte Unvollständigkeit den Tönen versagt ist, kann Musik nur menschenherrlich sein. Und der Zusammenhang der Töne bestimmt sich nicht als Schöpfung und Zeugung, sondern als Satzung und Ordnung. Dies ist nun eins und sehr wichtig: die Übertragung der Scheingesetze der Wirklichkeit auf die Töne, – der Versuch einer wirklichen Nachschöpfung zum Zweck der Kunst. Es findet hier kein blindes freies Spielen mit den Tönen statt, sondern man schafft sorgsam, streng und ernst; man sucht den Tönen dasselbe eigentümliche Leben einzuflößen wie den wirklichen Dingen. Man lauscht ängstlich: gelingt es oder gelingt es nicht? Man erwartet schon glückvoll die Geburt der Musik. Der Tonschöpfer setzt einen Ton und nennt ihn Herrscherton, Grundton. Der ist bewegend, selbst unbewegt. Neben dem mächtigen Ton ist dann für einen andern kein Platz. – Denn eben in der Unduldsamkeit, etwa der Länge, der Stärke, der Höhe, zeigt er seine Würde und den Anspruch seiner Macht – es sei denn, der andere nehme seinen Willen an. Dies heißt: er ende oder er werde ihm gleich. Der Herrscherton hat ein großes Maul; Kunst übt, wer sich von ihm verschlingen läßt. Die Unverträglichkeit und Überwertigkeit des Grundtons zwingt jeden Nebenton zum Enden, oder was dasselbe ist, zu einem zweiten, der die Unterwerfung des Sklaventons anzeigt, sofern er dem Machtton nicht schon von vornherein glich. So erzeugt er den dritten Ton; der Grundton bildet das Ende der Tonbewegung, die er so verursacht hat, selbst unbeweglich. Dies ist der Grundriß einer Musik, die einfachste Bestimmung der Musik als einer tonerzeugenden, tonverschlingenden Maschine.
Niemand kann König sein ohne Land; die Unterwerfung des Nebentons setzt das Vorhandensein eines Nebentons voraus. Es müssen unabhängig von dem Grundton Töne fließen, fremdwillig, den Musikstoff zu bilden. Jene andern Töne, die der Herrscherton beherrscht, treten, wie er selbst, aus der Fre[m]de hervor. Wenn nun diese fremdwillige Reihe der Töne einsetzt, so muß ich mich entschließen, einen Herrscher zu ernennen, damit das tönende Auf und Ab schwinde, damit die Reihe aufhöre und die Ordnung, der Zusammenhang, die Musik entstünde. Mit jenem sehr lauten oder sehr langen Königston muß ich mich in den Kampf stürzen, ihn festhalten und schützen gegen alle Angriffe. Fällt er, so schwankt der Boden, und das Chaos bricht herein! »Halt, halt!« muß ich über die Reihe rufen. Mit einer Meute hetzt der starkknochige Jäger sein Wild und macht das Feld frei. Statt eines Bewegers und Belebers ist er Beender und Mörder. Der Grundton herrscht nicht über die Töne, sondern erdrückt sie; folgen fremdwillig viele unterschiedene Töne aufeinander, so herrscht letztlich diese wirre Reihe, und Grundton heißt das Ende der Reihe, das er erzwingt durch seine Stärke und Dauer. Er nützt seine Macht von Menschen Gnaden schlecht, wenn er sich nicht selbst an den fliehenden Tönen mißt, sie angreift, sich ihrer bedient und sie sich unterordnet. So wäre nur wenig geschehen mit der Überwertung eines einzigen Tones, um das Chaos zu beenden und aus Tönen Musik zu machen.
Es gilt die Unvollständigkeit des gegenwärtigen Tones zu erzeugen: dieser Satz steht über allen, die einen Zusammenhang fordern; die Welt ist nicht aufzuhalten; sie ist nicht fertig, immer unwirklich, sie wächst. Während ich hier stehe, lodert die Welt, eine grelle Brandfackel, durch alle Räume. So wenig sich der innere Zusammenhang in Tönen geben läßt, läßt sich der äußerliche, scheinbare der Ursächlichkeit nachbilden. Die Fähigkeit jedes Fortschrittes, jede Stoßfähigkeit und Schwerkraft, ist den Tönen versagt; die Töne hier, von einem fremden Willen gereiht, gelangen bisher nachbildend zu keiner Ordnung. Wir steigen vom Himmel zur Erde.
Der Königston, der Grundton stellte an die Töne den runden, klaren Anspruch, ihm gleich zu werden, und dies war die einzige Handlung, in der sich der Wille zur Musik erklären konnte: der Grundton konnte nur enden. Die große Fülle der anderen Töne trat dem Königston gegenüber, nur als andere, schwächere Töne. In der Machtlosigkeit auf den einzelnen Ton einzugehen, ihre Verschiedenheit zu erfassen und sie nach ihrer Verschiedenheit verschieden zu bewegen, lag die tö[d]liche Schwäche des Ursachentons. Herrschen nun muß ein Ton, denn nur in der E[in]heit liegt Ordnung und Zusammenhang. Aber damit Musik entstehe, die sich im Tonverbinden, nicht im Beenden, erweist, muß der Herrscherton dem unterschiedenen Reichtum und der Mannigfaltigkeit der Töne gerecht werden, sich den Tönen nähern. Macht darf dann nicht allein der Königston besitzen, sondern es muß Stärke auch den anderen in unterschiedener Größe innewohnen, damit sie sich ihm vergleichen können. Ein Adelsgeschlecht muß geschaffen werden. Wenn aber von Herrschen und Stärke die Rede geht, so gilt es wohl zu bedenken, daß niemand stark heißen kann in sich, sondern nur gegen anderes, weil sich Stärke in den Leistungen beweist und danach bemißt. Die unterschiedene Kraftgröße der verschiedenen Töne wird musikalisch nur darum gefordert, weil die Töne sich vergleichen sollen, damit so eine Herrschaft, das ist Zusammenhang, entstehen möge. Gefordert wird hier die Kraft überhaupt nur um des Kraftverhältnisses willen, gefordert wird das Kraftverhältnis. Zusammenhang soll geschaffen werden; nicht also kann er schon dadurch erreicht werden, daß den einzelnen Tönen verschiedener Wert verliehen wird. Der Zusammenhang der Töne liegt ganz in der Bewegung eines auf den andern; der einzelne Ton hat nur Sinn als Träger und Übermittler einer Bewegung. Die Frage: »wie läßt sich die Beziehung der Töne regeln?«, verdichtet sich jetzt zu der: »welches Maß läßt sich für die Bewegungsgröße finden?« Um die Bewegungsgröße von Tönen zu messen, bedarf es eines Tonmaßes, denn die Töne kann man so wenig mit der Elle messen, wie eine Dichtung mit dem Steingewicht. Es gibt nun wohl ein festes Maß, um genau das Beziehungsverhältnis der Töne voneinander zu bestimmen, das Verhältnis der sie erzeugenden Schwingungen; doch ist dies kein Maß der Töne, sondern eben der Schwingungen. Ich weiß also, wenn ich frage: »wie ordnet man die Töne hintereinander, wie mißt man ihre Bewegungsgröße?«, daß daran alles Messen im Tönenden seine Grenze findet, daß nur das Greifbare, Sichtbare sich willig der Zahl unterwirft. Es kann nur Spielerei bedeuten, sagt man, dieser Tonfortschritt klinge wie 1:1 oder 1:2. Es gibt kein Tonmaß.
Die Weisen und Durchforscher der Natur haben ihre Stimme erhoben und vermeint, es gäbe ein solches Maß der Bewegungsgröße, man brauche es nicht schaffen, sondern nur finden – in der Natur; eben da[s] Maß sei die Zahl der Bewegungsgröße des tonerzeugenden Stoffes. Sie reden davon, daß jeder Ton »entstehe« durch eine Anzahl von Schwingungen des Stoffes, daß derjenige Ton einem andern nahestände, der doppelt so viel schwinge als der andere, näher als einer, der dreimal so oft schwinge, und so ähnlich weiter. Je einfacher das Verhältnis ihrer Schwingungszahlen sei, um so näher ständen sich die Töne an musikalischem Werte. Ich weiß, der Ton ist ein anderes, das harte Ding und die Schwingung ein anderes, – doch sind sie verbunden: es sind die Dinge, die tönen. Und wunderbar erscheint mir darum, daß doppelt so rasche Dingbewegung einen Ton erzeugt, der dem auf einfacher Schwingung ähnlicher klingt, als dem aus dreifacher und fünffacher. Auf die Innigkeit der Verbindung von Ton und Ding deutet weniges so scharf, wie die alte Bemerkung: je einfacher die Beziehung der Schwingungszahlen, um so übereinstimmender die Töne. Doch ist solche Beziehung von Ton und Ding weit entfernt, die Musik zu einer Kunst des unbewußten Zählens zu erniedrigen.