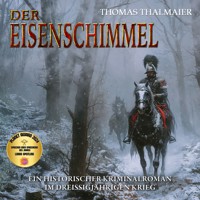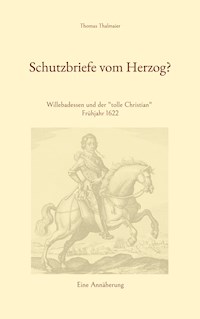
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1622 besetzen Braunschweiger Truppen das Oberwälder Land im Stift Paderborn und quartieren dort, während westlich Kämpfe um Soest, Lippstadt und Paderborn toben. Scheinbar vergessen liegen Stadt und Kloster Willebadessen am Eggerand, als das nördlich gelegene Neuenheerse geplündert wird, während für die Einwohner des südlichen Borlinghausen sämtlich Schutzbriefe gelten, die Herzog Christian von Braunschweig hat ausstellen lassen. Aus welchem Grund wurden diese beiden Ortschaften so unterschiedlich behandelt? Was mag dem zwischen diesen Orten angesiedelten Willebadessen widerfahren sein?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der blinde Fleck
Die Situation des Alten Reichs
Das europäische Theater
Söldner im Lande
Der Heerführer
Die Situation in Willebadessen
Löwen und Borlinghausen
Ein Schuldschein
Thesen
Benutzte Literatur
Anmerkungen
Der blinde Fleck
Gemeinhin gilt der Dreißigjährige Krieg 1618-1648 als eine Zeit der Verwüstung, des Plünderns und Landverderbens, in der Nichts und Niemand vor marodierenden Söldnern sicher war. Ganze Landstriche sollen verdorben worden sein, die Bevölkerung Deutschlands, so heißt es leichthin pauschalisierend, sei um ein Drittel, mancherorts gar um die Hälfte in den Kriegswirren dezimiert worden. So entsteht der Eindruck, Deutschland sei sprichwörtlich nach Gryphius „nunmehr gantz, ja mehr denn gantz verheeret“1 worden – doch so einfach ist die Sache nicht.
Denn erstens konnte der Jenaer Agrarhistoriker Günther Franz (1902-1992) als einer der Ersten schon 1940 nachweisen, dass es sich bei den entvölkerten Landstrichen zwar tatsächlich um menschenleere Regionen, verlassene Gegenden und wüste Felder und Fluren handelte.2 Doch den Grund hierfür fand er in den Wanderungsbewegungen der Bevölkerung, die vor den herannahenden Söldnerheeren flohen oder (ganz im Gegensatz zur kolportierten Meinung) mit diesen zogen, weil sie sich hierin ein besseres Leben versprachen. Oftmals wurden Bauern jedoch auch zum Dienst unter einem beliebigen Feldherrn gepresst. Hunger und Seuchen taten das ihre – in allen Fällen fiel jedoch die Heimstatt wüst.
Zum anderen kumuliert das kollektive Gedächtnis gern die Tatsachen, so dass Fakten nachfolgender Jahre auch an den Anfang einer Epoche gerückt werden. Und so gerät der Befund zum Bevölkerungsverlust des gesamten Krieges schon mal an den Anfang der Reihe der Vorkommnisse, anstatt ihn als Folge der vorangegangenen Jahre zu erkennen.
Dieses kleine Beispiel mag recht profan anmuten, es steht jedoch symptomatisch für die Überlieferung der Geschehnisse des betreffenden Zeitraums zwischen den Jahren 1618 als dem Schicksalsjahr des Prager Fenstersturzes und 1648 als dem Jahr der Verabschiedung des Westfälischen Friedens. So klar das Ende der Ära dieses so genannten „konfessionellen Zeitalters“ ersichtlich ist, so verschwommen sind die Missverständnisse, Versäumnisse, Bündnisse, Staats- und Herrscherfehler, die zum Ausbruch und zur Aufrechterhaltung dieses Krieges führten.
Seit gut einhundert Jahren schwelte zudem der Streit um die Sprache des jeweiligen Bekenntnisses, und dieser Streit machte vor nichts und niemandem Halt, alle waren betroffen, jedermann herausgefordert. Bei derart unzähligen Gründen lässt sich kein zentrales Vorkommnis ausmachen, das sich heute als Urkatastrophe des Dreißigjährigen Krieges identifizieren ließe. Über vierhundert Jahre sind seither vergangen, wer wollte da noch wissen, was den Funken ausmachte, der zuletzt alles in Brand setzte?
Anders als es das Zusammenspiel unglücklicher Zufälle und auch anders als die herbeiargumentierten Gründe für Kriege und Katastrophen späterer Jahrhunderte vermuten lassen, hat die Historiographie in Hinblick auf den Dreißigjährigen Krieg jedoch eine ganz eigene Note. Neben stichhaltigen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Forschung ist sie reichlich durchwoben von Histörchen, Kolportagen, Vermutungen, oft auch freimütig eingefärbten Meinungen einzelner Autoren und recht häufig auch regionalen Legenden wie etwa für die hiesige Region jene des so genannten „Maria Schuß“ in Geseke oder des „Trompetersprungs“ bei Rheder.3 Diese meist mündlich tradierten und erst zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich festgehaltenen Legenden (freilich stets auch gern mit einer Prise Moral gewürzt) spielen nur allzu oft ins Märchenhafte, ja Surreale und sind daher mit Vorsicht zu behandeln. Auch die Legende vom „tollen Christian“ und den Paderborner Libori-Reliquien,4 welche besagt, der Braunschweiger habe, als er 27jährig auf dem Totenbett lag, sich noch der von ihm gewaltsam geraubten Reliquien erinnert und reumütig gewünscht, Gott und seinen Heiligen nicht derart gelästert zu haben, will mir eher als ein Beispiel bester Legendenbildung erscheinen denn als historisches Faktum.
Solcherlei Legenden um die Person des Christian von Braunschweig haben bereits 1926 Heinrich von Xylander und 1929 Hans Wertheim aufzuspüren und zu entkräften versucht. Denn Legenden passen so gar nicht zur historischen Gestalt dieses für seine Zeit hervorragend ausgebildeten und belesenen, bereits in jungen Jahren weit gereisten und studierten Höflings aus dem nicht unbedeutenden Herzogenhaus der Welfen in Braunschweig-Wolfenbüttel.
Und doch ist selbst der Biograph Christians, Heinrich von Xylander, nicht davor gefeit, einer solchen Legende zu erliegen:
„Vielleicht hat er damals eine Tat begangen, von der der Chevalier Aubéry in geschwätziger Übertreibung erzählt, er habe sie sich öfters geleistet: Der Herzog habe, etwa gelegentlich eines Spazierritts einen Dachdecker erblickt, der auf der schwindelnden Höhe eines Kirchturms seine gefahrvolle Arbeit verrichtete. Christian habe den Karabiner seines Begleiters ergriffen und nach lebendiger Scheibe geschossen, bis der Unglückliche vor seinen Füßen zerschellt sei“.5
Xylander rückt diese Episode zwar an den Rand des Fragwürdigen. Doch ist sie ihm auch spektakulär genug, dass er sie nicht aussparen will. Einen Gegenbeweis liefert er nicht, außer entschuldigend anzuführen, ein geschwätziger Chevalier sei es vielleicht, der davon berichte.
Und doch, es ist nichts als Legende. Und zudem auch noch eine sehr schlechte. Denn der so genannte Vorfall lässt sich weder mit den Jahren 1620 bis 1626 als Christians aktiver Zeit als Heerführer in Verbindung bringen noch mit Christian selbst oder auch nur seinem Namen. Es handelt sich vielmehr in sehr auffälliger Weise um die Darstellungen aus Annette von Droste-Hülshoffs Ballade Kurt von Spiegel,6 und, wollte man das Geschilderte zeitlich einordnen, um Vorkommnisse nach dem Jahr 1661, als Ferdinand von Fürstenberg zum Fürstbischof von Paderborn gewählt wurde: Besagter Kurt von Spiegel soll am Ende einer Jagdgesellschaft, zu der Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg geladen hatte, aus Frust über sein miserables Jagdglück und aufgestachelt durch die Häme seiner Jagdgenossen einen Dachdecker (!) vom Neuhäuser Schlossdach geschossen haben, um so trotzig seine Treffsicherheit zu beweisen. Spiegel floh, kehrte jedoch Jahre später zurück, wurde verhaftet und schließlich hingerichtet. Noch heute zeugt eine steinerne, liegende Figur am Giebel eines der Dächer des Schlosses in Schloss Neuhaus von dieser Legende.7
Xylander kolportiert somit unwissentlich eine tatsächliche Legende um Christian von Braunschweig, obwohl das genaue Gegenteil in seiner Absicht liegt. Mangels eindeutiger Hinweise oder (in diesem Fall) lokaler Kenntnis, liefert selbst der um ein positives Christian-Bild bemühte Xylander ganz entgegen seiner eigenen Intention einen Beweis dafür, wie schwer es ist, die historische Gestalt des Braunschweiger Herzogs von den ihm angedichteten und nachgesagten Verbrechen zu trennen.
Derlei will nicht passen zur Gestalt eines Christian, der zum Winter 1621/22 bereits über viele Monate das Flair und den Gestus der zu jener Zeit hochmodernen, weltoffenen und freiheitsliebenden höheren Gesellschaftskreise der niederländischen Generalstaaten im Umkreis seines Schwagers Casimir in sich aufgenommen hatte. Zuvor hatte er bereits über ein Jahr am Hof seines leiblichen Onkels verbracht, des Königs von Dänemark, der zu den mächtigsten Potentaten im Ostseeraum zählte. Christian sprach Latein und Englisch, wohl auch Dänisch. Das Französische indes lag ihm gar nicht. Er war in den bildenden Künsten unterrichtet worden, hatte philosophische und historische, aber auch staatsrechtliche und vor allem militärische Schriften gelesen. Seine größte Leidenschaft war jedoch die körperliche Betätigung: Laufen, Ringen, Fechten und hier vor allem das Reiten. Als Sohn des am kaiserlichen Hof als Justiziar tätigen Herzogs Heinrich Julius (1564-1613), an dessen eigenem Hof in Wolfenbüttel der weithin bekannte Georg Engelhardt von Löhneysen (1552-1622) als Reit- und Stallmeister seinen Dienst versah,8 dürfen wir davon ausgehen, dass Christian bei Löhneysen das Reiten lernte. Die Begabung des jungen Christian für das Reiten mag man auch daran ablesen, dass ihm seine Mutter Elisabeth (1573-1626) ein erstes Pferd schenkte, als er gerade zehn Jahre alt war.9
All das gab ihm schon in jungen Jahren das Ansehen eines Reiterführers, der unerschrocken seinen Regimentern vorausstürmte und einen Ruf beförderte, den sich später der Zwanzigjährige als Kavalleriehauptmann unter Moritz von Oranien erwerben konnte. Das verwegene Reiten war ihm zu eigen, worüber sich Freund wie Feind zeitlebens einig waren. Selbst als nach der Schlacht bei Fleurus am 29. August 1622 körperlich versehrter, einarmiger Reiter genoss er noch ein solches Ansehen, was noch einmal mehr den Nimbus des tollkühnen Christian beförderte, den man seit 1622 an ihm zu entdecken glaubte. Einen Nimbus, von dem zu sprechen Christian hingegen allseits verbot.10
Hinsichtlich der späteren Vorfälle in Paderborn wurde erst in jüngster Zeit wieder der Fingerzeig auf eben jene Ungereimtheiten gegeben, die sich in der Geschichte des Paderborner Landes in Hinblick auf den jungen Welfenherzog Christian ergeben. So etwa wenn der Paderborner emeritierte Historiker Frank Göttmann in seiner Einleitung zur Stadtgeschichte über die vorgefundene Quellenlage schreibt:
„Liebgewordene, farbig ausgeschmückte Feindbilder haben so oft an Überzeugungskraft eingebüßt und erweisen sich nun im nachhinein als gezielte Mythenbildung – wie etwa im Fall des vornehmlich als Räuber des Liborischreins etikettierten ‚Tollen Christian‘ von Braunschweig, der 1622 Paderborn besetzt hielt und dem man dann generationenlang eine maßgebliche Verantwortung für den Niedergang Paderborns aufbürdete“.11
Eine genaue Einschätzung der Charakteristika der Person des Christian von Braunschweig bleibt schwer zu bewältigen. Viele haben sich daran versucht, doch ist es nur sehr wenigen Autoren gelungen, ein ebenso schlüssiges wie differenziertes Bild des Herzogs zu entwerfen. Es saß zudem auch immer der Zeitgeist mit am Schreibtisch, insbesondere wenn Worte über diesen Herzog aus Braunschweig zu Papier gebracht werden sollten.