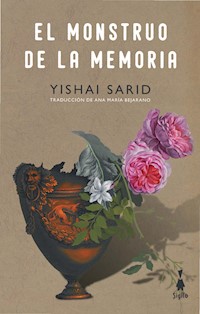13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein junger IT-Spezialist und begehrtester Aufspürer von Sicherheitslücken bekommt immer größere und politisch brisantere Aufträge, verdrängt
ethische Skrupel und kann sich gleichzeitig immer weniger zurücknehmen, sein Können auch privat einzusetzen. Eine erschreckend aktuelle, packende Bestandsaufnahme heutiger Datenkriminalität.
Leicht war es nie: Sivs Vater ist ständig pleite, seine Mutter geht mit einem Arzt fremd, und seine jüngere Schwester ist in die Drogensucht abgerutscht. Auch bei den Frauen kann er nicht punkten. Aber als professioneller Hacker – der Beste und Begehrteste in seinem Fach – wird er auf Händen getragen. Seine Aufträge in Israel und im Ausland werden politisch immer brisanter. Als er in einem europäischen Land ein Abhörsystem für Mobiltelefone installieren muss, um Regimekritiker ausfindig zu machen, kommen bei ihm erste ethische Skrupel auf. Einerseits redet er sich ein, nur seinen Job zu erfüllen – und andererseits kann er es immer weniger lassen, Sicherheitslücken von Smartphones mehr und mehr auch für private Zwecke zu nutzen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Yishai Sarid wurde 1965 in Tel Aviv geboren, wo er bis heute lebt. Nachdem er als Nachrichtenoffizier in der israelischen Armee tätig war, studierte er in Jerusalem und an der Harvard University und arbeitete später als Staatsanwalt. Heute ist er als Rechtsanwalt tätig und veröffentlicht Artikel in diversen Zeitungen. Bei Kein & Aber erschienen bislang seine Romane Limassol, Alles andere als ein Kinderspiel, Monster und zuletzt Siegerin.
Über Das Buch
Nach seinem Wehrdienst möchte Siv endlich das Leben genießen. Er will fremde Länder sehen, etwas erleben. Doch dann klopft plötzlich ein global führender Nachrichtendienst an seine Tür und möchte ihn einstellen. Siv ist nämlich ein Hacker und ein echter Profi noch dazu.
In seinem neuen Job steigt er dadurch rasch auf und bekommt schon bald die brisantesten und aufregendsten Aufträge zugeteilt. Dass diese ihn zusehends an die Grenzen des ethisch Vertretbaren bringen, ist dabei schnell verdrängt, denn endlich ist Siv nicht mehr nur in der Hacker-Szene der Held. Auch im echten Leben bekommt er nun Lob und Anerkennung für sein Talent, und sogar bei seiner Familie kann er mal punkten. Schließlich kann man sich in das System der Firma auch prima außerhalb der Arbeitszeiten einloggen, um als Agent der Gerechtigkeit Gutes im eigenen Umfeld zu tun. Doch dann geht Siv zu weit, und durch einen fatalen Ausrutscher wird der Jäger zum Gejagten.
YISHAI SARID
SCHWACHSTELLEN
ROMAN
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
ERSTER TEIL
Das Handy der Zielperson ist infiltriert. Plötzlich hört man Stimmen, das Bild taucht auf, und der gesamte Inhalt des gehackten Telefons strömt heraus. In dem Augenblick wirken die Kunden immer wie unschuldige Kinder bei einem Zauberkunststück, das sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Das funktioniert bei allen, selbst bei den härtesten und erfahrensten Geheimdienstlern. Ihre Augen weiten sich, der Mund klappt vor Staunen auf, und sie sind glücklich, als hätte man sie in einen Raum voll Schweizer Schokolade geführt und gesagt: Greift zu.
Das sah ich bereits auf meiner ersten Geschäftsreise, zwei Monate nach meinem Eintritt in die Firma. Als Rani Bulka mich im Vorstellungsgespräch überredete, bei ihm zu arbeiten, hatte er mir versprochen, ich würde die Welt sehen und nicht nur im Büro am Bildschirm sitzen. Bulka hielt immer Wort.
Diese erste Reise führte mich nach Mittelamerika, in ein Land voller Wälder und Pyramiden, archäologischer Stätten und bunter Märkte, von dem wir allerdings nicht viel mitbekamen, denn wir waren ja zum Arbeiten gekommen. Wir installierten unser System im Hauptquartier der Geheimpolizei, einem dunklen Steingebäude, das die spanischen Eroberer vor Jahrhunderten errichtet hatten. Während wir den technischen Part übernahmen, traf Bulka sich mit Ministern und Generälen und schloss mit ihnen Geschäfte ab. Als am dritten Vormittag alles fix und fertig installiert war, kam er mit einem Tross Würdenträger, die in ordensbehängten Uniformen und großen Mützen mit goldenen Abzeichen erschienen. Das allgemeine Lächeln und Lachen deutete darauf hin, dass Bulka sich bestens mit ihnen verstand. Er wusste mit Menschen umzugehen. Auch ich mochte ihn und vertraute ihm wie einem großen Bruder. Die Soldaten nahmen Haltung an, ihre Gesichter sahen aus wie alte, dunkle Statuen, während die meisten Generäle weiß waren. Die Höchstrangigen setzten sich vorn auf geschnitzte Polsterstühle, die Untergebenen stellten sich hinter sie und reichten ihnen Kaffee. Alle warteten darauf, dass ich das erste Terminal hochfuhr.
Das war meine Premiere. Bulka lächelte mich angespannt an – oha, aufgepasst, dass jetzt bloß nichts schiefgeht. Ich stand unter Stress, hatte es zwar beim Militär schon tausendmal gemacht, aber damals starrten mich nicht so viele Menschen an, es war wie im Theater. Keiner ist ein größerer Profi als du, sagte ich mir, du machst das doch im Schlaf. Ich konzentrierte mich auf die einzelnen Schritte. Man gab mir einen Zettel mit der Nummer des ersten Ziels. Ich speiste sie ins System ein. Bis vor Kurzem mussten wir noch einen Köder ausschicken und hoffen, dass der Adressat anbiss, aber in den verbesserten Versionen umgehen wir das, er muss nicht mal das Maul auftun, um geschnappt zu werden. Wir fangen ihn über die Protokolle der Kommunikationssysteme, unser System ist darauf programmiert, leise und undramatisch zuzuschnappen. Nachdem ich die Nummer eingetippt hatte, vergingen einige angespannte Sekunden. Die Generäle blickten mich argwöhnisch an, dachten vielleicht, wir hätten sie reingelegt, sie hätten umsonst eine Million Dollar für jedes Terminal bezahlt, zehn insgesamt. Und sogar ich geriet etwas in Sorge, denn der Vorgang dauerte einige Sekunden länger als normal, wegen der langsamen Internetverbindung, die sie dort hatten.
Ich zählte bis zweiundzwanzig, jede Sekunde dauerte eine Ewigkeit, doch dann hörten wir eine tiefe Männerstimme eine Frau ansprechen, worauf beide lachten. Offenbar mochten sie einander, und alle in unserer Runde lächelten erleichtert. Moment, dachte ich, das war noch nicht alles, nun kam auch das Bild aus dem Smartphone, das wir infiltriert hatten, auf den Monitoren: Da waren ein grüner Baumwipfel und ein Stück Himmel – alles, was die Linse des Apparats eingefangen hatte, sahen auch wir. Ich ließ sie den Anblick ein bisschen genießen, bevor ich fix in die Korrespondenzen des Ziels und in die Fotos auf seinem Handy eindrang und diese ebenfalls öffnete. Die Offiziere kriegten sich nicht mehr ein, bestaunten die Bildschirme von Nahem wie ein Zauberwerk, leckten sich schier die Lippen vor Gier. Sie waren selig. Die Daten dieses Mannes rannen süß wie Honig von den Bildschirmen. Bulka flüsterte mir von Weitem »gute Arbeit« zu und stand strahlend vor Stolz zwischen ihnen, als hätte er dem Steinzeitmenschen das Feuer vorgeführt. Auch ich war zufrieden über die gute Arbeit, die wir geleistet hatten.
Ich wusste nicht, wer der Mann war, den wir erwischt hatten. Laut Firmenpolitik dürfen wir das nicht fragen, das hatte man mir als erste Regel nach meiner Anstellung eingeschärft. Jetzt wurden vor uns auf den Bildschirmen Fotos von seinem Handy eingeblendet – er lacht mit Kindern, umarmt seine Frau, ein paar Waldfotos, er schüttelt einige Hände, redet auf einer Bühne mit farbigen Transparenten im Hintergrund –, und unterdessen spielte ich ihnen Tonaufnahmen ab, die ich aus seinem Telefon gefischt hatte, haute auf die Tasten wie ein DJ im Club. Die Begeisterung der Generäle steigerte sich, wie bei Kindern, die noch und noch Geschenke bekommen, sie konnten sich kaum von dem Material losreißen, das aus den Displays floss. Der Mann sah ziemlich normal aus, nicht wie ein Verbrecher, aber ich bin kein Fachmann für menschliche Physiognomien. Ich fragte nicht, wer er sei und warum sie seine Daten so dringend haben wollten. Nun sollten wir sein Bankkonto knacken, und einige Minuten später erfüllte ich ihnen problemlos auch diesen Wunsch. Plötzlich tauchte das Bild einer jungen Frau ohne Bluse auf, und unsere Kunden lachten und schrien wie auf einer Fußballtribüne. »Los, auf zum Essen«, rief einer, und sie schlugen einander auf die Schultern, umarmten Bulka, und der Raum leerte sich, als die Hochrangigen glücklich zum Mittagessen rausströmten.
Wir blieben, um die Soldaten anzuweisen, wie man das System bediente und weitere Ziele fasste. Ich hatte zwei Techniker und die Dolmetscherin Iris dabei, die so fließend Spanisch sprach wie ich Hebräisch. Sie himmelten sie an wie einen Engel, denn sie war bildschön. Uns alle hatte Bulkas Firma aus derselben Militäreinheit rekrutiert, aber Iris kannte ich nicht, sie hatte auf einem anderen Stützpunkt gedient. Im Betrieb war ich ihr mehrmals zufällig im Aufzug oder in der Kantine begegnet, ohne jedoch den Mut aufzubringen, sie anzusprechen. Jetzt arbeiteten wir erstmals zusammen, und als sie meine Worte geläufig ins Spanische übersetzte, sah sie rundum perfekt aus, als wäre sie aus seltenen Stoffen, die in der Natur kaum vorkommen, und nicht aus Fleisch und Blut. Jeder im Raum schien sich in sie verliebt zu haben. Ich versuchte, ihren Blick aufzufangen, um zu sehen, ob meine Hochleistung sie beeindruckt hatte, aber sie schenkte mir nur dasselbe freundliche Lächeln wie den Kunden. Ich wollte ihr schrecklich gern näherkommen. War bereit, den Regierungschef persönlich aus dem System zu fischen, um ihre Bewunderung zu erregen. Bloß ihretwegen nicht wieder in ein Loch fallen, warnte ich mich.
In der fünften oder sechsten Klasse war ich in eine Mitschülerin verknallt, die mich lange nicht beachtete. Eines Tages mitten im Winter gingen wir mit der Naturkundelehrerin runter an den Strand, um uns Krebse und Muscheln auf den Felsen anzusehen. Ich war so verzweifelt bemüht, Eindruck auf die Angebetete zu machen, dass ich voll bekleidet ins Wasser ging, um ihr meinen Mut zu beweisen. Die Kinder lachten, auch sie. Kein Mensch verstand, warum ich so was tat. Die Wellen überspülten mich, ich schluckte Wasser, kam völlig durchnässt heraus und zitterte vor Kälte. Ich hatte nichts zum Abtrocknen und lief weiter mit der Klasse, als ob nichts gewesen wäre. Hinterher lag ich mit Lungenentzündung, hohem Fieber und starkem Husten im Bett. Wann immer jemand das Haus betrat, hoffte ich, sie käme mich besuchen. Jetzt spürte ich, dass ich mich in Iris verliebte, und wieder kroch mir Kälte in die Knochen.
Am letzten Tag drehten unsere Gastgeber mit uns eine Runde durch den historischen Stadtkern. Wir besichtigten die große Kathedrale, die über und über vor Gold glitzerte und angenehm nach Weihrauch duftete. Hübsch gelockte, pausbäckige Engelchen umschwirrten den leidenden Jesus am Kreuz. Iris ging mir ein paar Schritte voraus, sichtlich hingerissen. Ihr Kopf schwang auf und ab und nach allen Seiten, und sie stellte dem Guide haufenweise Fragen, die Augen funkelnd vor Wissbegierde. Wie kann ich sie dazu bringen, sich wenigstens ein bisschen für mich zu interessieren, fragte ich mich, und mir fielen allerlei Faxen ein.
Danach ging es zum Aztekentempel nahe der Kathedrale. Der Guide erklärte, in alten Zeiten habe es hier einen See mit einer Insel gegeben, und laut Überlieferung sei die Stadt an dieser Stelle entstanden. Die Spanier zerstörten den Tempel und bauten daneben die Kathedrale, und erst vor wenigen Jahrzehnten wurden die Reste entdeckt und ausgegraben. Die Spitze der Pyramide war verwittert und das Übrige in die Erde abgesunken, weshalb wir zum Tempel ab- statt aufstie-gen. Auf der obersten Stufe zeigte der Guide uns den steinernen Altar, auf den man einst menschliche Opfer fesselte und ihnen bei lebendigem Leib das Herz herausriss. An den Mauern ringsum schilderten farbige Tafeln den genauen Ablauf in allen Schritten: Zuerst ließ man das Opfer aus einem goldenen Kelch trinken, anscheinend ein Narkosemittel, damit es sich nicht wehrte, dann entkleidete man es, markierte die Position des Herzens nach dem Pulsen und fixierte das Opfer mit Seilen auf dem Altar – ich spürte mein Herz heftig schlagen vor Angst, man könnte mich gleich selbst dort hinlegen –, und dann schnitten sie ihm das Herz aus dem Leib. Auf dem letzten Bild sah man den Hohepriester in der einen Hand das ausgerissene Herz in Richtung Himmel strecken und in der anderen ein blutiges Messer halten. Lange blieb ich dort stehen, die Sache fesselte mich. Alle gingen ganz runter, doch ich verharrte vor den Bildern, bis einer der Techniker mich rufen kam – sie seien hungrig und wollten auf dem Weg zum Restaurant noch über den Markt gehen. Ich suchte Iris, wunderte mich, dass sie sich nicht wie ich für diese sensationelle Geschichte von Leben und Tod interessierte, aber sie stand schon am Ausgang, mit schwarzer Sonnenbrille wie eine Touristin aus Frankreich. Ich eilte zu den anderen, um sie nicht aufzuhalten. Die Begleiter führten uns zwischen Ständen mit bunten Kleidungsstücken und Holzfigürchen hindurch, und meine Mitreisenden blieben stehen und schauten sich die Sachen an. Iris wollte ein Kleid kaufen, die alten Verkäuferinnen mit den komischen Hütchen hielten ihr verschiedene Modelle an den Körper, strichen mit den Händen über den Stoff, bis sie eines mit roten und gelben Blumen wählte. Für wen wirst du das anziehen, flüsterte ich im Stillen.
Das Restaurant lag in einem Innenhof, umstanden von Bäumen mit riesigen, fleischigen Blättern. Der General lud uns zum Abschluss der erfolgreichen Mission und in Aussicht auf weitere Geschäfte zum Mittagessen ein. Auf einer kleinen Bühne spielte eine Band mit Trompeten und Streichinstrumenten Liebeslieder. Ein Sänger in Toreroanzug und Sombrero sang bewegt aus tiefster Kehle. Ich kniff mich, um sicherzugehen, dass ich nicht im Kino war. Bulka saß an der Stirnseite des Tischs neben dem Gastgeber, sie prosteten und lachten. Er fand immer Anklang bei seinen Mitmenschen, weil er stark und ruhig wirkte und Vertrauen weckte. Als ich mich an den langen Tisch setzte, nickte er mir von Weitem zu. Ich wusste, er war zufrieden mit meinem Einsatz auf dieser ersten Reise, und das freute mich. Iris saß mir gegenüber und erzählte den Offizieren an ihrer Seite auf Spanisch von ihrem Leben als Tochter einer Botschafterin, von den vielen Orten, an denen sie als Kind gelebt hatte. Obwohl sie relativ klein war, hatte sie etwas Aufrechtes und Edles, und wir alle schwiegen, wollten nur, dass sie weiterredete und wir sie anschauen konnten. Mich sprach fast keiner an. Das überraschte mich nicht, so war es immer, ich war es gewohnt, schweigend dabeizusitzen und anderen zuzuhören. In der Oberschule war ich einmal drei Tage lang mit dem Bus auf Klassenreise, ohne ein Wort zu sagen. Stellte mir doch mal jemand eine derbe oder auch höfliche Frage, antwortete ich kurz und schlug die Augen nieder. Ich redete ungern über mich und begriff auch nicht, warum das wichtig sein sollte. Die Trompeten schmetterten lauter, der Sänger sang von Liebe, alle tranken viel und blickten auf Iris, die ihnen Schönes über unser Land erzählte. Als der Fleischgang kam, stand Bulka auf und hob sein Glas auf das Wohl des Generals und das der Colonels samt ihren Assistenten und auf das Wohl unseres Firmenteams, nannte unsere Namen, jeder erhob sich der Reihe nach, auch ich, und alle klatschten Beifall. Für einen Moment nahm man mich wahr, was mich verlegen machte, aber auch sehr freute.
Die Firma hatte mich zwei Monate vor meiner Entlassung aus dem Wehrdienst entdeckt. Ihr Headhunter kam als altgedienter Reservist von über vierzig Jahren zu uns, wir nannten ihn »Onkel«, und alle umringten ihn und wollten ihn beeindrucken. Es war bekannt, dass er im Reservedienst passende Leute für die privaten Unternehmen suchte, für die er arbeitete. Unsere Vorgesetzten waren damit einverstanden, weil sie an ihre eigene Zukunft dachten, meinten, er hielte den Schlüssel für ihr späteres Glück im Zivilleben in der Tasche, wenn sie nach ihrer frühen Pensionierung eine zweite Karriere anstrebten. Ich drängte mich ihm nicht auf, war unsicher, ob ich überhaupt weiter auf diesem Gebiet arbeiten wollte. Die Zukunft schien mir verschwommen und kaum planbar zu sein, und ich blickte fast nie über den nächsten Tag hinaus. Ich wollte eine lange Reise machen, ferne Länder sehen, wusste jedoch, dass das wegen Schiri nicht ging, dachte daran, Astrophysik zu studieren, weil ich gut in Naturwissenschaften war und damit zu den Sternen entfliehen konnte. Der Onkel kam und setzte sich neben mich an das Terminal. Ich arbeitete weiter, ohne ihn zu beachten, versuchte nicht, ihn irgendwie zu beeindrucken. Wahrscheinlich hatten die Vorgesetzten mich empfohlen, was mich nicht überraschte, ich wusste ja, dass ich super in meinem Fach war. Als ich zum Mittagessen ging, fragte er, ob er mitkommen dürfe. Wir saßen auf einer Bank am Rasen vor der Milchstube, und er kaufte uns beiden Käsetoast und Saft.
Er erzählte, Bulka komme nicht wie wir aus der Technologiebranche, sondern aus einer der wirklich geheimen Militäreinheiten, von deren Existenz nur sehr wenige wüssten, und habe bei den haarsträubendsten Einsätzen, die man sich denken könnte, häufig sein Leben riskiert. Vor ein paar Jahren habe er beschlossen, Abschied vom Militär zu nehmen und den besten privaten Nachrichtendienst der Welt zu gründen. Anfangs hatte er allein auf menschliche Spionage und Agenten gesetzt, Dinge, von denen er was verstand, aber sehr bald hatte er begriffen, dass die Firma nur mit einer Dienstleistung für technologische Aufklärung zur Spitze aufsteigen konnte. Er erstellte einen detaillierten Plan und nutzte seine Beziehungen, um die richtigen Leute davon zu überzeugen, dass sein Projekt dem Staat dienen, verschlossene Türen öffnen und viele Steuern einbringen würde. Bulka erhielt die nötige Lizenz und richtete eine technologische Nachrichtenabteilung in der Firma ein. »Hier kommst du ins Bild«, sagte mir der Headhunter und erklärte im Flüsterton, das Unternehmen habe bereits ein eigenes System zum Infiltrieren von Telefonen und Computern entwickelt, eines der weltbesten. Aber wie ich ja wisse, müsse man dabei ständig am Ball bleiben, und das Unternehmen rekrutiere die besten Fachleute, um seine Leistung stetig zu verbessern.
Ich zögerte. Wollte an mein Terminal zurück, blieb ihm ungern länger fern, aber ich dachte an Schiri und an Vater und an die häuslichen Probleme und sagte mir, ich dürfte keine Chancen verpassen. Wir saßen draußen in der Sonne, und ich erzählte dem Onkel ehrlich, dass mir die Zukunft schleierhaft vorkäme und ich nach dem Wehrdienst vielleicht eine Reise plante. Er nickte und hörte mir geduldig zu, sagte wie zu einem Kind, er verstehe all das, aber es sei eine außerordentliche Gelegenheit für mich, und viele seien für so einen Job zu allem bereit. Er schlug ein Treffen mit Bulka vor. Ich willigte ein, Ablehnen wäre unklug gewesen. Einige Tage später rief eine Ronit, Personalchefin des Unternehmens, an und gab mir einen Termin mit Bulka, Freitagmorgen in einem Café in der Stadt. Das klang eigenartig, aber der Headhunter erklärte mir, Bulka träfe einen Kandidaten für den ersten Eindruck lieber an einem neutralen Ort, und wenn die Chemie dabei stimme, bestelle er ihn danach in die Firmenbüros.
Als ich dann am Freitagmorgen das Haus verließ, saß Vater in der Küche und fragte, wo ich hinginge. Ich antwortete, ich träfe mich mit einem Freund. Man sah Vater an, dass er meine Lüge durchschaute, aber er sagte nichts, vielleicht dachte er, ich träfe mich mit einer Frau. Das Café lag in einem anderen Stadtteil, am Park, und ich fuhr mit dem Fahrrad hin. Beim Eintreten suchte ich Bulka nach dem Foto, das ich im Internet gesehen hatte. »Er sitzt dort, wartet auf Sie«, sagte mir die Kellnerin und deutete mit dem Kinn in eine hintere Ecke am Fenster. Er las etwas am Handy und lächelte, und als ich näher kam, hob er die Augen und lud mich ein, Platz zu nehmen, entspannt, als würden wir uns schon lange kennen. Ich bat die Kellnerin um einen Kaffee, und er fragte, ob ich keinen Hunger hätte. Ich überlegte kurz, was gut ankommen würde, und bestellte dann ein Stück Kuchen. Ich achtete darauf, ihn manierlich mit der Gabel zu essen und nicht etwa mit den Fingern zu zerkrümeln. Bulka eröffnete das Gespräch, fragte, wo ich wohnte und welche Schule ich besucht hatte, auch ein wenig über die Familie. Ich sagte ihm, meine Mutter sei Krankenschwester, und mein Vater habe allerlei Geschäfte gehabt, sei letzthin aber zu Hause. Er bohrte nicht nach. Vermutlich hatte er seine Nachforschungen bereits im Vorfeld angestellt. »Geschwister?«, fragte er, und ich antwortete, ich hätte eine neunzehnjährige Schwester. »Soldatin?«, fragte er weiter, und ich antwortete, sie sei nicht eingerückt. Er fragte, warum, ich antwortete, aus medizinischen Gründen. Ich wollte nicht lügen, aber auch nicht zu sehr ins Einzelne gehen, und er insistierte nicht. Ich hatte vom Militär eine sehr hohe Unbedenklichkeitsbescheinigung, doch er wollte sich wohl selbst vergewissern, dass sie nichts übersehen hatten, ich kein verkappter Psychopath oder russischer Agent war, sondern einer, auf den sie sich verlassen konnten. Er ging dabei taktvoll vor, ohne Druck, und es gefiel mir, dass er sich für mich interessierte, ich redete jetzt gern ein bisschen über mich. Meine Vorgesetzten beim Militär hielten viel von mir wegen meiner Fachkenntnisse, versuchten aber nicht, mir näherzukommen oder etwas über mein Leben zu erfahren. Bei Bulka war das anders. Er sah mir in die Augen und hörte geduldig zu, ohne mir ins Wort zu fallen. Er fragte, ob mir der Wehrdienst gefiele, und ich bejahte, er bringe mir Erfüllung, was wiederum ihm gefiel. »Hervorragend«, sagte er, »ich habe gute Dinge über dich gehört, von Menschen, die ich schätze.« Er trug leichte Kleidung, wirkte sonnengebräunt und ruhig wie ein Tennisspieler, ich hingegen hatte mich so förmlich wie für ein offizielles Vorstellungsgespräch angezogen und war blass. Trotzdem spürte ich, dass er mich mochte und mehr über mich wissen wollte. Er fummelte nicht an seinem Telefon, blickte auch nicht über meine Schulter hinweg, um jemand Interessanteren oder Wichtigeren auszumachen, während ich redete, wie andere es tun. Er fragte, ob ich gern Sport triebe. Ich sagte ihm, ich führe Fahrrad und liebte das Meer, und als Kind hätte ich Basketball gespielt. Er war kein Schönling, hatte aber interessante Gesichtszüge, alles an ihm war glatt und elegant, und ich meinte kurz, eines Tages könnte ich vielleicht auch so werden wie er. Frauen mögen solche Männer, schoss es mir durch den Kopf. Bulka erkundigte sich nach meinen Plänen. In dieser Gesprächsphase wollte ich schon liebend gern bei ihm arbeiten, er hatte mich mit der Aura des großen Bruders geködert, und ich dachte, wir könnten Freunde sein. Ich erzählte ihm, ich hätte vorgehabt, ein paar Monate auf Reisen zu gehen, bevor ich ins Berufsleben eintrat, so wie alle. Bulka sagte, das sei eine ausgezeichnete Idee, aber sie bräuchten mich schon sehr bald, weil das Unternehmen dauernd expandiere. Sofort sagte ich, das sei kein Problem, hatte ohnehin keinen Reisepartner. Er versprach mir, mich auf Geschäftsreisen an interessante Orte in aller Welt zu schicken. »Studium?«, fragte er. Ich antwortete, ich interessierte mich für das Universum und hätte daran gedacht, Astrophysik zu studieren, aber damit habe es keine Eile, ich wolle sowieso erst im nächsten Jahr anfangen. »Prima«, sagte Bulka, »es würde mich sehr freuen, wenn du zu uns kommst. Ich meine, du würdest dich wohl bei uns fühlen.« Ich spürte Wärme und sagte, ich würde mich auch freuen. Er bat die Kellnerin von Weitem um die Rechnung. Als wir aufstanden, legte er mir die Hand auf den Rücken und sagte, Ronit würde mich anrufen und die Bedingungen mit mir vereinbaren. Über Geld hatten wir überhaupt nicht gesprochen, das war mir unpassend erschienen. Draußen strahlte die Stadt in der Sonne, und ich radelte mit dem Kopf in den Wolken. Auf einmal hatte ich eine Zukunft. Bevor ich die Wohnung betrat, schminkte ich mir das Lächeln ab. Vater saß immer noch am Küchentisch über seinen Papieren, wir brummelten einander was zu, und ich erzählte ihm nichts.
Einen Tag nach der Entlassung aus dem Wehrdienst erschien ich bereits bei der Arbeit. Ronit von der Personalabteilung empfing mich mit breitem Lächeln und sprach die Gehaltsfrage und die Bedingungen mit mir ab. Die Summe, die sie anbot, klang in meinen Ohren derart hoch, dass ich gar nicht daran dachte, noch zu verhandeln, und erst später sah ich ein, dass das etwas dumm von mir gewesen war. Sie ließ mich einen Arbeitsvertrag und allerlei Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben und machte einen Rundgang durchs Gebäude mit mir: Sie zeigte mir die Kantine, die eigentlich ein Spitzenrestaurant war, die Yogahalle, die Kaffeeecke mit Gebäck und Obstkörbchen und die Spiele-Zimmer, erklärte mir, wie man mit Fingerabdruck und Gesichtserkennung von einem Stockwerk zum anderen gelangte, und trat mit mir raus auf die große Terrasse, auf der Liegestühle, Sonnenschirme und Kühlschränke voll mit Getränken und Eiscreme zur freien Bedienung standen. Zum Schluss brachte sie mich in das Stockwerk, auf dem ich zusammen mit anderen Programmierern und Schwachstellenentdeckern arbeiten sollte. Dort standen lange Gemeinschaftsarbeitstische und an der Seite auch schallisolierte Glaskabinen für die, die lieber für sich sein wollten. Sie stellte mich den Mitarbeitern vor. Einige kannte ich vom Wehrdienst, sie waren ein paar Jahre älter als ich. Alle trugen Bärte, und Ronit sagte, nach dem Etagenbrauch müsste auch ich aufhören, mich zu rasieren. Ich dachte, sie meine es ernst, geriet in Stress und sagte ihr leise, ich würde meine Wangen lieber glatt lassen, das fühle sich für mich sauberer an. Ich sah die anderen Blicke wechseln und begriff, dass es ein Witz gewesen war. Ich grinste. Sie sagten »viel Erfolg« und »herzlich willkommen«, aber ich spürte, dass sie mich argwöhnisch beäugten. Vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Ich ging mit Ronit auf den großen Balkon der Etage, und wir tranken Fruchtshakes. Sie sagte, Bulka seien zwei Dinge wichtig, Loyalität und Kreativität, und wer beides mitbringe, werde gut verdienen. Einigen Angestellten habe er schon Aktien gegeben und sie damit zu Millionären gemacht. So einen Arbeitsplatz gebe es sonst nirgends auf der Welt, versicherte sie. Was soll ich sagen, ich war begeistert.
Gleich nach Eingang des ersten Gehalts mietete ich mir eine Zweieinhalbzimmerwohnung in einer ruhigen Straße im Stadtzentrum, nicht weit vom Platz. Daheim war es mir zu eng geworden. Ich hauste bei meinen Eltern auf einer mit Schiebejalousien geschlossenen Veranda, ausreichend für ein Kind, aber nicht mehr für einen dreiundzwanzigjährigen Wehrdienstentlassenen. Vater saß den ganzen Tag zu Hause, seit sein Geschäft pleite gegangen war, ruinierte sich die Gesundheit mit zu viel Rauchen und Essen. In jeder Ecke türmten sich Klageschriften, die man gegen ihn eingereicht hatte. Mutter übernahm lange Schichten im Krankenhaus, um die Familie zu ernähren, kam zu unmöglichen Zeiten nach Hause und ging sofort schlafen. Manchmal musste ich mir die Bettdecke über den Kopf ziehen und die Ohren zuhalten, um den Ehekrach nicht zu hören. Dieser Albtraum war nichts mehr für mich. Als ich ihnen mitteilte, dass ich einen Job hätte und ausziehen würde, nahm Mutter mich beiseite und fragte, ob ich ihnen finanziell etwas unter die Arme greifen könne. Vater müsse Schulden abstottern und Anwälte bezahlen, sei neuerdings auch gesundheitlich angeschlagen. Sie würden alles zurückzahlen, sobald sie könnten, versicherte sie. Natürlich willigte ich sofort ein, schließlich hatten sie mich seit meiner Geburt ernährt und versorgt. Auf meine Frage, wie viel sie brauchten, nannte Mutter eine erstaunlich hohe Summe, rund ein Drittel meines Gehalts, aber ich gab keine Widerrede. Ich räumte alle meine Sachen aus der Veranda, putzte den Boden und schob die Jalousien auf zum Lüften. Danach blieb ich einen Moment stehen und blickte mich um in dem Raum, in dem ich viele schlimme Tage und Nächte verbracht hatte, war heilfroh, hier wegzukommen.
Der Umzugsdienst kam mit einem Lieferwagen, und wir fuhren gemeinsam die paar Minuten zur neuen Wohnung, kaum einen Kilometer weit entfernt. Es gab keine Abschiedsszene, denn niemand bedauerte mein Weggehen, es war längst überfällig. Ich hatte eine ruhige, einigermaßen helle Bleibe gesucht und diese Wohnung auf den ersten Blick für gut genug befunden. Mir gefiel der hohe Baum vorm Fenster, der gerade in voller roter Blüte stand. Ich bestellte ein Sofa und dachte mir, dass es schön sein würde, darauf zu sitzen und ungestört den Baum zu betrachten. Im zweiten Zimmer legte ich die Matratze auf den Fußboden. Mein altes Bettgestell war beim Transport kaputtgegangen, und ich hatte es auf der Straße stehengelassen, wollte ohnehin ein breiteres Bett kaufen, das für einen Erwachsenen passte. In der fensterlosen Kammer installierte ich meine Computer.
Ich richtete mich in der Wohnung ein, kaufte ein paar wichtige Sachen hinzu und fand schnell einen guten Rhythmus. Morgens fuhr ich mit dem Rad in die Firma, etwa zwanzig Minuten, kaufte mir unterwegs einen Kaffee, fühlte mich wie im Ausland. Ich wachte früh auf, blieb morgens ohnehin ungern lange im Bett und traf immer unter den Ersten ein. Meist saß ich lieber in einer der ruhigen Arbeitsecken am Rand der Etage und schloss die Tür, so konnte ich mich besser konzentrieren, aber manchmal riefen mich die Kollegen mit an den langen Arbeitstisch im Großraum. Meine Aufgabe bestand darin, Sicherheitslücken in Telefon- und Computernetzen zu entdecken, damit man diese infiltrieren konnte. Bald schon lieferte ich Ergebnisse. Bereits wenige Tage nach Arbeitsantritt knackte ich ein Sicherheitssystem, mit dem sie sich vor meiner Ankunft herumgeschlagen hatten. Alle erkannten, dass ich wirklich gut darin war und begannen mich zu schätzen, das sah man ihren Mienen an. Einige waren neidisch, auch das spürte ich. Ronit gab mir gute Rückmeldung und sagte, Bulka sei sehr zufrieden mit mir. Mittags aß ich in der Kantine. Das Chefkochessen schmeckte vorzüglich, und ich achtete darauf, mir nicht zu sehr den Bauch vollzuschlagen. Danach trank ich einen starken Espresso und arbeitete weiter, bis mein Gehirn mir das Arbeitsende signalisierte. Gegen Abend radelte ich zurück durch die Boulevards, zufrieden, dass ich gute Arbeit leistete, in jungen Jahren schon so schön verdiente und entsprechende Anerkennung genoss. Ich gewöhnte mich an dieses Leben, es gefiel mir, und ich wusste jeden ruhigen und gelassenen Tag dankbar anzunehmen. Freitagabends besuchte ich die Eltern. Vater wollte mir entlocken, was ich bei der Arbeit machte, und ich log, ich würde mich mit Computersicherheit befassen. In den fünf Jahren Militärdienst hatte ich kein Geheimnis verraten, und ich hatte nicht vor, jetzt damit anzufangen.
Unsere heißeste Zeit kam immer, wenn die Kommunikationsunternehmen ihre Sicherheitssysteme aktualisierten. Sie schlossen Breschen in ihren Mauern, und wir mussten in Windeseile neue schlagen. Wir wussten, dass unsere Kunden auf uns angewiesen waren und es in unseren Diensten keinesfalls eine Unterbrechung geben durfte. Unsere Professionalität und Einfallsgabe waren gefordert, Versagen kam nicht in Frage. An solchen Tagen besuchte uns Bulka auf der Etage wie ein Befehlshaber, der seine Soldaten in den Schützengräben inspiziert. Er verstand nicht viel von unserer Arbeit, wusste jedoch zu motivieren. Wir verbrachten ganze Nächte an den Bildschirmen, setzten alle unsere Tools ein und zerbrachen uns gemeinsam die Köpfe an den langen Tischen, bis wir einen ersten Anhaltspunkt fanden. Ich liebte diese Tage und Nächte, fühlte mich lebendig und gebraucht. Zuerst sah es immer wie eine undurchdringliche Wehrmauer aus, die man mit Öl übergossen hatte, damit wir sie nicht erklimmen konnten. Also begannen wir, ringsum und in den Ritzen zu graben, in den Programmzeilen und an den Schnittstellen nach Schwachpunkten zu fahnden. Fündig wurde man immer an den Rändern, bei einem kleinen Detail, das jemand auf der Gegenseite übersehen hatte. Ich liebte diese Suchaktionen, es war, wie auf hohen Klippen über dem Abgrund zu wandern, an Orten, an die andere sich nicht wagten. Wir arbeiteten zusammen und teilten unser Wissen, aber gleichzeitig wollte jeder derjenige sein, der den Durchbruch schaffte. Oft war ich es, und alle wussten das, auch Bulka. Nach solchen Tagen radelte ich todmüde von der Arbeit nach Hause, sang innerlich jedoch ein Siegeslied: We are the champions, my friends, we are the champions.
Ein paar Kollegen von der Etage luden mich einen Donnerstagabend ein mitzukommen. Sie trafen sich zu Beginn des Wochenendes immer gern zum Biertrinken. Eigentlich wollte ich nicht. Banden von Jungs ohne Aufsichtsperson machten mir Angst. Wer weiß, was für wilde Dinger sie drehten, das war mir von Kind an unheimlich. Sie wollen dich doch nur in ihren Kreis holen, redete ich mir gut zu, geh mit, es wird Zeit, die schlimmen Kindheitserinnerungen hinter dir zu lassen. Sie werden dich schon nicht schlagen oder auslachen oder so was. Noch ein kleines Problem: Ich trinke nicht gern, und doch bestellte ich letztlich Bier wie alle anderen. Wir saßen zu zehnt an einem hohen Tisch draußen auf dem Bürgersteig – besser als drinnen eingepfercht zu sein. Am Morgen hatte ich mich nicht rasiert, denn alle waren Bartträger, und ich wollte daneben nicht wie ein kompletter Lackel aussehen. Ich trank in Ruhe mein Bier und beteiligte mich nicht am Gespräch. Sie redeten über Aktien und Autos, berichteten von Geländetouren mit Fahrrad oder Jeep, einer von ihnen war vom Tauchen auf fernen Inseln zurückgekehrt und erzählte davon. Beim Militär waren sie alle Schreibtischhengste wie ich gewesen, keiner von uns hatte der kämpfenden Truppe angehört, aber jetzt versuchten sie das mit ihren Bärten und Hobbys und Fahrzeugen zu kaschieren.
Als sie von Frauen anfingen, verkrampfte ich mich, spürte meinen Puls schneller werden. Das war ein wunder Punkt, und ich fürchtete, sie könnten bei mir nachhaken. Dem Gespräch entnahm ich, dass sie fast alle auf die eine oder andere Art in festen Händen waren, aber so taten, als suchten sie weiter. Plötzlich erwähnte jemand am Ende des Tischs Iris, die Dolmetscherin. Ich spitzte die Ohren. Sie sähe kühl aus, sagte er, und sein Nebenmann prahlte, auch kühle Frauen könne man erwärmen, er habe da so seine Methoden. Das Gerede widerte mich an. Ein Jerusalemer in der Runde erzählte, sie sei ein paar Jahre unter ihm im selben Gymnasium gewesen, ihre Mutter sei Diplomatin, deshalb hätten sie in vielen Weltstädten gelebt, und daher könne sie mehrere Sprachen fließend. Sie habe als das schönste Mädchen der Schule gegolten und als eine der intelligentesten obendrein. Mit fachmännischem Ernst schloss die Runde, dass sie erstrebenswert war, das aber auch wusste und entsprechend viel von sich hielt. Solche Frauen seien schwer zu kriegen, wie eine gute Aktie, die in aller Munde und daher sehr teuer sei.
Unterdessen landeten Würstchen und Pommes auf dem Tisch. Alle waren bester Laune wegen des anbrechenden Wochenendes. Wir verdienten gut, und die großen Weltprobleme berührten uns nicht. Danach sprachen sie von Bulka und debattierten, wie viele Millionen er schon wert sei. Alle schätzten ihn wegen seiner Klugheit und Männlichkeit, aber man hörte auch Neid heraus. Sie bemängelten, dass er den Mitarbeitern nicht genug Optionen gebe, wollten Könige sein wie er, wollten die guten Fleischbrocken abbekommen und nicht nur Krümel. Über die Arbeit selbst wurde am Tisch nicht gesprochen. Beim Militär hatte man uns auf Geheimhaltung getrimmt, wie man Hunden das Bellen austreibt. Schon meinte ich, den Abend unbeschadet überstanden zu haben. Die Tische ringsum waren besetzt, alle lachten, und die Musik wummerte laut.
Doch dann meinte einer der alten Hasen (er war sicher drei oder vier Jahre älter als ich), ich sei sehr still, hätte den ganzen Abend noch nichts gesagt. Er hatte schon ziemlich viel intus, sein Gesicht war gerötet, die Stirn schweißbedeckt, und seine Augen funkelten trunken und boshaft. Plötzlich richteten sich aller Blicke auf mich. Ich schenkte ihnen das schüchterne Lächeln, das ich hasse: Bitte, bitte seid nicht gemein zu mir und beleidigt mich nicht, ich bin eine gute Seele, schaut, ich wedele sogar mit dem Schwanz für euch, damit ihr seht, dass ich keinem was tue. So hat ein Kind wie ich gelernt, in der Welt zurechtzukommen. Er starrte mich weiter an und verlangte eine Antwort. »Alles in Ordnung«, sagte ich schrecklich schüchtern. Das genügte ihm nicht, und er fragte, wo ich wohnte. »Nicht weit von hier, in der Nähe des Platzes«, erwiderte ich. Mit wem ich dort wohnte, legte er nach. Mit einer Frau, log ich. »Wie heißt sie?«, wollte er wissen wie beim Verhör. Ich verhedderte mich noch mehr und nannte sie Adi. »Aber wir sind nur Mitbewohner«, sagte ich und glaubte, in einem Strudel zu ertrinken. Er fragte, ob ich Interesse an ihr hätte. Ich wurde knallrot, und die anderen lachten und erteilten mir Ratschläge aus ihrem Erfahrungsschatz, wie ich es angehen sollte, um bei ihr im Bett zu landen. Beim Lachen fletschten sie die Zähne wie große Ratten, und ihre Schnurrbärte glänzten feucht vom Bier. Sie wollten mir wohl helfen, mich aber auch erniedrigen. Ich fühlte mich in die Enge getrieben, wie von einem Scheinwerfer angestrahlt. Tat so, als würde ich ihre Ratschläge begierig aufnehmen, nickte ohne hinzuhören, saß auf den Händen und wartete darauf, dass der Lichtkegel endlich erlosch und ich ins Dunkel zurückkehren könnte.
»Junger Mann, kannst mal kurz mit anpacken?«, rief mir eine Stimme nach, als ich am Morgen zur Arbeit gehen wollte und das Rad von dem Pfeiler löste, an den ich es angeschlossen hatte. Der Nachbar vom ersten Stock stand draußen, ein kleiner, kräftiger Alter mit einer Hacke in der Hand, der aussah wie ein zionistischer Pionier von einst. Ich wohnte schon einige Monate im Haus, aber wir hatten uns noch nicht gesprochen. »Sicher«, sagte ich. Ich helfe gern alten Menschen. Er zeigte mir eine Grube, die er im Vorgarten gegraben hatte, und einen Sack Erde daneben. »Hauruck«, rief der Nachbar, wir hoben gemeinsam den Sack hoch und entleerten ihn in die Grube. Er formte eine Mulde und stellte einen schönen, geraden Baumsetzling hinein, drückte mit den Händen die Erde ringsum fest, und ich half ihm dabei. Die Erde fühlte sich angenehm an. Danach goss er den Setzling mit dem Schlauch und erklärte mir, es sei eine Baumart, die nicht viel Sonne brauche, denn dieser Vorgarten liege die meiste Zeit des Tages im Schatten. »Magst du Bäume?«, fragte er. Ich nickte bejahend, was auch stimmte. Ich beachte sie, wenn ich auf der Straße gehe, streichle manchmal ihren Stamm oder reiße ein paar Blätter ab und rolle sie, und wenn sie Blüten haben, rieche ich gern daran. »Ausgezeichnet, dann kannst du mir helfen«, sagte er. Meist staunen andere über solche Ansagen, aber bei ihm bestand ich dadurch seine Prüfung. Er erzählte mir von seinem Krieg für die Bäume: Überall wolle man sie fällen, um neue Gebäude zu errichten, und er rette sie. Schriebe Briefe an die Stadtverwaltung, setze Journalisten darauf an, lege Widerspruch gegen Bauvorhaben ein, sei ein paarmal sogar vor Gericht gezogen und habe gewonnen. Er holte ein Papier aus der Hosentasche, um es mir zu zeigen, hielt dann jedoch inne, wischte sich die erdigen Hände an der Hose ab und entschuldigte sich: »Du hast es sicher eilig, zur Arbeit zu kommen, und ich halte dich auf.« – »Nein, schon gut, ich bin sonst immer als Erster da«, sagte ich.
»Was arbeitest du?«, fragte er. »Mit Computern«, antwortete ich, und er erwiderte freudig: »Ah, genau so einen wie dich suche ich.« Irgendwas stimme nicht mit seinem Rechner, deswegen müsse er alle Briefe von Hand schreiben, und wenn ich bei Gelegenheit bei ihm reinschauen könnte, wäre das großartig, erklärte er. »Sicher«, sagte ich und meinte es ehrlich. Ich mochte ihn und freute mich, endlich mit einem Nachbarn in Kontakt zu kommen. Er drückte mir die Hand, »Noah«, stellte er sich verspätet vor. »Siv«, gab ich zurück. Seine Hand war fest wie die eines Bauern, kein junger Mensch aus meinem Bekanntenkreis hatte so einen Händedruck. »Wir werden große Dinge miteinander vollbringen«, sagte er. »Klar doch«, bestätigte ich, und wir lachten beide. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns verstanden, und war stolz, ihm beim Retten der Bäume helfen zu können.
Schiri erschien am Freitagabend bei den Eltern, nachdem wir sie ein paar Wochen nicht zu Gesicht bekommen hatten. Äußerlich sah sie beinahe okay aus, gekämmt und sauber gekleidet, aber ihr Teint war ungesund. Sie wirkte wie ein verschwommenes Abbild ihrer selbst, fanden wir alle. Mutter nötigte sie dauernd zum Essen, bis Schiri sie genervt bat, damit aufzuhören. Vater traute sich gar nicht erst, sie irgendwas zu fragen, weil er befürchtete, sie würde explodieren und abhauen, wie früher schon oft. Beide hatten sichtlich ihre Probleme, Vater wie auch Schiri.
Wir waren mit der Gewissheit aufgewachsen, dass Vater klug sei und vieles wisse und wir uns auf ihn verlassen könnten. Mutter vertraute ihm, dachte, wir würden eines Tages wohlhabend werden, und arbeitete unterdessen all die Jahre als Schwester auf der Frühchenstation im Krankenhaus. Sie schob haufenweise Nachtschichten, um uns zu ernähren, und war immer müde. Aber sie waren gute Freunde, und wir waren eine fröhliche Familie – feierten gebührend alle Geburtstage, machten Ausflüge, und Mutter hörte gern laute Musik und sang mit, wenn sie die Wohnung putzte. Als wir klein waren, hatte Vater ein Restaurant, das jedoch einging, danach importierte er Elektrogeräte, und später handelte er mit Immobilien. Bei jeder neuen Geschäftsidee hofften wir, nun käme der Erfolg, der uns von der engen Wohnung mit den blätternden Wänden in ein geräumiges Penthaus mit Panorama katapultieren würde. Es endete immer in einer Enttäuschung, aber wir hatten ein Heim und genug zu essen, bekamen Liebe und waren zusammen. Bis das mit Schiri passierte. Wir sprachen nie darüber, wussten aber alle, dass das die Familie zerrüttet hatte.
Zunächst sah es so aus, als würde sie es überwinden. Wir kehrten in den Alltag zurück, ich aufs Gymnasium, Schiri auf die Grundschule, Vater zu seiner Arbeit und Mutter in die Frühchenstation, jeder an seinen Platz. Aber wenn wir gemeinsam zu Hause waren, wagten wir kaum noch, miteinander zu reden, alles war heikel und wund und voller Vorwürfe. Meist schwiegen wir, nur manchmal schrien Vater oder Mutter mich lauthals wegen irgendeiner Kleinigkeit an, wegen eines Kleidungsstücks, das ich nicht weggeräumt, oder Geschirr, das ich nicht gespült hatte, oder auch völlig grundlos, und dann wusste ich, dass sie ihre Wut an mir ausließen und ich es verdient hatte. Schiri hingegen fassten sie mit Samthandschuhen an und verwöhnten sie, aber sie wurde nicht wieder wie früher. Etwa von ihrem dreizehnten Lebensjahr an verschwand sie hin und wieder. Ganze Nächte lang suchten wir sie, sie weckten mich zum Mithelfen, ich lief im Dunkeln durch die Straßen, suchte sie mit der Taschenlampe auf den Hinterhöfen, und erst am Morgen ging sie ans Telefon, sie sei bei einer Freundin eingeschlafen, und versprach, sich beim nächsten Mal zu melden. Ein oder zwei Jahre später – ich kann mich nicht an die genaue Zeitabfolge erinnern – gab sie sich mit älteren Männern ab, allerlei Typen, die zu uns reinkamen. Sie kiffte mit ihnen in ihrem Zimmer hinter geschlossener Tür, und bald stank die ganze Wohnung nach Rauch. Vater wurde ganz verrückt davon, sagte aber nichts. Mutter konnte nicht länger schweigen und verlangte, dass sie damit aufhörte. Die Diskussionen der beiden steigerten sich zu Mordsgeschrei, wir schlossen die Fenster, damit die Nachbarn es nicht hörten, und das Ganze endete unweigerlich mit Türenknallen, wenn Schiri die Wohnung verließ. Vater rannte ihr nach, flehte sie an, nicht wegzulaufen, aber es nützte nichts. Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, herrschte schreckliche Stille. Sie redeten nicht mit mir, aber eindeutig war ich an allem schuld.
Jetzt war sie neunzehn Jahre alt, und als sie am Freitag kam, sahen wir ihr bleiches Gesicht und ihre erloschenen Augen. Vater wollte nach ihrer Hand greifen, aber sie zog sie zurück und sagte, er solle sie nicht anrühren. Mutter bat mich, beim Abräumen vor dem Nachtisch zu helfen, und flüsterte mir in der Küche mit strenger Miene zu, ich müsse etwas tun, sie fürchte, Schiri werde sterben. Als wir danach den leckeren Kuchen, den Mutter für den Schabbat gebacken hatte, und den Obstsalat aßen, wagte ich Schiri zu fragen, wo sie jetzt wohnte, und sie sagte, bei einer Freundin, und schickte mir ein todmüdes Lächeln wie aus einem tiefen Loch. Vater fing an zu husten und ging ins Bad, um ein paar Züge aus seinem Inhalator zu nehmen. Er rauchte viel, hatte auch Diabetes und sah sehr alt aus, obwohl er noch keine sechzig war. Wenn Schiri früher als Baby nachts weinend aufwachte und Mutter Dienst hatte, war ich aufgestanden, um die Kleine zu beruhigen, bis Vater im Pyjama kam, ihr das Fläschchen gab, uns Wiegenlieder sang und bei uns blieb, bis sie wieder einschlief. Seine Silhouette wirkte riesig, wenn er das Zimmer betrat, seine Stimme war angenehm, und nie hatte ich damals Angst vor ihm. Schiri war ein sehr hübsches Kind, alle bewunderten sie, mich weniger, aber ich spürte, dass Vater uns beide lieb hatte.