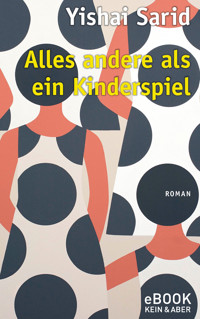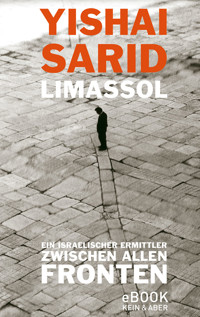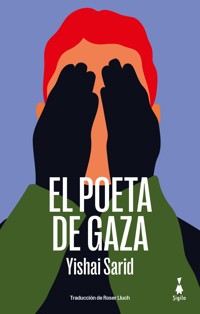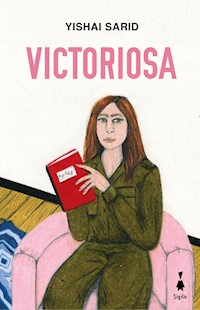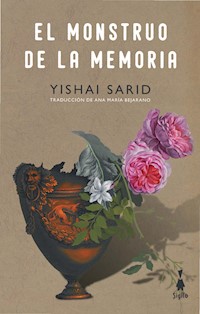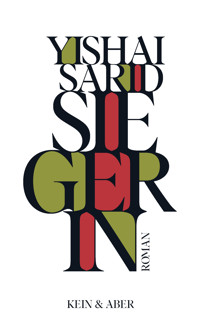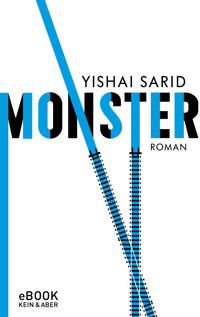
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am Ende des Romans steht eine Eskalation: ein Faustschlag, mit dem ein Tourguide in Treblinka einen Dokumentarfilmer niederstreckt. Doch wie konnte es dazu kommen? In einem Bericht an seinen ehemaligen Chef schildert der Mann, wie die Menschen, die er jahrelang durch NS-Gedenkstätten führte, mit der Erinnerung an den Holocaust umgehen. Er fragt nach der Verbindung zwischen Juden damals und Israelis heute, nach Machtverherrlichung und danach, was Menschen zu Mördern macht. Und er beobachtet Schülergruppen, die sich in Fahnen hüllen, scheinheilige Minister oder manipulative Künstler, er beobachtet, wie ein jeder in dem Grauen der Geschichte vor allem eines zu erkennen meint: einen Nutzen für sich selbst.
Yishai Sarid, einer der bekanntesten Autoren Israels, wirft in seinem Roman ein neues Licht auf die Erinnerungskultur, wagt sich an vermeintlich unantastbare Fragen und stellt in stillem, unaufgeregtem Ton eingefahrene Denkmuster infrage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Glossar
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Yishai Sarid wurde 1965 in Tel Aviv geboren, wo er bis heute lebt. Nachdem er als Nachrichtenoffizier in der israelischen Armee tätig war, studierte er in Jerusalem und Harvard und arbeitete später als Staatsanwalt. Heute ist er als Rechtsanwalt tätig, und er veröffentlicht Artikel in diversen Zeitungen. Bei Kein & Aber erschienen bislang seine Romane Limassol und Alles andere als ein Kinderspiel.
ÜBER DAS BUCH
Am Ende des Romans steht eine Eskalation: ein Faustschlag, mit dem ein Tourguide in Treblinka einen Dokumentarfilmer niederstreckt. Doch wie konnte es dazu kommen? In einem Bericht an seinen ehemaligen Chef schildert der Mann, wie die Menschen, die er jahrelang durch NS-Gedenkstätten führte, mit der Erinnerung an den Holocaust umgehen. Er fragt nach der Verbindung zwischen Juden damals und Israelis heute, nach Machtverherrlichung und danach, was Menschen zu Mördern macht. Und er beobachtet Schülergruppen, die sich in Fahnen hüllen, scheinheilige Minister oder manipulative Künstler, er beobachtet, wie ein jeder in dem Grauen der Geschichte vor allem eines zu erkennen meint: einen Nutzen für sich selbst.
»Das wichtigste Buch, das je hierzulande über Moral und Opferrollen geschrieben wurde.« Navit Barel
»Yishai Sarid kann so schreiben, dass es einem mitten ins Herz zielt.« NDR Kultur
»Ein Schlag in die Magengrube. Ein starkes Buch und ein absolutes Muss.« IDF Radio
Sehr geehrter Herr Direktor von Yad Vashem, dies hier ist der Bericht über das, was dort vorgefallen ist. Mir wurde mitgeteilt, dass Sie einen solchen erwarten, und ich möchte ihn auch erstatten, da Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt haben. Zuerst wollte ich mich selbst ganz ausklammern, den Bericht rein akademisch abfassen, ohne meine Person und meinen Lebenslauf einzubeziehen, die an sich nicht besonders interessieren. Doch schon nach einigen Sätzen merkte ich, dass das nicht gelingen würde, denn ich bin das Gefäß, das die Geschichte enthält, und wenn die Risse in meinem Innern sich zum Bersten verbreitern sollten, wäre auch die Geschichte verloren. Wissen Sie, ich blicke seit jeher zu Ihnen auf. Ich war mehrmals an Debatten und Beratungen beteiligt, die Sie leiteten, Sie haben mir einige wichtige Aufträge erteilt, darunter auch das letzte Projekt. Nie werde ich Ihre bewegenden Worte bei der Präsentation meines Buches vergessen. Ich habe Ihnen nach besten Kräften assistiert, kann mich aber nicht entsinnen, dass wir je persönliche Worte gewechselt hätten. Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, Sie tragen eine schwere Bürde. Ich erinnere mich an den schönen Blick, den man aus Ihrem Büro über den Jerusalem-Wald hat, an den Natursteingeruch der Wände und das gute Tuch Ihrer Kleidung. Ich habe mich stets als treuen Abgesandten betrachtet. Ich sehe Ihr kluges Gesicht vor Augen und spreche Sie als den offiziellen Repräsentanten der Erinnerung an.
Zur Holocaustforschung bin ich aus pragmatischen Erwägungen gelangt. Nach der Wehrentlassung und der üblichen Zeit der Reisen und Zukunftspläne schrieb ich mich für die Studienfächer Internationale Beziehungen und Geschichte ein. Ich strebte eine Diplomatenlaufbahn an, dachte, im Ausland könnte ich unbeschwerter leben. Ich wusste zwar, dass das Ansehen des diplomatischen Dienstes bröckelt, da er im digitalen Zeitalter an Bedeutung verliert, aber ich betrachtete das sogar als Vorteil. Ich sah mich in einer tropischen Stadt im hellen Anzug im Café sitzen und meine Tage in goldener Muße verbringen, mit einem bescheidenen, aber respektablen Gehalt vom Staat. Ich strebte nicht die Rolle eines Stars an, nach dem Straßen und Plätze benannt werden. Ich las gern Bücher über historische Gestalten und Ereignisse, sie beruhigten mich, weil alles darin beendet und besiegelt ist, nichts sich mehr ändern kann. Fiktive Geschichten wurden von einem Menschen und seinen Capricen bestimmt und machten mich unruhig. Im zweiten Studienjahr, mit vierundzwanzig Jahren, trat ich zu den Prüfungen des Auswärtigen Amtes an und bestand mühelos den ersten, schriftlichen, Teil. Beim zweiten Teil, zu dem ich einige Wochen später einbestellt wurde, veranstalteten unsere Prüfer soziale Workshops und listige Spielchen mit uns und interviewten uns zum Abschluss einzeln. Im Verlauf dieses Tages spürte ich mein Scheitern. Ich brauchte den Antwortbrief gar nicht erst abzuwarten, um zu wissen, dass ich durchgefallen war. Eine Zeit lang erwog ich, alles hinzuwerfen und nach Fernost, nach Thailand, zu fahren, weil die Zukunft mir verschlossen schien, aber finanzielle und familiäre Erwägungen (mein Vater war damals erkrankt) hielten mich davon ab. Da der Traum vom diplomatischen Dienst ausgeträumt war, gab ich das Fach Internationale Beziehungen auf, das mich für sich genommen kaum interessierte, und studierte nur noch Geschichte. Es lag mir sehr, mich mit der Historie zu befassen, Arbeiten zu schreiben, zu forschen, stundenlang über alten Schriften in der Bibliothek zu sitzen, in die Cafeteria zu gehen, zurückzukehren – ich schob eine ruhige Kugel und gab mir den Anschein von Ernsthaftigkeit. Ich studierte gemächlich weiter bis zum zweiten Abschluss und entkam der Namenlosigkeit dank einer Seminararbeit in einem Kurs unter Leitung des Dekans, der sie sehr lobte, mich fortan förderte und mir eine Lehrassistentenstelle verschaffte. Ich avancierte zum vielversprechenden Nachwuchshistoriker, was mich mit Stolz erfüllte. Der Dekan sprach von Zukunftschancen, einem Auslandsstudium. Schon sah ich mich in Oxford oder Boston am Kamin sitzen, würdig und bequem altern, und bedauerte die Ablehnung des Außenamts nicht mehr so sehr.
Mir graute vor der modernen Geschichte, die mir wie ein mächtig tosender und schäumender Wasserfall vorkam. Ich suchte Ruhe und Gelassenheit in der Beschäftigung mit frühen Zeitaltern, deren Geschichte abgeschlossen und besiegelt ist und keinen Menschen mehr sonderlich aufregt. Ich erwog, mich der Geschichte des Fernen Ostens zu widmen, bedachte jedoch, dass ich dazu Chinesisch oder Japanisch lernen müsste, aber nur über geringe Sprachbegabung verfügte. Die Turbulenzen und Katastrophen unseres Volkes wollte ich meiden, erahnte schon zu Beginn des Weges die Gefahr, die mir dort drohte. Aber als ich Ruth kennenlernte und merkte, dass wir auf die Hochzeit zugingen, musste ich realistisch denken. Durch gründliches Überlegen kam ich zu dem Schluss, dass mir theoretisch zwar die ganze Menschheitsgeschichte offenstand, praktisch aber nur wenige Lebenswege darin blieben. Die Lehrstühle an der Universität waren rar und von älteren Professoren besetzt, und neue Stellen für auswärtige Lehrkräfte, quasi Leiharbeiter, wurden zu einem Hungerlohn ausgeschrieben.
Eines Tages informierte mich der mir wohlgesinnte Dekan, dass der militärische Nachrichtendienst Iranexperten suchte und einem geeigneten Kandidaten die Promotion in persischer Geschichte finanzieren würde. Allerdings müsste ich mich anschließend für sieben Jahre als Zeitsoldat verpflichten, fügte er hinzu. Ich wusste zwar, dass ich dann in einem Büro im Hauptquartier in Tel Aviv sitzen und nicht zu meiner alten Panzertruppe zurückkehren würde, aber der Gedanke an eine erneute Militärzeit bereitete mir einige Albträume und schlaflose Nächte. Ich teilte daher dem Dekan mit, dass ich nicht interessiert sei, zumal dieses Studium das Erlernen einer schwierigen Fremdsprache erfordern würde. Der Dekan zeigte Verständnis und sagte, dann bliebe mir allerdings nur eine einzige realistische Möglichkeit, als Historiker in Israel zu leben – ich müsste in Holocauststudien promovieren. Davor grauste mir. Ich wollte weiterhin als ruhiger Mensch, sorglos und unaufgeregt, durchs Leben segeln, unternahm einige fruchtlose Versuche, mich dieser Last zu entziehen, und hätte es beinahe geschafft: Eine gute Universität in der australischen Stadt Perth war bereit, mich zum Promotionsstudium in der Geschichte des europäischen Mittelalters zuzulassen, meine Unterkunft zu finanzieren und mir eine Lehrassistentenstelle zu geben. Doch Ruth hatte wenig Lust auf den Umzug, und wir hatten schon einen Termin für die Hochzeit. Wären wir aufgebrochen zu jenen sonnigen Gestaden, zu den Biergläsern, die bereits um vier Uhr nachmittags vollgeschenkt werden, unser gemeinsames Schicksal hätte vielleicht anders ausgesehen. Doch ich kapitulierte. Suchte den Dekan auf und erklärte ihm, ich sei nun willens, mich vor den Karren der Erinnerung spannen zu lassen. Von da an wendete sich fast alles zum Positiven. Ich erhielt ein kleines Stipendium, gespendet von einer jüdischen Familie aus Amerika, das für unsere bescheidenen Bedürfnisse reichte. Ich begann Deutsch zu lernen und konnte nach einigen Monaten amtliche Schreiben der SS lesen und verstehen. Meine Sprachkenntnisse blieben rudimentär, nie habe ich mich an Heine oder Goethe versucht. Hingegen stürzte ich mich auf alle Bücher und Studien, die mir in die Hände fielen. Darin liegt meine Stärke: Ich kann in kurzer Zeit große Mengen an Material verdauen. Mich reizten vor allem die technischen Details der Vernichtung: der Verwaltungsapparat, das Personal, die Methode. Ich vertiefte mich mehr und mehr in die Materie, bis sich das Thema meiner Doktorarbeit abzeichnete und mein Doktorvater ihm zustimmte. Ich hatte meine Laufbahn eingeschlagen.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Arbeitsmethoden deutscher Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg lautete das Thema meiner Doktorarbeit, die ich nun anging. Ich stellte die Vernichtungsmethoden in den einzelnen Lagern nebeneinander – Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek und Auschwitz (natürlich unterschieden die letzten beiden sich darin, dass sie auch Arbeitslager waren, während die ersteren ausschließlich als Vernichtungslager dienten) – und zerlegte sie in ihre einzelnen Schritte. Ich prüfte unter dem Mikroskop des Historikers die jeweils gängigen Stadien, vom Aussteigen aus den Eisenbahnwagen über das Auskleiden und das Einsammeln der Kleidungs- und Gepäckstücke, die Täuschungsmanöver, die die Deutschen vollführten, um die Opfermassen zu beruhigen, das Abscheren des Kopfhaars, den Marsch zu den Gaskammern, die Konstruktion dieser Kammern und die Art des verwendeten Gases, die Vorgehensweise beim Einlassen der Menschen in die Kammern, die Wartezeit, das Ziehen der Goldzähne und die Suche nach Wertgegenständen in den Körperhöhlen bis hin zur Entsorgung der Leichen und der Personaleinteilung für die einzelnen Stationen etc., wobei ich jeweils Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitete. Selbstverständlich gab es auch hier, in jedem dieser Stadien, unzählige Variationen und Abweichungen in den Details. Ich las Hunderte, wenn nicht Tausende von Büchern und Zeugnissen über das Leben und Sterben in den Lagern, vertiefte mich nach besten Kräften in Originalquellen, um bisher ungeklärte Einzelheiten zu verifizieren. Durch die Fülle des einschlägigen Materials navigierte ich bald mit sicherer Hand. Die Programmablaufpläne verzweigten sich zusehends, aber ich verlor nie den Überblick. Zunächst ordnete ich sorgfältig die Fakten, Ruth half mir, spezifische Vergleichsdateien zu erstellen, und dann ging ich der akademischen Frage nach, warum es gewisse Variationen in den Arbeitsmethoden gab und keine völlige Einheitlichkeit, wie nach der Art der Organisation und Aufgabe zu vermuten gewesen wäre.
Nebenher begann ich, aus finanziellen Gründen, Gruppen durch Yad Vashem zu führen. Sie persönlich leiteten die Kommission, die mich dafür engagierte, ich erinnere mich an Ihre edlen Züge und an die Ehrfurcht, die Sie mir einflößten. Sie fragten, warum ich Gruppen führen wolle, und ob ich mir der damit verbundenen seelischen Belastung bewusst sei. Ich antwortete mit einer Halbwahrheit, sagte, es sei eine außerordentliche Gelegenheit für einen Historiker, sein Fachgebiet im Alltagsleben einzusetzen und das Gelernte einer größeren Öffentlichkeit nahezubringen. Dass meine Frau schwanger war und ich meine kleine Familie ernähren musste, sagte ich nicht. Ich erzählte, dass ich gerade meine Doktorarbeit schriebe und schon umfangreiches Wissen über alle Einzelheiten der Vernichtung erworben hätte. Erwähnte in meinem Lebenslauf, dass ich während meines Wehrdienstes Unterricht auf dem Gebiet der Artillerie in der Panzertruppenschule erteilt hatte und danach, an der Universität, Lehrassistent des Dekans der historischen Fakultät gewesen war. Sie und Ihre Kommissionskollegen baten mich, in aller Kürze, wie vor einer Schulklasse, die Geschichte des Warschauer Ghettoaufstands darzustellen. Anscheinend habe ich einen guten Eindruck hinterlassen, denn schon am nächsten Tag hieß es, ich sei angenommen. Ihre Warnung bezüglich der seelischen Belastung nahm ich nicht wirklich ernst, denn ich hatte bisher keine großen Gefühlswallungen im Leben erlitten, hielt mich diesbezüglich für immun. Wie ein Jungstier stürzte ich mich kraftvoll in die Arena. Übernahm sofort Führungen im Museum, in der Allee der Gerechten unter den Völkern, in den Unterrichtsräumen, überhäufte die Kinder mit meinem gesammelten Wissen. Ich besaß eine gewisse Begabung dafür. Bemühte mich, ihnen ein scharfes und klares Gesamtbild, angefüllt mit unzähligen Einzelheiten, zu verschaffen, dabei einigen Hauptsträngen zu folgen, denn auf alle Nebenhandlungen einzugehen hätte sie verwirrt. Die Schüler einer der ersten Klassen, die ich führte, sagten mir, bei mir hätten sie dieses ganze Riesengebiet des Holocausts zum ersten Mal begriffen.
Ich war fleißig und arbeitete meine Vorträge gut aus, erschien niemals unvorbereitet. Ging davon aus, dass sie rein gar nichts wussten und ich ihnen die Erinnerung vermitteln musste. Ich erklärte ihnen die Wurzeln des traditionellen und des modernen Antisemitismus, den Aufstieg des Nationalsozialismus, einiges aus der Biografie Adolf Hitlers und seiner frühesten Jünger, sprach vom Kriegsausbruch, der Entrechtung, dem Einsperren in Ghettos, den Deportationen, der Vernichtung. Gelegentlich packte mich das interessierte Gesicht eines Mädchens oder Jungen oder eine kluge Frage, aber meist kamen und gingen die Klassen, ohne besondere Spuren zu hinterlassen. Einmal, erinnere ich mich, betraten Sie überraschend den Unterrichtsraum, um meinen Vortrag vor Oberschülern aus Rechovot oder Gedera mitzuhören, setzten sich nach hinten, bedeuteten mir fortzufahren, und ich wollte Sie beeindrucken. Der Bildschirm zeigte den Grundriss von Treblinka, und ich folgte leicht und fließend den Stationen bis hin zur Verbrennung der Leichen in den großen Verwesungsgruben. Nach einigen Minuten nickten Sie mir zu und gingen. Später sagte mir die Abteilungsleiterin, ich hätte durch mein Wissen geglänzt, aber Sie hätten auch angemerkt, dass es mir etwas an Gefühl und Opferbezug mangele. Ich bin Historiker und keine Sozialarbeiterin, dachte ich, versprach ihr aber, es mir zu Herzen zu nehmen und möglichst zu korrigieren.
Nach Polen fuhr ich zum ersten Mal während meiner Promotion, um die Orte zu sehen, über die ich Zehntausende von Seiten gelesen hatte. Mein Doktorvater, der Leiter des Fachbereichs Holocauststudien an der Universität, wollte mitfahren, da er über weitverzweigte Beziehungen dort verfügte, erlitt vor dem Abflug jedoch einen Hexenschuss, vielleicht sogar einen Bandscheibenvorfall. Daher flog ich allein, mietete am Flughafen ein Auto und fuhr zwei Wochen lang die Lager ab, stürzte mich begierig auf sie und kehrte mit Hunderten von Fotos und mehreren Heften voll Aufzeichnungen zurück. Bei dieser Tour wurde mir alles klar. Ich erfasste genau, was ich vor mir sah, und diese Erkenntnis versetzte mich in Hochstimmung, eine Art intellektuelle Ekstase. Mit meiner Doktorarbeit kam ich wunderbar voran. Einige Monate später fuhr ich erneut nach Polen, zu einem eurer Kurse für Gruppen-Guides. Nun kannte ich die Orte bereits und fühlte mich dort fast wie zu Hause. Nach meiner offiziellen Zulassung kamen die Anfragen, und ich fuhr immer häufiger nach Polen. Bei jeder Tour verdiente ich ein paar Tausend Schekel, und endlich ernährte ich meine kleine Familie, Ruth und unseren Sohn Ido, in Ehren. Bald darauf, in der Hochsaison der Oberschülerreisen, blieb ich oft einen Monat oder länger von zu Hause weg, weil zwischen den Gruppen nicht genug Zeit zum Heimfliegen blieb. Ruth und das Baby gewöhnten sich an diese Lebensweise, es blieb uns nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, ob Sie diese Jugendreisen je begleitet haben, ob Sie mal nachts mit den Schülern geflogen und dann sieben oder acht Tage mit ihnen unterwegs gewesen sind, ob Sie vor ihnen gestanden und ihnen wieder und wieder erklärt haben, was dort in den Wäldern, den Ghettos, den Lagern geschehen ist, ob Sie versucht haben, ihre Mienen aufzubrechen, in ihr vom Handyflimmern erfülltes Denken einzudringen, ihnen den Tod zu verdeutlichen, ob Sie ihnen Daten und Fakten, Nummern und Namen geliefert haben, während die Jugendlichen Ihnen, in Flaggen gehüllt, nachliefen, vor den Gaskammern die Hatikwa sangen, auf den Erdhügeln Kaddisch sagten, im Gedenken an die Kinder in den Gruben Gedenkkerzen entzündeten und allerlei selbst erfundene Rituale zelebrierten, um ihren Augen eine Träne abzuringen. Oft fragte ich mich, ob Sie das einmal miterlebt haben.
Jede Tour begann auf dem Friedhof in Warschau. Herr Direktor, ich sage Ihnen, darauf sollte man lieber verzichten. Kein Schüler weiß, wer Isaak Leib Perez war und warum man ihm ein so großes Grabmal errichtet hat. Er mag einst ein bedeutender Schriftsteller gewesen sein, aber ich kenne niemanden, der ein Buch von ihm gelesen hat. Die Jugendlichen wissen auch nicht, was Esperanto ist und wer Zamenhof war, und da haben sie das Recht auf ihrer Seite, denn die Sache mit dieser Plansprache ist ja tatsächlich völlig gescheitert. Wir bemühen uns, eine großartige Kultur vorzuführen, aber das ändert nichts an der Wahrheit, nämlich, dass diese Juden, die einst in Polen lebten, keine Kathedralen gebaut und keine Sinfonien geschrieben haben. Die meisten waren kleine Händler, Leute, die Salzheringe aßen, Klezmer-Musik hörten und in Hütten lebten. Erst gegen Ende gab es auch Ärzte und Anwälte unter ihnen, diesen dunklen Typen aus dem Orient, denen, die Jesus ermordet haben. Die Kinder tappen zwischen den Grabsteinen umher, müde vom Nachtflug, wissen nicht, ob man sich schon in die Flagge hüllt oder noch nicht, antworten automatisch Amen, wenn der Lehrer auf jedem wichtigen Grab das Kaddisch spricht, ihnen ist kalt, und sie möchten bloß ins Hotel und einen Hauch Ausland spüren. Vom Friedhof fahren wir sie im Bus dahin, wo einst das jüdische Viertel war, zum Umschlagplatz, und dann zum Kommandobunker der Aufständischen in der Miła-Straße 18. Die waren nur wenig älter als ihr, erkläre ich ihnen, hatten kaum Waffen, nur Molotowcocktails und ein paar Granaten und Pistolen, und damit haben sie beinah einen Monat lang die deutsche Besatzungsmacht aufgehalten. Ich stand vor ihnen und bemühte mich, Leid und Heldentum bildhaft darzustellen, hielt mich an all eure Vorgaben, ohne nach rechts oder links abzuweichen, war ein braves Kind, versuchte mit aller Kraft, die Jeans und die Leggings und die Locken und die Pferdeschwänze und die dicken Jacken und das schnelle, seichte Schwatzen und den apathischen Blick und die Telefone zu überwinden und in ihre Köpfe und Herzen einzudringen. Nie schien es mir ganz zu gelingen, denn dafür liebte ich sie nicht genug, wie ich erst heute erkenne.
Die Nächte im Hotel sind ein Albtraum für die Lehrer. Damit anderntags nicht etwa in der Zeitung steht, Schüler aus Israel hätten in Polen randaliert, Hotelzimmer verwüstet, sich sinnlos besoffen, Prostituierte bestellt, patrouillieren die Lehrer nachts in den Gängen, lauschen an den Türen, drohen den Kindern mit drakonischen Strafen, verbieten ihnen, das Hotel zu verlassen, und haben bei Tagesanbruch vor Schlaflosigkeit gerötete Augen. Aber normalerweise passiert nichts, die Kinder lungern in der Lobby herum, bestellen allerhöchstens Coca-Cola, und danach duschen sie mit dem Shampoo und den Seifen des Hotels, spielen auf der Gitarre traurige Lieder und schlafen wie brave Kinder, sobald es »Licht aus« heißt. Gewiss kommen manchmal auch auffällige Kinder, die eigentlich keine Kinder mehr sind, junge Orientalen mit ihren Bräuten, bei denen – zur Rache an den Gojim und den Aschkenasen – ein kleiner Lautsprecher die ganze Nacht mediterrane Schnulzen quäkt. Sie bestellen Room Service, ohne zu bezahlen, und hinterlassen das Zimmer verdreckt – was das für einen Wirbel auslöst! Ihre Lehrer bitten mich händeringend, die Situation zu retten, und ich eile zu Hilfe, obwohl das nicht meine Aufgabe ist, rede mit den Rabauken, weiß mit ihnen umzugehen, vereinbare mit dem Empfangschef eine akzeptable Entschädigung, beruhige die aufgebrachten Lehrer. Ein schwaches Signal in meinem Gehirn sagt mir, dass diese Rowdys fähig sind zu morden, mit Befehlen jedoch schwerer zurechtkommen, sie wissen sie auch zu verweigern, zu umgehen, Wodkaflaschen ins Zimmer zu schmuggeln, mitten in der Nacht Krach zu machen, aber vielleicht würden sie dafür im entscheidenden Moment – trotz entsprechender Befehle – auch nicht ihren Nachbarn denunzieren, was die braven Kinder sofort tun würden, weil bei ihnen Gesetz nun mal Gesetz ist.
Am zweiten Tag fuhren wir normalerweise nach Majdanek, eine lange Strecke nach Osten, auf der einst Krupp-Panzer rollten, um Lebensraum für das deutsche Volk zu erobern. Kohl- und Rübenäcker bis zum Horizont. Ich weiß, was ein Panzer ist, und kenne das herrliche Gefühl reibungsloser Fahrt, ohne zu bremsen, ohne anzuhalten, im Bauch eines rasenden eisernen Tieres, mit dem man verwachsen ist. Zweimal wird unterwegs an Tankstellen haltgemacht, um etwas zu essen und zu trinken zu kaufen, sonst werden die Kinder nervös. Bekanntlich haben die Deutschen es nicht geschafft, das Lager vor Eintreffen der Russen zu zerstören, und so ist es unversehrt am Stadtrand von Lublin stehen geblieben, gut sichtbar von der Landstraße. In Majdanek schlägt einem sofort alles voll ins Gesicht. Zwei kleine Gaskammern stehen gleich rechts neben dem Tor, in die eine wurde Kohlenmonoxid durch einen Schlauch vom Motor eines Panzers eingeleitet, und in die andere warf man Dosen mit Zyklon B. Hundert- bis zweihunderttausend Menschen hat man dort getötet, die genaue Zahl ist unbekannt. Im Vergleich zu den anderen Lagern ist das nicht viel, aber dort sieht man alles vor Augen, die ganze Prozedur, auch das Krematorium ist heil geblieben, ein Gebäude auf einer Anhöhe mit Schornstein und gut erhaltenen deutschen Öfen, und daneben die Erschießungsgruben, wo man zum Erntefest zwanzigtausend Juden erschoss, um es zur Feier des Tages mal ordentlich krachen zu lassen. Seltsamerweise hörte ich sie gerade in Majdanek, auf dem wenige Hundert Meter langen Weg von den Gaskammern zu Mausoleum und Krematorium, über Araber reden. In Flaggen gehüllt flüsterten sie: Araber, so müsste man es mit den Arabern machen. Nicht immer, nicht bei allen Gruppen, aber häufig genug, um mir im Gedächtnis zu bleiben. Ich stellte mich taub, es interessierte mich nicht, sollten sich ihre Lehrer darum kümmern, aber gehört habe ich es, Herr Direktor, das kann ich nicht leugnen. Zeigt man ihnen diesen einfachen Todesmechanismus, den man problemlos überall und fast jederzeit neu anwerfen könnte, dann regt das ihr praktisches Denken an, und sie sind ja noch Kinder, da ist das natürlich, sie können es schwer stoppen, Erwachsene denken genau dasselbe, schweigen jedoch. Zum Schluss, bei den letzten Gruppen, habe ich die Erklärungen vor dem Bau mit den Verbrennungsöfen gegeben und bin nicht mit ihnen hineingegangen. Ich wollte nicht hören, was sie da drinnen reden.
In Lublin besuchen wir auch die Chachmei Lublin Jeschiwa, in der heute ein merkwürdiges Hotel, verziert mit jüdischen Symbolen, in Betrieb ist. Die Synagoge betritt man durch eine Seitentür, wo man dem polnischen Wärter ein paar Złoty bezahlt. Die Religiösen mit den Häkel-Kippot beten dort gern. Ich stehe abseits und höre zu, manchmal gefällt mir die Melodie, und ich falle bei einem Satz oder Wort mit ein. Danach, in der Altstadt, unterhalb der Festung, lese ich ihnen aus Der Zauberer von Lublin vor, finde selten mal jemanden, der Bashevis Singer gelesen hat – da schimpfe ich schon wieder über die Jugend, aber ich habe nun mal versprochen, die Wahrheit zu erzählen. Ohne die Juden ist nicht mehr viel los in dieser Stadt, ein langweiliger Ort fern im Osten, Touristen kommen kaum, abgesehen von Freaks des Kriegs. In diesem Gebäude hier befand sich das Hauptquartier der Gestapo, in dieser Villa wohnte Odilo Globocnik, der SS