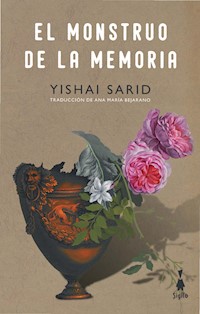12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie lernt man zu töten, ohne daran zu zerbrechen? Als Psychologin berät Abigail seit Jahren erfolgreich das israelische Militär, wie es Soldaten besser auf Einsätze vorbereitet. Doch dann wird ihr einziger Sohn Schauli einberufen, und sie muss sich entscheiden:Was wiegt schwerer, dasWohl ihres Landes oder das ihres Kindes?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Yishai Sarid wurde 1965 in Tel Aviv geboren, wo er bis heute lebt. Nachdem er als Nachrichtenoffizier in der israelischen Armee tätig war, studierte er in Jerusalem und Harvard und arbeitete später als Staatsanwalt. Heute ist er als Rechtsanwalt tätig und veröffentlicht Artikel in diversen Zeitungen. Bei Kein & Aber erschienen bislang seine Romane Limassol, Alles andere als ein Kinderspiel und zuletzt Monster.
ÜBER DAS BUCH
Abigail ist Expertin für die Psychologie des Tötens. Im Auftrag des israelischen Militärs hilft sie Soldaten, den Feind zu besiegen und selbst am Leben zu bleiben – möglichst ohne bleibende Traumata. Auch privat scheut sie keine Kampfgebiete: Ihr Vater, ebenfalls Psychologe, kritisiert ihre Arbeit heftig, und ihre Liebschaften scheinen allesamt ehemalige Patienten zu sein.
Doch dann wird ihr Sohn Schauli zum Militär eingezogen, und plötzlich sieht sie ihren Beruf aus einer neuen Perspektive: Während es ihr bisher stets um den Sieg ihres Landes ging, geht es plötzlich um das blanke Überleben ihres einzigen Sohns.
»Der Dolch will töten, will jäh Blut vergießen.«JORGE LUIS BORGES, DER SÜDEN
Am Ende wird er mich rufen lassen, wenn die Feiern vorbei sind. Warte zehn Tage, höchstens zwei Wochen – die Einladung wird kommen. Ich hatte die feierliche Amtseinführung in den Nachrichten gesehen, mit Ehrengarde und Dienstgradverleihung und Militärkapelle. Er hätte mich dazu einladen können, dachte ich, verstand aber auch, warum er es nicht getan hatte. Der Anruf von seinem Büro traf zwei Wochen und zwei Tage später ein. Der Generalstabschef möchte dich treffen. Klar, sagte ich, Rosolio ruft, und ich bin zur Stelle.
Meine Zutrittsgenehmigung war bereits abgelaufen, und so musste ich am Eingang lange warten. Ich zeigte den Wächtern meinen Dienstausweis als Oberstleutnant der Reserve, aber sie hielten sich streng an die Vorschriften. Danach erreichte ich das Büro etwas außer Atem, leicht verschwitzt und nicht so frisch wie geplant, aber auf die Minute pünktlich, schließlich war ich noch nirgends zu spät gekommen. »Einen Moment«, sagte die Stabssekretärin. Ihr eifersüchtiger Blick missfiel mir auf Anhieb. »Nimm bitte Platz.« Sie deutete auf ein paar Stühle in der Ecke und ließ mich warten. Erst als eine Gruppe beleibter Männer in hellblauen Zivilhemden aus dem Zimmer kam, fand sie sich bereit, ihm mein Eintreffen zu melden. Einige Sekunden vergingen, dann stand Rosolio in der Tür, geschmückt mit den höchsten Rangabzeichen, und mir stockte der Atem. »Abigail«, sagte er. »Jawohl, Chef«, erwiderte ich – war mir blöderweise rausgerutscht – und strahlte ihn mit meinem breitesten Lächeln an. Tatsächlich war ich mächtig stolz, als wäre er mein großer Bruder, oder mein fester Freund.
Schon bei unserer ersten Begegnung vor fünfundzwanzig Jahren, bei einer Übung seines Bataillons auf den Golanhöhen, hatte ich vorausgesehen, dass er dieses Amt einmal erreichen würde, so er nicht vorher umkam. Er war nicht gestorben, hatte sein Ziel heil und gesund erreicht, allerdings Jahre später als gedacht. Die alten Bilder überfluteten mich. Ich geriet in Erregung. Er hatte zugenommen, aber sein guter Duft war nicht verflogen, auch nicht sein männliches Flair unter Uniform und Dienstgrad, und seine Augen hatten noch den klugen Blick, der mich mehr als alles Körperliche angezogen hatte. Er freute sich über mein Kommen. »Tritt ein, Abigail, bitte schön«, lud er mich mit großer Geste ein und setzte sich hinter den Tisch, an dem schicksalhafte Entscheidungen fielen. Auf dem Tisch stand ein gerahmtes Bild seiner Frau und Töchter. Er hatte es vor meinem Eintreffen nicht eigens versteckt.
»Wie gehts dir?«, fragte ich. Ich erkannte Stresssymptome um seine müden Augen und an seiner Kopf- und Schulterhaltung, bemerkte die abgekauten Fingernägel. »Na, du siehst ja«, sagte er lachend, »es gibt viel Arbeit zu erledigen, viele Dinge zu ändern.« Seine Ausdrucksweise war seit jeher etwas hölzern, und ich musste in ihn dringen, um die Spuren der Empfindsamkeit zu finden. Hinter seinem Kopf hing die berühmte topografische Karte des Nahen Ostens, und er wirkte einsam. Ich wollte zu ihm treten, ihn anfassen, ihm die steifen Schultern massieren, war aber nicht sicher, wie er reagieren würde. »Ich arbeite wie verrückt«, sagte er, »es ist eine enorme Verantwortung. Erst wenn man hier angelangt ist, kennt man ihr wahres Gewicht.« Ich fragte ihn, was er aß und wie viel er schlief. Über die Jahre hatte ich Rosolio in vielen Stresssituationen gesehen, wusste, dass er stark, aber nicht eisern war, nicht zu den raren Supermännern gehörte, die beim Militär nur alle ein oder zwei Generationen einmal auftauchten. Mehrmals hatte er mich vor einem Einsatz oder einer weitreichenden Entscheidung wirklich gebraucht. Dann musste ich seine Hand nehmen, ihm mit Worten versichern, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte, ihn vor Zweifel und Verwirrung bewahren, vor der Angst, die mit der Opferung menschlichen Lebens verbunden ist. Rosolio war mutig, verlässlich und klug, verfiel aber zuweilen in Grübeleien, aus denen man ihn befreien musste, damit er loslegen konnte.
Ich hatte mich für ihn schön gemacht, helles, kaum sichtbares Rouge aufgelegt, mich mit einem frühlingshaft frischen und jungen Duft parfümiert. Besonders fürchtete ich, ich könnte ihm alt erscheinen, mein Körper ihn anwidern, aber ich sah seinen Augen an, dass ich diese schlimme Grenze noch nicht überschritten hatte.
Er fragte, wie das Zivilleben sei, ich antwortete, dass ich noch nicht vom Militär loskäme, vorwiegend langjährig Kriegstraumatisierte therapierte, in dem Ruf stände, ihnen wirklich helfen zu können. Ich erzählte ihm, ich würde immer noch Vorträge auf dem Fortbildungsstützpunkt für Stabs- und Kommandooffiziere halten und gelegentlich gebeten werden, einige Tage Reservedienst für Sonderaufgaben zu leisten. »Ich habe auch ein paar Zivilisten behandelt, brachte aber kaum Geduld für sie auf«, berichtete ich Rosolio. »Ihre kleinen Probleme haben mich gelangweilt. Ich konnte nur mit Mühe das Gähnen unterdrücken.«
»Ein Glück, dass wir dich mit Arbeit versorgen«, erlaubte sich Rosolio zu scherzen, wurde jedoch gleich wieder ernst, als fürchtete er, jemand könnte ihn durch die Wand beobachten. »Wir haben vielen jungen Leuten das Leben kaputtgemacht«, sagte er und setzte kurz darauf hinzu: »Nicht immer war es die Sache wert.«
»Mit solchen Gedanken solltest du dich jetzt nicht beschäftigen«, sagte ich. »Heb sie dir für den Ruhestand auf, wenn du deine Memoiren schreibst.«
»Super, dass du gekommen bist, Abigail«, lachte er, »ich hatte schon Sehnsucht. Es ist lange her, dass mir jemand gesagt hat, was ich denken soll. Wir sind in die guten alten Zeiten zurückgekehrt.«
Hinter all unseren Reden stand das, was wir nicht aussprechen konnten. Wir befanden uns im Büro des Generalstabschefs, die Landkarte des Nahen Ostens blickte auf uns herab, und es gab keinerlei Raum für Intimität. Rosolio kratzte sich am Nacken und sagte: »Ich habe dich rufen lassen, weil ich meine, du könntest helfen. Du hast immer einen besonderen Beitrag für die Truppe geleistet, hast nicht nur die Geschädigten im Hinterland behandelt, sondern uns geholfen vorzupreschen. Genau das möchte ich mit dieser ganzen Streitmacht machen. Mit ihr vorwärtsstürmen.«
Hättest du das nicht etwas formeller?, dachte ich, sagte jedoch nur: »Klar, ich bin dabei, womit kann ich behilflich sein?«
»Zu Luft und zu Wasser sind wir großartig – schnell, tüchtig, unbesiegt«, sagte Rosolio. »Dafür hapert es zu Lande, bei Bodengefechten, von Mann zu Mann. Dort töten und entführen sie uns, dort kommen wir nicht weiter. Wir haben feinsinnige Kinder, haben sie nicht zum Töten erzogen.« Jetzt konnte ich das Treffen einordnen: Dazu hatte er mich eingeladen, als Expertin für die Psychologie des Tötens.
Ich schlug die Beine übereinander, saß aufrecht, trug das Haar im Nacken zusammengefasst wie immer. »Alles, was von fern per Knopfdruck geht, kommt ihnen natürlich vor«, erwiderte ich. »Von Weitem töten ist unproblematisch, wie ein Spiel. Aber der Nahkampf, das ist eine ganz andere Geschichte. Sie spielen ja kaum noch draußen, diese Kinder, prügeln sich nicht. Sie leben am Smartphone, alles nur symbolisch, die reale Welt existiert für sie fast nicht mehr. Manchmal denke ich, wir müssten ihnen erst mal beibringen, ein Huhn zu schlachten oder jemandem das Nasenbein einzuschlagen, ehe wir von ihnen erwarten, Menschen zu töten.«
Rosolio lachte. »Kannst du dir vorstellen, was die Zeitungen über mich schreiben würden, wenn ich das Schlachten von Hühnern in die Ausbildung aufnehmen wollte?«
»Sie vögeln auch nicht mehr«, sagte ich, »fassen einander kaum noch an.«
»Ich habe nur Töchter«, erwiderte Rosolio, hielt verlegen inne und korrigierte sich dann: »Wir haben nur Töchter, deshalb stört mich das weniger.«
Vor fünfundzwanzig Jahren hatte Rosolio mir vor seinem Bataillonsführerzelt türkischen Mokka gekocht, ehe wir uns über den Menschen als tötendes Wesen austauschten. Er wollte gern mit mir reden, obwohl ich eine zum Studium freigestellte junge Offizierin war, die noch nie ein Schlachtfeld gesehen hatte. Wie hatte mir das geschmeichelt. Auch jetzt wollte ich das Gespräch gern erweitern, ihn beeindrucken, ihm von neuen Studien ausländischer Militärpsychologen berichten, mit meinem Wissen glänzen, Berufserfahrung demonstrieren. Aber die Stabssekretärin klopfte an, entschuldigte sich vielmals und sagte, Rosolio müsse los zu einem Termin beim Minister, werde erwartet. Dabei streifte mich ihr argwöhnischer Blick.
»Einen Moment noch«, sagte Rosolio und wartete, bis sie raus war. »Was ist mit dem Jungen?«, fragte er leise, fast flüsternd. Ich wusste nicht, ob alle Gespräche in seinem Büro aufgezeichnet wurden, nahm mich jedenfalls in Acht.
»Rückt in ein paar Tagen ein«, berichtete ich, hätte nicht davon angefangen, wenn er nicht gefragt hätte. Es verletzte unser Abkommen.
»Schon? Wohin?«, fragte er überrascht, sogar verlegen. Er hatte keine Ahnung, wie alt Schauli war.
Ich sah ihm direkt in die Augen und antwortete: »Fallschirmjäger, wie du.«
»Fallschirmjäger, wieso das denn? Wie ist das passiert?«
»Das frage ich mich auch. Anscheinend habe ich ihn schlecht erzogen. Er hätte zum Nachrichtendienst gehen können, hat einen hellen Kopf. Oder zur Luftwaffe, wenn er unbedingt ein Held werden wollte, oder zur Marine, wo er doch dauernd am Strand rumhängt. Aber nein, er will zu den Fallschirmjägern. Ein altmodischer Junge. Als Einziger unter seinen Freunden. Er will ein Mann sein. Der Trick funktioniert bei ihm noch.«
»Das kann kein Zufall sein. Hast du ihm von mir erzählt, irgendwas angedeutet?«, fragte Rosolio misstrauisch.
»Nein.« Ich verzog das Gesicht, die Frage gefiel mir nicht. Ich hatte nie etwas ausgeplaudert, würde es auch künftig nicht tun. Schließlich hatte ich ihm mein Wort gegeben. Wir hatten ein Abkommen geschlossen.
»Verzeih, Abigail, klar hast du nichts erzählt«, versuchte mich Rosolio zu beschwichtigen. Ich erinnerte mich, wie erschöpft Rosolio damals nach unserem Beischlaf aufgestanden war, und wie sanft er mich angefasst hatte. Er ist ein großartiger Mann, der Rosolio. Nicht umsonst hatte ich ihn auserkoren.
»Dann ist er jetzt ein großer Junge«, schloss Rosolio mit einer abgedroschenen Phrase und blickte auf die Uhr, die ihm zeigte, dass er spät dran war. »Komisch, wahrscheinlich würde ich ihn auf der Straße gar nicht erkennen.« Immer war es »er« oder »der Junge«. Rosolio nannte ihn niemals beim Namen. Aber daran war ich schuld, denn ich hatte ja jede Verbindung zwischen den beiden untersagt und Schauli nie erzählt, wer sein Vater war. »Moment«, sagte ich. Plötzlich tat es mir von Herzen leid um die beiden, und ich suchte mein Handy, um ihm ein aktuelles Bild von Schauli zu zeigen, wie groß und schön er geworden war. Aber dann fiel mir ein, dass man mir das Gerät am Eingang abgenommen hatte. Schade. Oder vielleicht besser so.
»Grundausbildung Fallschirmjäger?«, fragte Rosolio auf einmal erheitert. »Ich werde mich nach ihm erkundigen. Werde hören, was man sagt.«
Ich erstarrte. »Tu das auf gar keinen Fall. Es wäre zu heikel, und er ist ein kluger Junge. Was soll er wohl denken, wenn der Generalstabschef plötzlich nach ihm fragt? Er weiß, dass du mal mein Vorgesetzter gewesen bist, da wird er eins und eins zusammenzählen.«
»Du hast recht, ich werde den Mund halten«, sagte Rosolio, die Hand schon auf der Klinke, und eilte zum Termin beim Minister.
»Warte noch kurz«, stoppte ich ihn. Ich trat zu ihm und fasste ihn an seine mit Rangabzeichen bepackten Schultern, wollte ihm Kraft spenden, versagte mir jedoch eine feste Umarmung. »Gib mir Bescheid. Ich möchte mit dir vorwärtsstürmen.« Er kam mir kurz nahe und eilte dann seines Weges.
Ich begleitete Schauli, zusammen mit einigen seiner guten Freunde, zum Rekrutierungszentrum. Wir warteten, bis sein Name auf der Anzeigentafel erschien und er aufgerufen wurde, in den Bus zu steigen. Ich versuchte, mich an Kindheitsmomenten festzuhalten, an Geburtstagen, Festen im Kindergarten, Elterntagen in der Schule, an den unzähligen Mahlzeiten, die wir zu zweit eingenommen hatten. Aber all die Jahre brachen jetzt über meinen Kopf herein wie ein gewaltiger Erdrutsch im Gebirge und ließen nichts mehr übrig. Ich streichelte ihn, ergriff seine Hand, sagte ihm wiederholt, er könne mich bei jedem Problem anrufen, schließlich hätte ich Bekannte in der Armee. Schauli erwiderte, ich solle mir keine Sorgen machen, er käme gewiss zurecht. Er lachte mit den Freunden, die uns begleiteten, und irgendwie dachte ich an eine Braut, die allein ans andere Ende des Kontinents geschickt wird, eine Szene, die ich einmal in einem alten Film gesehen hatte. Seine Freunde mochten ihn, waren besorgt und verwundert, denn keinem sonst war eingefallen, sich freiwillig zu einer Kampfeinheit zu melden. Sie brauchten diese Herausforderung nicht mehr, um ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Aber ich war stolz auf ihn, den ich ganz allein zu dem offenen und gutherzigen jungen Mann erzogen hatte, und etwas beunruhigt darüber, was ihn jenseits des Zauns erwarten würde, sobald ich ihn der Armee übergab. An einer Wand hing ein großes Foto von Rosolio, dem Generalstabschef, und daneben sein Tagesbefehl an die Rekruten. Beinahe hätte ich zu Schauli gesagt: Schau, das ist dein Vater dort an der Wand, er wird dich beschützen, er wird mit dir vorpreschen ins Feuer. Und mir selbst sagte ich: Das ist deinetwegen, denn aus deinem Blick und deiner Stimme und deiner Aura hat er ja entnommen, welche Männer du achtest und welche du gering schätzt, hat kapiert, dass du nur die Mutigen und Harten leiden kannst, die Weichen jedoch zutiefst verachtest.
An den letzten Tagen seines Zivillebens war Schauli zum Surfen ans Meer gegangen, hatte sich von der Sonne bräunen lassen und auf dem Schulhof Basketball gespielt. Später dann füllten seine Freunde und Freundinnen unsere Wohnung. Ich brachte ihnen Getränke und Obst und bestellte Pizza. Einige blieben über Nacht, drängten sich in seinem Zimmer auf dem Boden. Es war ein langer und turbulenter Abschied, sie klammerten sich aneinander, bis er gehen musste.
Jetzt war ich unruhig, strich ihm übers Haar, sagte, es sei schade, dass er nicht mehr zum Haareschneiden gegangen sei, und er fragte: »Mama, du bist viel nervöser als ich, warst doch so viele Jahre beim Militär. Verbirgst du mir was von dem, was dort geschieht?« Ich verneinte erschrocken: »Nein, nein, wird alles okay, der Abschied fällt mir einfach schwer.« Es war nicht der richtige Zeitpunkt, diese Dinge mit ihm zu besprechen. Und dann erschienen sein Name und seine Personalnummer auf der Leuchttafel, und die Ansage trieb die Rekruten zum Bus. Wir alle begleiteten ihn zum Durchgang, seine Freunde besprengten ihn mit Wasser aus einer Plastikflasche, und als er drinnen war, winkte er uns durch die Scheibe zum Abschied.
Zu Hause räumte ich sein Zimmer auf, das unter dem Trubel der letzten Tage gelitten hatte, damit es für ihn bereitstand, wenn er auf Urlaub kam. Bevor ich die Gitarre in ihren Kasten legte, versuchte ich, die Saiten zu zupfen, aber ich kann kein Instrument spielen und brachte keine Melodie zuwege. Du bist einfach überdreht, sagte ich mir, diesen oder nächsten Schabbat kommt er heim, seine Freunde werden ihn besuchen, drei Jahre sind schnell vorbei, und danach beginnt er das großartige Leben, das er verdient.
Ich erzählte Mendi, dass ich allein war. Er kam auf Besuch und brachte mir eine kleine Eisenfigur mit, die er geschaffen hatte: Eine Frau, die in den Himmel blickte, der Körper verdreht wie der einer kanaanäischen Göttin. »Bin ich das?«, fragte ich, und er lachte brummend. Er war weit gefahren aus seinem Dorf und wollte gern über Nacht bleiben. Abgesehen von der kleinen Skulptur hatte er einen Kanister Olivenöl aus seinem Hain mitgebracht. Ich briet Omeletts in dem Öl und bereitete Salat zu, sagte ihm, ich sei diese Stille nicht gewohnt, die Wohnung komme mir jetzt leer vor, ich sehnte mich nach Schauli und dächte jeden Augenblick daran, was er wohl durchmachte. »Zieh zu mir«, sagte er, »ich bin auch allein.«
Später saßen wir auf dem Balkon und blickten auf die Straße, auf die erleuchteten Häuser und die Gestalten, die sich darin bewegten wie auf der Bühne eines Puppentheaters. Ich betastete die Narben auf seiner Hand, versuchte sie mit den Fingern zu unterscheiden: die von Wunden durch die scharfen Werkzeuge, die er beim Bildhauern verwendete, die von Verletzungen, die er sich bei der Landwirtschaft zugezogen hatte, und jene älteren aus seinen früheren Lebensjahren, deretwegen wir uns kennengelernt hatten.
Mendi war der Einzige, den ich zu einer Therapie bei mir überredet hatte. Vor einigen Jahren hatte ich einen Artikel über ihn in der Zeitung gelesen, anlässlich einer großen Ausstellung, die man ihm im Museum widmete. Der Artikel berichtete von seinem Kriegstrauma, erwähnte die Schreie, die ihn bei Nacht, und die Gewaltszenen, die ihn bei Tag heimsuchten. Ich errechnete, dass er etwa fünfzehn Jahre älter war als ich. Die Journalistin schrieb, die Ausstellung enthalte keine neuen Werke, denn in den letzten Jahren habe Mendi nicht schöpferisch arbeiten können. Ich ging ins Museum, und seine Werke berührten mich zutiefst. Er hatte harte, rabiate Statuen geschaffen, die einsam und brutal im Saal standen, anscheinend dem Zusammenbruch nahe. Ich fasste genug Mut, um ihn anzurufen, sagte ihm, seine Kunst gefalle mir außerordentlich, ich hätte den Zeitungsartikel über ihn gelesen und dächte, ich könnte ihm helfen, seine Kunst wieder aufzunehmen. »Dann komm, und wir reden«, sagte er.
Er wohnte auf dem Land, am Rand eines fast verlassenen Einwanderer-Moschaws am Fuß eines eichenbestandenen Felshangs. Zu seiner Landwirtschaft gehörte ein verwilderter Obstgarten. Dort sah ich Krähen an Granatäpfeln picken, ihre Köpfe in den roten Brei stecken, als hackten sie in einem menschlichen Schädel. »Hier gab es mal haufenweise Früchte«, sagte er entschuldigend, »aber dann ist meine Frau gestorben, und ich war mit den Kräften am Ende. Ich kapituliere vor meinem Kopf. Der funkt mir, was er will, schlimme und verstörende Bilder, mit denen ich nichts anfangen kann.« Er führte mich in seinen Olivenhain und sagte, früher mal habe er tausend Liter Öl pro Jahr gewonnen, aber in den letzten Jahren habe er sich nicht dazu aufraffen können, habe kein Öl mehr gepresst, und auch die Statuen, die er geschaffen habe, seien nichts als bedeutungslose Klumpen. »Ich bin völlig verdorrt«, sagte er, »habe keinen Tropfen Saft mehr in mir.« Ich blickte in sein runzliges Gesicht und auf seine starken Schultern und wusste, dass ich ihn wiederbeleben könnte. Da war noch genug Energie, um damit zu arbeiten. In seinem Atelier, voll von Werkzeugen für Metallarbeiten, zeigte er mir schließlich Statuen, die er angefangen, aber aufgegeben hatte. »Da steckt nichts drin«, sagte er, »einfach seelenlose Eisenbrocken.«
»Die Seele wird wieder einziehen«, sagte ich lächelnd, mächtig beeindruckt von seinem Atelier und davon, dass er mich eingelassen hatte.
Danach saßen wir in seinem Haus, Mendi ging draußen ein paar Blätter zupfen und brühte daraus eine Kanne Tee auf. »Ich weiß nicht, warum ich dir erlaubt habe zu kommen«, sagte er. »Ich wollte schon absagen, aber jetzt freue ich mich, dass du da bist. Es tut gut, mit dir zu reden. Du laberst nicht so viel.« Draußen wehte ein starker Wind, keine lebende Seele war zu sehen, als sei der Moschaw gänzlich verlassen. Mendi schälte eine Orange, reichte mir Schnitz für Schnitz und erzählte mir von den Menschen, die er einst getötet hatte und die nun kamen, um sich an ihm zu rächen, sein Leben zu zerstören. Seine gestikulierenden Hände erzählten die ganze Geschichte. Wie er getötet hatte, mit dem Messer, durch Erdrosseln und mit der Pistole, immer lautlos auf Armeslänge. »Stell dir vor, du begegnest einem Menschen zum ersten Mal, gehst gleich nahe ran, hörst seine Atemzüge, riechst seinen Geruch, siehst seinen Gesichtsausdruck, und ein bis zwei Sekunden später durchlöcherst du seinen Leib schon mit Messerstichen oder Pistolenschüssen. Du bist im letzten Moment seines Lebens bei ihm. Seine Frau ist nicht anwesend, auch nicht seine Eltern und Kinder, nur ich. Manchmal fielen sie mir auf die Schulter und murmelten Abschiedsworte, kein Mensch sonst war dabei.«
»Wenn ich es richtig verstehe, haben sie dir in den ersten Jahren nicht zugesetzt«, sagte ich.
»Stimmt«, erwiderte Mendi. »Ich konnte sie fernhalten, sie trauten sich nicht in meine Nähe, ich brachte sie in der Erinnerung ein zweites Mal um. Aber als meine Frau starb, kamen sie wieder, und nun konnte ich sie nicht mehr abwehren. Anscheinend spüren sie meine Schwäche. Sie reden beharrlich auf mich ein, zeigen mir ihre Wunden, versetzen mich zurück zum letzten Augenblick, und dann ersticke ich schier. Ich kriege keine Luft mehr, und alles ringsum erstirbt.«
Draußen dunkelte es, und Mendi erzählte weiter von einer der Gestalten, die seine Nächte störten, einem hohen Terroristenführer. Das Team war weit übers Meer gereist, um ihn zu liquidieren. Als unsere Leute leise in sein Haus eindrangen, fanden sie ihn im Badezimmer im Pyjama, dabei, sich Tropfen in die Augen zu träufeln. Seine Frau setzten sie im Wohnzimmer fest und spritzten ihr ein Schlafmittel, damit sie nicht aufschrie. Mendi erzählte, der Mann sage ihm im Traum dauernd: »Moment, warte, bis ich mit den Augentropfen fertig bin, das ist nicht nett, einfach so reinzukommen«, aber Mendi konnte damals nicht warten, sondern musste ihm mit der schallgedämpften Pistole in den Kopf schießen, und in seinen Träumen verstöre ihn die Sache mit den Tropfen, die Augen des Mannes seien tatsächlich gerötet, als hätte er zu lange gelesen oder viel Zeit an der Sonne verbracht, aber das sei egal, er werde gleich sterben, und doch komme der Mann beharrlich auf Mendi zu, der die Pistole halte, kaum abdrücken könne, während es ihm in Wirklichkeit nie schwergefallen sei.
»Was hast du gemacht, als du jünger warst?«, fragte ich. »Wie bist du sie da losgeworden?« Mendi erklärte, er habe sie von Weitem nahen sehen und sei dann ausgegangen, zum Trinken und Rauchen und um ein Mädchen kennenzulernen, habe sich danach in die Arbeit an einer neuen Statue gestürzt, und das hätte sie verjagt. »Aber jetzt lassen sie mir keine Ruhe«, sagte er, »sie sitzen mir im Gehirn.«
Ich überredete ihn, zu Sitzungen bei mir in die Stadt zu kommen. Es wurde eine Erfolgsgeschichte, denn er besaß starke psychische Ressourcen und Schaffenskraft, und deshalb gelang es uns, das Trauma in sein Versteck zurückzudrängen. Manchmal schafften es seine Opfer, sich in nächtlichen Albträumen, die ich nicht gänzlich ausbremsen konnte, erneut anzuschleichen, aber tagsüber war er wieder voll auf dem Damm. Als ich die Therapie für beendet erklärte, lud Mendi mich zum zweiten Mal zu sich nach Hause ein. Ich kam für einen Tag, es war Frühling, und blieb fast eine Woche lang, wollte gar nicht wieder weg. Wir brachten gemeinsam den Obstgarten in Schuss, ich sah ihm im Atelier bei der Arbeit an seinen verrenkten, gleichzeitig erhabenen und verwundeten Figuren zu. Er ließ mich nahe an sich heran, als könne meine Anwesenheit die Erinnerungen vertreiben. Er wollte mich für immer dahaben, und ich dachte mir: wie eine lebende Vogelscheuche. Ich fühlte mich zu ihm hingezogen, schätzte ihn, beneidete ihn um sein Talent, konnte jedoch nicht bleiben. Ich versprach, öfter auf Besuch zu kommen.
Ich rief Vater an, um zu fragen, ob ich was für ihn einkaufen sollte. Vater antwortete, mit dem Supermarkt käme er zurecht, man liefere ihm die Waren nach Hause. Aber wenn ich beim Gemüsehändler vorbeigehen und etwas Obst für ihn besorgen könnte, wäre das nett von mir. Schauli hatte ihm einmal die Woche Obst gebracht, doch nun, wo er eingezogen war, musste ich ihn ersetzen. Schauli ging gern zu meinem Vater. Am Ende eines jeden Besuchs bekam er einen Zweihundert-Schekel-Schein, aber nicht wegen des Geldes suchte er ihn auf. Vater ging sanft und sensibel mit ihm um, schenkte ihm all die Liebe, die er mir vorenthalten hatte. Ich besuchte ihn ungern, weil ich schwer gegen ihn ankam. Nachdem Mutter gestorben war, verließ er selten das Haus, bewegte sich langsam und schwerfällig. Ich hatte ihm immer wieder geraten, einen Pfleger anzustellen, aber das lehnte er stur ab. Er kochte für sich und machte die Wäsche allein, nur einmal die Woche kam eine Putzfrau ins Haus. Mehr Hilfe wollte er nicht annehmen. Vater war vierundachtzig, und an seinen Blutkörperchen nagte schon seit Jahren ein Krebs, der ihn langsam ums Leben brachte.
Ein paar Tage später, als ich einen freien Nachmittag hatte, fiel mir seine Bitte plötzlich siedend heiß ein, und sofort lief ich zum Gemüsehändler, um ihm schöne und teure Früchte zu kaufen. Ich brachte ihm die Tasche ohne Vorankündigung. Er wohnte nur wenige Straßen von mir entfernt, und als ich seine Tür öffnete, witterte ich sofort die stickige Anwesenheit eines Patienten. Augenblicklich wurden meine Schritte lautlos, ich hätte vorher anrufen sollen. Ich sah die geschlossene Schiebetür im Flur, ein Zeichen dafür, dass er mit jemandem in der Praxis saß. Ich stellte leise die Tüten in die Küche und drückte ein Ohr an die Wand, hörte nur gedämpfte Stimmen. Ich tappte auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer und setzte mich aufs Sofa. So hatten wir einst geschwiegen, Mutter und ich, wann immer ihn ein Patient aufsuchte, waren völlig verstummt, damit kein Stückchen vom realen, normalen Privatleben des Psychoanalytikers ans Licht kam und das Unbewusste beeinträchtigte, das für die Therapie so wichtig war. Was wäre, wenn ich jetzt die Tür im Flur einen Spalt aufschieben, kurz den Kopf in die Praxis stecken und zu Vater sagen würde: »Guten Tag, ich habe dir Obst gebracht, will nicht stören, auf Wiedersehen«, und sofort wieder verschwände? Nie im Leben wirst du den Mut dazu aufbringen, gestand ich mir ein.
Vater hatte noch einige langjährige Patienten, für die er den Fels in der Brandung spielte. Er begrüßte sie ruhig und gediegen an der Tür, sagte, »bitte treten Sie ein«, und folgte ihnen in seine Praxis am Ende des Korridors, die durch eine knarrende Schiebetür vom Rest der Wohnung abgetrennt war. In seinem Praxisraum standen eine klassische Couch, auf der sich der Patient ausstreckte, und ein bequemer Sessel für Vater. Auf dem Boden lag ein dicker Perserteppich, und an der Wand hing ein naives Gemälde der Jerusalemer Berge, das Geschenk eines berühmten Malers, den Vater einmal behandelt hatte. Als ich klein war, hielt ich seine Praxis für den wichtigsten und geheimnisvollsten Ort auf der Welt. Dort drang er mit Worten in den Kopf von Menschen ein, erkannte ihre Probleme und behandelte sie, damit sie nicht mehr traurig waren. Ich wollte so werden wie er, schnellstmöglich, hatte keine Geduld, zu warten. Vater therapierte mit klassischer Psychoanalyse, war einer ihrer letzten gläubigen Anhänger und verachtete die modernen kürzeren und dynamischeren Methoden. »Ratgeber« nannte er abschätzig Therapeuten, die solche Methoden anwandten. Solange du nicht die tiefe Wunde aufgefunden und geheilt hast, hast du rein gar nichts erreicht, sagte Vater. Manchmal gelange man innerhalb von Stunden dorthin, manchmal erst nach fünf Jahren und zuweilen auch gar nicht, aber man dürfe nicht hastig nach Abkürzungen suchen.
Ich hatte heute keine Lust, mit Vater zu sprechen, würde ihm das Obst dalassen und gehen. Ich wusste, dass er seine Therapiesitzungen fünfzehn Minuten vor der vollen Stunde beendete, und jetzt war es zwanzig vor fünf. Ich biss in einen schönen Pfirsich, den ich für ihn gekauft hatte, wobei mir etwas Saft aufs Kinn troff, und hinterließ ihm einen Zettel auf dem Wohnzimmertisch: »Papa, ich war da, lass dir die Früchte schmecken.« Dann zog ich die Tür leise hinter mir ins Schloss.
Zu Anfang der Grundausbildung rief Schauli fast jeden Abend an, man ließ ihnen ein paar freie Minuten vor dem Abendappell. An seiner Stimme hörte ich, dass er ungebrochen, aber unglücklich war. Ich fragte, was sie zu essen bekämen und ob sie viel herumgehetzt würden, wie seine neuen Kameraden hießen und ob sie schon ihre Waffe erhalten hätten. Während ich seinen knappen Antworten lauschte, fragte ich mich, warum man sie jeden Abend zu Hause anrufen ließ. Das schwächte sie nur, vorerst war er ja nicht in Gefahr, und diese täglichen Gespräche, wie bei einem Kind, das aus dem Sommerlager anruft, belasteten ihn – und mich auch. Er sollte seine Freizeit lieber zum Ausruhen nutzen oder sich was im Laden des Stützpunkts kaufen.
Als er in den Kindergarten kam, wurde er anfangs regelmäßig von einem bösen Kind geschlagen und gebissen. Jeden Tag kam er mit Blessuren nach Hause. Ich sprach mit der Kindergärtnerin, doch die unternahm nichts. Notgedrungen musste ich ihm beibringen zurückzuschlagen. Er war ein schmächtiger und zarter Junge, noch keine drei Jahre alt, und schon zeigte ich ihm, wie man mit der Faust zuschlägt, an den Haaren zerrt und zurückbeißt. Ich hämmerte seinem kleinen Gehirn ein, dem aggressiven Jungen nächstes Mal ordentlich die Fresse zu polieren. »Fresse polieren«, plapperte er mit kindlicher Stimme nach und lachte. An dem Tag, als die Kindergärtnerin sich bei mir beschwerte, dass Schauli das rabiate Kind geschlagen habe und ich da etwas unternehmen müsse, dann auch seine Mutter erregt anrief und mich anschrie (ich schickte sie höflich zum Teufel), war mir leichter ums Herz, denn ich wusste, Schauli hatte sich zu wehren gelernt. »Gute Nacht, mein Schatz, sei stark«, verabschiedete ich ihn in den ersten Wochen der Grundausbildung am Telefon, bis er nicht mehr anrief. Das machte mir keine Sorge. Er wusste, dass ich ihn liebte.
Es ist mein erstes Referat für einen neuen Jahrgang des Bataillonsführerlehrgangs, eine der angenehmen Aufgaben, die ich nach meinem Ausscheiden aus der Truppe beibehalten habe. Die meisten Kursteilnehmer sind Ende zwanzig, ehrgeizige junge Männer mit Befehlsgewalt. Diesmal ist auch eine Offizierin dabei, vermerke ich im Stillen. Sie schauen mich neugierig an, wenn ich in Rock und Absatzschuhen vor ihnen stehe. Morgens hatte ich lange vor Schrank und Spiegel verbracht, um das richtige Outfit zu wählen. Einmal die Woche werde ich zu ihnen sprechen, einige Monate lang, in meinem berühmten Kurs über Militärpsychologie.
Ich erzählte ihnen, wie ich mit fünfundzwanzig Jahren, nach zwei Abschlüssen in Psychologie, für die mein Wehrdienst ausgesetzt war, als Psychologin einer Fallschirmjägerbrigade angegliedert wurde, als Beauftragte für psychische Gesundheit. Man gab mir einen kleinen Raum mit einem Tisch und zwei Stühlen, dort sollte ich Soldaten mit Problemen befragen, um zu prüfen, wer wirklich verrückt war und wer sich bloß drücken wollte. Das wurde mir schnell langweilig. Nach ein paar Wochen ging ich zum Kommandeur und sagte ihm, ich wollte raus ins Gelände, ein bisschen mit den Soldaten zusammen sein. Er starrte mich an, als sei ich vom Mond gefallen. »Bisher ist noch keiner ins Gelände rausgegangen. Was hast du dort zu suchen?«, fragte er. Ich erklärte ihm, ich wollte sehen, wie die Soldaten lebten, ihre Aufgaben kennenlernen, um zu erfahren, welchem Druck sie ausgesetzt waren. Wie sollte ich sonst verstehen, was in ihnen vorging? Er bewilligte mir die Teilnahme an einer dreitägigen Übung auf den Golanhöhen. Der Name des Bataillonsführers wird euch bekannt sein: Oberstleutnant Rosolio, heute euer Generalstabschef. Damals war er etwa in eurem Alter, und als ich bei ihm ankam, hat er mich ungefähr so angeschaut wie ihr mich jetzt: Was will die von mir. Ich erklärte ihm sofort, ich wollte keineswegs stören, nur lernen. Seine Gehirnzellen arbeiteten rasch. »Gut, dann man los, raus auf Übung, aber beeil dich, gleich fangen wir an«, sagte er. Ehe ich noch den Rucksack abgestellt hatte, winkte er mich in seinen Jeep, und ich fuhr mit raus ins Gelände. Unterwegs erklärte er mir den Ablauf, wo die Hauptstoßtruppe sei, wer das Ablenkungsmanöver übernehme, und wo der Sperrtrupp stehe. Ich rannte mit ihm und dem Funker zwischen den Felsen herum, und er ließ mir nichts nach. Zweimal fiel ich hin, und als die Übung des Tages einige Stunden später beendet war, schwitzte ich so, dass mein ganzes Make-up zerlief. Aber wir hatten das Ziel erobert, hatten gesiegt. Obwohl es kein echter Feind gewesen war, empfand ich Siegesfreude. Danach kehrten wir ins Zeltlager zurück, ich aß mit ihnen Kampfrationen und blieb über Nacht. Keine Sorge, man wies mir ein Feldbett im Zelt der Soldatinnen an und sogar eine separate Dusche mit etwas warmem Wasser. Sie waren perfekte Gentlemen.