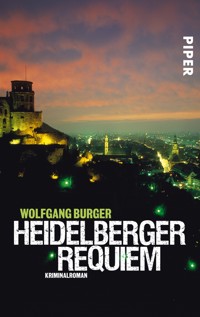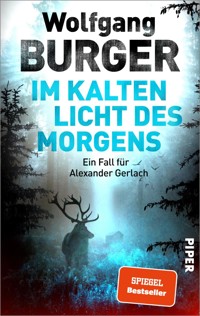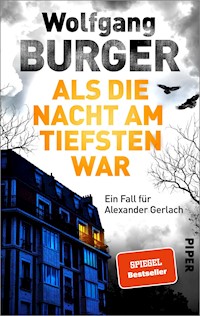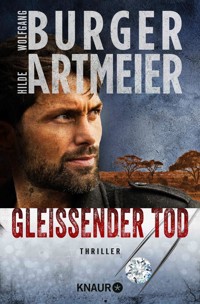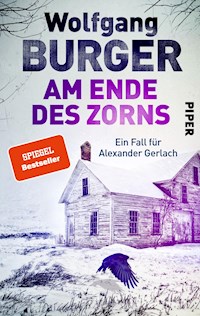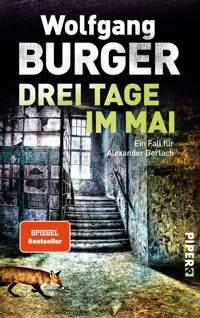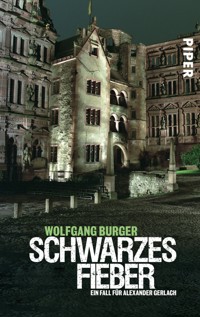
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine bewusstlose Frau mit starken Kopfverletzungen, die in der Nähe von Heidelberg gefunden wird, gibt der Polizei Rätsel auf: Wer ist sie? Und weshalb wird sie von niemandem vermisst? Als sie aufwacht, stellt sich heraus, dass sie nicht sprechen kann. Kripochef Alexander Gerlach übt sich in Geduld, doch dann kommt es zu weiteren Mordanschlägen auf die Fremde. Erst als die Leiche eines Mannes aus Angola auftaucht, beginnt Gerlach die wahren Zusammenhänge zu erahnen, und ein gefährlicher Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
9. Auflage Dezember 2012
ISBN 978-3-492-95460-0
Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2008 Umschlag: semper smile, München Umschlagfoto: Berthold Steinhilber / Bücherberg
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Nichts wäre besser, wenn ich den Anfang noch wüsste. Keiner der Toten würde wieder zum Leben erwachen. Auch nicht die, für deren Tod ich selbst die Verantwortung trage.
Nichts würde sich ändern, wenn ich mich daran erinnern könnte, wann ich zum ersten Mal von Rosana hörte. Dennoch will irgendetwas in mir unbedingt wissen, wie und wann genau sie in mein Leben trat. Vielleicht, um in meinem Kopf wenigstens eine Illusion von Ordnung zu schaffen. Um dieser Geschichte, deren Ende ich so gut kenne wie kein Zweiter, einen Anfang zu geben.
Denn jede Geschichte muss doch ihren Anfang haben.
War Rosana zunächst eine nur mit halbem Ohr gehörte Nachricht im Radio? Oder war sie Inhalt eines unfreiwillig belauschten Gesprächs beim Edeka-Markt an der Ecke? Ich weiß es nicht mehr. Im Grunde hat sie sich in mein Leben geschlichen. Still, wie es ihrer Natur entsprach, und als nebensächliche Randfigur.
Wieder einmal hatten wir einen Jahrhundertsommer in diesem Jahr, es war Ende Juli, und mit unserem Urlaub war alles schiefgegangen. Ich hatte geplant, mit meinen Töchtern für zwei Wochen meine Eltern zu besuchen, die sich im Süden Portugals, in der Nähe von Albufeira, zur Ruhe gesetzt hatten.
Mutter war es gewesen, die vor fünf Jahren zur Überzeugung kam, sie habe in ihrem Leben genug Regen gesehen. Als Vater dann etwas vorzeitig in Pension ging, hatte sie ihn mehr oder weniger zur Flucht in den Süden gezwungen. Seither sahen wir uns selten. Immer war etwas dazwischengekommen. Einmal scheiterte unser Besuch in der neuen Heimat meiner Eltern daran, dass meine Töchter – natürlich absolut gleichzeitig – an Mumps erkrankten. Ein anderes Mal lag es am überraschenden Tod von Vera, meiner Frau, später an meiner Versetzung nach Heidelberg. Einmal war Mutter unpässlich gewesen, oder es streikten eigens für uns die portugiesischen Fluglotsen. So hatte ich in den vergangenen fünf Jahren meine Eltern nur zwei Mal getroffen.
Diesmal hatte nun alles so ausgesehen, als würde es klappen. Die Flüge waren gebucht, alle Fluglotsen auf dem Posten, die Nachbarschaft informiert, sogar ein Teil des Gepäcks schon gepackt, als der aufgeregte Anruf von der Algarve kam: Wasserrohrbruch in der Wohnung über der meiner Eltern. Überschwemmung, Riesenkatastrophe, Teppiche, Möbel, Bücher, Tapeten, alles Mögliche beschädigt. Zum Glück war der Nachbar gut versichert, aber für die nächsten Wochen würden meine Eltern nun erst einmal im Hotel wohnen müssen, und an einen Besuch war unter diesen Umständen natürlich nicht zu denken. Mein naheliegender Vorschlag, sie sollten doch stattdessen nach Heidelberg kommen, stieß auf ratloses Unverständnis. Fast schien Mutter sich vor einer auch nur vorübergehenden Rückkehr in ihre alte Heimat zu fürchten.
Meine Zwillinge waren in Maßen enttäuscht gewesen. Um etwas anderes zu organisieren, war es jetzt, mitten in der Hochsaison, zu spät, und so verbrachten sie ihre Ferientage auf den Wiesen am Neckarufer oder im Schwimmbad. Einmal machten sie sogar zusammen mit Freunden und Freundinnen eine richtige altmodische Radtour nach Schwetzingen und schwärmten anschließend mit leuchtenden Augen vom dortigen Schloss und dem großartigen barocken Park. Mit jedem Tag wurden sie brauner, kräftiger und gesünder.
Auch ich hatte endlich wieder einmal etwas für meinen Körper tun wollen. Aber morgens war ich zu müde zum Joggen, tagsüber war es zu heiß, und abends war ich vom Faulenzen erschöpft. Je weniger ich mich bewegte, desto schlapper wurde ich, und so war ich drauf und dran, mich zum Perpetuum immobile zu entwickeln. Ich hing zu Hause herum, zu träge, all die lästigen Dinge zu erledigen, für die ich nun Zeit hatte: die Steuererklärung, die immer wieder aufgeschobene Reparatur meines Fahrrads, das überfällige Streichen des Balkongeländers auf der Westseite.
Andererseits genoss ich es, mich ohne eine Spur von schlechtem Gewissen von morgens bis abends zu langweilen und alles zu lesen, was mir in die Finger geriet.
So wird es wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit die Zeitung gewesen sein, aus der ich zum ersten Mal von Rosanas Existenz erfuhr. Eine kleine Meldung in einem Kästchen auf der Lokalseite: Verunglückte Motorradfahrerin mit schweren Kopfverletzungen ins Uniklinikum eingeliefert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war es gewesen, irgendwo auf einem dieser steilen und kurvigen Sträßchen, die zum Königstuhl hinaufführten, dem Heidelberger Aussichtsberg.
Am nächsten Tag, das muss dann ein Dienstag gewesen sein, war der Bericht schon ein wenig größer. Rosana, deren Namen ich natürlich erst Wochen später erfahren sollte, war weder Motorradfahrerin, noch stammten ihre Verletzungen von einem Verkehrsunfall. Ihr Überleben verdankte sie einem dieser irrwitzigen Zufälle, wie sie nur das Leben selbst sich erlauben kann. Auf der Straße vom Königstuhl ins Elsenztal hinunter war spätnachts eine Horde Motorradfahrer unterwegs gewesen. Alle nicht mehr ganz nüchtern, alle ein bisschen zu guter Laune, und so war es kein Wunder, dass der Anführer des Rudels in einer tückischen Kurve von der Straße abkam. Der Unfall war völlig harmlos, seine Maschine erlitt ein paar Kratzer, er selbst kam mit einem verstauchten Daumen davon, und das Schlimmste an der Sache dürfte für ihn der Spott seiner Kumpels gewesen sein.
Während sie ihm halfen, seine BMW Enduro wieder auf die Räder zu stellen, und feixend das Laub von seiner Jacke pflückten, entdeckte einer, der die Gelegenheit zum Austreten nutzte, eine leblose Frau. Nur wenige Schritte von der Straße entfernt hatte sie im Wald gelegen, halb unter einem Gebüsch. Sie war vollständig bekleidet gewesen, und inzwischen ging man davon aus, dass sie Opfer eines Raubüberfalls geworden war. Außer ihrer Kleidung hatte sie nichts bei sich gehabt, keine Handtasche, keine Papiere, einfach nichts. Die medizinische Diagnose lautete Schädelbasisbruch, verursacht durch massive Gewalteinwirkung mit einem stumpfen, glatten Gegenstand. Einem Baseballschläger zum Beispiel.
Wären die Motorradfahrer ein klein wenig vorsichtiger gefahren oder hätte der Gestürzte ein Bierchen weniger getrunken, Rosana hätte vermutlich wochenlang dort gelegen und wäre vielleicht erst im Herbst von Pilzsuchern gefunden worden. Nach Meinung der Ärzte hätte sie schon zwei Stunden später keine Überlebenschance mehr gehabt. Außer der Kopfverletzung und einigen kleineren Schrammen und Kratzern war sie unversehrt. Ein Sexualdelikt konnte ausgeschlossen werden.
Zurzeit war das Opfer immer noch bewusstlos, hieß es in der Zeitung, und angesichts der Schwere des Schlags würde sie es möglicherweise noch eine Weile bleiben. Und es sollte noch dreizehn Tage dauern, bis ich ihr zum ersten Mal gegenüberstand.
Als Chef der Heidelberger Kriminalpolizei wusste ich natürlich, was nun routinemäßig in der Polizeidirektion ablief: Klara Vangelis, die ich mit meiner Vertretung beauftragt hatte, würde sämtliche Vermisstenmeldungen sichten lassen, auf der Suche nach einer zu der Verletzten passenden Beschreibung. Ihre Daten wurden in den Computern des BKA abgelegt, auf die jeder Polizist Deutschlands jederzeit Zugriff hat. Und dann blieb ihr nichts übrig, als zu warten. Zu warten, bis jemand sich meldete, dessen Ehefrau oder Mutter, Nachbarin oder Freundin seit einiger Zeit verschwunden war.
Aber niemand schien die Frau zu vermissen, und so sah ich am Donnerstag zum ersten Mal Rosanas Gesicht. Ein nicht besonders gut geratenes, nicht übermäßig großes Foto in der Zeitung, denn noch immer war sie ja nur eine Meldung am Rande: »Wer kennt diese Frau? Größe: einszweiundsechzig, Alter: Anfang bis Mitte dreißig, Gewicht: einundfünfzig Kilo.« Und am Abend desselben Tages, in diesem Punkt bin ich mir sicher, sah ich sie auch in den Regionalnachrichten des Fernsehens.
Ich betrachtete dieses nicht unattraktive, ein wenig rundliche Gesicht mit den ausgeprägten Wangenknochen, das schwarze, leicht gelockte und knabenhaft kurz geschnittene Haar. Die Jeans und die kurzärmlige Bluse, die sie getragen hatte, waren nicht modisch, weder neu noch teuer, aber reinlich. Unauffällige, gepflegte Erscheinung, las ich. Allem Anschein nach handelte es sich bei dem Opfer also weder um eine Obdachlose noch um eine Drogensüchtige, die an den falschen Freier geraten war. Man hatte auch keinerlei Anzeichen für einen Kampf oder auch nur Gegenwehr an ihrem Körper gefunden. Der Schlag auf den Hinterkopf musste völlig überraschend gekommen sein.
Auf dem Foto wirkte Rosana, als würde sie schlafen. Man wäre nicht auf den Gedanken gekommen, es sei ihr ein Unglück zugestoßen, hätten nicht diese hässlichen durchsichtigen Schläuche aus ihrer Nase gehangen.
Vangelis schien kein Glück zu haben in diesem Fall, denn schon zwei Tage später, am Samstag, erschien wieder ein Foto in der Zeitung. Größer und schärfer diesmal, der Artikel war auch ausführlicher, schließlich handelte es sich um die Wochenendausgabe, man hatte Platz. Da sich noch immer niemand gemeldet hatte, der die Frau kannte, musste man davon ausgehen, dass sie nicht aus der Gegend stammte.
Nun ist der Hochsommer naturgemäß eine schlechte Zeit zur Identifizierung Unbekannter. Zahllose Wohnungen und Häuser stehen leer, weil ihre Bewohner verreist sind. Wenn jemandem überhaupt auffällt, dass er einen Nachbarn länger nicht gesehen hat, dann wird er diesen in der Regel im Urlaub vermuten. Dieses Mal betrachtete ich das Foto länger als beim ersten Mal und las die Beschreibung aufmerksamer. Ein Etikett in der Bluse verriet, dass diese aus portugiesischer Produktion stammte. Als Schmuck hatte die Unbekannte einen schmalen, silbernen Ring mit einem Bergkristall an der linken Hand getragen sowie ein billiges, ebenfalls silbernes Kettchen mit einem kleinen Kreuz am Hals. Die beiden einfachen Schmuckstücke, die man eher an einem Teenager als an einer erwachsenen Frau erwartet hätte, waren neben ihrem Gesicht vergrößert abgebildet.
Meine Zwillinge waren an diesem Tag zusammen mit Freunden in Frankfurt, zum ersten Mal in ihrem Leben allein in einer richtigen Großstadt, und ich war deshalb ein wenig unruhig. Vielleicht war dies der Grund dafür, dass ich mich endlich überwinden konnte, einen neuen Schlauch für mein altes, früher einmal sehr geliebtes Motobecane Zwölfgang-Rennrad zu besorgen und auch gleich zu montieren. Da ich schon einmal dabei war, gönnte ich mir gleich noch einen wunderbar weichen Gelsattel als Ersatz für den alten, über die Jahre rissig gewordenen sowie eine neue Klingel, da die alte nur noch heisere Rasselgeräusche von sich gab. Mit zunehmendem Vergnügen putzte, ölte und schraubte ich an meinem Rad herum, und da es nicht gar so heiß war, steckte ich am Ende ein wenig Geld ein und begab mich am späten Nachmittag auf eine Probefahrt.
Natürlich war es kein Zufall, dass ich den Königstuhl als Ziel wählte. Aber es trieb mich auch keine innere Unruhe, höchstens Neugierde. Jedenfalls hatte es überhaupt nichts mit Schicksal oder Vorsehung zu tun.
Die Straße zum Gipfel hinauf war verteufelt steil, stellte ich rasch fest. Im kleinsten Gang quälte ich mich aufwärts. Unentwegt wurde ich dabei von bunt gekleideten und meist auch noch fröhlich schwatzenden Radfahrern auf ihren High-Tech-Sportgeräten überholt, und mehr als einmal stand ich kurz davor umzukehren. Aber diese Blöße wollte ich mir dann doch nicht geben.
Oben angekommen, gönnte ich mir auf der Terrasse des Ausflugslokals ein großes, eiskaltes Weizenbier und genoss dieses lange nicht gekannte Gefühl, Muskeln zu haben, einen Körper, und dazu diese herrliche Aussicht auf den Neckar, das Rheintal, heute ausnahmsweise sogar die Vulkankegel der Pfälzer Berge und die Dampffahnen über den Kühltürmen des Kernkraftwerks Philippsburg. Ich war schweißgebadet und ein wenig glücklich.
Um mich herum herrschte lärmender Trubel. Die Luft war hier oben viel frischer als im Tal, die Schatten wurden schon länger, es duftete nach sonnendurchglühtem Wald. Eine Wespe machte sich des Mundraubs an meinem Bier schuldig.
Der Alkohol machte mich müde, und so legte ich mich vor der Weiterfahrt in der Nähe in den Wald. Ich hatte mir sogar Lektüre mitgebracht. Ein abgegriffenes, für den Fahrradtransport geeignetes Bändchen, das ich kürzlich beim Sortieren meines Bücherregals wiedergefunden hatte: Tucholsky, Schloss Gripsholm. Das Buch beginnt damit, dass Tucholskys Ich-Erzähler mit seiner Lydia nach Schweden in Urlaub fährt. Beim Lesen der Sätze »Sie war mir Geliebte, komische Oper, Mutter und Freund. Was ich ihr war, habe ich nie ergründen können« musste ich an Theresa denken. Wir hatten beschlossen, zur selben Zeit Urlaub zu machen, damit wir nicht länger als unbedingt nötig getrennt sein mussten. Das war nicht ganz einfach gewesen, denn zu meinem Leidwesen war Theresa nicht nur verheiratet, sondern ihr Mann auch noch mein Vorgesetzter, Polizeidirektor Liebekind. Und wenn der oberste Polizeichef und der Leiter der Kripo gleichzeitig Urlaub machen, dann ist das ein bisschen kompliziert, hatte ich lernen müssen. Aber irgendwie hatte es dann auf einmal doch geklappt, und ich bin überzeugt, Theresa spielte dabei eine nicht unwesentliche Rolle.
Nach Thailand war meine Liebste zusammen mit ihrem Mann geflogen, eine Bildungsreise, von der sie schon seit Ewigkeiten träumte, und erst in drei Wochen würde sie zurückkehren. Um uns die Trennung nicht schwerer als nötig zu machen, hatten wir beschlossen, in dieser Zeit keinen Kontakt zu pflegen. E-Mail-Verkehr war ohnehin schlecht möglich, da sie natürlich ohne Computer reiste, und ob man von Thailand aus SMS versenden konnte, wussten wir beide nicht.
Der Abendwind war angenehm, die Temperatur genau richtig, und ich fühlte mich gut wie lange nicht mehr. Plötzlich hatte ich das Gefühl, meine Ferien hätten eben erst begonnen, und konnte nicht begreifen, warum um Himmels willen ich so lange unfähig gewesen war, mein Fahrrad wieder auf Vordermann zu bringen. Von heute an würde ich jeden Tag eine Tour machen. Radfahren war ja tausendmal unterhaltsamer als Joggen. Man sah etwas von der Welt und kam außerdem an netten Lokalen vorbei. Auch für den morgendlichen Weg ins Büro würde ich künftig, so oft es ging, das Rad nehmen und abends nach Dienst gar nicht erst nach Hause fahren, sondern die Gegend erkunden, meine immer noch neue Heimat entdecken. Fit und ein bisschen schlanker würde ich werden und nur noch gute Laune haben. Über dieser Vorstellung schlief ich ein.
Natürlich wählte ich für den Heimweg nicht dieselbe Strecke wie für die Herfahrt, und natürlich führte mich dieser Weg an der Stelle vorbei, wo Rosana gelegen hatte. Einmal Kripo, immer Kripo, hatte Vera gerne gesagt, als sie noch lebte.
Auch bergab wurde ich unentwegt überholt. Aber diesmal machte mir das nichts aus. Bergab zu rasen, zeugt weder von Kondition noch von Mut, sondern nur von mangelnder Phantasie. Ich bremste ständig und hatte dabei sogar die schöne Ausrede, dass ich nicht aus Versehen an der gesuchten Stelle vorbeisausen wollte. Diese war jedoch nicht zu übersehen.
Ein Stück weiß-rotes Polizei-Absperrband flatterte im Auslauf einer scharfen Linkskurve. Einige helle Schrammen im Asphalt, die vermutlich von der dahinschlitternden BMW stammten, endeten im aufgewühlten Moos am Straßenrand. Die Straße führte hier durch einen hohen, lichten Buchenwald, nur hie und da hatte sich eine Tanne dazwischengemogelt. Es duftete nach Sommerabend, irgendwo in der Ferne wurde gegrillt, Menschen lachten. Die Vögel, die in der Hitze des Tages geschwiegen hatten, holten das Versäumte jetzt mit umso größerem Eifer nach. In der Ferne hupte ein Auto.
Rosana musste etwa zehn Schritte vom Straßenrand entfernt unterhalb einer ungefähr anderthalb Meter hohen Böschung gelegen haben. Der Täter hatte sie hinuntergeworfen wie einen Müllsack, in dieses struppige Gebüsch, und es war ein Wunder, dass der Motorradfahrer sie im Dunkeln überhaupt bemerkt hatte.
Ich lehnte mein Rad an einen Baum, setzte mich oberhalb der Böschung auf den weichen Boden und sah hinab. Die Spuren der Retter und Spurensucher waren deutlich zu erkennen. Aber das war auch schon alles, was es hier zu sehen gab.
Warum hatte der Täter ausgerechnet diesen Ort für geeignet gehalten, sein Opfer loszuwerden? Dort, wo er die Frau niedergeschlagen hatte, konnte sie vermutlich nicht liegen bleiben. Also hatte er sie ins Auto gepackt und hierher gefahren, so weit vom Tatort entfernt, dass keine Spur zurückführte. Wahrscheinlich hatte er sie für tot gehalten. Andernfalls musste er damit rechnen, dass sie ihn verriet, sobald sie das Bewusstsein wiedererlangte.
Auffällig war, dass der Täter es nicht für notwendig befunden hatte, die vermeintliche Leiche zu verstecken. Er hätte sie ja irgendwo vergraben können. Oder wenigstens ein Stück von der Straße entfernt unter dem Laub verscharren. Er hatte sie jedoch nur wenige Meter weit getragen und dann diesen kleinen Abhang hinuntergeworfen. Offenbar war er der Überzeugung gewesen, dass es nicht gelingen würde, eine Verbindung zwischen ihm und seinem Opfer herzustellen.
Von irgendwoher wehte Musik heran, ein alter Schlager aus den Sechzigern, und plötzlich fühlte ich mich, als hätte ich eine große Entdeckung gemacht.
2
Am Sonntagabend sah ich das nun schon wohlbekannte Gesicht wieder, um zehn vor acht in den Fernsehnachrichten des SWR. Am Montag wurde es sogar in der süddeutschen Ausgabe der Bild-Zeitung gezeigt, zusammen mit einigen gutmütigen Spekulationen, sowie in fast allen Tageszeitungen Baden-Württembergs und der Pfalz.
Doch ohne Erfolg.
Das Wetter war unverändert heiß, sonnig und für das Oberrheintal ungewöhnlich klar, und tatsächlich machte ich in meiner zweiten und letzten Ferienwoche noch die eine oder andere Ausfahrt mit meinem Rad. Einmal besuchte ich abends Lorenzo, und wir spielten eine Partie Schach auf seiner Terrasse. Lorenzos wirklicher Name war Horst-Heinrich Lorentz. Ich hatte ihn im vergangenen Winter im Zuge der Aufklärung eines verzwickten Falls kennengelernt. Wir hatten uns ein wenig angefreundet und es bisher geschafft, die Verbindung nicht wieder abreißen zu lassen. Er bewohnte ein von außen schönes, innen jedoch altmodisch und für meinen Geschmack ungemütlich eingerichtetes Haus, das er von seinen Eltern geerbt und einfach so gelassen hatte, wie es war. Sein Vater war ein angesehener Professor an der Universität gewesen und hatte es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Lorenzo hatte zwar Verschiedenes studiert, dann jedoch nach allerhand Kapriolen ausgerechnet im Gastgewerbe seine Berufung gefunden.
Sein Haus lag unterhalb des Philosophenwegs über dem nördlichen Neckarufer und bot eine so unglaubliche Aussicht auf die Alte Brücke, die Stadt mit ihren Spitzweg-Giebeln und Turmspitzen, das selbst als Ruine noch majestätische Schloss, dass ihm mancher Amerikaner ohne Wimpernzucken Millionen dafür bezahlt hätte. Aber das war Lorenzo gleichgültig. Er gehörte zu den wenigen Glücklichen, die genug Geld hatten.
Selbstverständlich verlor ich das Schachspiel. Gegen Lorenzo verlor ich immer, aber hier ging es nicht um Sieg oder Niederlage, sondern um gemeinsames Schweigen und Grübeln, höchstens unterbrochen von einem gelegentlichen Brummen der Enttäuschung oder der Befriedigung, einem verschmitzten Grinsen, wenn einem ein guter Zug gelang. Dazu tranken wir Wein aus seinem Keller, der vermutlich zu den am besten ausgestatteten der ganzen Kurpfalz gehörte.
»Matt«, seufzte Lorenzo nach kaum zwanzig Minuten mit wohligem Behagen. Er machte sich nie die Mühe, seine Schadenfreude zu verbergen.
Wir stießen an. Die hohen Gläser klangen, dass ich meinte, man müsse es noch jenseits des Neckars hören. Der Abend war vollkommen windstill, die weiche Luft voller Geräusche, Düfte, Stimmen, Gemurmel und Gezirpe.
»Appetit?«, fragte Lorenzo, nachdem er sein Schlückchen Wein auf unbeschreiblichen Umwegen durch den Mund befördert hatte.
»Was glaubst du wohl, wozu ich hier bin?«
Lorenzo hatte nämlich nicht nur guten Wein im Keller, er konnte auch vorzüglich kochen. Jahrzehntelang hatte er als Empfangschef in großen Hotels mit exzellenten Küchen gearbeitet und dem jeweiligen Chef de Cuisine über die Schulter geguckt. In puncto Kochen war er mein unerreichbares Vorbild. Inzwischen hatte ich es dabei aber immerhin so weit gebracht, dass meine Zwillinge nicht mehr in Panik gerieten, wenn ich ein Sonntagsmenü plante.
Leise grunzend stemmte er sich aus dem knarrenden Korbsessel, ergriff seinen schwarzen Stock mit Elfenbeingriff und verschwand mit mühsamen kleinen Schritten in der Küche. Obwohl er noch nicht im Rentenalter war, hatte er wegen einer rasch fortschreitenden Arthrose den geliebten Beruf aufgeben müssen, der ihn die meiste Zeit zum Stehen zwang.
»Wo steckt eigentlich Maria?«, rief ich ihm nach.
»Sie hat ab September ein Engagement in Hannover«, rief er zurück. »Sie ist schon mal hingefahren, um sich ein Zimmer zu suchen. Wir werden uns leider nicht oft sehen in nächster Zeit.«
Maria war eine Schönheit italienischer Abstammung mit honigblondem Haar, gut zwanzig Jahre jünger als Lorenzo. Sie spielte Cello auf einem Niveau, von dem Normalsterbliche höchstens hin und wieder träumen. Die beiden schienen trotz des Altersunterschieds das glücklichste Paar zu sein, das ich kannte. Nie würde ich begreifen, was eine junge, attraktive Frau an diesem alten Kerl fand. Aber wer versteht schon die Beziehungen anderer? Wir verstehen ja meist nicht einmal unsere eigenen.
Ich lehnte mich zurück, faltete die Hände im Nacken und versuchte herauszufinden, welcher Wochentag heute war. Mittwoch? Donnerstag? Ich entschied mich für Mittwoch. Weshalb hatte ich eigentlich nur zwei Wochen Urlaub genommen? Was wollte ich bei diesem göttlichen Sommerwetter in meinem stickigen Büro mit meinen trockenen Akten? Sollte ich verlängern? Ja, wozu überhaupt arbeiten?
Auf einmal beneidete ich Lorenzo um seine Freiheit. Er war finanziell unabhängig und in jeder Hinsicht Herr seiner selbst. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass auch ich irgendwann in Pension gehen würde, vielleicht wie Lorenzo einen Stock benötigen. Dass Arbeiten, jeder Beruf, alles irgendwann ein Ende hat.
Meine Eltern fielen mir ein. Wie es ihnen wohl ging mit der abgesoffenen Wohnung, in ihrem engen Hotelzimmer? Warum riefen sie eigentlich nie an? Warum rief ich sie nie an? Auch mein Vater war Beamter gewesen, beim Finanzamt, und hatte mir, als die Zeit gekommen war, mit den üblichen Argumenten in den Ohren gelegen, ebenfalls in den Staatsdienst zu treten.
Lehrer kam nicht infrage, davon hatte ich zu viele kennengelernt, das Finanzamt war für mich unvorstellbar gewesen, und so hatte die Polizei nicht weit gelegen. Ich liebte es, mit Menschen zu tun zu haben, den verschiedensten Menschen aus allen Schichten. An ihrem Schicksal teilzuhaben. Meinen Teil dazu beizutragen, ihre Welt in Ordnung zu halten. Zu helfen, sie wieder zurechtzurücken, falls sie einmal in Unordnung geraten war.
Und das war leider ein Problem bei der Position, die ich nun seit fast einem Jahr bekleidete: Als Kripochef hatte ich im Leben außerhalb meines Büros nichts mehr zu suchen. Ohne recht zu wissen, wie mir geschah, war ich plötzlich zum Verwaltungsbeamten mutiert, der das Leben außerhalb der Polizeidirektion nur noch vom Hörensagen und aus Berichten und Protokollen kannte.
Ich nippte an meinem Wein, während Lorenzo in der Küche heimelige Geräusche erzeugte. Meine Gedanken schwebten von hier nach dort und landeten – wo sonst – bei Theresa. Auch wenn wir Funkstille vereinbart hatten, fand ich, hätte sie mir wenigstens eine klitzekleine SMS schicken können, damit ich mir keine unnötigen Sorgen machte. Natürlich machte ich mir nicht die geringsten Sorgen um sie, aber das konnte sie ja nicht wissen. Ich brauchte sie, wurde mir bewusst, jetzt, wo sie nicht da war. Und wie vermutlich alle Männer dieser Welt hasste ich es, jemanden zu brauchen.
Ich nahm mir vor, aus unserem Wiedersehen in knapp drei Wochen ein Fest zu machen mit Champagner und Kaviarhäppchen, echtem Kaviar natürlich, Lachs und Trüffelpastete. Theresa liebte den Luxus, und manchmal beschlich mich das Gefühl, auch ihre Beziehung zu mir sei nur eine Art Luxus für sie. Etwas, das sie sich gönnte wie eine neue Frisur, ein Schaumbad bei barocker Trompetenmusik, sinnlos teure Unterwäsche oder ein siebengängiges Abendessen im Hotel Ritter. War es das, was mich so verrückt machte nach dieser Frau? Dass sie mir nie das Gefühl gab, ich könnte sie besitzen? Dass ich immer wusste, es war nur auf Zeit, auf lange Zeit vielleicht, aber eben doch eine Beziehung ohne Ewigkeitsanspruch und Treueschwüre?
Lorenzo klapperte immer noch in der Küche herum. Er verriet grundsätzlich nie, was er auf den Tisch bringen würde, aber es war immer das Passende. Es duftete jetzt ein bisschen nach Thymian und, in diesem Haus unverzichtbar, nach Knoblauch. Ich tippte auf Fisch.
Drüben lag das rote Schloss im Abendlicht, manche Fenster der Altstadt glühten auf im Feuer der untergehenden Sonne. Ich gönnte mir noch einen Schluck Wein. Nein, unvorstellbar, niemals würde ich in Pension gehen, denn ich war ja unsterblich.
Humpelnd erschien Lorenzo mit zwei großen, flachen Tellern, die so heiß waren, dass er sie nur mithilfe zweier blau karierter Küchentücher anfassen konnte. Pangasiusfilet, gedämpft, erklärte er, dazu Basmatireis, vermengt mit ein wenig Wildreis, feines Mischgemüse, und das alles in einer rötlichen und nach allen Wundern des Mittelmeers duftenden Soße. Wie um alles in der Welt hatte er das in fünf Minuten hingezaubert? Wenn ich so etwas kochte, dann stand ich zwei Stunden in der Küche und verbrachte anschließend zwei weitere damit, die angerichteten Kollateralschäden zu beseitigen.
Oder sollten es mehr als fünf Minuten gewesen sein? Ich begann, das Gefühl für die Zeit zu verlieren. Ein gutes Zeichen. Morgen früh würde ich in der Direktion anrufen und meinen Urlaub verlängern. Vangelis konnte mich problemlos noch zwei weitere Wochen vertreten. Sie war meine beste und zuverlässigste Mitarbeiterin, und (aber das verriet ich natürlich niemandem) in manchen Dingen besser als ich. Am Samstag würde ich vielleicht wieder einmal Lotto spielen. Im Radio hatte ich gehört, fünfzehn Millionen lägen im Jackpot.
Die Soße war zu sauer und außerdem versalzen, und Lorenzo hatte plötzlich schlechte Laune.
»Das ist mir ja schon ewig nicht mehr passiert!«, maulte er, als wäre es meine Schuld.
Gegen das Salz half ein fruchtiger Chardonnay aus dem Trentino, stellten wir fest, und die übertriebene Säure war vermutlich gut für die Verdauung. Diesmal war ich es, der sich keine Mühe gab, seine Schadenfreude zu verhehlen.
»Dieser Wein ist einsame Spitze. Gibt’s in Norditalien auch Mafiaclans, zu denen du Beziehungen pflegst?«, fragte ich kauend.
Lorenzo war – soweit ich informiert war – ein gesetzestreuer Mann. Er hatte jedoch aus Gründen, über die er hartnäckig die Aussage verweigerte, geheimnisvolle Kontakte zu irgendeiner kalabresischen Mafiagröße. In grauer Vorzeit hatte er dessen Sohn unter nicht näher bekannten Umständen das Leben gerettet, und seither wurde sein Weinkeller niemals leer. Da es kein Verbrechen ist, von Verbrechern ohne Gegenleistung Geschenke anzunehmen, ging mich das in meiner Eigenschaft als Polizist nichts an. In meiner Eigenschaft als Freund jedoch schon, fand ich. Aber wie immer biss ich auch heute auf Granit mit meinen Sticheleien.
»Den Chardonnay musste ich leider Gottes bezahlen«, erwiderte er und studierte mit kritischem Blick das Etikett. »Das Zeug ist entsetzlich teuer, aber ich muss sagen, es ist jeden Cent wert.«
Später, da war es schon dunkel, gelang es mir mit knapper Not zu verhindern, dass Lorenzo noch eine dritte Flasche öffnete. Der Alkohol machte mir inzwischen zu schaffen, und auch mein Gastgeber war längst nicht mehr nüchtern. Wir alberten herum, philosophierten über Belanglosigkeiten, und irgendwann kam unser Gespräch auf die verletzte Frau, die keiner vermisste. Auch Lorenzo hatte die Geschichte in der Presse verfolgt.
»Sie ist jedenfalls nicht von hier«, sagte ich, »sonst hätte sich längst jemand gemeldet, der sie kennt.«
»Woher mag sie kommen?«
»Wenn ich im Dienst wäre, dann würde ich auf Osteuropa tippen. Balkan, Menschenhandel, irgend so was. Ich bin aber nicht im Dienst, ich habe Urlaub.«
»Du meinst, sie sollte zur Prostituierten gemacht werden? Zuhälter, vor allem die aus dem Osten, sollen ja recht rigoros sein im Umgang mit … hm … unwilligem Personal.«
»Dann hätte sie ganz andere Verletzungen. Prellungen, Blutergüsse, Spuren von ausgedrückten Zigaretten am Körper. Sie hätten sie vergewaltigt, wieder und wieder. Nichts davon haben meine Leute gefunden. Nur ein einziger glatter Schlag auf den Hinterkopf und aus.«
»Ich habe gelesen, sie ist über den Berg. Irgendwann wird sie zu sich kommen und reden.«
Eine Weile schwiegen wir. Leichter Wind kam auf, die Rosenbüsche unterhalb Lorenzos Terrasse dufteten.
»Sagst du nicht immer, Morde seien meistens Beziehungstaten?«
»Ja, ja, der gute alte eifersüchtige Ehemann. Aber der hätte sich längst gestellt.« Ich nahm den letzten Schluck Wein, ließ ihn langsam durch meinen Mund schweben. Schluckte erst, als es gar nicht mehr anders ging. »Oder sich auf dem Dachboden erhängt.«
Gedankenverloren sah Lorenzo auf den Neckar hinunter, wo immer noch Boote unterwegs waren. Lachen klang zu uns herauf. Eine Frau kreischte, etwas platschte ins Wasser.
»Eine Touristin?« Lorenzo sah mir plötzlich lebhaft ins Gesicht. »Eine alleinreisende Amerikanerin vielleicht? Auf Europarundreise? Dann kann es Monate dauern, bis sie jemand vermisst.«
»Ich vermute eher, der Täter hatte Panik. Zu unserem Glück stellt sich der Mensch selten so dämlich an, wie wenn er ein Verbrechen begeht.«
Was redete ich da? Was ging mich das alles an? Ich hatte Ferien. Auch Lorenzo hatte nun das Interesse am Thema verloren. Versonnen sahen wir auf das mittlerweile von Scheinwerfern angestrahlte Schloss, wo immer noch verspätete Touristen Erinnerungsfotos knipsten. Und in den unzähligen dunklen Ecken trieben sich bestimmt unzählige Liebespaare herum. Ob auch meine Töchter darunter waren? Heute Morgen waren sie ungewöhnlich früh aufgestanden und hatten mir beim Frühstück erzählt, sie wollten zusammen mit einer Freundin irgendeinen Reiterverein besuchen. Wozu, hatte ich nicht verstanden. Und falls sie sich nun wirklich dort drüben mit Jungs vergnügen sollten? Hatte ich mir nicht felsenfest vorgenommen, niemals zu den Vätern zu gehören, die auf die Lover ihrer Töchter eifersüchtig sind? Heute gelang es mir beinahe.
Ein Ausflugsdampferchen verließ brummend die Schleuse flussabwärts. Schmalzige Musik wehte zu uns herauf, eine Lautsprecherdurchsage erklärte das baldige Ende einer gelungenen Rundfahrt. Manchmal kann Kitsch richtig schön sein.
»Seltsame Vorstellung, dass man einfach seine Identität verlieren könnte.« Lorenzos Gedanken kreisten offenbar doch noch um die unbekannte Frau. »Plötzlich ist man kein Mensch mehr, sondern nur noch ein Aktenzeichen. Ein Klumpen aus Wasser und Kohlenstoff und ein paar anderen Materialien im Wert von vielleicht zehn Mark.«
Er ignorierte standhaft die Tatsache, dass es die D-Mark seit Jahren nicht mehr gab.
»Ich sage es ungern, mein Freund, aber du wirst auf deine alten Tage ganz schön trivial.«
»Einer der wenigen Vorzüge des Alters«, meinte Lorenzo vergnügt, »man muss nicht mehr unentwegt einen intelligenten Eindruck machen.«
3
Aus der Verlängerung meines Urlaubs wurde nichts, und der Jackpot war am Sonntag immer noch nicht geknackt. Dabei hatte ich sogar einen Lottoschein ausgefüllt, später jedoch vergessen, ihn abzugeben. Klara Vangelis hatte zu meiner Überraschung plötzlich Urlaub beantragt und ihn sich auch gleich selbst genehmigt. Dagegen konnte ich schlecht etwas sagen, denn auch sie hatte natürlich ein Recht auf Erholung.
So ließ ich am Montagmorgen meine wegen der Ferienzeit stark dezimierten Truppen antreten und Bericht erstatten. Natürlich waren vor allem die anwesend, die keine schulpflichtigen Kinder hatten.
Die unbekannte Frau war seit Samstag bei Bewusstsein, erfuhr ich von Sven Balke.
»Das heißt, wir wissen jetzt endlich, wer sie so zugerichtet hat?«
»Das leider nicht«, erwiderte er. »Sie spricht nämlich nicht. Es liegt vermutlich an dem Schlag auf den Hinterkopf, meinen die Medizinmänner.«
Balke stammte aus dem Norden. Man sah es, und man hörte es, sowie er den Mund aufmachte. Er war in der Nähe von Bremerhaven aufgewachsen und aus mir nicht bekannten Gründen irgendwann in Heidelberg gestrandet. Hellblond und kräftig, selbstbewusst und mit diesem gewissen Glitzern im Blick war er der Schwarm nahezu jeder geschlechtsreifen Frau und, da er diese Eigenschaft oder Fähigkeit mit Vergnügen ausnutzte, vermutlich der Albtraum jeder Schwiegermutter in spe. Seit etwa einem halben Jahr war er jedoch in festen Händen. Nun wohnte er mit seiner Nicole zusammen, die darauf achtete, dass er abends rechtzeitig ins Bett kam und morgens meistens rasiert zum Dienst erschien.
»Aber irgendwann wird sie ja hoffentlich imstande sein, eine Aussage zu machen.«
Balke hob die Schultern. »Die Ärzte können es momentan einfach noch nicht sagen. Möglich, dass sie von Geburt an stumm ist.«
»Dann wird sie einen Stift halten und schreiben können.«
»Dass es einem vorübergehend die Sprache verschlägt, ist bei einer schweren Gehirnerschütterung nichts Ungewöhnliches, hat man mir erklärt. Wir werden wohl einfach noch ein bisschen Geduld haben müssen.«
Der Rest von dem, was meine Leute zu berichten hatten, war langweilig, und so löste ich die Runde bald auf, in der angenehmen Gewissheit, dass die Welt im schönen Heidelberg – abgesehen vom üblichen Kleinkram wie Taschendiebstählen und nächtlichen Prügeleien auf der Hauptstraße – im Großen und Ganzen in Ordnung war. Etwas beunruhigend war nur eine Einbruchserie in den Dörfern des südlichen Odenwalds, die nun schon fast ein halbes Jahr anhielt und den zuständigen Mitarbeitern langsam den letzten Nerv raubte. Immer traf es Häuser wohlhabender Bürger, die für längere Zeit verreist waren. Eine Spur hinterließen die Täter nie, die im Übrigen ein erstaunliches Gespür für den Wert der wenigen gestohlenen Dinge an den Tag legten. Meist fehlte nur Bargeld, wenn die Hausbesitzer heimkehrten, manchmal ein wenig ausgewählt kostbarer Schmuck. Niemals wurde mehr zerstört als unbedingt nötig. Aber früher oder später würden auch diese Täter – vermutlich waren es zwei – von Nachbarn beobachtet werden oder in eine nächtliche Verkehrskontrolle geraten.
Meine Leute rückten Stühle, und dann war ich allein. Die Fenster standen weit offen, noch war die Luft draußen frisch, noch konnte man es aushalten. Das Häufchen Post auf meinem Schreibtisch war überraschend niedrig. Vor allem war nicht viel dabei, das mit Verwaltungskram zu tun hatte. Das war gut, denn erstens hasste ich Verwalten, und zweitens war Sonja Walldorf, meine Sekretärin, länger in Urlaub als ich, und ohne sie war ich in diesem Feld verloren. Viel lieber arbeitete ich bei der Aufklärung wichtiger Fälle mit, und »Sönnchen«, wie sie genannt werden wollte, hielt mir dabei den Rücken frei. Wir waren ein perfektes Team, und im Umgang mit Akten und Vorschriften war sie tausendmal erfahrener als ich, da sie schon meinem Vorgänger und dessen Vorgänger zur Hand gegangen war.
Meine Leute hatten sich notgedrungen damit arrangiert, dass ich es nicht lassen konnte, ihnen ins Handwerk zu pfuschen. Liebekind, mein Chef, zog zwar noch hie und da die buschigen Brauen hoch, ließ mich aber gewähren, solange der Rest funktionierte. Und dass er funktionierte, verdankte ich der besten aller Sekretärinnen.
Ich überflog die Wochenberichte meiner Mitarbeiter, die Vangelis für mich bereitgelegt hatte, und zeichnete sie ab. Die meisten Dienststellen, die mich sonst mit lästigen Anfragen und Datenerhebungen zu quälen pflegten, waren zum Glück derzeit ebenfalls unterbesetzt, selbst der E-Mail-Eingang hielt sich in Grenzen. Dafür, dass ich zwei Wochen nicht im Büro gewesen war, fand ich erstaunlich wenige dieser lästigen Müll-Mails vor. Allerdings war auch von Theresa nichts gekommen. Ich sortierte die Post auf zwei Stapel. Einen kleinen, den ich selbst erledigen würde, und einen großen, um den sich Sönnchen nach ihrer Rückkehr kümmern durfte.
Dann wusste ich plötzlich nichts mehr mit mir anzufangen, und so stand ich, ohne recht zu wissen wozu, um halb elf im Uniklinikum neben Rosanas Bett.
Auf dem weiß lackierten, blitzsauberen Nachttisch stand eine billige Vase mit einem halb verwelkten bunten Sträußchen. Die Wände waren in einem fröhlichen Gelb gestrichen. Es roch nach Plastik und Sauberkeit. Der Platz für das zweite Bett war leer. Vermutlich deshalb wirkte das Zimmer etwas ungemütlich.
Die Patientin war wach. Sie hatte die Decke bis zur Nasenspitze hochgezogen und sah mich aus dunklen Augen an. Verwirrt? Furchtsam? Ich lächelte beruhigend, aber sie reagierte nicht. Sie war noch zierlicher, als ich sie mir aufgrund der Beschreibung vorgestellt hatte. Vielleicht, weil das Bett und der Raum um sie herum so groß waren. Ein riesiger Verband klebte an ihrem Hinterkopf.
»Ich bin von der Polizei«, sagte ich und räusperte mich.
Sie wandte den Blick nicht ab, sondern schloss nach Sekunden einfach die Augen. Als hätte sie genug von mir gesehen. Als würde sie mich ausknipsen wie eine langweilig gewordene Seifenoper.
»Do you speak English?«
Keine Reaktion.
»Parlez-vous français?«
Nichts.
»Italiano? Español?«
Damit war ich am Ende mit meinen bescheidenen Sprachkenntnissen, wobei ich auf Italienisch und Spanisch ohnehin nicht viel mehr als »Guten Tag« oder »Brot und Wein« hätte sagen können. Eine groß gewachsene Schwester mit langen, hennaroten Locken beobachtete mich aufmerksam und leise amüsiert.
Das haben wir ja alles längst versucht, sagte ihre Miene.
Laut sagte sie: »Heute Nachmittag machen wir ein EEG. Ich hoffe, anschließend können wir Ihnen sagen, was mit der Dame los ist.«
»Kann man denn anhand der Hirnströme feststellen, ob ihr Sprachzentrum beschädigt ist oder so was?«
»Na ja, das zwar nicht. Aber wir können messen, ob ihr Gehirn auf bestimmte Reize reagiert.«
»Wie sieht es mit ihrem Erinnerungsvermögen aus? Wird sie den Täter beschreiben können?«
»Alles ist möglich.« Sie fuhr sich mit den Händen durchs üppige Haar. »Aber verlassen würde ich mich an Ihrer Stelle erst mal auf nichts.«
Wir befanden uns im dritten Obergeschoss des riesigen und verwirrend komplexen Gebäudes der Heidelberger Kopfklinik. Ich hatte zweimal fragen müssen, um die Abteilung für Neurologie zu finden. Auch hier standen alle Fenster offen. Im Gegensatz zu denen in meinem Büro gingen diese hier nach Westen, und so war es auch jetzt, am späten Vormittag, noch angenehm kühl. Draußen begannen ein Mann und eine Frau sich lautstark zu streiten. Autotüren knallten, ein Wagen fuhr mit quietschenden Reifen an. Dann war es wieder still.
Das Kettchen mit dem Kreuz trug unsere Unbekannte schon wieder am Hals.
»Das wollte sie unbedingt so«, erklärte die Schwester halblaut, als sie meinen Blick bemerkte. »Das war praktisch das Erste, nachdem sie wach war: Sie hat sich an den Hals gefasst und nach dem Kreuz getastet. Die Kolleginnen haben ihr das Ding dann umgehängt, und da hat sie gelächelt.«
Auch der dünne Ring mit dem funkelnden Steinchen steckte wieder an seinem Platz. Kleine, kräftige Hände hatte sie. Hände, die Arbeit gewohnt waren. Die Nägel waren kurz geschnitten und unlackiert. Auch ihr Gesicht hatte keinerlei Spuren von Make-up aufgewiesen, als man sie fand.
Eine leichte Sommerbluse hing im Einbauschrank. Viskose, mit dreißig Grad zu waschen und einem Punkt zu bügeln. Der Stoff duftete ein wenig nach Zimt, bildete ich mir ein. Am Rücken Schmutzspuren, ein langer Riss, beides vermutlich vom Sturz die Böschung hinab. Irgendwann war das Kleidungsstück enger gemacht worden. Mit der Hand genäht, nicht ohne Geschick. Hatte es früher jemand anders getragen? Oder hatte die Besitzerin abgenommen? Daneben hing eine Jeans der Marke Levi’s, überall auf der Welt zu kaufen. Am Gesäß einmal gestopft, der Saum der Hosenbeine schon ein wenig verschlissen. Nichts in den Taschen. Nicht einmal Krümel.
Reich war diese Frau nicht, so viel stand fest. Dem billigen weißen BH, Größe 70 B, fehlte jeglicher Sexappeal. Schließlich noch ein schwarzer Slip, altmodisch breit, ohne Hinweis auf seine Herkunft. Plötzlich fühlte ich mich wie ein Voyeur, wie ich mit der Unterwäsche einer Fremden in der Hand herumstand. Die Schwester beobachtete mich erwartungsvoll.
»Wo sind ihre Schuhe?«, fragte ich und legte die Sachen ins Fach zurück. »Die Strümpfe?«
Sie schüttelte die rote Lockenpracht. »Nicht mal ein Taschentuch hat das Schwein ihr gelassen.«
Die Augen der Patientin waren immer noch geschlossen. Ihr Atem ging flach und ruhig. Nichts in ihrer entspannten Miene verriet, ob sie uns hörte.
»Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?«
»Ihr Friseur muss ein Idiot sein.«
Jetzt sah ich es auch: Das Haar der Patientin, das mir länger vorkam, als ich es von den Fotos in Erinnerung hatte, war äußerst talentlos geschnitten. Es sah aus wie das Ergebnis einer Do-it-yourself-Aktion vor dem Spiegel, zudem mit stumpfer Schere.
»Manchmal hat sie ein bisschen erhöhte Temperatur. Sonst ist alles so weit normal. Den Umständen entsprechend sozusagen.«
»Was ist mit ihrem Gebiss? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten?«
»Da sollten Sie vielleicht besser mit einem der Ärzte reden.« Die hennarote Schwester sah auf ihre eckige silberne Armbanduhr. »Gleich kommt das Essen, und vorher müsste ich eigentlich noch eine Runde Blutdruck und Fieber messen.«
»Wo kommen die Blumen her?«, fragte ich, als sie mir zum Abschied überraschend kräftig die Hand drückte. »Hat sie Besuch gehabt?«
»Nein. Die waren übrig. Die Frau im zweiten Bett durfte gestern heim und hat sie hiergelassen.«
»Hat sich vielleicht jemand nach ihr erkundigt, seit sie hier ist?«
»Kann ich nicht sagen. Ich war bis letzten Mittwoch im Urlaub. Ostsee, Meckpomm, echt klasse, wenn man sich mal so richtig erholen will.«
Ich überreichte ihr mein Kärtchen mit dem Kommentar »Falls noch was ist«, und sie verschwand eilig.
Nun war ich allein mit unserer Unbekannten. Ich nahm die Bluse noch einmal in die Hand. Sie war nicht mein Geschmack. Zu bunt, vielleicht einem abstrakten Gemälde nachempfunden, jedenfalls nichts Alltägliches. Ich ärgerte mich ein bisschen über meine Leute. Warum hatte man in der Presse nicht auf dieses Kleidungsstück hingewiesen? Dieses Muster war manchen Menschen gewiss besser im Gedächtnis geblieben als das Halskettchen.
Inzwischen waren über zwei Wochen vergangen. Diese Spur war kalt. Alle Spuren waren inzwischen kalt. Drei Tage, sagen wir immer. Was wir nach drei Tagen nicht gefunden haben, das brauchen wir nicht mehr zu suchen.
Mechanisch schlug ich die Umschläge der kurzen Ärmel um, fand im linken ein Haar und ärgerte mich nun wirklich. Ein blondes Haar, vielleicht zehn Zentimeter lang, das die Herren von der Spurensicherung offenbar übersehen hatten. Ich tat es in eines der Plastiktütchen, von denen ich aus Gewohnheit immer einige in der Jacketttasche trug. Hier war wohl wieder einmal ein Gespräch mit gehobener Lautstärke notwendig. Ich beschloss, mir die Akten vorlegen zu lassen, sobald ich wieder im Büro war. Wer konnte wissen, was die Herrschaften noch alles übersehen hatten?
Aber daraus wurde vorläufig nichts.
Mein Handy schlug Alarm.
»Chef, wir haben hier eine ziemliche Schweinerei.« Balkes Stimme klang heiser. »Sollten Sie sich vielleicht mal ansehen.«
Es musste schlimm sein.
4
»Die ganze Zeit haben wir uns gewundert, woher der widerliche Gestank kommt«, erklärte mir ein rüstiger, kugelrunder Mann, dessen Alter ich auf Mitte sechzig schätzte. Seine verschreckte, weißhaarige Frau überragte ihn um Haupteslänge und nickte zu jedem seiner Worte.
Wir standen am Rande eines kleinbürgerlichen Wohngebiets am südlichen Ortsrand von Altenbach. Meine Gesprächspartner waren Besitzer eines zweigeschossigen Häuschens aus der Nachkriegszeit. Das überraschend große Grundstück, auf dem es stand, stieg nach hinten hin stark an und grenzte an den Wald. Vorne, zwischen Haus und Straße, blühten hingebungsvoll gepflegte Rosen gegen die Hitze an. Wir standen am Zaun im rückwärtigen Teil des Gartens, wo sich Beet an Beet reihte. Tomaten, Stangenbohnen, Lauch, ein Kräuterbeet, ein großer, schön gewachsener Kirschbaum wie aus dem Bilderbuch. Die Hände der Frau verrieten, wer zuständig war.
Die Leiche lag nur wenige Schritte jenseits des mannshohen und rostigen Maschendrahtzauns in dichtem Gestrüpp und war schon weitgehend mumifiziert.
»Der Hund ist auch die ganze Zeit so rebellisch gewesen«, fuhr der Mann fort, dessen Namen ich erst beim zweiten Mal verstanden hatte: Aschebier. »Wir haben gedacht, vielleicht ist wieder ein Igel im Garten.«
»Wir mögen ja Igel«, fügte Frau Aschebier mit schuldbewusst gesenktem Blick hinzu. »Sie fressen nämlich Schnecken. Drum haben wir unseren Jury nicht mehr hinten rausgelassen, weil er sich immer so verrückt aufgeführt hat. Immer nur noch vorne, nicht wahr, mein Armer? Da hast du dich bestimmt geärgert, mein Guter?«
Der wuschelige, sandfarbene Hund zu ihren Füßen sah mit spitzen Ohren zu ihr auf und fiepte zustimmend.
Der Mann rieb sich das ausladende Kinn und nickte wichtig. »Hat sich nämlich schon ein paarmal eine blutige Nase geholt an einem. Er ist einfach zu blöd zu begreifen, dass er mit denen nicht fertig wird.«
Der Tote war männlich, zu Lebzeiten maximal eins siebzig groß gewesen, und in den vergangenen Tagen und Wochen hatten einige Tiere ihren Hunger an seinen sterblichen Überresten gestillt. Vielleicht aus diesem Grund fluchten die Spurensicherer heute noch mehr und lauter als sonst. Sogar Balke war blass.
»In den letzten Tagen hat der Gestank dann Gott sei Dank aufgehört«, meinte der Hausbesitzer grimmig.
»Erzähl dem Herrn von dem Wildschwein!«, flüsterte seine Frau, während sie den Hund zwischen den Ohren kraulte.
»Stimmt. Vor ein paar Jahren ist da nämlich mal eine verendete Wildsau gewesen. Und damals hat’s genauso gestunken. Nehme an, dass es an der Straße oben angefahren worden ist, die ist ungefähr hundert Meter von hier«, er wies irgendwohin, »und dann hat sich das blöde Vieh noch bis hierher geschleppt, und ausgerechnet hier, ausgerechnet an unserem Zaum muss es dann … na ja.«
»Genau.« Die Frau sah mich empört an. »Ungefähr da, wo der Mann jetzt liegt, da ist es gestorben.«
»Drum haben wir uns ja auch nichts weiter gedacht. Wieder irgendein totes Tier, haben meine Frau und ich gedacht. Ein großes. Die kleinen, die stinken … ja nicht so … lang.«
Bei seinen letzten Worten hatte er plötzlich langsamer gesprochen. Vielleicht wurde ihm erst jetzt bewusst, dass er und seine Frau wochenlang neben einem Toten gewohnt hatten.
Eine Weile beobachteten wir schweigend die zwei Spurenspezialisten in ihren weißen Kapuzenanzügen, die maulend und schimpfend in immer weiteren Kreisen durch das dichte und offenbar auch stachelige Gesträuch um den Leichnam herumstapften. Es waren die beiden, die im internen Dienstgebrauch »Dick und Doof« genannt wurden. Nach einem ersten, nicht allzu langen Blick auf die Leiche vermied ich es hinzusehen. Auch Balke beobachtete lieber die Vögel. Der neben uns herumlungernde baumlange Uniformierte betrachtete angestrengt seine ziemlich ramponierten schwarzen Halbschuhe und wirkte, als müsse er sich jeden Moment übergeben.
Schließlich kam der Chef der Spurensicherung durch Gestrüpp und Brennnesseln zu uns herüber. Unter den kritischen Blicken des Hausbesitzers schlüpfte er durch ein Loch im Zaun, das dabei nicht kleiner wurde. Mit der flachen Hand wischte er sich den Schweiß aus dem runzligen Gesicht. Seine Ähnlichkeit mit Oliver Hardy verblüffte mich immer wieder.
»Der Kunde kann dann weg. Die Mediziner werden aber nicht viel Spaß mit ihm haben. Die reinste Mumie. Sogar die Maden sind schon krepiert.«
Im Tal schlug eine Kirchturmuhr scheppernd zwölf.
»Die Todesursache?«
»Dafür sind wir nicht zuständig«, seufzte der schweißtriefende Kollege und blickte demonstrativ auf seine überraschend elegante Armbanduhr. Natürlich, wie hatte ich es vergessen können, es war Essenszeit.
Ich zwang mich, einen letzten Blick auf die Stelle jenseits des Zauns zu werfen. Die Haut des Toten war im Lauf der Wochen blauschwarz geworden. Die Augenhöhlen starrten leer zu mir herüber, das Gesicht war zu einem schadenfrohen Grinsen verzerrt.
»Echt eklige Geschichte«, meinte Balke während der Rückfahrt. »Keine zwanzig Meter vom nächsten Haus modert da wochenlang eine Leiche vor sich hin, und kein Schwein merkt irgendwas!«
Ich saß auf dem Beifahrersitz unseres mausgrauen, erst zwei Jahre alten BMW. Runkel, ein älterer Kollege, hing erschöpft auf dem Rücksitz und gähnte markerschütternd. Balke kurvte die Serpentinen der Straße nach Ziegelhausen hinunter, und wir wurden im Wagen hin und her geschaukelt.
»Also, Gerichtsmediziner, das wär ja kein Job für mich«, fuhr Balke mit seinen Überlegungen fort, als niemand reagierte. »Da muss man schon einen ziemlichen Schatten haben, um so was zu machen. Finden Sie nicht auch?«
Ich war absolut seiner Meinung, schwieg aber weiterhin. Bald kamen die ersten Häuser von Ziegelhausen in Sicht, Kurven und Schaukelei hatten ein Ende, und der Schatten der Bäume leider auch. Minuten später bog Balke auf die in der Mittagshitze flimmernde Bundesstraße in Richtung Heidelberg ab. Er überholte ein holländisches Wohnwagengespann, das auf der Suche nach einem geeigneten Parkplatz den spärlichen Verkehr behinderte. Im nächsten Augenblick musste er eine Vollbremsung hinlegen, weil ein Mann mit der Miene eines Priesters, Pilgerstab in der Hand, klobigem Rucksack auf dem Rücken und Wanderstiefeln an den Füßen, die Straße überquerte, ohne nach links oder rechts zu sehen.
»Da glaubt wirklich noch einer an Gott!«, knurrte Balke.
»Das kommt von der Hitze«, meinte Runkel von hinten. »Die Hitze macht die Leute verrückt.«
Balke drosch den ersten Gang ins Getriebe.
»In Offenburg hat vorgestern so ein Hartzie seine Frau umgebracht«, fuhr Runkel fort und gähnte schon wieder, »bloß weil sie gesagt hat, er könnte doch vielleicht mal duschen gehen. Und zack, haut er ihr einfach die Schnapsflasche über den Schädel.«
»Hartzies« nannten meine Leute seit Neuestem unsere traurigsten Kunden. Keine Arbeit, keine Zukunft, zu wenig Geld. Dafür jede Menge Alkohol, zu viel Streit, hin und wieder die Polizei im Haus und irgendwann leider oft auch die Kripo.
»Anschließend hat der Depp noch die Kollegen angerufen«, empörte sich Runkel, »und das Einzige, was den interessiert hat, war, ob die Zellen im Knast klimatisiert sind.«
»Und?«, fragte ich, von seinem Gähnen angesteckt. »Haben sie in Offenburg klimatisierte Zellen?«
»Das wär ja noch schöner«, brummte Runkel. »Solang nicht mal wir Klimaanlagen für unsere Büros kriegen.«
»Eigentlich sind das ja die nettesten Mordfälle«, meinte Balke mit schiefem Grinsen. »Der Mörder sitzt neben der Leiche, gibt alles zu, du tippst ein hübsches Protoköllchen, knipst ein paar Bilder, und fertig ist die Keksfabrik.«
»Aber da wären wir ja alle arbeitslos«, gab Runkel zu bedenken, »wenn das immer so wär.«
Womit er natürlich auch wieder recht hatte. Ich konnte inzwischen gar nicht mehr aufhören zu gähnen. Trotz auf höchster Stufe laufender Klimaanlage kam es mir vor, als würde es von Minute zu Minute heißer im Wagen.
»Sogar Mahsuri meint, die Hitze wär langsam nicht mehr zum Aushalten«, maulte Runkel nach längerem Nachdenken. »Und die kommt aus Indonesien!«
Er hatte, obwohl schon Ende vierzig, erst vor wenigen Jahren geheiratet. Darüber, wie er seine Mahsuri genau kennengelernt hatte, kursierten diverse Gerüchte. Er selbst schwieg zu diesem Punkt. Die Ehe schien jedoch bestens zu funktionieren und überaus fruchtbar zu sein. Längst hatte ich den Überblick verloren, wie viele Kinder er hatte und ob seine Frau gerade mal wieder schwanger war oder jüngst entbunden hatte. Mahsuri selbst hatte ich noch nie zu Gesicht bekommen. Balke dagegen schon, und er schwor, sie sei die hässlichste Frau, die er je gesehen habe.
Das Heidelberger Ortsschild und die Schleuse blieben zurück, bald kam die Alte Brücke in Sicht. Die Neckarwiesen an beiden Ufern – zwei bunte Meere von Menschen, Handtüchern und Sonnenschirmen. Auf dem Fluss trieben alle möglichen und unmöglichen Wasserfahrzeuge, von der einfachen Luftmatratze über Faltboote und Kanus bis hin zu kleinen Segelbooten mit schlapp herabhängender Takelage. Sogar eine aufblasbare Insel samt Palme bekam ich zu Gesicht. Kinderstimmen kreischten, es roch nach Wasser und Ferien. Ich hatte nicht die geringste Lust zu arbeiten und beneidete Vangelis, die für zwei Wochen nach Kreta geflogen war, wie ich vorhin von Balke erfahren hatte.
»Paps, wir brauchen Geld!«
»Das tun wir alle.«
Wir saßen beim Abendessen zusammen. Sarah und Louise dufteten nach Sonnencreme und frischer Luft und waren blendender Laune.
Sarah strahlte mich an. »Wir wollen ein Pferd.«
Richtig, heute waren sie ja bei diesem Reitclub in Handschuhsheim gewesen. Dass das gleich derart dramatische Folgen haben würde, hatte ich natürlich nicht erwartet.
»Habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, was so ein …?«
»Keine Angst.« Louise schenkte mir ihr liebstes Lächeln.
»Hört mal, Mädels. Ich kenne mich da natürlich nicht so aus, aber ich vermute, selbst wenn ihr das Pferd geschenkt bekommt, allein die Kosten für Futter, Unterbringung …«
»Meinst du, wir sind doof?«, fuhr mir Sarah barsch ins Wort.
»Sieh mal«, säuselte Louise, »wir wollen das Pferd doch gar nicht kaufen.«
Bei der Polizei nannten wir diese Taktik das »Good-Cop-bad-Cop-Spiel«.
Ich legte Lyoner auf eine Scheibe duftendes Bauernbrot und schnitt ein Radieschen in feine Scheiben. Das Brot hatte ich auf dem Heimweg noch rasch gekauft, und wieder einmal wurde mir bewusst, dass die einfachsten Dinge die größten Delikatessen sein können. Die Zwillinge hielten sich an ihren merkwürdigen Frischkäse, der nach nichts schmeckte, und Himbeermarmelade. Noch immer war ihre Vegetarierphase nicht zu Ende.
Ende der Leseprobe