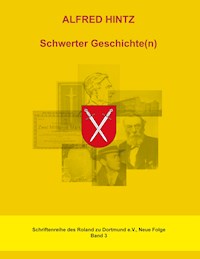
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriftenreihe des Roland zu Dortmund e.V., Neue Folge
- Sprache: Deutsch
Die Schwerter Geschichten sind eine lose Zusammenstellung verschiedener Aspekte der letzten 200 Jahre Schwerter Geschichte. Fürsorge, Emanzipation, Widerstand und Wiedaraufbau spielen dabei ebenso wichtige Rollen wie Inflation, Krieg, Vertreibung und Pogrome. Personen und Institutionen aus Schwerte werden in den größeren Zusammenhang deutscher und internationaler Geschichte gestellt und wiederum deren Auswirkung auf das Leben in Schwerte gezeigt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Druck dieses Buches wurde gefördert von Sparkassenstiftung Schwerte und Kulturbüro im Kultur- und Weiterbildungsbetrieb der Stadt Schwerte sowie Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG
Inhalt
Vorwort
19. Jahrhundert
Wurzeln des Bährens-Gymnasiums reichen in die Reformationszeit
Kampf gegen Fürstenthrone – für Einigkeit und Recht und Freiheit
„Oh grüß Dich Gott, Westfalenland“ – Heimatbild im Wandel der Zeit
Der Armenarzt von Schwerte
Herberge zur Heimat – Arbeit statt Almosen und Bollwerk gegen Bettelei
Erster Weltkrieg
Steckrübenwinter an der Heimatfront
Vom Soldatenlied zum Fußballfan-Gesang – Schwerter schrieb Text
Patriotische Gesinnungsbildung mit Hammer und Nagel
Weimarer Republik
Luise Elias – Jüdin im Schwerter Stadtrat
Hyperinflation 1923 – Schwerter Fabriken drucken Notgeld – Trikolore über der Hohensyburg
Nationalsozialismus
Vom braunen in den grauen Rock – das RAD-Arbeitslager „August Haßler“ in Ergste
Zwei Briefe von der Ostfront
Friedrich Kayser – Pazifist und Widerstandskämpfer
Kriegsende bis in die 1970er Jahre
Deutschland unterwegs – Was werden wir essen, wo werden wir schlafen?
Kriegsende vor über 75 Jahren – Ruhrtal im Abgrund
Hunger, Hamstern, Schwarzer Markt und Zigarettenwährung
„Hitlerismus und falsche Propheten schuld an Krieg und Katastrophe“
Währungsreform 1948 plündert Sparkonten – Bevölkerung verarmt
Kultureller Aufbruch aus Kriegstrümmern
Mit Kultur und britischer Kontrolle zur offenen Gesellschaft
Mit Schüppe und Hacke zum Eigenheim – „Häuslebauen“ gegen den Kommunismus
Halbstarke, Rock ‘n‘ Roll, Randale – Messerstecherei unterm schiefen Turm
Jüdisches Leben in Schwerte
Schwerter Persönlichkeiten
Erinnerungen an Willy Kramp – „Er liebte die Erde und den Himmel“
Vom Arbeiterkind zum umjubelten Opernsänger
Vorwort
Im Jahr 2008 hat der Roland zu Dortmund e.V. eine Dokumentation von Alfred Hintz über die Schicksale jüdischer Mitbürger, aber auch von Dissidenten und anderen dem nationalsozialistischen System unliebsamen Personen aus Schwerte unter dem Titel „Ohne Meldung unbekannt verzogen“ publiziert. Seither hat der Historiker und Journalist Alfred Hintz weitere Episoden zur Geschichte der Stadt Schwerte und ihrer Bewohner vor allem in der Zeitschrift „Aktive Senioren“ (AS), herausgegeben von der Stadt Schwerte, veröffentlicht. Der zeitliche Rahmen dieser Episoden reicht von etwa der Mitte des 19. bis schwerpunktmäßig zur Mitte des 20. Jahrhunderts und etwas darüber hinaus. Hintz beleuchtet dabei sowohl Einzelschicksale wie auch die Geschichte von Institutionen und Gemeinschaften vor dem Hintergrund der größeren deutschen Geschichte. Auch wenn hier nicht ganzen Familien-Clans nachgegangen wird, so sind es doch die biographischen und historischen Aspekte, die eine Veröffentlichung in der Schriftenreihe eines genealogischen Vereins rechtfertigen, denn Familiengeschichte wird erst dann richtig erlebbar, wenn persönliche Schicksale in den Kontext der regionalen und internationalen Geschichte gesetzt werden, wenn das Einzelschicksal eben kein einzelnes Schicksal ist.
Die hier wiederabgedruckten Beiträge wurden leicht überarbeitet und an einigen Stellen aktualisiert. Das Stadtarchiv Schwerte stellte durch seine Leiterin Beate Schwietz zudem zahlreiche Abbildungen aus den eigenen Beständen zur Verfügung.
19. Jahrhundert
Wurzeln des Bährens-Gymnasiums reichen in die Reformationszeit
Die Wurzeln des Friedrich-Bährens-Gymnasiums reichen 500 Jahre zurück in die Reformationszeit. Zwar findet man in den Akten des Gemeindearchivs Schwerte beim Landeskirchenamt Bielefeld keine Gründungsdaten der dem Gymnasium vorhergehenden Lateinschule. Aber, so Anna Warkentin, Archivarin beim Landeskirchenamt, man vermute, dass die Schwerter Schule „kurz nach der Reformation“, etwa gleichzeitig mit den entsprechenden Schulen in Breckerfeld, Kamen, Unna und Soest gegründet worden sei.
Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Magistrat der Stadt Schwerte über den konfessionellen Charakter des damaligen städtischen Realgymnasiums stellte das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Schwerte 1925/26 Nachforschungen zur Geschichte der evangelischen höheren Lehranstalt an. Grund dafür war, dass von katholischer Seite der evangelische Charakter der Anstalt bestritten worden war.
Das Gründungsjahr der Lateinschule ließ sich seinerzeit, wie aus dem beim Landeskirchenamt archivierten Bericht des Presbyteriums hervorgeht, nicht exakt ermitteln. Man ging aber davon aus, dass die Schule im Zusammenhang bzw. als Ergebnis der Schrift des Reformators Dr. Martin Luthers an die deutschen Städte errichtet wurde.
Die Reformation war eine Bildungs-Offensive. Luther ermahnte die politisch Verantwortlichen seiner Zeit zu spürbaren Investitionen in die Bildung. „Das ist ungemein gut angelegt“, schrieb er. Die Investitionen lägen in einem elementaren landespolitischen Eigeninteresse, denn „das Gedeihen einer Stadt besteht nicht allein darin, dass man große Häuser, viele Kanonen und Harnische herstellt [...] Vielmehr das ist einer Stadt Bestes und ihr allerprächtigstes Gedeihen, ihr Wohl und ihre Kraft, dass sie viele gute, gebildete, ehrbare, wohlerzogene Bürger hat, die dann sehr wohl Schätze und Güter sammeln können, sie erhalten und recht gebrauchen“ (aus: „An die Ratsherren aller Städte deutschen Lands“, in: Metzger, Wolfgang (Hg.): Calwer Luther-Ausgabe, Bd. 4, Stuttgart 1955, S. 160-162).
Unterrichtsgebäude der ursprünglichen Lateinschule war eingangs vermutlich das Gebäude der späteren Synagoge an der Großen Marktstraße. Von 1702 an war der dritte Pfarrer der ev.-luth. Kirchengemeinde neben seiner Funktion als Pfarrer zugleich auch Rektor der Lateinschule, weil andere finanzielle Mittel außer denen der Kirchengemeinde zu seiner Besoldung nicht zur Verfügung standen.
Nach einem Bericht der Schwerter Zeitung von 1936 wurden Schüler in dem Gebäude der ehemaligen Synagoge durch Erteilung von Lateinunterricht durch den dritten Pfarrer, u. a. Friedrich Bährens (* 1. März 1765 in Meinerzhagen, † 16. Oktober 1833 in Schwerte), auf den Besuch eines Gymnasiums vorbereitet.
Bährens, Namensgeber des späteren Gymnasiums, war ebenfalls einer der Rektoren der Lateinschule. Etwas in Vergessenheit geraten ist inzwischen, dass das Gymnasium vor seiner Benennung mit dem Namen des Schwerter Hofrats und Mediziners Bährens „Goethe-Gymnasium“ hieß.
Vom Zeitpunkt der Gründung im 16. Jahrhundert bis 1925 handelte es sich um eine ausschließlich evangelische Schule, denn von evangelisch-kirchlicher Seite wurden nachweislich von 1702 bis 1855 durch die personelle und finanzielle Verknüpfung der dritten Pfarrstelle mit dem Rektorat der Schule laufende Beiträge zum Unterhalt der Schule geleistet. Mit Vertrag zwischen evangelischer Kirchengemeinde und dem Schwerter Magistrat vom 15. November 1855 wurde die Schule eine städtische ev. höhere Lateinschule, später über die Umwandlung in ein Realgymnasium und dann ein Progymnasium schließlich zum Gymnasium.
Lehrerkollegium 1955 (Foto: StASchw, FBG, Nr. 3) v.l.n.r. (stehend): van Ackeren, Kling, Korb, Dietzler, Grundmann, Weinrich, Winken, Aubke, Dette, Killet, Stüttgen, Schmidt, Hillebrand, Pfr. Stumpf (sitzend): Abel, Buckemüller, Maruschke, Herzer, Fromen, Jäde, Hiddemann, Hahn
Bis 1925 war der gesamte Lehrkörper evangelisch. Entgegen Festlegungen von 1900 und 1901 wurden dann zwei katholische Studienräte angestellt. Im Jahre 1926 unterrichteten dort 17 Lehrkräfte, davon waren 14 evangelisch und drei katholisch. Der renommierte Historiker Thomas Nipperdey bilanziert zum Thema Religion den „konfessionellen Gegensatz als Grundtatsache“. Er schreibt, für die meisten Menschen des 19. Jahrhunderts sei „der Konfessionsgegensatz ungleich wichtiger als jener doch auch fundamentale Gegensatz zwischen Christen und Nicht-Christen“ gewesen. Dieser konfessionelle Gegensatz bestimmte „das Leben und den Stil, vom Schulbesuch übers Heiraten und die Tragödien, wenn eine Liebe an der Konfessionsverschiedenheit auflief, bis zu den geselligen Kreisen“ (Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866 – 1918, Bd. I, S. 529).
Das spätere Synagogengebäude wurde von der jüdischen Gemeinde Schwerte etwa um 1850 von der ev. Gemeinde käuflich erworben und um 1920 von dem bekannten Architekten Friedrich Schmitz, der auch das neue Rathaus entwarf, umgebaut. Am 9. November 1938 wurde die Synagoge während der sogenannten „Kristallnacht“, heute Pogromnacht, von den Nationalsozialisten entweiht und einige Tage später dem DRK Schwerte zur weiteren Verwendung übergeben.
Nach Beendigung des Krieges fiel die Synagoge an Hermann Giesberg. Giesberg, mosaischen Glaubens und Teilnehmer des Ersten Weltkriegs, hatte die Deportation in das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. In den Folgejahren wechselte das Synagogengebäude mehrfach den Besitzer. Den meisten älteren Schwertern war es bekannt als Jahrzehnte langer Unterrichtsraum der Fahrschule Schleicher. Der letzte Inhaber, der in den Räumen der früheren Schwerter Zeitung eine Druckerei betrieb, wollte sein Unternehmen um den Raum der früheren Synagoge erweitern, stellte einen Erweiterungsantrag und ließ das Gebäude 1984 in Unkenntnis der früheren sakralen Funktion abreißen. Die Leerstelle an der Großen Marktstraße wurde Gedenkstätte.
Kampf gegen Fürstenthrone – für Einigkeit und Recht und Freiheit
Die Revolution von 1848/49 war eine gescheiterte Revolution. Dennoch wurden ihre Ideale und Ziele letztendlich erfolgreich verwirklicht. Zwar schlugen preußische Soldaten im Frühjahr 1849 den Aufstand – auch der Arbeiter – in der Nachbarstadt Iserlohn in einem blutigen Massaker mit über 100 Todesopfern nieder. Doch ein Jahr zuvor – nach den Berliner Barrikadenkämpfen – hatte die schwarz-rot-goldene Siegerfahne am Turm von St. Viktor geweht, ein in die Zukunft weisendes Symbol für Einigkeit und Recht und Freiheit.
„Voran mit ihrer deutschen Fahne unsere wackren, vom Geist der Zeit mächtig angeregten Turner, die Rektoratsschüler, dann das 18 Ellen lange schwarz-rotgoldene Banner und hinter ihm der Sängerbund und die kernige Bürgerschaft“, so ein Zeitungsbericht. Und weiter: Unter Musik und Sang ging es zum Markt, „wo dem König [!] und unseren in Berlin für die Freiheit gefallenen Brüdern und der deutschen Einheit ein Hoch dargebracht wurde, welches Tausende von Stimmen in edler Begeisterung mehrfach wiederholten.“ Dann wurde die deutsche Flagge am Kirchturm gehisst (Öffentlicher Anzeiger für die Grafschaft Limburg, 1848, Nr. 26).
Turner, Männergesangvereine und Schützen waren bis in das Reichsgründungsjahrzehnt hinein Teil der deutschen Nationalbewegung. „Am Vorabend der Revolution bildeten sie [...] deren organisatorisches Fundament [...] Der Wille zur Nation wuchs in diesen Vereinen zur organisatorischen Massenbewegung heran. Ihnen kommt deshalb im Prozess der Nationsbildung der gleiche historische Rang zu wie den anderen Kräften und Entwicklungen, die den Nationalstaat vorbereiteten und ermöglichten [...] Und vor allem senkten sie das Leitbild ‚Nation‘ in das Denken und Fühlen vieler Menschen“ (Langewiesche, Dieter: Nationalstaat in Deutschland und Europa, S. 132/133).
Neben der nationalen Frage, also der Einigung der staatlichen Zersplitterung des deutschen Reichsverbandes stand darüber hinaus die Garantie staatsbürgerlicher Freiheiten durch eine Verfassung auf dem Programm der revolutionären Bewegung. Allerdings waren die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten (Pauperismus) und die daraus resultierenden Hungerrevolten ihre unmittelbare Vorgeschichte.
Unter den zahlreichen Bürgern, die die revolutionären Ideen begeistert aufgriffen, sich gegen Fürstenthrone, für „Einigkeit und Recht und Freiheit“, für ein demokratisches Deutschland engagierten, hatte sich der gebürtige Schwerter Moses Abraham Blumenfeld hervorgetan. Arno Herzig, em. Hamburger Historiker, hat Blumenfelds Vita, wie nachstehend zusammengefasst, skizziert (Herzig, Arno: Judentum und Emanzipation in Westfalen, S. 109):
Blumenfeld, mosaischen Glaubens, war nach den revolutionären Märztagen Teilnehmer des Westfälischen Kongresses Ende November 1848 in Münster. Eine spätere Druckschrift formuliert den Kongress-Anlass: „Als im November 1848 das Ministerium Brandenburg-Manteuffel den lang vorbereiteten Schlag gegen die Volksvertretung in Ausführung brachte, (siehe Iserlohn) entstand eine großartige, aber friedliche Agitation im ganzen Volk zum Schutze des durch die Revolution errungenen Rechtsbodens“. Der erste Antrag des Kongresses lautete: „Der Kongress erkennt an, dass die Nationalversammlung zu Berlin die einzige augenblicklich gesetzliche und gesetzgebende Gewalt ist.“ Neben anderen Punkten plante die Münsteraner Versammlung einen Aufruf an die Soldaten des Königs, sich nicht als Instrument zur Unterdrückung der Volksfreiheit missbrauchen zu lassen. Dazu hatte Blumenfeld, der zwischenzeitlich in Essen Lehrer und Kantor geworden war, einen Zusatzantrag eingebracht: „Zugleich die Familien aufzufordern, ihre im Heere dienenden Mitglieder über die Lage des Vaterlandes und ihre Pflichten aufzuklären.“
Diese politischen Forderungen reichten den preußíschen Juristen, Blumenfeld wegen „Verbrechen des Aufruhrs“, „versuchter Erregung von Aufruhr resp. Anreizung zu strafbaren Handlungen und zum Ungehorsam gegen das Gesetz und die Anordnungen der Obrigkeit“ sowie drittens wegen des „Versuchs der Erregung von Aufruhr resp. der öffentlichen Aufforderung des Soldatenaufstandes zum Ungehorsam“ in Hamm auf die Anklagebank zu setzen.
Einen knappen Monat nach der Münsteraner Veranstaltung wurde er am 12. Dezember 1848 mit 14 anderen Kongressteilnehmern verhaftet; Blumenfeld noch in der Schule. Zur Voruntersuchung wurde er bis zum 6. April 1849 im Münsteraner Zuchthaus inhaftiert, dann gegen Kaution entlassen. Im Prozess im folgenden Jahr, 1850, wurde er freigesprochen.
Moses Abraham Blumenfeld wurde 1821 in Schwerte geboren. Mit zehn Jahren wurde er von seinen Eltern zu Löb Cohen nach Hattingen zum Studium des Talmud und der rabbinischen Wissenschaften geschickt. Drei Jahre später besuchte er das Lehrerseminar am Max-Haindorf-Institut in Münster und bestand mit 16 Jahren in Soest die allgemeine und spezielle jüdische Lehrerprüfung. Vier Jahre arbeite er als Lehrer in Viersen, 1841 kam er dann nach Essen, wo er als Prediger, Kantor und Leiter der jüdischen Volksschule wirkte. Gemeinsam mit Franz Schwenniger gründete er in der Aufbruchphase der Revolution den Essener Arbeiterverein. Mit seiner Frau Lisette Fränkel, einer Verwandten Heinrich Heines, hatte er sieben Kinder. Als Blumenfeld am 9. Januar 1902 starb, geleitete ein unabsehbares Trauergefolge seinen Sarg zum Friedhof. Noch heute erinnert ein Straßenname in Essen an den jüdischen Revolutionär, ein Grabstein auf dem jüdischen Friedhof am Nordwall in Schwerte an seinen Vater Salomon Blumenfeld.
Karl Overweg, der zweite Schwerter „Pionier“ der Demokratie und des Parlamentarismus, wurde am 28. November als Sohn eines Gastwirtes in Unna geboren. Er erwarb 1842 das damalige Rittergut „Haus Ruhr“ in Wandhofen. Der Montanindustrielle, auf dessen Initiative die Errichtung des Vincke-Turms auf der Hohensyburg zurückgeht, vertrat 1848/49 den Wahlkreis Iserlohn/Hamm/ Dortmund in der Nationalversammlung in Frankfurt. Die am 18. März 1848 in der Frankfurter Paulskirche eröffnete und tagende Nationalversammlung war potentiell symbolisch und realpolitisch wichtigstes Ergebnis der Märzrevolution.
Als Abgeordneter in Frankfurt hatte Overweg mehrfach gegen die preußische Regierungspolitik opponiert – in Zeiten des Obrigkeitsstaates durchaus gewagt. Gemeinsam mit zwei weiteren Abgeordneten aus dem märkischen Raum protestierte er am 30. April 1849 öffentlich in einem „von Wohlhabenden und Armen“ mit unterzeichneten Aufruf gegen die Zurückweisung der Kaiserkrone durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV mit den Worten: „Die Liebe zum Vaterlande, welches durch die Politik des Staatsministeriums [...] an den Abgrund des Verderbens, an die Schwelle der Revolution gebracht ist, macht es uns zur heiligen Pflicht, die Erklärung abzugeben, daß uns diese Politik mit dem höchsten Mißtrauen erfüllt hat und wir nur dann die Rettung des Vaterlandes erwarten, wenn das jetzige Ministerium [...] einem wahrhaft vernünftigen Platz macht [...] Wir versichern zugleich, daß wir entschlossen sind, mit der uns von der Deutschen Nationalversammlung verkündeten Reichsverfassung zu stehen und zu fallen“ (Luda, Manfred: Abgeordnete in der Grafschaft Mark, S. 144).
In den stürmischen Zeiten der Revolution war Overweg ganz offensichtlich auch politisch aufgefallen. Denn, so Luda weiter, eine Zeitungsnotiz, die öffentliche Meinung, bezeichne Overweg auf Haus Ruhr gemeinsam mit einem anderen Abgeordneten bei der „Anstiftung des Aufstandes als sehr graviert (belastet).“ [Steht belastet in runden klammern im Zitat? Bei eigener Satzbeendung besser nach den Zitatzeichen!] Demgegenüber erklärte Overweg gegenüber der Zeitung, die ihn betreffenden hämischen und verdächtigenden Andeutungen und Bemerkungen als böswillige Erfindung.
Die Opposition gegen das politische System wurde bis 1840 fast ausschließlich vom Bildungsbürgertum getragen. Erst mit dem industriellen Durchbruch gewann die wirtschaftliche Führungsschicht des Bürgertums verstärkt Einfluss auf den deutschen Liberalismus. Karl Overweg gehörte als Angehöriger bank- und industriekapitalistischer Kreise über sein politisches Engagement hinaus zu den herausragenden Persönlichkeiten der beginnenden Industrialisierung im langsam aufstrebenden Ruhrgebiet. Er starb am 27. Mai 1876 auf Haus Letmathe.
Heute, fast 175 Jahre nach den Barrikadenkämpfen, nach Paulskirchenverfassung und folgender restaurativer Politik lässt sich nachstehendes Fazit ziehen: „Dass das Kaiserreich von 1871 – bei allen Einschränkungen – erstmals in der deutschen Geschichte einen nationalen Verfassungsstaat schuf, ist ohne die Ereignisse von 1848/49 schwer vorstellbar [...] Der mit der Paulskirchenverfassung von den gewählten Vertretern der deutschen Gesamtnation erhobene Anspruch auf Einheit und Freiheit ließ sich angesichts des gewaltigen und nachhaltigen Politisierungsschubes von 1848/49 [...] nicht mehr aus den Köpfen verbannen. Der Grundrechtskatalog der Paulskirche beeinflusste maßgeblich die Weimarer Verfassung von 1919 sowie das Grundgesetz von 1949“ (Brandt, Peter: „Die deutsche Revolution 1848/49“, in GlobKult, März 2010).
„Oh grüß Dich Gott, Westfalenland“ – Heimatbild im Wandel der Zeit
Viele Generationen „im Land vom Rhein bis Weserstrand“ sangen es: Das Westfalenlied. In der Schule, bei geselligen Anlässen, in den seinerzeit noch zahlreichen Gesangvereinen beim „kühlen Blonden“ oder zur fortgeschrittenen Stunde eines studentischen Kommerses. Die Urschrift des Textes von Emil Rittershaus wurde über Jahrzehnte im Ruhrtal-Museum Schwerte aufbewahrt.
Um die Überlassung der handschriftlichen Urfassung des Liedtextes, die der damalige Schwerter Museumsleiter Josef Spiegel 1932 für das Ruhrtal-Museum erworben hatte, kam es Jahre später zwischen der Ruhrstadt und Iserlohn zu einem langjährigen Streit. Nach knapp zehn Jahren wurde er von Iserlohn mit der „Zahlung“ von 13 römischen Silberdinaren als Ausgleich für Schwerte beendet.
Unweit des Segelflugplatzes Sümmern, in der Halinger Gemarkung Bertingloh, erinnert die imposante Bronzestatue eines bärtigen Mannes mit ordentlich gescheiteltem Haupthaar an den Verfasser der „westfälischen Hymne“. Im Hintergrund der Statue drei mächtige Findlinge, das Gesamtensemble mit Bruchsteinmauern stilvoll umfasst und geschickt in die hügelige Landschaft eingelassen. Man ist durchaus geneigt, einer Überlieferung zu folgen, die dort – oder zumindest in der Nähe – eine Kultstätte aus germanischen Zeiten verortet.
„Hier am Bertingloh verfasste ich 1869 das Westfalenlied“, ist auf einer Tafel des Rittershaus-Denkmals zu lesen. Vermutlich jedoch wurde der Dichter dort dazu wohl eher inspiriert. Denn das Stadtarchiv Iserlohn präzisiert: Nach seiner Rückkehr vom Gutshof Bertingloh in den Iserlohner Gasthof zur Post, „in dem er Wohnung genommen hatte, floss aus seiner Feder seine bedeutsamste Dichtung, das Westfalenlied“ (StA Iserlohn B 4, Nr. 89). Rittershaus, der als Unternehmer aus Barmen zahlreiche private und geschäftliche Verbindungen nach Iserlohn unterhielt, besuchte Ende April 1869 einen Iserlohner Geschäftsfreund zu dessen Hauseinweihung. Bei dieser Gelegenheit machte man in der waldreichen Umgebung einen Jagdausflug und besuchte dabei auch das Gut Bertingloh.
Friedrich Emil Rittershaus wurde am 3. April 1834 in Wuppertal-Barmen geboren. Dort starb er auch am 8. März 1897. Neben seiner hauptberuflichen Arbeit als Metallwarengroßhändler betätigte er sich als Dichter, Schriftsteller und als Hauptautor der damals sehr populären Zeitschrift „Die Gartenlaube“. Zu seinen Freunden zählte er die Dichter Ferdinand Freiligrath und Emanuel Geibel. Mit Hofmann von Fallersleben unterhielt er einen langjährigen Briefwechsel. Es gab ferner Kontakte zu Teilnehmern der Revolution 1848 wie z. B. Caspar Butz, ein Freund des 1848er Revolutionärs Friedrich Hecker, und Eduard Schute. Butz stand 1849 an der Spitze der Iserlohner Revolution.
Unmittelbar nach seiner Entstehung wurde der Rittershaus-Text von Peter Johann Peters, Kapellmeister des Kölner Stadttheaters, vertont. „Das Westfalenlied machte schnell die Runde durch die Männergesangvereine, tauchte in zahlreichen Lieder- und Kommersbüchern auf und wurde immer mehr zu dem Text, der mit Rittershaus in Verbindung gebracht wurde“, hält der Iserlohner Kunsthistoriker Walter Wehner fest. Er schaffte es von den Kriegsliederanthologien des Ersten Weltkriegs über das Soldatenliederbuch 1926 bis ins „Liederbuch der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei“.





























