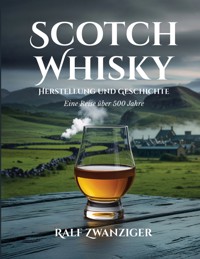
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist eine Zeitreise durch die gesamte Geschichte des Scotch Whiskys. Das erste Kapitel erklärt zunächst die einzelnen Schritte der Herstellung des Getränks - natürlich immer im Wandel der Zeit, denn über die Jahrhunderte haben sich die Produktionstechniken ständig weiterentwickelt. Der lange Prozess von der Ernte des Getreides über das Mälzen, Brennen, die Reifung im Holzfass bis hin zur Abfüllung in die Flasche, sowie die verschiedenen Arten von Whisky werden hierbei erklärt. Der zweite und weitaus größere Teil des Buches beschäftigt sich mit der über 500 Jahre alten Geschichte des schottischen Whiskys, von seiner ersten überlieferten Erwähnung im Jahr 1494 bis heute. Der Einfluss von Militär, Landwirtschaft, Infrastruktur und Naturkatastrophen auf die Whiskyherstellung wird ebenso beleuchtet wie der stärkste Faktor der Beeinflussung: die Politik mit ihren ständig wechselnden Anforderungen, Gesetzen, Steuern und willkürlichen Ideen. Sie lesen über die Entstehung der einzelnen Whiskyregionen und über die Geburt der schottischen Whiskyindustrie mit ihren großen Akteuren, sowie den von ihnen gegründeten und teilweise heute noch existierenden Großbrennereien. Sie erfahren die Geschichten der Whiskypioniere, die hinter der Gründung von heute noch bekannten Namen und Marken wie Chivas Regal, Johnnie Walker, Teacher's, Ballantine's, The Famous Grouse und vielen weiteren stecken. Sie lesen über den Siegeszug des Blended Scotch, wie am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Crash die Whiskyindustrie beschädigte, wie sie sich in den beiden Weltkriegen aufstellte und wie sie sich danach weiterentwickelte, was der Contergan-Skandal der 1960er Jahre mit Whisky zu tun hatte, wie der größte Getränkekonzern der Welt entstand und welche Rolle Guinness dabei spielte. Begeben Sie sich auf eine spannende Reise durch mehr als 500 Jahre Whiskygeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Herstellung von (Malt-)Whisky
Die Zutaten des Malt Whiskys
Mälzen des Getreides
Mahlen in der Malzmühle
Maischen und alkoholische Gärung
Destillation in einer Pot Still
Destillation in einer Column Still
Der Spirit Safe
Die Fassabfüllung
Fässer und Fassreifung
Finishing
Ursprung der Fässer
Kühlfilterung
Die Flaschenabfüllung
Whisky-Arten
Blended Scotch Whisky
Grain Whisky
Pot Still Whiskey
Single Grain Malt?
Blended Malt Whisky
Bastard Malt / Mystery Malt
The Singleton
Die Geschichte des Scotch Whiskys
Die frühen Jahre
Der Staat entdeckt die Geldquelle Alkohol
Das 18. Jahrhundert
Schottland in der Union
Infrastruktur durch das Militär
Weiterentwicklung der Landwirtschaft
Lowlands, Highlands und Whiskyregionen
Die Geburt der schottischen Whisky-Industrie
Lowland-Brennereien des späteren 18. Jahrhunderts
St Magdalene
Littlemill
Weitere Brennereien dieser Epoche
Die Auswirkungen einer Naturkatastrophe
Maische-Gesetz und eine inländische Grenze
Ein Untersuchungsausschuss für Brennereien
Das 19. Jahrhundert
Situation in den Lowlands
Situation in den Highlands
Das Jahr ohne Sommer
Das Verbrauchssteuergesetz von 1823
Die Auswirkungen des Gesetzes
Weiterentwicklung der Whiskyindustrie
Schwarzbrennen nach 1823
Die Whiskyregion Campbeltown
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
Die Anfänge des Blendings
Gründung der „Distillers Company Ltd“
Die Entstehung der großen Blender
John Haig & Co
Andrew Usher & Company
Mackie & Co: White Horse
Matthew Gloag & Son: The Famous Grouse
Charles Mackinlay
John Walker
John und Thomas Dewar
Chivas Brothers: Chivas Regal
James Buchanan: Black & White
George Ballantine: Ballantine’s Finest
William Teacher
William Phaup Lowrie
William Sanderson: VAT 69
Boom, Blase und der Pattison-Crash
Das 20. Jahrhundert
Der „Was ist Whisky“-Fall
Der Erste Weltkrieg
Nach dem Ersten Weltkrieg
Campbeltowns Untergang
Die Wirtschaftskrise vor dem Zweiten Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg
Rationalisierungen im 20. Jahrhundert
Malt Whisky auf dem Vormarsch
Probleme der 1980er Jahre
Das skandalöse Ende der DCL
Vorwurf Marktmanipulation
Nach der Übernahme
Entstehung des Diageo-Konzerns
Das 21. Jahrhundert
Ein hundertjähriger Whisky
Weitere Brennerei-Neugründungen im 21. Jahrhundert
Erneute Steuererhöhungen
Anhang
Anhang A: Alte Maßeinheiten
Geld
Pfund, Shilling, Pence
(Scots) Merk
Längenangaben
Foot / fit
Yard
(Scots) Mile
Gewichte und Massen
Unze
Pfund
Boll
Volumen, Flüssigkeiten, Alkoholstärke
Flüssigunze
Pint, Scottish Pint
Bushel
Gallone
Britische Fassgrößen
Alkoholstärke
Anhang B: Chronologische Ereignisse
Frühzeit bis 17. Jahrhundert
18. Jahrhundert
19. Jahrhundert
Neuzeit ab dem 20. Jahrhundert
Anhang C: Literatur- und Quellenverzeichnis
Bücher und E-Books
Bücher in Google-Books
Artikel in Magazinen und Zeitschriften
Sonstige Quellen
Anhang D: Abbildungsverzeichnis
Vorwort
Wenn man in einem Buchladen nach Büchern über Whisky sucht, findet man neben Michael Jacksons „Malt Whisky – das Standardwerk“ vor allem Bücher, die verschiedene Whiskybrennereien und deren Produkte beschreiben. Außerdem gibt es Bücher, die Tipps für ein Whisky-Tasting geben oder Reiserouten beschreiben, auf denen man verschiedene Brennereien auf einer Rundreise besuchen kann. Klar, da sind auch ein paar interessante Bücher dabei, einige davon stehen auch bei mir im Regal. Whisky ist ja die Spirituose mit den meisten Varianten und Sorten weltweit. Aber warum ist das so? Woher kommt diese Vielfalt? Und wer steckt eigentlich hinter den ganzen Produkten? Diese Infos findet man nur selten. Wie lange gibt es Whisky schon? Wie hat sich die Herstellung verändert? Und wer sind die wichtigen Leute und Erfinder in der Whiskybranche? Kurz gesagt: Wie ist die Geschichte von Whisky? Leider gibt es dazu bisher nur wenig Literatur, zumindest im deutschsprachigen Raum.
Ich fand die Geschichte des Whiskys, vor allem des schottischen Whiskys, ziemlich interessant. Wenn man hier Infos sucht, kommt man allerdings um englischsprachige Literatur nicht herum. Da gibt es jede Menge Bücher und Zeitschriftenartikel, aber kaum Bücher, die die Geschichte des Whiskys von den Anfängen bis heute umfassend darstellen. Deswegen habe ich mich entschlossen, das zu ändern. Das Ergebnis halten Sie in den Händen.
Die größte Herausforderung war, dass die einzelnen Werke, die als Grundlage für dieses Buch dienten, oft widersprüchliche Angaben machen. Vor allem bei Jahreszahlen vor 1900 und Namen von Personen kommt dies häufig vor. Ich habe mich, wo es ging, bemüht, bei widersprüchlichen Aussagen wenigstens zwei Quellen zu finden, die die gleiche Information teilen. Ich habe bei den einzelnen Aussagen keine jeweilige Quelle angegeben, stattdessen finden Sie alle verwendeten Quellen im Literaturverzeichnis am Ende des Buches. Auch die Auszüge aus dem britischen Staatsarchiv zu früheren Gesetzestexten, Untersuchungsberichten und ähnlichen Dokumenten waren sehr hilfreich. Danke an dieser Stelle an die entsprechenden Mitarbeiter, die mir ohne viel Bürokratie und zu relativ günstigen Gebühren geholfen haben.
Whisky wird mittlerweile in vielen Ländern der Welt hergestellt. Neben Schottland und Irland sind vor allem die USA, Kanada, Japan und Indien wichtige Produzenten. Auch Deutschland gehört mittlerweile zu den Ländern, in denen Whisky hergestellt wird. Diese Länder sind jedoch nicht Gegenstand dieses Buches. Stattdessen möchte ich mich hier ganz besonders auf die Geschichte des Whiskys aus Schottland konzentrieren. An einigen Stellen werde ich auch einen kleinen Abstecher nach Irland machen, wenn es für die Geschichte wichtig ist.
Bei meinen Recherchen zu diesem Buch ist mir immer wieder aufgefallen, wie sehr die Behörden über die Jahrhunderte hinweg gegen Schwarzbrenner und Schmuggler ankämpften, vor allem in der Zeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt so viel Material, Erzählungen, Berichte und Folklore zu diesem Thema, dass man damit ein weiteres Buch füllen kann – vielleicht tue ich das auch irgendwann. In diesem Buch konnte ich das Thema jedoch nur an verschiedenen Stellen streifen.
Dieses Buch besteht aus zwei Teilen und einem Anhang. Im ersten, kleineren Teil beschreibe ich die Herstellung von Whisky und stelle die Unterschiede zwischen heutigen Produktionstechniken und vergangenen Methoden dar. Hier hat sich über die Jahrhunderte viel verändert. In diesem Teil werden auch viele Fachbegriffe und Techniken erklärt, deren Erfindung dann im geschichtlichen Teil auftaucht. Der zweite, weit größere Teil des Buches ist der Geschichte des schottischen Whiskys gewidmet. Wir begeben uns auf eine spannende Reise, die mit der ersten Erwähnung von Whisky beginnt und im 21. Jahrhundert endet. Im Anhang habe ich unter anderem auch noch eine Übersicht der im Buch verwendeten, alten Maßeinheiten zusammengestellt, damit Sie sich besser zurechtfinden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und spannende Momente auf Ihrer Reise durch die faszinierende Geschichte des Whiskys.
Die Herstellung von (Malt-)Whisky
Seit es Whisky gibt, hat sich an der Herstellung dieses Getränks eigentlich nicht viel geändert. Die Methoden wurden natürlich modernisiert, die Brennanlagen sind heute größer und anders aufgebaut und die Herstellungsprozesse laufen größtenteils automatisch. Die einzelnen Schritte bei der Herstellung sind aber gleich geblieben. Die Herstellung ist in viele aufeinander aufbauende Schritte unterteilt, die ich auf den nächsten Seiten vorstellen möchte. Jeder dieser Arbeitsschritte prägt den Geschmack des Whiskys zu einem gewissen Teil, mal mehr, mal weniger. Das Zusammenspiel aller Schritte macht am Ende den Charakter einer Brennerei aus. Deshalb sind Whiskys so vielseitig.
Ich schreibe bei den Fachbegriffen jeweils die englischen Bezeichnungen in Klammern dazu. Wenn Sie einmal die Gelegenheit haben, eine Whiskybrennerei in Schottland zu besichtigen, werden Ihnen diese Begriffe begegnen. Für einige Fachbegriffe gibt es in der deutschen Sprache nicht einmal passenden Wörter. Nehmen wir zum Beispiel die „Würze“, die wir vom Bierbrauen her kennen. Bei der Whiskyherstellung gibt es dafür zwei Begriffe: Die Würze wird zunächst als „wort“ bezeichnet und wandelt sich nach Zugabe von Hefe und durchlaufener Gärung zu „wash“. Im Deutschen wird die bei der Bierherstellung vergärende Flüssigkeit in allen Phasen nur als „Würze“ bezeichnet.
Wenn Sie sich die einzelnen Schritte der historischen Herstellung von Whisky im Rahmen eines Urlaubs in Schottland ansehen möchten, können Sie das übrigens in der „Dallas Dhu Historic Distillery“ tun. Sie finden sie am Südrand des Städtchens Forres in den Highlands, die genaue Adresse lautet: Mannachie Road, Forres, Morayshire, IV36 2RR. Die 1898 gegründete Dallas Dhu hat bis zum Jahr 1983 als Whiskybrennerei gearbeitet, wurde dann aber geschlossen. Im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen Brennereien wurde die Dallas Dhu aber nicht abgerissen. Die alten Geräte und Gebäude wurden restauriert und renoviert und fünf Jahre später als Museum wiedereröffnet. Als Besucher kann man allein durch die historische Brennerei laufen, sich in jedem Bereich beliebig lange aufhalten und mithilfe eines mehrsprachigen Audioguides interessante Hintergründe erfahren. So kann man auch Bereiche sehen, die Besuchern in einer arbeitenden Brennerei normalerweise nicht zugänglich sind.
Erst seit den 1950er Jahren arbeiten Whiskybrennereien durchgehend über das gesamte Jahr. Vor dieser Zeit gab es eine Brenn-Saison, die nur vom 1. Oktober bis etwa Ende Mai ging. Die Gründe dafür waren vier Probleme, die im Sommer auftauchten.
Zuallererst gab es Probleme mit der Rohstoffversorgung, denn im Sommer war günstige Gerste schwer zu bekommen. Im September wurde auch früher schon geerntet, aber die Möglichkeiten der Trocknung und sicheren Lagerung, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Außerdem gab es im Sommer teilweise Wasserknappheit, auch im sonst so nassen Schottland. So musste man die Gerste und das Wasser dann verwerten, wenn beides reichlich vorhanden war, also nach einer eventuellen Trockenperiode, besonders aber nach der Ernte im Herbst.
Als zweites Problem haben sich die oft zu hohen Außentemperaturen erwiesen. Im Sommer war es schwierig, den Mälzprozess zu kontrollieren. Die Gärung verlief auch unterschiedlich gut, weil die Maischen oft zu warm waren. Dadurch war die Qualität der Maischen nicht immer gleich. Natürlich gab es früher auch keine Möglichkeit, wie heute im großen Stil zu kühlen.
Drittens gab es im Sommer weniger oder gar keinen Brennstoff, um die Brennblasen zu heizen. Die meisten Anlagen wurden mit Torf (peat) geheizt, der aber hauptsächlich im Mai und Juni gestochen wird und dann mehrere Monate trocknen muss, damit er überhaupt brennt. Wenn im April oder Mai der Vorrat des Vorjahres an Brennstoff aufgebraucht war, konnte nicht mehr produziert werden. Es gab einfach keine Möglichkeit, die Brennblasen zu befeuern. Das änderte sich erst mit der Industrialisierung, als man auch auf Kohle zurückgreifen konnte.
Das vierte und sicher nicht das kleinste Problem waren die Arbeitskräfte, die im Frühling und Sommer einfach knapp wurden. Viele von ihnen arbeiteten in der Landwirtschaft und hatten in dieser Jahreszeit einfach genug auf dem Hof zu tun. Dort musste Torf gestochen werden, Aussaat und Ernte standen an, Heu musste gemacht werden und so weiter. Erst ab Herbst wurde es ruhiger, wenn die Ernte eingefahren war. Diese als „silent season“ bekannte Auszeit für die Whiskyproduktion wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft. Der Grund: Durch die aufkommende Automatisierung wurde weniger Arbeitskraft benötigt. Außerdem war Gerste das ganze Jahr über in ausreichender Menge verfügbar. Und bestimmte Anlagenteile konnten im Sommer gekühlt werden. Seitdem stoppen die Brennereien die Produktion nur noch für ein paar Wochen, um nötige Reparaturen und Renovierungsarbeiten zu erledigen.
Aber genug der Vorrede, kommen wir zum Wesentlichen. Als erstes beschreibe ich, welche Zutaten für die Herstellung von Whisky gebraucht werden. Danach erkläre ich, wie Whisky hergestellt wird. Dabei werde ich auch einen Blick darauf werfen, wie sich die Arbeitsweisen im Laufe der Zeit verändert haben. Schließlich ist auch die Whiskyherstellung ein Handwerk, das sich weiterentwickelt hat. Die modernsten Brennereien arbeiten inzwischen vollautomatisiert und mit sehr wenig Personal – dank Computertechnik. Es gibt aber auch noch Brennereien, die auf Handarbeit setzen und auf Computertechnik weitgehend verzichten. Die Brennerei Wolfburn zum Beispiel ist eine „handwerkliche“ Brennerei, die erst 2013 fertiggestellt wurde und die gleichzeitig die nördlichste Brennerei des schottischen Festlands ist. Nur die Temperatur beim Maischen wird hier per Computer überwacht und geregelt. Alle anderen Schritte laufen hier ab wie früher.
Die Zutaten des Malt Whiskys
Ein Malt Whisky besteht im Prinzip nur aus drei Zutaten: Wasser, Gerste und Hefe. Außerdem muss man sich noch den Herstellungsprozess und die Reifung im Fass ansehen. Beides wird in diesem Kapitel genauer erklärt. Trotz dieser eigentlich sehr wenigen Parameter schmeckt jeder Malt Whisky anders. Selbst innerhalb einer einzigen Brennerei kann eine neue Charge ganz anders schmecken als die vorherige. Sogar wenn der Whisky aus dem gleichen Brennvorgang stammt, kann er ganz unterschiedlich schmecken, je nachdem, in welchem Fass er anschließend gelagert wird. Und auch die Art und Weise, wie die einzelnen Schritte durchgeführt werden, hat Einfluss auf den Geschmack.
Wasser ist bei der Herstellung eigentlich ein zweigeteilter Rohstoff. Wasser wird zum einen gebraucht, um die Gerste einzuweichen, die Maische anzusetzen und um am Ende die Alkoholstärke des fertigen Whiskys auf einen bestimmten Wert zu verdünnen. Zum anderen wird Wasser an verschiedenen Stellen während der Herstellung zum Kühlen gebraucht. Dieses Wasser wird auch Prozesswasser genannt und kommt mit dem eigentlichen Getränk nicht in Berührung. Meistens kommt es aus Bächen, Flüssen oder Seen, denn es besteht beim Prozesswasser kein besonderer Anspruch an Reinheit. Kein Wunder, dass sich Brennereien gern in der Nähe von Wasserläufen oder Seen ansiedeln. Die Qualität des Prozesswassers hat keinen Einfluss auf das Endprodukt, nur die Temperatur spielt dabei eine kleine Rolle, wie wir noch sehen werden. Das A und O ist aber, dass immer genug Prozesswasser vorhanden ist. Wenn es zum Beispiel aus einem Bach kommt, der in einem heißen Sommer austrocknet, kann in diesem Fall nicht weiter produziert werden.
Beim Wasser, das direkt für die Herstellung verwendet wird, sieht die Sache natürlich ganz anders aus, da es letztendlich in der gekauften Flasche landet. Dieses Wasser kommt meistens aus Quellen oder Brunnen. In vielen Fällen wird die Quelle sogar auf den Internetseiten der Brennereien angegeben. Quellwasser gibt es in verschiedenen Härtegraden. Weiches Wasser bedeutet, dass darin nur wenige Mineralien gelöst sind. Wenn das Wasser dann noch über oder durch Gestein fließt, löst es dabei einen gewissen Anteil an Mineralien aus dem Gestein. Es wird dadurch härter, und zwar umso mehr, je länger es mit dem Gestein in Kontakt ist. Die meisten Brenner denken, dass weiches Wasser besser ist als hartes. Deshalb zapfen sie das Wasser möglichst nahe an der Quelle ab. Einige Brenner schwören auch auf härteres Wasser, weil sie glauben, dass mehr Mineralien den Whisky würziger machen. Egal ob hart oder weich – alle Brenner sind sich einig, dass das Wasser absolut rein sein muss. Es darf keine organischen Rückstände, Mikroorganismen oder Verschmutzungen enthalten.
Weitere Zutaten kommen dann ins Spiel, wenn sie im Herstellungsprozess zum Einsatz kommen. Sobald das Getreide geerntet und gedroschen ist, startet der eigentliche Prozess.
Mälzen des Getreides
Whisky ist ein Destillat, das aus vergorenem Getreidebrei gewonnen wird. Das klingt jetzt vielleicht nicht sehr lecker, ist aber genau so. Als erstes wird ein Bier (ale) hergestellt. Dafür eignet sich Gerste am besten, die zunächst gemälzt werden muss. Einige Getreidesorten wie Hafer, Weizen oder Roggen verderben nach der Ernte schnell, wenn sie nicht sofort sorgfältig getrocknet werden. Dafür sind Bakterien verantwortlich, die die äußeren Hüllen und Spelzen durchdrungen und so ins Innere des Korns gelangen können. Aus solchem Getreide eine Maische herzustellen, ist immer ein Kampf gegen Schimmel und Bakterien. Hafer ist etwas besser geeignet, aber auch hier sind die Spelzen nur locker am Korn festgewachsen und fallen leicht ab, wenn man den Hafer nicht sorgfältig behandelt. Bei Gerste ist das anders, da sind die Spelzen sehr stabil und undurchlässig für schädliche Substanzen, Bakterien oder wilde Hefen. Das Korn hat nur einen kleinen „Zugang“ in Form eines Lochs am Ende, durch das die Wurzel beim Keimen wächst. Gerste hat sich über die Jahrhunderte hinweg als das Getreide der ersten Wahl für Whisky und Bier erwiesen, weil das Korn eine besonders stabile Hülle hat.
Ein weiterer Grund dafür ist, dass die Enzyme, die man für den Vorgang des Mälzens (malting) braucht, nur in der Gerste in ausreichender Menge vorhanden sind. Brenner, die auf andere Getreidesorten setzen, brauchen also immer auch eine gewisse Menge Gerstenmalz. Man kann auch noch andere Getreidesorten zur Gerste hinzufügen, zum Beispiel Roggen oder Mais. Hier geht es aber erst einmal nur um Gerste, denn die wird für den Malt Whisky benötigt, der ja sozusagen das „Königsprodukt“ ist. Übrigens: Schon in der Antike wusste man, dass man aus gemälzter Gerste und Hefe Bier herstellen kann.
Eine gute Zeit für einen Besuch in Schottland ist Ende August bis etwa Mitte September, wenn die dort vorherrschenden und manchmal äußerst lästigen Insekten namens „highland midges“ ihre Aktivität bereits nahezu eingestellt haben. Dann können Sie auch die vollen Getreidefelder und die Ernte in der Gegend nördlich von Inverness auf der Halbinsel Black Isle bewundern. Wie an vielen Orten auf der Welt wird das Korn dann von den Ähren befreit und in Kornspeichern gelagert. In großen Lastwagen wird es dann das ganze Jahr über je nach Bedarf an die Brennereien geliefert. Dank moderner Trockentechniken kann man das Getreide heute sicher und ohne Gefahr des Schimmelbefalls lange genug lagern.
Die Gerstenkörner, die in der Brennerei angeliefert werden, werden erst einmal einer Qualitätskontrolle unterzogen. Danach kommen sie ins Gerstenlager (barley loft). Das Lager ist in der Regel im oberen Bereich des Gebäudes untergebracht. Früher war das eine ziemlich anstrengende Tätigkeit, säckeweise Getreide nach oben zu transportieren. Heute wird die Gerste ohne Säcke und in großen Lebensmittel-Lastwägen angeliefert und aus diesen ins Gerstenlager geblasen – ganz ohne mühsames schleppen von Säcken.
Die Gerste ist bei der Anlieferung trocken (hat also etwa zehn bis zwölf Prozent Wasseranteil) und inaktiv. In diesem Zustand ist sie längere Zeit lagerfähig. Ein Gerstenkorn besteht hauptsächlich aus Stärke, dazu kommen noch Fette, Eiweiße, Mineralstoffe und andere Spurenelemente. Die Stärke dient normalerweise dem entstehenden Keim als Nahrung. Alkoholische Gärung funktioniert aber nur mit Zucker, nicht mit Stärke. Deshalb muss das trockene Getreide erst einmal ein Verfahren durchlaufen, bei dem sich die Struktur des Korns ändert. Dieses Verfahren nennt man Mälzen. Dabei werden die harten Zellwände des Korns, die die Stärke umgeben, aufgebrochen. In seinem Buch „Miscellany of Whisky“ vergleicht Charles MacLean den Vorgang passenderweise mit dem Auswickeln eines Bonbons vor dem Verzehr.
Wenn man die Biochemie betrachtet, sieht man, dass Zucker und Stärke ziemlich ähnlich sind. Stärke besteht nämlich aus langen Ketten von Zuckermolekülen. Um diese Ketten aufzuspalten, kommt das Getreide zunächst in große Holzbehälter (steeps). Dann wird mehrmals Wasser eingeleitet und wieder abgelassen. Das Einweichen (steeping) wird über die Dauer von zwei bis drei Tagen fortgeführt, abhängig von Jahreszeit, Wetter und Gerstenart. In dieser Zeit saugen sich die Körner voll Wasser. So wird der komplexe Wachstumsvorgang ausgelöst und ein natürliches, im Korn vorhandenes Enzym, die zu den Amylasen gehörende Diastase, dazu angeregt, die Stärke in Zucker aufzuspalten. Das passiert durch den Kontakt mit Luftsauerstoff beim Ablassen des Wassers. Dem Korn wird dabei quasi vorgegaukelt, jetzt sei Frühling. Es beginnt nun zu keimen, denn eigentlich soll ja aus ihm eine neue Pflanze entstehen, wenn es auf den Boden fällt und vom Regen benetzt wird.
Jetzt wird das Korn, das inzwischen einen Wassergehalt von fast 50 % hat, durch Öffnungen in den Böden der Holzbehälter in den darunterliegenden Malzboden (malting floor) geschaufelt. Dort wird es in einer dicken Schicht von etwa einer Handbreite auf dem Malzboden ausgebreitet. Man spricht davon, dass das Korn dabei „atmet“. Während des Mälzens atmet das Korn tatsächlich wie ein Mensch, es nimmt dabei Sauerstoff auf und gibt Kohlendioxid ab. Der gesamte Mälzprozess dauert zwischen vier und 14 Tagen. Die genaue Dauer hängt wieder davon ab, welches Korn verwendet wird und wie warm es ist. Beim Mälzen entstehen die kleinen Wurzelfasern, mit denen sich der neu entstehende Halm normalerweise im Boden verankern würde.
Während des gesamten Mälzprozesses muss das Korn regelmäßig gewendet werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die oberen Körner austrocknen und absterben, während die unteren anfangen zu schimmeln oder die ganze Masse verklumpt, wenn sich die entstehenden Keime ineinander verhaken. Durch das Wenden (turning the piece) wird sichergestellt, dass alle Körner gleichmäßig keimen. Außerdem kann so die beim Keimen entstehende Wärme, die am Boden der Kornschicht am höchsten ist, besser abgeleitet werden.
Früher wurde das feuchte Getreide traditionell in Handarbeit gewendet, indem man es mit hölzernen Schaufeln (shiels oder malt shovels) hochgeworfen hat – ein- bis zweimal täglich. Für diese ziemlich anstrengende Arbeit gab es eigens die sogenannten „malt turner“. Oft hatten sie durch die hohe körperliche Belastung auch Schleimbeutelentzündungen in den Schultern. Viele haben sich durch die immer wiederkehrenden, gleichförmigen Bewegungen mit der Malzschaufel, die sie oft über Jahrzehnte ausführten, eine Krankheit zugezogen, die im Volksmund den Begriff „Monkey Shoulder“ hatte. Das führte praktisch dazu, dass sich das Skelett dauerhaft und ziemlich schmerzhaft verformte. Auf dem Whiskymarkt gibt es einen Blended Malt, der in Erinnerung an die Arbeiter und die mit ihrem Beruf verbundene Krankheit ebenfalls „Monkey Shoulder“ heißt. Auf dem Rückseitenetikett wird erklärt, woher der Begriff kommt. Die Krankheit heißt wissenschaftlich RSI-Syndrom (Abkürzung für: Repetitive-Strain-Injury-Syndrom). In abgeschwächter Form gibt es die Krankheit heute noch (umgangssprachlich: Sekretärinnenkrankheit, Maus-Arm).
Norman Morrison, ein früherer Mitarbeiter der Brennerei Talisker, der seit Anfang der 1970er Jahre dort arbeitete, erzählt in Gavin D. Smiths Buch „Stillhouse Stories, Tunroom Tales“ von seinen Erfahrungen mit dem Wenden des Malzes: „Das war meine erste Stelle bei Talisker. Damals hatte fast jede Brennerei noch ihren eigenen Malzboden. Wir hatten gleich zwei Malzscheunen mit je zwei Malzböden, die jeweils mit etwa 20 Tonnen Malz gefüllt wurden. Wenn es im Sommer richtig heiß und stickig war, habe ich lieber die Nachtschicht übernommen. Die Gerste spross wie verrückt. Wir mussten sie oft wenden, damit die Keime sich nicht ineinander verknoten. Von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh warst du allein, hattest aber selten viel Zeit zum Ausruhen. So hart habe ich vorher noch nie gearbeitet. Wenn du dann morgens nach Hause kamst, bist du einfach umgefallen und hast geschlafen.“
Später, im Zuge der Industrialisierung, wurden dann natürlich Maschinen erfunden, die die keimende Gerste mit Motorkraft wenden konnten. Sie sehen ein bisschen aus wie Motorhacken. Eine weitere Methode, um die Gerste zum Keimen zu bringen, war die Erfindung der Saladin-Box. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einem Franzosen namens Charles Saladin konstruiert, der damit auch gleichzeitig Namensgeber war. Die Körner werden hier nicht auf einem Malzboden verteilt, sondern kommen in einen großen, langgestreckten Behälter, der meistens aus Stein oder Beton besteht. Oben sind korkenzieherförmige Quirle angebracht, die sich über die ganze Länge des Behälters auf Schienen bewegen. Diese ziehen die Körner dann mit Drehung vom Boden der Box nach oben, ähnlich wie bei den Knethaken eines Handmixers. Dadurch wird das Getreide umgerührt und gewendet. Das Wenden erfolgte zwei- bis dreimal täglich. Der Vorteil ist, dass die Saladin-Box weniger Platz braucht als ein Malzboden. Man kann das Getreide nämlich bis zu einem Meter hoch einfüllen, während es auf dem Malzboden nur in einer etwa zehn Zentimeter dicken Schicht liegt.
Etwa zur selben Zeit haben die Ingenieure noch eine weitere Methode entwickelt, um die Gerste mit Maschinen zu mälzen. Die Idee war, eine Methode zu finden, mit der man das Getreide gleichmäßiger und mit einer konstanten Temperatur mälzen kann. Das A und O dabei ist die Belüftung. Nicholas Galland hat dann ein System aus gusseisernen Zylindern (drums) entwickelt, die per Druckluft belüftet wurden. In den 1890er Jahren hat dann der schottische Ingenieur R. Blair Robertson das System noch weiter verbessert. So entwickelte sich das Trommelmälzverfahren (drum malting), wie es auch genannt wird, um 1900 zum gängigsten Mälzverfahren. Hierbei kommt eine große, rotierende Trommel zum Einsatz, in der die Gerste keimt. Das Getreide wird dabei schonender gewendet, weil die Trommel sich nur langsam dreht. Durch Löcher in der Trommel wird Luft eingeblasen, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Anfangs konnten die Trommeln zwischen zwei und zehn Tonnen Getreide fassen, aber sie wurden schnell weiterentwickelt. Malz wird heute noch mit genau dieser Technik großindustriell hergestellt.
Der Keimprozess dauert so lange, bis die Zellwände des Korns aufgebrochen sind. Dabei verändert sich die Struktur des Korns (modification), es wird weich und breiig. Erfahrene Mälzer (maltmen) beißen in ein Korn und erkennen, wie weit der Keimvorgang schon fortgeschritten ist. Sie spüren, ob die Textur schon weicher ist und ob sich Süße gebildet hat. Wenn der Keim etwa halb so lang ist wie das Korn selbst, wird der Mälzprozess verlangsamt, indem die Schicht an Körnern dünner ausgelegt wird als bisher. So bildet sich weniger Stauwärme und das Wachstum geht langsamer vonstatten. Über das Ende des Mälzvorgangs sagte einmal ein alter Mälzer: „Fertig bist du, wenn du mit den Körnern deinen Namen auf die Wand schreiben kannst“ – weil das Korn nun weich und kreidig ist.
Am Ende des Mälzprozesses könnte der aus aufgespaltener Stärke entstandene Malzzucker für das Wachstum der neu entstehenden Pflanze sorgen. An dieser Stelle muss der Keimprozess unterbrochen werden, da der Zucker, der für die Pflanze nur ein Zwischenprodukt darstellt, sonst weiter in Zellulose umgewandelt wird. Das versucht der Mälzer zu vermeiden, denn der Zucker soll ja für die alkoholische Gärung zur Verfügung stehen. Den perfekten Zeitpunkt dafür kennt der Mälzer durch seine Berufserfahrung. Das Ziel ist, auf der einen Seite möglichst viel Zucker zu gewinnen und auf der anderen Seite den Keimungsprozess nicht zu weit voranzutreiben. Am Ende dieser Phase hat man sogenanntes „grünes Malz“ (green malt), weil die kleinen Keime dem Ganzen eine insgesamt grüne Färbung verleihen.
Jetzt wird der Mälzprozess unterbrochen, indem der Mälzer dem Korn das anfangs zugesetzte Wasser wieder entzieht. Das gekeimte Korn wird aufgesammelt und in die Malzdarre (drying kiln) gebracht, wo es getrocknet wird (kilning, to kiln-dry). Dazu wird das Ganze auf engmaschigen Rosten in einer Schicht von 30 bis 60 cm Höhe ausgebreitet, worunter ein Feuer (kiln fire) entfacht wird. Die heiße Luft, die dabei entsteht, dringt durch die Roste und trocknet so die gekeimte Gerste. Der Rauch wird über die Pagodendächer der Schlote abgeführt, die das typische Erscheinungsbild einer Whiskybrennerei ausmachen.
Der Mälzer muss darauf achten, dass die aufsteigende Luft aus dem Ofen nicht über 70 °C heiß wird. Das würde nämlich die Diastase zerstören, aber dieses Enzym wird für den nächsten Schritt der Herstellung noch benötigt. Die Hitze, die nach oben steigt, beendet zum einen den Mälzprozess, indem sie das Korn trocknet. Zum anderen werden Pilze und Keime durch die Hitze unschädlich gemacht. Dadurch kann das getrocknete Malz besser und länger gelagert werden als die ursprüngliche, ungemälzte Gerste.
Wie auch zum Heizen von Häusern hat man früher in Schottland oft Torf (peat) für das Darrfeuer verwendet, vor allem in den Highlands und auf den Inseln, wo es keine Kohle gab und Torf an vielen Stellen ausreichend vorhanden war. So bekam das Malz diese typische, phenolartige Rauchnote, die man auch im fertigen Produkt noch deutlich schmeckt. Vom englischen Wort „peat“ für Torf kommt auch der Ausdruck „peated whisky“ für einen Whisky, der nach Torfrauch schmeckt. Früher war das Torfstechen eine wichtige Aufgabe in jeder Brennerei, weil die Gerste ja noch rein mit Torf gedarrt wurde. Die Torfbrocken mussten mit dem Spaten aus dem Torffeld abgestochen werden. Als nächstes mussten die Torfbrocken, die nach dem Stechen triefnass sind, getrocknet und anschließend gelagert werden. Die Trocknung dauerte etliche Wochen bis Monate. Im Sommer, wenn die Brennereien traditionsgemäß sowieso nicht liefen, hat jeder Brennereimitarbeiter Torf gestochen, teilweise wurden sogar zusätzlich noch Saisonarbeiter dafür beschäftigt. Denn es musste ja eine so große Menge getrocknet und eingelagert werden, dass der Vorrat dann für die gesamte Brennsaison reichte. Und natürlich brauchte jeder auch noch Torf, um den eigenen Hof zu beheizen.
An dieser Stelle ein paar Informationen zum Thema „rauchiger Whisky“ und Torf, denn in diesem Produktionsschritt entsteht das Raucharoma. Teilweise wird auch heute noch bei der Trocknung des Malzes Torf als geschmacksbildendes Element zugesetzt, wenn man in bestimmten Whiskys genau diese rauchige Note haben möchte. Doch was ist Torf eigentlich und wie entsteht er? Und warum ist der Rauch von brennendem Torf anders als der Rauch eines Kohlefeuers? Der Entstehungsprozess wird wissenschaftlich „Inkohlung“ (coalification) genannt. Abgestorbene Pflanzenteile fallen in der Natur zu Boden und verrotten. In einem Moor herrschen dabei besondere Bedingungen: stehendes Wasser, wenig Sauerstoff und ein saures Milieu. Dies führt dazu, dass die Pflanzenteile nicht vollständig verrotten, wie es zum Beispiel auf einem Waldboden der Fall ist. Dies kann man in einem Torfmoor an den Stellen sehen, an denen Torf gestochen wird: Im oberen Bereich ist der Torf heller und noch sehr faserig. In tieferen Schichten wird der Torf dunkler, verdichtet sich und man sieht immer weniger Pflanzenteile. Da die grünen Pflanzen, die auf einem Moor wachsen, absterben, wächst die Torfschicht kontinuierlich. Das Wachstum ist jedoch sehr langsam und beträgt nur etwa einen Millimeter pro Jahr. Der richtig dunkle Torf aus tieferen Schichten braucht viel Zeit, um zu entstehen, etwa 10.000 Jahre. Aus solchem Torf wird nach Jahrmillionen zunächst Braunkohle und nach etwa 500 Millionen Jahren schließlich Steinkohle.
Je älter die Substanz wird, desto mehr Kohlenstoff enthält sie. Während Holz zu etwa 50 Prozent aus Kohlenstoff besteht, sind es bei Torf bis zu 60 Prozent und bei Steinkohle schließlich rund 90 Prozent. Dementsprechend hat Torf einen deutlich höheren Anteil an anderen Elementen, vor allem Wasserstoff- und Sauerstoff-Stickstoff-Verbindungen. Insbesondere die Elemente Wasserstoff und Sauerstoff sind für den typischen, medizinischen Geruch von über Torfrauch geräuchertem Malz verantwortlich. Sie bilden nämlich zusammen mit Kohlenstoff sogenannte Phenole. Phenol, chemisch exakt heißt es Hydroxybenzol, wurde früher häufig als Desinfektionsmittel in Krankenhäusern verwendet, daher kommt der Begriff „medizinischer Rauch“ bei getorften Whiskys. Neben Phenolen bilden sich im Torf auch noch weitere aromatische Verbindungen. Wird Torf verbrannt, werden diese Verbindungen freigesetzt und reichern das Malz und damit später den Whisky mit den entsprechenden Aromen an.
Die meisten dieser aromatischen Verbindungen entweichen, wenn der Torf nicht mit heller Flamme brennt. Deshalb werden die brennenden Torfstücke mit Wasser abgelöscht, wodurch ein Schwelbrand und infolgedessen dicker Rauch aus Wasserdampf und echtem Rauch entsteht, der besonders reich an Aromen ist und sich auf den Gerstenkörnern niederschlägt. Mit reinem Torffeuer trocknet heute allerdings niemand mehr die gemälzte Gerste, weil das fertige Produkt für den heutigen Geschmack einfach zu stark nach Torf schmecken würde. Je mehr Phenole sich auf dem Malz niedergeschlagen haben, desto mehr schmeckt der fertige Whisky danach.
Der Phenolgehalt von Whiskys wird in „phenolic parts per million“ (ppm) angegeben und kann mit Hilfe eines Flüssigkeitschromatographen im Malz oder im fertigen Brand gemessen werden. Dabei ist zu beachten, dass der Phenolgehalt im Malz immer höher ist als im fertigen Brand, wo er nur noch knapp die Hälfte des Wertes wie im Ausgangsmalz beträgt. Außerdem nimmt der Phenolgehalt während der Lagerung des Whiskys weiter ab. Stark getorfte Whiskys wie Ardbeg oder Laphroaig haben etwa 40 bis 55 ppm Phenolgehalt im Malz bzw. 20 bis 25 ppm im frischen Brand (newmake), um eine Größenordnung zu haben. Der am stärksten getorfte Whisky auf dem Markt dürfte derzeit der Octomore mit einem Phenolgehalt von über 100 ppm sein, doch ist ein so hoher Wert tatsächlich selten. Übrigens: Der größte Torfverbrauch geht vor allem auf die Vergangenheit zurück, als Torf auch zum Heizen der Häuser verwendet wurde. Heute wird Torf nur noch zu einem geringen Teil im Darrfeuer verwendet, so dass der Verbrauch durch die Whiskyindustrie nur noch etwa 0,1 % der Menge beträgt, die in den schottischen Mooren nachwächst.
Nun aber wieder zurück zum Herstellungsprozess. Das Darren wird fortgeführt, bis nur noch etwa drei bis fünf Prozent Restfeuchte vorhanden sind. Das dauert etwa zwei Tage. Der Keimvorgang wäre zwar schon vorher gestoppt, aber die Körner dürfen nur noch diese Restfeuchte aufweisen, weil sie sonst nicht gemahlen werden können. Dafür müssen die Körner trocken und spröde sein, ähnlich wie Kaffeebohnen in einer Kaffeemühle. Wenn die Trockenzeit vorbei ist, ist das Malz bröckelig und kann gut und lange gelagert werden. Je spröder am Ende der Trocknung das Korn ist, desto weiter war der Grad der „modification“ schon fortgeschritten.
Am Ende dieses Produktionsschritts hat man gemälzte Gerste (malted barley), meist nur Malz (malt) genannt. Deshalb heißt Whisky, der nur aus gemälzter Gerste und nicht aus beispielsweise Roggen (rye) hergestellt wurde, auch „malt whisky“. Die kleinen Wurzeln (malt culms), die sich beim Keimen gebildet hatten, sind nach diesem Arbeitsschritt vertrocknet und braun. Sie werden dann in einer Maschine (dressing machine) entfernt. Manchmal werden sie noch als Tierfutter verwendet, in der Regel aber als biologischer Abfall entsorgt oder als Dünger verwendet.
Früher haben die meisten Brennereien noch selbst gemälzt. Ironischerweise sind die schönen Pagodendächer, das Wahrzeichen jeder Whiskybrennerei, heutzutage bei den meisten Brennereien eigentlich überflüssig. Denn wo nicht mehr selbst gemälzt wird, findet auch kein Trocknungsprozess unterhalb dieser Pagoden mehr statt. Heute beziehen nämlich die meisten Brennereien ihr Malz von Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ein Beispiel ist die 1967 eröffnete „Burghead Maltings“ in Burghead an der Nordküste Schottlands, eine der größten Mälzereien in ganz Europa. Hier arbeiten ganze 48 Trommeln mit je 60 Tonnen Kapazität. Die Firma übernimmt das Einweichen, Mälzen und Trocknen des grünen Malzes. Das Malz, das hier jedes Jahr hergestellt wird, reicht rechnerisch für 135 Millionen Flaschen Whisky. Aber natürlich gehören auch Bierbrauer zu den Kunden der Malzfirmen.
Eine weitere Mälzerei befindet sich in Muir of Ord, direkt am Rande der Black Isle, einer Halbinsel, die als Kornkammer Schottlands gilt. Die „Glen Ord Maltings“ beliefern nicht nur die gleichnamige Brennerei mit Malz, sondern auch Talisker und andere Brennereien der Diageo-Gruppe. Eine dritte Malzquelle hat einen kleinen Sonderstatus, denn es handelt sich um die Mälzerei der ehemaligen Brennerei Port Ellen auf der Insel Islay. Hier wird seit 1983 kein Whisky mehr gebrannt, aber die Mälzerei ist noch in Betrieb und beliefert einige andere Brennereien auf der Insel. Port Ellen gehört ebenfalls zum Diageo-Konzern, der auf Islay die Brennereien Lagavulin und Caol Ila betreibt und diese natürlich bevorzugt mit Malz aus Port Ellen beliefert.
Über eigene Mälzereien verfügen in Schottland derzeit noch Bowmore, Kilchoman und Laphroaig, alle auf der Insel Islay, sowie Balvenie (Speyside), Springbank (Campbeltown), Highland Park (Orkney) und einige weitere. Aber auch diese Brennereien kaufen teilweise Malz aus anderen Quellen zu. Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele Brennereien im Laufe der Zeit vergrößert wurden, um der steigenden Nachfrage nach Whisky gerecht zu werden, die Malzböden aber nicht weiter ausgebaut wurden. Generell ging der Trend seit den 1960er Jahren stark dahin, keine eigenen Mälzereien mehr zu betreiben, sondern das Malz ausschließlich von externen Firmen zu beziehen. Die weltweite Nachfrage nach Whisky stieg in dieser Zeit so stark an, dass sich der Betrieb eigener Mälzereien nicht mehr lohnte oder die vorhandenen Mälzereien zu wenig ertragreich waren.
Auch die in Schottland angebaute Gerste reichte längst nicht mehr aus, um den enormen Bedarf der Brennereien zu decken, zumal Gerste neben Whisky auch zur Bierherstellung verwendet wird. Da Gerste aber in vielen Ländern angebaut wird, importiert Schottland einen Teil der verwendeten Gerste und teilweise sogar fertiges Gerstenmalz aus anderen Ländern.
Mahlen in der Malzmühle
Der nächste Schritt für die gemälzte Gerste ist das Mahlen in der Malzmühle. Obwohl die meisten Brennereien keine eigene Mälzerei mehr betreiben, mahlen sie ihr Malz auch heute noch selbst. Dies mag auch daran liegen, dass eine Malzmühle wesentlich weniger Platz benötigt als der gesamte Mälzprozess.
Das bedeutet, dass in den meisten Brennereien das Malz heute fertig per Lastwagen angeliefert wird und der erste Schritt zur Whiskyherstellung tatsächlich das Mahlen, auch Schroten genannt, ist. Das Mahlen ist sehr staubintensiv, weshalb in diesem Bereich der Brennerei in der Regel keine Besucher zugelassen sind. Oder besser gesagt, es wird einfach nicht gemahlen, wenn Besucher anwesend sind, denn das wäre für diese gesundheitsschädlich. Das Personal, das dort arbeitet, hat natürlich die entsprechende Schutzausrüstung, aber für die Besucher steht diese nicht zur Verfügung.
Das angelieferte Malz ist krümelig und spröde. Um die Mühlen nicht zu beschädigen, kommt das Malz zunächst in einen Steinentferner (stone extractor, de-stoner). Hier werden eventuell vorhandene Steinchen entfernt, die die Mähdrescher mit den Ähren aus dem Feld geholt haben und die auch nach dem Dreschen teilweise noch zwischen den Körnern verbleiben. Anschließend gelangen die getrockneten Körner über einen Trichter in die eigentliche Malzmühle. Ziel des Mahlens ist es, die einzelnen Körner so weit zu zerkleinern, dass im nachfolgenden Prozess möglichst viel Zucker herausgelöst werden kann, der dann für die Gärung zur Verfügung steht.
Tatsächlich gab es nur zwei große Hersteller von Malzmühlen in Großbritannien. Wenn Sie eine Brennerei besuchen, die über eine eigene Malzmühle verfügt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie entweder von der Firma Porteus stammt, die ursprünglich in Leeds (England) ansässig war, bevor sie von der „Hull engineering company“ übernommen wurde, oder von der Firma Robert Boby Ltd Engineers, Bury St. Edmunds (ebenfalls England, etwa 40 km östlich von Cambridge). Beide Firmen stellten Malzmühlen her, die für ihre lange Lebensdauer bekannt waren. Kein Wunder also, dass die meisten Mühlen, die heute noch in Betrieb sind, aussehen, als wären sie aus einem Museum entwendet worden. Tatsächlich arbeiten diese Mühlen seit vielen Jahrzehnten zuverlässig.
Leider war die Qualität der Mühlen auch der Fluch dieser beiden Firmen. Die Mühlen waren so zuverlässig, dass praktisch nie neue Anlagen angeschafft werden mussten, so dass sich die beiden Firmen selbst überflüssig machten und vom Markt verschwanden. Fast alle Malzmühlen, die heute in Whiskybrennereien in Betrieb sind, sind Generationen alt. Die jüngsten dürften aus den 1970er Jahren stammen. Malzmühlen waren für Brennereibesitzer eine Investition für das Leben, und fast alle haben die Schließung der Brennerei, für die sie angeschafft wurden, überlebt. Danach fanden sie oft als Gebrauchtmaschinen in einer anderen, vielleicht neu eröffneten Brennerei eine zweite Verwendung. Geplante Obsoleszenz, bei der die Hersteller Geräte absichtlich so konstruieren, dass sie irgendwann (idealerweise kurz nach Ablauf der Garantie) kaputt gehen, war damals einfach noch nicht erfunden.
Abb.1: Malzmühle bei Glendronach, hier ein Modell von Robert Boby Ltd.
Die Tatsache, dass beide Hersteller nicht mehr existieren, führt dann zu großen Problemen, wenn doch einmal ein Defekt an einer Mühle auftritt. Ersatzteile sind dann nur sehr schwer zu bekommen. In den meisten Fällen müssen sie extra angefertigt werden, was deutlich teurer ist, als ein vorrätiges Ersatzteil kosten würde. Und natürlich bedeutet eine solche Reparatur dann auch einen längeren Ausfall für die gesamte Brennerei, sobald der Vorrat an gemahlenem Malz aufgebraucht ist.
Die Mühlen beider Hersteller arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Das eingefüllte Malz muss zunächst ein Gittersieb passieren, in dem größere Teile als das eigentliche Korn nochmals ausgesiebt werden. Solche Fremdkörper sind z.B. Strohhalme, früher vielleicht auch mal eine tote Maus. Außerdem sind Magnete angebracht, um eventuell vorhandene Metallteile aus dem Mahlgut zu entfernen. Die Mühle selbst besteht aus zwei Walzenpaaren, wobei das erste Paar die Schale des Korns aufbricht und das zweite Paar das Korn zerkleinert. Unter jedem Walzenpaar befindet sich ein speziell geformtes Buchenholzbrett, das im Falle einer Selbstentzündung des Mehls eine Staubexplosion verhindern soll, indem es den Mahlraum verschließt.
Der Mahlgrad ist einstellbar und reicht von grobem Schrot (grist) über feinen Grieß (grit) bis hin zu Mehl (flour). Wird das Mehl zu fein gemahlen, verstopft es im nachfolgenden Prozess Behälter, Siebe und Rohrleitungen. Zu grob gemahlenes Malz hingegen kann den Zucker nicht optimal verwerten und herauslösen. Als ideal gilt eine Mischung aus 15 bis 20 Prozent Spelzen, 70 bis 80 Prozent mittelgrobem Schrot und fünf bis zehn Prozent feineren Partikeln und Mehl. Die jeweiligen Gewichtsanteile im Mahlgut werden mit einer so genannten Shuttle-Box ermittelt. Sie besteht aus einem Holzkasten mit zwei eingelassenen Sieben, einem feinen unten und einem gröberen oben. Eine abgewogene Menge Mahlgut wird in die Box gegeben und geschüttelt. Anschließend werden die einzelnen Ebenen geleert und gewogen. Dann wird die Malzmühle so lange verstellt, bis das für die Brennerei ideale Verhältnis der Mahlgrade erreicht ist.
Das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes, also die Mischung der oben genannten Anteile, wird Malzschrot oder kurz Schrot (grist) genannt und nun dem nächsten Prozessschritt zugeführt.
Maischen und alkoholische Gärung
Bei diesem biologischen Prozess wandeln bestimmte Hefen den Malzzucker in Alkohol um. Dieser Vorgang ist bei allen alkoholischen Getränken gleich, egal ob es sich um Wein, Bier, Schnaps, Rum oder Whisky handelt. Bei Getränken mit geringerem Alkoholgehalt wie Wein, Bier und Sekt ist das Getränk nach Abschluss der Gärung im Prinzip fertig - abgesehen von nachgelagerten Prozessen, die Aussehen und Geschmack verbessern, wie Klärung und Lagerung. Bei stärkeren Alkoholika wie Obstbränden, Weinbränden, Whisky, Rum, Wodka und dergleichen wird durch Destillation ein noch höherer Alkoholgehalt erreicht - dazu später mehr.
Während z. B. beim Wein einfach der Saft der ausgepressten Trauben (beim Rotwein werden anfangs auch die Schalen mitverwendet) in einen Gärbehälter gegeben und vergoren wird, ist beim Whisky (und auch beim Bier) noch ein weiterer Schritt notwendig, nämlich das Einmaischen (mashing). Dies geschieht in großen metallenen Maischebottichen (mash tuns), die heute mit einem mechanischen Rührwerk (mash rake) ausgestattet sind. Maischebottiche für die Whiskyherstellung sehen aus wie überdimensionale Teekessel. In manchen Brennereien sind sie außen noch mit Holz verkleidet, aber die Bottiche selbst sind heute alle aus Edelstahl, da sie die gleiche Funktion wie ein echter Teekessel haben.
Der Malzschrot wird im Maischebottich mit einer bestimmten Menge Wasser (je nach Brennerei zwischen 4.000 und 9.000 Liter pro Tonne Malzschrot) bei einer Temperatur von 63 bis 68 °C zu einem Brei vermischt. Dieser Brei wird Maische (mash) genannt und während des gesamten Prozesses ständig gerührt, heute natürlich mit motorgetriebenen Rührwerken. Die Temperatur des zugegebenen Wassers ist hoch genug, um den Zucker und andere Inhaltsstoffe aus dem Malzschrot herauszulösen, aber noch nicht so hoch, dass die noch vorhandenen Enzyme zerstört würden. Denn neben dem bereits gebildeten Malzzucker enthält das Korn noch viel Stärke, die beim Mälzen nicht vollständig umgewandelt wurde. Durch das erneute Einweichen werden die Enzyme wieder aktiviert und setzen so den beim Mälzen begonnenen Umwandlungsprozess von Stärke in Zucker fort.
Dies ist auch aus einem anderen Grund wichtig, denn nur so ist es möglich, einen gewissen Anteil ungemälzter Gerste oder anderer Getreidesorten für die Whiskyherstellung zu verwenden. Hier ist nämlich noch kein Zucker im Mahlgut enthalten, sondern nur die Stärke. Wenn man also in diesem Schritt ungemälztes Getreide hinzufügt, erhält man später Kornwhisky (grain whisky). Verwendet man nur gemälzte Gerste, ist das Endprodukt reiner Malzwhisky (malt whisky). Die Enzyme arbeiten so gut, dass für die Herstellung von Kornwhisky nur etwa 10 % Gerstenmalz zugesetzt werden muss, damit die Umwandlung der Stärke stattfinden kann.
Nach einer gewissen Zeit, in der die Temperatur auf 64 °C gehalten und die Maische mit dem Rührwerk ständig umgewälzt wird, wird die Maische von den festen Bestandteilen getrennt. Dies geschieht durch Siebe am Boden des Maischebottichs. Die Flüssigkeit wird in einem Zwischenbehälter (underback) aufgefangen, die festen Bestandteile der Maische verbleiben im Maischebottich. Nun wird wieder mit Wasser aufgegossen, diesmal bei einer Temperatur von etwa 80 °C. Bei diesen Temperaturen können die Enzyme nicht mehr arbeiten und werden zerstört. Ziel dieses „Waschvorgangs“ ist es aber auch nur, den restlichen Zucker aus der Maische zu lösen, denn die Stärke ist nun bereits fast vollständig in Zucker umgewandelt. Auch dieses Gemisch wird nach einiger Zeit wieder durch das Sieb von den festen Bestandteilen getrennt, die Flüssigkeit wandert zum „ersten Aufguss“ in den Zwischenbehälter.
Was sich nun in diesem Zwischenbehälter befindet, ist die sogenannte Würze (wort). Vielleicht kennen Sie den Begriff „Stammwürze“ vom Bier. Die Stammwürze bezeichnet die Menge des gelösten Malzzuckers und entspricht dem Mostgewicht bei der Weinherstellung. Die Würze wird im nächsten Schritt in den Gärtanks vergoren. Doch noch ist es nicht so weit. Ein drittes Mal wird die Maische mit Wasser aufgegossen, nun bei Temperaturen um 90 °C. Dadurch werden auch der letzte Zucker und die letzten verwertbaren Inhaltsstoffe aus dem Getreide gelöst. Diese nun relativ zuckerarme und dünne Lösung nennen die Bierbrauer Glattwasser (sparge). Sie wird nicht in den Gärbottich gegeben, sondern in der nächsten Charge beim ersten Waschvorgang mitverwendet.
Die festen Bestandteile, die sich nun noch im Maischebottich befinden, werden Treber oder Trester (draff) genannt. Der Trester wird mit Schaufeln aus dem Maischebottich entfernt. Weggeworfen wird er aber nicht, denn er enthält zwar keinen Zucker mehr, aber andere wertvolle Stoffe wie Eiweiß und Ballaststoffe. Deshalb wird er in spezialisierten Betrieben getrocknet und zu Viehfutter verarbeitet. Zu Pellets gepresst und getrocknet ist das Produkt lange lagerfähig. Früher, als dies noch nicht möglich war, wurde der Trester sofort an die Bauern abgegeben, die damit ihr Vieh über den Winter brachten.
Die Geschwindigkeit, mit der die Würze aus der Maische abgezogen wird, beeinflusst den Geschmack des Whiskys. Wird die Würze langsam abgelassen, erhält der Brenner eine klarere Würze als bei einem schnellen Ablassen, bei dem eine eher trübe Würze entsteht, da mehr feste Bestandteile, die so genannten Trubstoffe, mitgerissen werden. Ein Whisky aus einer solchen trüben Würze weist später Getreidearomen auf, die einem Whisky aus einer klareren Würze fehlen.
Zurück zur Würze aus den ersten beiden Aufgüssen. Aus Gründen der Energie- und Zeitersparnis wird sie heute in Gegenstromkühlern auf Raumtemperatur abgekühlt und in die Gärtanks (washbacks) geleitet. Als es früher diese Kühler noch nicht gab, wartete man einfach ab, bis die Würze abgekühlt war. Heute wird die beim Abkühlen gewonnene Wärme zum Vorwärmen der nächsten Charge an Würze verwendet.
Die Gärbottiche sind manchmal noch aus Holz, heute aber meist aus Edelstahl und fassen in der Regel einige zehntausend Liter. Hölzerne Behälter sind natürlich schwieriger zu reinigen, aber einige Brennereien schwören auf sie, weil in ihnen neben der alkoholischen Gärung noch andere mikrobiologische Prozesse ablaufen. Diese erzeugen weitere, oft fruchtige Aromen, die sich später im fertigen Whisky wiederfinden.
Die Größe der Gärbottiche ist wirklich beeindruckend, wenn man bei einer Brennereibesichtigung zum ersten Mal davorsteht, auch wenn man die wahre Größe gar nicht gleich abschätzen kann. Man sieht nämlich nur den großen Durchmesser von drei Metern und mehr, nicht aber die Höhe der Behälter, die gut sechs Meter betragen kann. Das liegt daran, dass man bei den Führungen die Behälter nur von einem Arbeitsboden aus sehen kann, der sich etwas mehr als einen Meter unter der Oberkante befindet - eben so, dass die Arbeiter bequem einsteigen können, um die Behälter zu reinigen. In einigen Brennereien ist es möglich, einen Blick in den unteren Bereich (underfloor) zu werfen, wodurch die gesamte Größe der Gärbehälter deutlich wird. Größere Gärbottiche werden mit einigen zehntausend Litern Maische pro Gärvorgang gefüllt, in kleineren Brennereien können es auch nur 2.000 Liter sein.
Für die alkoholische Gärung wird neben der zuckerhaltigen Würze auch Hefe benötigt, da die Hefepilze den Zucker in Alkohol und Kohlendioxid umwandeln. In einem Edelstahltank werden dazu getrocknete Hefeblöcke (yeast) mit lauwarmem Wasser vermischt und so die Hefepilze aktiviert. Diese milchige Flüssigkeit wird nun in die Gärtanks mit der Würze gegeben, was auch der Grund für die vorherige Kühlung der Würze ist, denn ab einer bestimmten Temperatur würden die empfindlichen Hefezellen absterben. Bei Temperaturen um 20 °C fühlen sie sich jedoch wohl, und in den folgenden Tagen wandeln die sich rasch vermehrenden Hefezellen den gelösten Zucker in Alkohol um.
Die Gärbottiche werden nur bis etwa 2/3 ihrer Höhe gefüllt, da die Würze durch die Gärung und die dabei entstehende Kohlensäure stark zu brodeln und zu schäumen beginnt. Würde man die Gefäße ganz füllen, würde die Würze während der Gärung „überkochen“. Um das Überschäumen im Moment der heftigsten Gärung zu verhindern, wurde seit dem späten 18. Jahrhundert ein rotierender Arm (switcher) an der Oberseite der Gärbottiche angebracht, der den Schaum zerstörte, bevor er den oberen Rand des Bottichs erreichen konnte. Davor war es Aufgabe der Arbeiter, den Schaum regelmäßig mit Heidebesen zu zerstören.
Bis zu diesem Punkt ist der Prozess fast identisch mit dem der Bierherstellung. Für ein Bier würde nun noch Hopfen als Geschmacksgeber hinzugefügt, der gleichzeitig als Konservierungsmittel dient und das Bier haltbar macht.
Neben Alkohol und CO2 entstehen bei der Gärung in geringem Umfang weitere Nebenprodukte (congeners): Verschiedene Ester, Aldehyde, Säuren und höherwertige Alkohole. Sie sind entscheidend für den Geschmack des Whiskys. Insbesondere die Ester liefern eine Vielzahl von Fruchtaromen, die dem späteren Whisky seine Geschmacksvielfalt verleihen.
Während der zwei- bis viertägigen Gärung werden die Gärbehälter mit Deckeln verschlossen, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Das Endprodukt der Gärung ist ein stärkeres Bier mit einem Alkoholgehalt von sieben bis zehn Volumenprozent, je nach dem ursprünglichen Zuckergehalt der Würze, der Art der verwendeten Hefe, der Temperatur und der Dauer der Gärung. Die so gewonnene alkoholische Flüssigkeit wird im Englischen als „wash“ bezeichnet, einen deutschen Begriff gibt es dafür nicht.
Beim Wein ist die Gärung beendet, wenn genügend Alkohol entstanden ist, um die Hefezellen abzutöten. Zu diesem Zeitpunkt ist noch eine gewisse Menge Restzucker gelöst. Das ist beim Wein auch notwendig, denn sonst wäre der Wein so sauer, dass man ihn nicht mehr genießen könnte - das gilt auch für trockene Weine, die in der Regel noch 5 bis 9 Gramm Zucker pro Liter enthalten. Anders bei der Whiskyherstellung: Hier endet die Gärung, wenn der gesamte gelöste Zucker zu Alkohol vergoren ist. Die Hefezellen verhungern dann sozusagen, weil ihre Nahrung aufgebraucht ist. Bei der Whiskyherstellung soll der Zucker möglichst vollständig in Alkohol umgewandelt werden, da der Wash am Ende der Gärung nicht zum direkten Verzehr bestimmt ist und daher kein harmonisches Verhältnis zwischen Alkohol und Restzucker benötigt.
Destillation in einer Pot Still
Eine Destillationsanlage für Malt Whisky besteht immer aus zwei, manchmal auch aus drei Brennblasen, die vom Prozess her in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass jeder Tropfen Malt Whisky mindestens zweimal destilliert wird. Aufgrund der Bauform einer solchen Brennblase, die entfernt an einen überdimensionalen Kochtopf erinnert, wird sie als „Pot Still“ bezeichnet, im Gegensatz zur Säulendestillationsanlage (column still), die für Grain Whisky verwendet wird.
Diese mächtigen, mehrere Meter hohen Kupferbrennblasen beeindrucken durch ihre Größe und Form, die ein wenig an eine stehende Birne oder eine in die Länge gezogene Zwiebel erinnert. Damit sind sie deutlich größer als die vielleicht aus Obstbrennereien bekannten Brennblasen, das Funktionsprinzip ist jedoch das gleiche. Eine Pot Still besteht aus einem großen, runden, manchmal auch kugelförmigen Teil am Boden, dem Unterteil. Darauf sitzt das Oberteil (head), das aus einem sich nach oben verjüngendem Rohr besteht. Dieses kann je nach individueller Konstruktion noch mehrere Einbuchtungen und/oder Verdickungen aufweisen. Allen Pot Stills gemeinsam ist jedoch, dass das Rohr am oberen Ende seitlich in einem Bogen (neck) abknickt und in einem Kupferrohr (lyne arm) endet. Dieses Rohr wird weiter durch die Wand des Brennhauses geführt und endet im Nebenraum in einem Kühler.
Nach Abschluss der Gärung wird die Maische aus den Gärbehältern in einen Zwischenbehälter (wash charger) gepumpt, von dem aus die eigentliche Brennblase für den ersten Brennvorgang befüllt wird. Da hier die vergorene Würze direkt eingefüllt wird, trägt die Brennblase dieser ersten Brennstufe den Namen „wash still“. Der englische Begriff „still“ wird allgemein für eine Brennblase verwendet. Nach dem Einfüllen der vergorenen Würze in die Brennblase wird das Wasser-Alkohol-Gemisch erhitzt. Die heute am häufigsten verwendete Heizmethode besteht aus einem Kupfer- oder Stahlrohr, das in mehreren Schlangen oder Windungen im Inneren am Boden der Brennblase verlegt ist und nach dem Befüllen direkt von der vergorenen Würze umspült wird. Durch dieses Rohr wird heißer Wasserdampf geleitet, der die Flüssigkeit wie bei einem Tauchsieder erwärmt.
Früher wurde einfach ein Torf- oder Kohlefeuer unter den Brennblasen entzündet, später eine Gasflamme. Während sich eine Gasflamme noch recht gut regulieren ließ, bestand bei kohle- und torfbefeuerten Anlagen immer die Gefahr, dass der Wash in der Brennblase verbrannte, denn er bestand nicht aus einer klaren Flüssigkeit, sondern enthielt durchaus noch Reste von Spelzen, Körnern und Hefe. Und ein verbrannter Wash hatte zur Folge, dass auch das gesamte Destillat verdorben war und nicht mehr verwendet werden konnte. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts konnte das Problem durch den Einsatz eines Rührwerks gelöst werden, bei dem Stahlketten (rummagers) über den Boden der Brennblase gezogen wurden und die Flüssigkeit während des Erhitzens ständig umrührten. Seit der Einführung der Dampfbeheizung besteht die Gefahr des Anbrennens nicht mehr und die Rührwerke werden in solchen Anlagen nicht mehr eingesetzt.
Bei der Destillation macht man sich den Effekt zunutze, dass die einzelnen Bestandteile (hier Wasser und Alkohol) unterschiedliche Siedetemperaturen haben. Wasser hat eine Siedetemperatur von 100 °C, Ethanol (Alkohol) siedet jedoch bereits bei etwas über 78 °C. Ein Wasser-Alkohol-Gemisch, wie es in der Würze nach der Gärung vorliegt, hat einen Siedepunkt irgendwo zwischen diesen beiden Werten. Wird das Gemisch langsam erhitzt, beginnt es zu sieden und zu verdampfen. Dabei verdampft mehr Alkohol als Wasser, die Alkoholkonzentration der Ausgangslösung sinkt also, der Siedepunkt steigt dadurch leicht an. Um das Sieden aufrechtzuerhalten, muss die Flüssigkeit etwas weiter erhitzt werden, wodurch nun mehr Wasser verdampft. Der Prozess setzt sich fort, wobei die Flüssigkeit im Kessel immer heißer wird und der Dampf immer weniger Alkohol enthält. Der Dampf steigt nach oben und wird über das Kupferrohr in einen Kühler oder Kondensator (condenser) im Nebenraum geleitet. Die Temperatur in der Brennblase kann vom Brenner über ein Ventilrad beeinflusst werden, mit dem er mehr oder weniger Dampf durch das Heizelement strömen lässt. Eine „heißere“ Destillation läuft schneller ab, aber die Alkoholabscheidung ist nicht so gut wie bei einer langsamen Destillation. Die Brenngeschwindigkeit beeinflusst also auch den Charakter des Endproduktes.
Es gibt verschiedene Arten von Kühlern. Die gebräuchlichsten sind der Spiralkühler (worm condenser) und der Säulenkühler (tube condenser). Allen Bauformen ist gemeinsam, dass das zunächst als Dampf einströmende Destillat eine längere Strecke in einem Rohr zurücklegen muss, das dabei durch Wasser außerhalb des Rohres gekühlt wird. Durch die Abkühlung kondensiert der Dampf an den Wänden wieder zu einer Flüssigkeit, die am anderen Ende des Kühlers austritt. Heute wird nicht mehr nur gekühlt, sondern die dem Destillat entzogene Wärme an anderer Stelle wieder dem Brennprozess zugeführt, um möglichst energieeffizient zu arbeiten. Früher wurde das Kühlwasser einfach in den Fluss zurückgeleitet.
Ein Spiralkondensator oder Spiralkühler kann gewaltige Ausmaße von mehreren Metern Höhe und Durchmesser erreichen. Im Kühler läuft eine Kupferspirale in einem großen Wasserbad, das unten ständig mit frischem, kaltem Wasser gefüllt wird, während oben das erwärmte Wasser abfließt. Häufig ist der Kühler außerhalb der Brennerei im Freien installiert und doppelt ausgeführt, so dass für jeden Brenngang ein Kühler vorhanden ist. Von außen sehen diese Kühler aus wie große hölzerne Wasserbottiche (worm tubs), weshalb sie manchmal mit Wasservorratsbehältern verwechselt werden.
Abbildung 2: Holzbottiche (worm tubs) für die Spiralkühler der Brennerei Dalwhinnie
Den Säulenkühler (tube condenser oder shell-and-tube condenser) kann auch als Rohrbündelkühler bezeichnet werden. Er ist so aufgebaut, dass ein Bündel dünner Kupferrohre parallel in einem Kupferbehälter angeordnet ist. Auf der einen Seite des Behälters befindet sich ein Einlass für den Dampf. Dieser tritt in den Behälter ein, kondensiert an den Kupferrohren, durch die Kühlwasser geleitet wird, und tropft von dort auf den Boden des Behälters, von wo aus das Destillat abgeführt wird. Der Vorteil dieses Kühlers liegt darin, dass er leichter zu reinigen ist, wenn bei zu starker Destillation etwas überkocht. Außerdem benötigt er weniger Wasser als der klassische Spiralkühler und bietet dem Dampf eine größere Kontaktfläche mit dem Kupfer, was dem Destillat einen reineren und leichteren Charakter verleiht.
Obwohl die Säulenkühler viele Vorteile gegenüber den klassischen Spiralkühlern hatten, setzten sie sich nur langsam durch. Selbst in der Boomzeit nach 1890, als viele neue Brennereien gebaut wurden, setzten die meisten noch die alten Spiralkühler ein. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Siegeszug der Säulenkühler.
Im Kühler, gleich welcher Bauart, ist auch die unterschiedliche Temperatur des Kühlwassers entscheidend. Ist es wärmer, so legt der Dampf insgesamt einen längeren Weg bis zur Kondensation zurück als bei kälterem Wasser, hat also länger Kontakt mit dem Kupfer. Dieses Metall hat aber gleichzeitig eine chemisch reduzierende Wirkung auf bestimmte Bestandteile des Destillats, höherwertige Alkohole, Aldehyde usw. Diese können bei längerem Kontakt besser abgebaut werden, der Whisky wird weicher, verliert aber gleichzeitig bestimmte Geschmacksanteile. Deshalb sagt man auch, dass Winterwhisky mehr Charakter hat, schwerer ist und traditioneller schmeckt, denn im Winter ist das Kühlwasser, das meist aus Flüssen oder Seen stammt, sehr kalt. Die Kondensation des Dampfes erfolgt schneller, der Kontakt des Dampfes mit dem Kupfer ist entsprechend kurz und die Reduktion daher geringer. Ein bekannter Winterwhisky ist der „Dalwhinnie Winter‘s Gold“.
Der Brennvorgang, auch Destillieren (distilling) genannt, kann vom Brennmeister (stillman) durch kleine Fenster im Kupfermantel der ersten Brennblase beobachtet werden. Der Brenner muss darauf achten, dass das Gemisch nicht zu stark kocht, da sich sonst Schaum bildet, der, wenn er zu stark wird, zu hoch aufsteigt und in den Seitenarm eindringt. Dies kann zu einer Verstopfung des nachgeschalteten Kühlers führen, was eine aufwändige und zeitraubende Reinigung nach sich zieht.
Der Destillationsprozess in dieser ersten Stufe wird so lange fortgesetzt, bis fast der gesamte Alkohol durch den Kühler geflossen ist und praktisch nur noch Wasser verdampft. Kontrolliert werden kann dies durch die Temperatur der Flüssigkeit in der Brennblase und durch eine Messeinrichtung, auf die ich später beim „Spirit Safe“ noch eingehen werde. Was nun in der Brennblase verbleibt (pot ale, manchmal auch: burnt ale), hat einen Restalkoholgehalt von unter einem Volumenprozent und wird, teilweise zusammen mit dem Trester, zu eiweißhaltigem Viehfutter verarbeitet, teilweise aber auch verworfen. Manchmal wird die abdestillierte Würze auch noch zum Düngen von Feldern verwendet.
Das Ergebnis des ersten Brennvorgangs ist noch lange kein Whisky, denn die Mischung hat jetzt erst einen Alkoholgehalt von etwa 20 bis 25 Vol.%. Im Vergleich zu den sieben bis zehn Volumenprozenten der Maische ist sie aber bereits etwa dreifach konzentriert. Diese erste Destillation dient vor allem dazu, die Wassermenge zu reduzieren, und tatsächlich hat man danach nur noch etwa ein Drittel der Flüssigkeit wie vor dem Brennen. Außerdem ist sie jetzt wasserklar und kann beim nächsten Brennvorgang nicht mehr anbrennen.
Dieses Zwischenprodukt nach dem ersten Brennvorgang nennt man „low wines“. Es wird in einen geschlossenen Zwischenbehälter aus Stahl (low wines and feints receiver) geleitet und dort für den zweiten Brennvorgang aufbewahrt. Das „feints“ in seinem Namen steht für das englische Wort „Nachlauf“, dazu später mehr. Meistens werden im Zwischenbehälter die „low wines“ von zwei Brenndurchgängen gesammelt, bevor sie im nächsten Schritt weiterverarbeitet werden.
Das eigentliche Endprodukt wird in einer zweiten Brennblase (spirit still) destilliert. Im deutschen Sprachgebrauch wird diese Stufe manchmal auch Feinbrand-Brennblase genannt. Sie ist in der Regel etwas kleiner als die erste, da das gebrannte Volumen hier geringer ist als beim ersten Durchgang. Ausgangsprodukt sind hier die low wines aus dem ersten Brennvorgang, weshalb die spirit still selten auch als „low wines still“ bezeichnet wird.
Die Brennblasen beider Stufen befinden sich in der Regel zusammen in einem gemeinsamen Brennraum (still room). Die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Destillation erfolgt durch die Farbe der Rohrleitungen bzw. deren Verbindungen: Rohrverbindungen und Ventile, die mit der Befüllung der Wash Still zu tun haben, sind rot lackiert. Leitungen, die zur Spirit Still führen, sind blau markiert und Leitungen, die den fertigen Brand nach der Spirit Still transportieren, sind schwarz markiert. Die weiß markierten Leitungen führen Wasser. Achten Sie einmal auf dieses Detail, wenn Sie eine Whiskybrennerei besichtigen. Die Farbgebung hat ihren Ursprung in einem Gesetz von 1823, dem „1823 Excise Act“. Darin wurde bis ins kleinste Detail festgelegt, wie eine Brennerei aufgebaut sein musste, um den Steuerbeamten die Kontrollen zu erleichtern. Dazu gehörte auch die vorgeschriebene Farbe der Rohrleitungen:
[...] and every pipe tobe used in such distillery shall be painted as hereinafter mentioned; that is to say, every pipe for the conveyance of wort or wash shall be painted of a red color, every pipe for the conveyance of low wines or feints shall be painted blue, every pipe for the conveyance of spirits shall be painted black, and every pipe for the conveyance of water shall be painted white […]
Heute gibt es diese Vorschrift zwar nicht mehr, aber wie so oft hat man sich wohl an die Farbgebung zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Leitungen gewöhnt und sie vielerorts beibehalten.
Die Brennblasen selbst unterscheiden sich auch dadurch, dass nur die Wash Still über die erwähnten kleinen Sichtfenster verfügt. In der Spirit Still werden die Low Wines schonender erhitzt, auch findet keine Schaumbildung mehr statt, da hier bereits ein flüssiges Destillat ohne feste Bestandteile vorliegt. Aus diesem Grund ist die Gefahr des „Überkochens“ in den Kühlern hier nicht gegeben, so dass auf Fenster in der Brennblase verzichtet werden kann.
Es gibt einige schottische Brennereien, die noch einen dritten Brennvorgang anhängen, üblich sind aber meist nur zwei. Diese Beschreibung bezieht sich daher auf das doppelte Brennen mit zwei Brennblasen. Bei Whiskey aus Irland sind drei Brennvorgänge hingegen die Regel.
Die Form der Brennblasen beeinflusst den Geschmack des Destillats. Eine niedrige, gedrungene Form mit möglichst wenig Einschnitten oberhalb des Flüssigkeitsspiegels (z. B. Birnenform) ergibt einen kräftigeren und intensiveren Geschmack, während eine hohe Form eher einen weicheren und reineren Alkohol ergibt. Hat der Hals einer Brennblase mehr „Ecken und Kanten“, so führt dies dazu, dass ein größerer Teil des aufsteigenden Dampfes bereits an diesen Stellen kondensiert und wieder nach unten abfließt. Bei einigen Brennblasen werden daher kugelförmige Ausbuchtungen (reflux balls, boil balls) in den Hals eingearbeitet, um den Rückfluss zu erhöhen. Die Brennerei Balvenie hat die Form ihrer Flaschen diesen Kugeln nachempfunden. Sie weisen ebenfalls eine runde Verdickung im Hals auf.





























