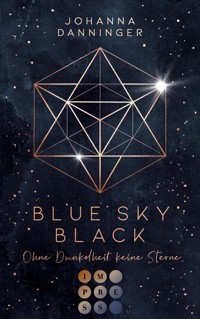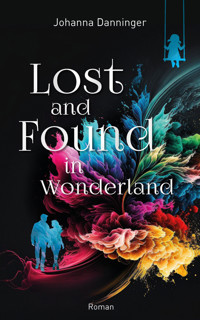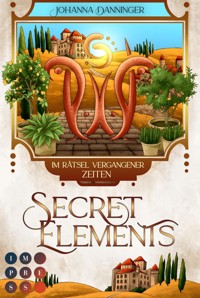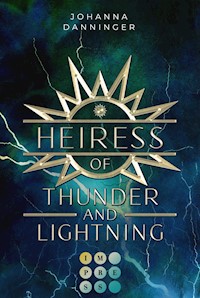4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Dort, wo deine Welt endet, beginnt Magie…** Jay hat sich entschieden: Sie ist bereit, sich auf die Anderswelt einzulassen und ihr Schicksal anzunehmen. Doch während sie es kaum erwarten kann, sich ihren Feinden entgegenzustellen und die restlichen Elemente aufzuspüren, verbietet Lee ihr weiterhin, sich an den Missionen von Team 8 zu beteiligen. Er sieht in ihr nur eine Gefahr für sich und andere. Etwas, das er Jay bei jeder Gelegenheit deutlich spüren lässt und womit er sie buchstäblich in den Wahnsinn treibt. Jay ist gefangen zwischen Angst und Selbstzweifeln, denn keiner weiß, was geschehen wird, wenn sie als Trägerin des Orinion versagt… //Textauszug: Wir waren gerade dabei, den Aufzug zu verlassen, als Lee in der Lichtschranke der Türen abrupt stehen blieb. Ich wäre beinahe mit der Nase in seinem breiten Rücken gelandet. Er drehte sich zu mir um und ich musste den Kopf in den Nacken legen, um in seine dunkelblauen Augen blicken zu können. »Wenn ich dich in unser Team integrieren soll, musst du mich endlich als Captain akzeptieren«, sagte er leise und sah fast schon bedrohlich zu mir herab. »Wenn ich dich als Captain akzeptieren soll, dann musst du mich auch wie ein gleichwertiges Mitglied des Teams behandeln.«// //Alle Bände der »Secret Elements«-Reihe: -- Secret Elements 0: Secret Darkness: Im Spiegel der Schatten (Die Vorgeschichte) -- Secret Elements 1: Im Dunkel der See -- Secret Elements 2: Im Bann der Erde -- Secret Elements 3: Im Auge des Orkans -- Secret Elements 4: Im Spiel der Flammen -- Secret Elements 5: Im Schatten endloser Welten -- Secret Elements 6: Im Hunger der Zerstörung -- Secret Elements 7: Im Rätsel vergangener Zeiten -- Secret Elements 8: Im Zeichen des Zorns -- Secret Elements 9: Im Licht göttlicher Mächte -- Die E-Box mit den Bänden 0-4 der magischen Bestseller-Reihe -- Die E-Box mit den Bänden 5-9 der magischen Bestseller-Reihe//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Johanna Danninger
Secret Elements 2: Im Bann der Erde
**Dort, wo deine Welt endet, beginnt Magie…**Jay hat sich entschieden: Sie ist bereit, sich auf die Anderswelt einzulassen und ihr Schicksal anzunehmen. Doch während sie es kaum erwarten kann, sich ihren Feinden entgegenzustellen und die restlichen Elemente aufzuspüren, verbietet Lee ihr weiterhin, sich an den Missionen von Team 8 zu beteiligen. Er sieht in ihr nur eine Gefahr für sich und andere. Etwas, das er Jay bei jeder Gelegenheit deutlich spüren lässt und womit er sie buchstäblich in den Wahnsinn treibt. Jay ist gefangen zwischen Angst und Selbstzweifeln, denn keiner weiß, was geschehen wird, wenn sie als Trägerin des Orinion versagt …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Leben ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten endlich aufgeschrieben zu werden!
KAPITEL 1
Die Wellen tosten. Mit unbändiger Wucht rollten sie über mich hinweg. Bereitwillig gab ich mich den Naturgewalten hin und ließ mich von ihnen mitreißen. Immer tiefer zogen sie mich, trugen mich hinab zur Mitte ihres Seins. Eine leuchtende dunkelblaue Kugel war ihr Quell und Ursprung. Die gewaltige Energie dieser gebündelten Macht ließ mich erstarren. Sie war zu gewaltig für mein eigenes Selbst, das im Vergleich zu dieser Macht geradezu nichtig schien. Was hatte ich dieser unermesslichen Kraft schon entgegenzusetzen? Nichts. Ich war ihr völlig ausgeliefert. Mir war, als wäre mein Brustkorb plötzlich versteinert. Ich rang nach Luft, doch der Druck auf meine Rippen ließ nicht zu, dass sich meine Lungen mit Sauerstoff füllten. Ich würde ersticken. Würde sterben. Der markerschütternde Schrei eines Dämonengreifs hallte in meinen Ohren …
Ich fuhr hoch und fand mich schwer atmend in meinem Bett wieder. Verdattert blickte ich mich um. Die zarten Strahlen der Morgensonne fielen durch das Fenster. Tausende winzige Staubflöckchen tanzten durch das Licht.
Es dauerte eine Weile, bis ich den Schrecken meines Traums abgeschüttelt und mich einigermaßen gefasst hatte. Meine Hände tasteten prüfend über meinen Brustkorb und bekamen das Orinion zu fassen. Die vertrauten Konturen des Amuletts unter dem dünnen Stoff meines Oberteils zu spüren, beruhigte mich ungemein.
Ich seufzte, als ich das Desaster zu meinen Füßen bemerkte.
Nicht schon wieder!
Ächzend rieb ich mir über das Gesicht und sprang auf, um die klatschnassen Laken abzuziehen. Das war nun schon das vierte Mal, dass ich im Schlaf mein Bett geflutet hatte. Irgendwie machte sich die Energie des Wassers in meinen Träumen selbstständig und sprudelte munter aus meinen Fingerspitzen hervor. Zumindest vermutete ich, dass das Wasser aus meinen Fingern kam. Wirklich gesehen hatte ich es noch nicht. Und verstehen konnte ich diesen Vorgang sowieso nicht. Jedenfalls musste ich dringend lernen, die Kräfte des Orinions unter Kontrolle zu bekommen.
Beim ersten Vorfall dieser Art hatte ich noch im Krankenflügel der Agency gelegen. Einzig Ivan hatte ich es zu verdanken, dass ich in meiner Panik nicht meine Tarnung als einfache Praktikantin gefährdet hatte. Der beigefarbene Kater mit dem russischen Akzent hatte jede Nacht auf dem Besuchersessel meines Krankenzimmers über mich gewacht und er hatte mich aufgeweckt, als plötzlich Wasser von meiner Matratze auf den Boden getropft war. Während ich völlig aufgelöst mit meiner triefenden Bettdecke kämpfte, hatte er beruhigend auf mich eingeredet und von den dämmrigen Fluren des Hospitals einen Wäschewagen geholt, womit wir die Sauerei schließlich heimlich beseitigen konnten. Das Gute daran war, dass General Stanson den nächtlichen Zwischenfall zum Anlass nahm, mich aus dem Krankenflügel zu entlassen.
Ich zog die nasse Bettwäsche ab und stopfte sie in den Schmutzwäschekorb in meinem Schlafzimmer, der sich wie von Zauberhand jeden Tag leerte.
Nachdenklich betrachtete ich mich in dem hohen Standspiegel neben meinem Bett. Die Morgensonne ließ mein zerzaustes dunkelrotes Haar förmlich aufleuchten.
Irgendetwas an mir hatte sich merklich verändert, doch ich konnte nicht genau sagen, was es war. Vielleicht nur mein ungeschminktes Gesicht und die Tatsache, dass ich mich allmählich daran gewöhnte. Jahrelang hatte ich mich hinter einer Maske mit schwarzem Kajal und Lidschatten versteckt. Hatte mich vorwiegend in dunkle Klamotten gehüllt, um mein Leben so unauffällig wie möglich zu führen. Wirklich funktioniert hatte dieser Plan leider nicht. Ich konnte mich noch so sehr im Hintergrund aufhalten – letztlich landete ich doch wieder in einer Auseinandersetzung, die zumeist im Büro des Schuldirektors endete, weil irgendein Schlaumeier meinte, sich mit mir anlegen zu müssen. Irgendwie war ich nicht dazu geschaffen, nicht aufzufallen.
Ich hob das Shirt meines Schlafanzugs hoch und begutachtete die Narbe an meiner Taille. Sie war winzig, kaum größer als ein Stecknadelkopf, und doch hätte mich diese Verletzung beinahe das Leben gekostet. Niemals würde ich das Feuer der Vergiftung vergessen, das mich erfasst hatte. Die Schmerzen waren unerträglich gewesen und mir war inzwischen bewusst, dass ich den Kampf gegen das Gift bereits aufgegeben hatte, als ich mich der Ohnmacht hingab. Wäre Lee nicht gewesen, wäre ich jetzt tot. Seine Begabung hatte mich gerettet. Er hatte mich gerettet.
Wie immer, wenn ich darüber nachdachte, ergriffen mich gemischte Gefühle. Einerseits war ich Lee unsäglich dankbar und stand zutiefst in seiner Schuld. Doch genau das war es auch, was mich mit Widerstreben erfüllte. Ich wusste, was er von mir und meiner menschlichen Herkunft hielt. Er machte keinen Hehl daraus, dass er meine Eignung als Trägerin des Orinions grundsätzlich in Frage stellte. Seine Einstellung mir gegenüber machte es mir wahrlich nicht leicht, ihm für seine Tat Dankbarkeit zu zeigen. Tatsächlich hatte ich es bis zu diesem Augenblick nicht zustande gebracht, Lee auf die Geschehnisse auch nur anzusprechen. Je mehr Zeit verging, umso mehr regte sich mein schlechtes Gewissen deswegen, aber ich schaffte es einfach nicht, über meinen eigenen Schatten zu springen.
Ich zerrte die Matratze über das erhöhte Fußende des Bettes, damit sie besser trocknen konnte. Dann raffte ich die feuchte Bettdecke an mich, tappte barfuß hinaus auf den Balkon und hängte sie über das Geländer.
»Schon wieder?«
Ich fuhr zusammen und sah hinüber zum Nachbarbalkon, von dem die Stimme erklungen war. Lee saß entspannt auf seinem Schaukelstuhl, umrankt von Hunderten von Topfpflanzen, und hielt eine dampfende Tasse in den Händen. Seine schwarzen Haare schimmerten feucht, als wäre er gerade frisch geduscht.
Er trug bereits seine dunkelblaue Einsatzuniform, während ich, zerknittert von Kopf bis Fuß, in meinem grauen Schlafanzug inklusive nasser Hosenbeine bis zu den Knien, bestimmt einen wenig ansprechenden Eindruck machte. Unauffällig fuhr ich mir durchs Haar, um es mir zumindest notdürftig zu glätten.
»Du bist ja auch schon wach«, stellte ich verlegen fest und zog kurz in Erwägung, die Flucht nach drinnen zu ergreifen. Das wäre wohl erst recht peinlich gewesen, darum blieb ich heldenhaft stehen.
Er nahm einen Schluck aus seiner Tasse. Der Duft des frisch gebrühten Kaffees wehte bis zu mir herüber und stieg mir verlockend in die Nase.
Ich lehnte mich lässig an die Brüstung. »Lee, ihr habt mich jetzt lange genug geschont. Es wird Zeit, dass ich lerne, wie ich das Orinion benutzen kann.«
Lee beugte sich ungerührt zu einem seiner Pflänzchen hinunter und zupfte ein verwelktes Blütenblatt davon ab.
»Ich kann nicht ewig auf der faulen Haut liegen, verdammt!«, schimpfte ich und schlug mit der Faust auf das Geländer. »Mir geht es hervorragend. Ich bin wieder gesund. Siehst du das denn nicht?«
»Zumindest hast du genug Kraft, um ein wehrloses Balkongeländer zu verprügeln«, entgegnete Lee unbeeindruckt.
Ich mahnte mich selbst zur Beherrschung. Mit gezeterten Forderungen kam ich bei dem sturen Bock nicht weit. Das hatte ich doch eigentlich schon gelernt. Bei Lee musste man eher diplomatisch vorgehen. Das Problem war nur, dass ich in solchen Dingen ungeschickt war. Gelinde ausgedrückt. Eigentlich war ich eher der Typ, der seinen Willen mit handfesten Mitteln durchsetzte. Mit dem Kopf durch die Wand und ähnlichen Methoden. Andere gruben sich einen Weg durch den Berg – ich sprengte ihn lieber. Und Lee hatte offenbar seinen Spaß daran, mich regelmäßig explodieren zu lassen.
»Jetzt mal im Ernst«, begann ich mit erzwungener Ruhe. »Mir geht es wirklich gut. Ich halte das nicht mehr aus, einfach tatenlos hier herumzulungern, während die Füchsin und ihre Anhänger dort draußen die übelsten Sachen anstellen. Ich wurde auserwählt, um zu kämpfen, und genau das werde ich auch tun. Ich bin bereit, Lee.«
Erwartungsvoll hielt ich seinem Blick stand und versuchte dabei seine Gedanken zu ergründen, was mir bei seinem rätselhaften Gesichtsausdruck nicht einmal annähernd gelang.
»Ich muss zuerst mit dem Chief darüber sprechen«, sagte er schließlich.
Das war mehr, als ich erwartet hatte. Natürlich war es noch keine Freigabe für mich, aber im Vergleich zu den bisherigen abweisenden Antworten ein riesiger Fortschritt. Meine Mundwinkel schnellten ganz von selbst in die Höhe. Ich konnte mir einen leisen Jubelschrei nicht verkneifen. Auf Lees Stirn bildete sich eine kleine Falte.
»Genial!«, sprudelte ich euphorisch los. »Dann kann ich endlich mein Versprechen an Herokla einlösen. Und ich kann euch bei der Suche nach den restlichen Elementen helfen!«
»Übertreib es nicht, Jay«, mahnte Lee.
»Ach, komm schon. Langsam könntest du mal zugeben, dass ihr den Geist des Wassers ohne mich vermutlich immer noch nicht gefunden hättet.«
Das war eigentlich als Scherz gemeint, doch Lees erhobene Augenbrauen zeigten mir, dass er es nicht als solchen erkannt hatte. »Soweit ich mich erinnere, war es purer Zufall, dass du auf ihn gestoßen bist.«
»Vielleicht war es das, aber wenn ich die Sache nicht in die Hand genommen hätte, wäre dieser Zufall nie passiert«, erwiderte ich trotzig.
Lee zuckte mit den Schultern. »Wenn du meinst …«
Das war doch wieder einmal typisch für ihn. Obwohl ich ganz genau das winzige Fünkchen Anerkennung in seinen Augen aufblitzen sah, brachte er es einfach nicht fertig, mich für meine bisherigen Leistungen auch nur ein einziges Mal zu loben. Nicht dass ich gesteigerten Wert darauf legen würde, aber heruntermachen ließ ich mich wirklich nicht. Natürlich war es eine glückliche Fügung gewesen, dass ich den Aufenthaltsort des Wassergeists so schnell herausbekommen konnte. Andererseits hätte uns Königin Herokla niemals zu ihm durchgelassen, wäre ich nicht gewesen. Beziehungsweise meine große Klappe. Damals hätte der Schuss freilich auch nach hinten losgehen können, aber letztendlich war es mir doch gelungen. Also – was sollte das dumme Getue des werten Herrn Leannán schon wieder?
Nein, Jay, bloß nicht aufregen, versuchte ich mich selbst zu beruhigen. Denn genau das wollte Lee wahrscheinlich erreichen. Dass ich mich unheimlich aufregte und er mich wegen »emotionaler Labilität« noch länger in den Krankenstand versetzen konnte.
Ich richtete meinen Blick hinaus auf die weitläufige Landschaft, die das Gelände der Agency umgab. Die Sonne stand noch tief hinter dem Wohnhaus. Das Gebäude warf einen langen Schatten über die von Tautropfen glitzernde Wiese. Dahinter ließ das Morgenlicht die Wipfel des fernen Smaragdwaldes geheimnisvoll aufleuchten. Noch war die Luft kühl und erfrischend, doch man konnte spüren, dass ein angenehm warmer Tag bevorstand.
Jetzt brauchte ich dringend auch einen frischen Kaffee. Ich sah wieder zu Lee hinüber.
»Lee?«
»Hm?«
Ich druckste einen Moment herum. »Ähm, sag mal … Wie funktioniert eigentlich meine Kaffeemaschine?«
»Du weißt nicht, wie deine Kaffeemaschine funktioniert?«, wiederholte er belustigt. »Seit wann wohnst du hier, Jay?«
Inklusive meines Aufenthalts im Krankenflügel knapp vier Wochen. Und genau dieses arrogante Grinsen, das Lee jetzt wieder aufsetzte, hatte mich in dieser ganzen Zeit davon abgehalten, mich in die Geheimnisse meines Apartments von ihm einweihen zu lassen. Einiges darin funktionierte wie von selbst: Das Licht ging automatisch an und aus, sämtliche Wasserhähne ließen sich mühelos auf- und zudrehen, und der Zutritt zur Wohnung wurde über einen Handabdruckscanner gewährt. Und einen Zimmerservice gab es offensichtlich auch, denn egal welches Chaos ich auch hinterließ – sobald ich zurückkam, war alles picobello aufgeräumt.
Doch die technischen Geräte, die in meinem derzeitigen Zuhause zur Verfügung standen, konnte ich alle nicht bedienen. Ich wusste weder, wie man den ultraflachen Fernseher zum Flimmern brachte, noch, wie die Küchengeräte zu handhaben waren, von denen kein einziges über irgendeinen sichtbaren Knopf verfügte.
»Bekomme ich heute noch eine Antwort von dir oder muss ich jemand anderen fragen?«, fragte ich genervt.
»Deine Wohneinheit heißt ›Dora‹«, antwortete Lee.
Das hatte ich sogar gewusst. Allerdings entzog sich mir gerade jeglicher Zusammenhang. »Ja, und?«
»Sprachsteuerung.«
»Was?«
»Die Wohneinheit funktioniert mittels Sprachsteuerung«, erläuterte er. Dabei redete er so betont langsam, als wäre ich schwer von Begriff.
Erstaunt atmete ich auf. »Echt? Da wäre ich ja in hundert Jahren nicht draufgekommen! Warum hast du das denn nicht gleich gesagt?«
»Warum hast du denn nicht gleich gefragt?«, meinte er trocken.
Ich schürzte die Lippen und stolzierte ohne ein Wort des Dankes in mein Wohnzimmer zurück. Wütend warf ich die Balkontür hinter mir zu. Lee hatte mich wieder einmal dazu gebracht, dass ich die Fassung verlor und alle Höflichkeit vergaß. Im Allgemeinen wusste ich sehr wohl, was sich gehörte – ganz im Gegensatz zu dem unmöglichen Kasper da draußen, dessen Eltern bei der Erziehung scheinbar gehörig am Knigge gespart hatten.
Nach einer kurzen Dusche zog ich die kotzgelben Klamotten an, die für einen Praktikanten der Agency vorgeschrieben waren, ging in den Küchenbereich und lauschte einen Moment auf die Stille des Apartments.
Dann nahm ich meinen ganzen Mut zusammen. »Dora?«, fragte ich zögerlich.
»Guten Morgen, Jessica«, antwortete eine weibliche Computerstimme.
Ich gluckste. Wie krass war das denn?
»Also, ich heiße Jay.«
»Soll ich den Namen des Hauptbewohners von Jessica auf Jay ändern?«
»Ja, bitte.«
»Name erfolgreich geändert. Guten Morgen, Jay.«
»Sag mal, bist du eine künstliche Intelligenz?«
»Ich habe Sie leider nicht verstanden.«
Ah ja. Gewundert hätte es mich allerdings nicht, wenn die Leute hier in der Agency eine künstliche Intelligenz hervorgebracht hätten. Immerhin war das Volk der sogenannten Tuatha de Dannan so fortschrittlich, dass sie Wurmlöcher und eine ganze Parallelwelt erschaffen hatten – was mich immer noch völlig faszinierte. Physik war nämlich meine Leidenschaft und das vielfältige Wissen, das die Agency besaß, war für mich hochinteressant.
»Dora, ich möchte einen Kaffee trinken«, sagte ich und stand auf.
»Soll ich den Heißgetränkeautomaten aktivieren?«
»Ja.«
»Bitte, nennen Sie Ihr gewünschtes Heißgetränk.«
»Äh … Cappuccino.«
»Soll ich einen – Cappuccino – für Sie zubereiten?«
»Ja.«
»Bereite – Cappuccino – vor.«
Die Kaffeemaschine erwachte zum Leben und gab geschäftige Geräusche von sich. Ich sauste zum Küchenschrank, holte eine Tasse hervor und warf sie hastig unter die Maschine, so dass das Porzellan bedenklich klirrte. Gleich darauf merkte ich, dass meine Eile gar nicht nötig gewesen war.
»Bitte, Trinkgefäß platzieren und bestätigen«, schnarrte die Computerstimme.
»Okay.«
»Ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte, Trinkgefäß platzieren und bestätigen.«
»Bestätigt.«
»Zubereitung läuft. Trinkgefäß nicht entfernen.«
Meine Güte, war das eine aufwendige Prozedur! Wenn ich die Maschine per Hand bedient hätte, wäre es eindeutig schneller gegangen. Ich befürchtete, dass mir diese Sprachsteuerung schon bald auf die Nerven gehen würde.
»Zubereitung – Cappuccino – beendet. Entnehmen Sie nun Ihr Getränk. Vorsicht, heiß.«
Ich schüttelte den Kopf über die überflüssige Warnung und hockte mich mit meiner dampfenden Tasse an die erhöhte Küchenbar. Sprachsteuerung hin oder her – der Cappuccino schmeckte himmlisch.
Inzwischen war die Kaffeemaschine verstummt und mit ihr auch Dora. Während ich das Getränk mit dem warmen Milchschaum schlürfte, schweiften meine Gedanken ziellos umher.
Ich war noch nicht lange in dieser Anderswelt, und doch kam es mir vor, als würde mein altes Leben weit hinter mir liegen. Als wäre das Waisenheim, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte, und meine problematische Schulzeit nur mehr eine ferne Erinnerung. Noch vor wenigen Tagen hatte ich mich verzweifelt an mein vertrautes Leben zu Hause in der Dortwelt geklammert. Ich wollte nicht hier sein, in dieser fremden und äußerst seltsamen Welt, wo es magische Dinge wie sprechende Katzen und Meerjungfrauen gab, und gleichzeitig überragende technologische Errungenschaften. Anfangs hatte ich mich vehement gegen all die fremden Dinge um mich herum gewehrt. Die Angst vor dem Unbekannten war einfach zu groß gewesen und hatte mich geradezu in Panik versetzt.
Inzwischen hatte ich mich damit abgefunden und versuchte, meine Ahnungslosigkeit in kindliche Neugier umzuwandeln. Ich hatte beschlossen mich auf die Anderswelt einzulassen.
Gänzlich gelang mir das freilich noch nicht. Es gab einfach zu viele Dinge, die mein Verstand nicht fassen und begreifen konnte. Der Grund, warum ich überhaupt hier war, zum Beispiel.
Auf der Erde tobte ein Kampf zwischen Mächten, die ich bisher noch nie wahrgenommen hatte. Energien, die ohne einander nicht existieren konnten und für das Fortbestehen unseres Lebens unverzichtbar waren, schienen aus dem Gleichgewicht geraten zu sein – Gut und Böse, Licht und Dunkelheit. Die Dunkelheit hatte sich aus ihrem Schatten geschlichen und versuchte gerade die Oberhand zu gewinnen. Der gesamten Menschheit drohte große Gefahr. Und auch wenn mir das alles unvorstellbar vorkam, wusste ich tief in meinem Innersten, dass es die Wahrheit war. Und ich wusste, dass ich in diesem Kampf eine wichtige Rolle spielte.
Danu, die Mutter des Planeten, hatte mir mit dem Orinion eine mächtige Waffe an die Hand gegeben. Ein Amulett, mit dessen Hilfe ich die vier Elemente beherrschen konnte: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die vier Elemente, aus denen alles Leben hervorging.
Und obwohl ich noch nicht wusste, wie ich mit dieser Waffe umgehen musste, war mir klar, dass ich den Kampf gegen die Dunkelheit damit aufnehmen würde.
Die Dunkelheit, welche sich in einer Frau manifestiert hatte, die sich selbst »die Füchsin« nannte. Meine erste und bisher einzige Begegnung mit ihr hatte mich beinahe das Leben gekostet. Völlig unvorbereitet und hilflos hatte ich ihr gegenübergestanden und gelähmt vor Angst in ihre schwarzen Augen geblickt. Sie war das personifizierte Böse, und die bloße Erinnerung an die Begegnung mit dieser furchterregenden Frau jagte mir eiskalte Schauer über den Rücken.
Nie wieder würde ich ihr derart schutzlos gegenübertreten. Bei unserer nächsten Begegnung wollte ich kämpfen und sie besiegen.
Aber wenn man die Kraft der Elemente nutzen wollte, brauchte man zunächst deren Einverständnis. Das des Wassers hatte ich bereits eingeholt. Doch von den restlichen drei Naturgeistern fehlte leider jegliche Spur. Erst wenn ich die Erlaubnis von allen vier Elementen bekam, konnte das Orinion seine ganze Macht entfalten. Dann musste ich nur noch lernen, wie diese Macht zu beherrschen war und wie ich sie für meine Zwecke nutzen konnte.
Ich leerte meine Tasse und stellte sie auf dem Küchentresen ab. Es war wirklich höchste Zeit, endlich loszulegen – ich war lange genug krank gewesen!
***
»Ich weiß, dass du ungeduldig bist, Jay. Aber deine Gesundheit steht nun mal an oberster Stelle.«
Genervt sah ich zu Ivan hinunter, der sich neben mir auf dem Boden rekelte. Wir saßen in der kleinen Gartenanlage vor den Wohngebäuden der Agency. Es war später Nachmittag und außer dem Kater hatte ich noch kein weiteres Mitglied von Team 8 gesehen. Meine morgendliche Begegnung mit Lee einmal ausgenommen. Anscheinend war die Mannschaft noch vor der offiziellen Frühstückszeit aufgebrochen, um einem Hinweis auf den Aufenthaltsort des Erdengeistes nachzugehen, und seither noch nicht zurückgekommen. Dass Lee dieses Vorhaben mit keinem Wort erwähnt hatte, ging mir gewaltig gegen den Strich. Wenn ich schon nicht mitfliegen durfte, hätte er mich wenigstens auf dem Laufenden halten können.
Der Einzige, der mich regelmäßig über die Aktivitäten von Team 8 informierte, war mein treuer Freund Ivan. Der Kater war ebenfalls nicht an den Außeneinsätzen der Mannschaft beteiligt, hatte sich aber im Gegensatz zu mir selbst dafür entschieden. Er hatte gewaltige Flugangst, die ihn von derlei Tätigkeiten befreite.
»Ich kann nicht mehr länger stillhalten. Und das hat nichts mit Ungeduld zu tun«, erwiderte ich. »Es ist reine Zeitverschwendung …«
Der Kater öffnete träge ein Auge. »Ganz so ist es nun auch wieder nicht. Immerhin ist inzwischen eine ganze Sonderkommission damit beschäftigt, die restlichen Elemente zu finden. Und fast die gesamte Aufmerksamkeit der Agency ist auf die Machenschaften des roten Ordens und der Füchsin gerichtet. Die beteiligten Agenten sind allesamt hervorragend ausgebildet. Du solltest ihnen ein bisschen mehr Vertrauen schenken.«
Vertrauen …
Ein großes Wort. Zu groß, um leichtfertig damit umzugehen. Meine Vergangenheit hatte mich das gelehrt und ich war der festen Überzeugung, dass es nur einen gab, dem ich uneingeschränkt vertrauen konnte. Und das war ich selbst.
Ich wischte eine verirrte Haarsträhne von meiner Stirn. »Ich weiß, dass das alles Fachleute sind. Trotzdem will ich nicht einfach nur rumsitzen und abwarten. Ich komme mir überflüssig vor.«
»Die Trägerin des Orinions, die wichtigste Person von allen kommt sich also überflüssig vor … So, so.« Er wiegte amüsiert den Kopf hin und her.
»Irgendwie hab ich das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst.«
»Und ich habe das Gefühl, dass du übertreibst.«
Ich schnaubte und hätte mir am liebsten die Haare gerauft. Die Gelassenheit des Katers mochte grundsätzlich beneidenswert sein, doch in meiner augenblicklichen Verfassung trieb sie mich beinahe in den Wahnsinn. Ich sprang auf und wanderte unruhig vor dem Springbrunnen auf und ab.
»Wie soll ich mir nicht überflüssig vorkommen?«, zeterte ich laut. »Erst werde ich hierher entführt und eingesperrt. Dann darf ich endlich aus der Agency raus, und nach meinem ersten großen Erfolg werde ich sofort wieder eingesperrt.«
»Du bist nicht eingesperrt, Jay.«
»Ach ja? Und was passiert, wenn ich jetzt da rübergehe und durch das Tor marschiere?« Aufgebracht deutete ich auf das bewachte Außentor hinter mir.
Ivan gluckste schnurrend. »Nicht viel, denke ich.«
»Wie bitte?«
Der Kater seufzte schwer und rollte sich auf seinen Bauch. »Deine Registrierung war die ganze Zeit über freigeschaltet. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Dass du während deiner Genesungszeit innerhalb der Agency bleiben sollst, war nur eine Bitte des Generals.«
»Das ist nicht dein Ernst!« Ich ließ langsam meinen Arm sinken.
Der Kater fixierte mich mit seinen bernsteinfarbenen Augen. »Hat etwa irgendjemand explizit gesagt, dass du das Gelände nicht verlassen darfst?«
Mir klappte der Mund auf. Dann klappte er wieder zu.
Ivan hatte recht. General Stanson hatte mir nicht ausdrücklich verboten, während der Zeit meiner Genesung die Agency zu verlassen. Trotzdem war ich davon ausgegangen, dass die Wachposten mich an den Ausgangstoren des Geländes aufhalten und bei meiner Flucht automatisch Alarm auslösen würden.
Im ersten Moment wusste ich nicht recht, was ich nun von dem Ganzen halten sollte. Mein Blick wanderte zu dem Außentor und dem Weg zum Smaragdwald, der sich dahinter verbarg. Ich konnte also einfach hindurchschreiten und endlich zum Waldsee gehen, um mein Versprechen einzulösen, das ich der Königin der Meermenschen gegeben hatte.
Aber ich tat es nicht.
»Es wird Zeit, dass ich aktiv werde«, sagte ich stramm zu Ivan. »Ist der Chief in seinem Büro?«
»Ich denke, schon.« Der Kater blinzelte. »Aber du solltest lieber noch warten, Jay. Lee wird …«
»Lee ist mir egal!«
Entschlossen stapfte ich los, an dem offenstehenden Außentor vorbei zum Hauptgebäude der Agency.
Der imposante Turm mit der elfenbeinfarbenen Fassade und den schweren Steinsäulen wirkte inzwischen nicht mehr so bedrohlich auf mich wie zu Beginn meiner Zeit in der Anderswelt. Ich konnte mich noch gut an die Nacht erinnern, als ich das Hauptgebäude der Agency zum ersten Mal betrat. Team 8 hatte mich damals durch den Haupteingang an der prunkvollen Vorderseite hineingeführt. Die Eindrücke der riesigen Empfangshalle waren für mich atemberaubend gewesen.
Seither war ich nicht einmal mehr in die Nähe des Haupteingangs gekommen, den auch sonst kaum einer der hier Angestellten benutzte. Auf meine Nachfrage hin, warum ich an meinem ersten Abend durch die Empfangshalle geführt worden war, hatte Joe nur breit gegrinst und behauptet, es sei für die Erfassung meiner biometrischen Daten nötig gewesen. Ich hingegen war mir sicher, dass sie mich damit bloß beeindrucken wollten. Als wäre es für mich nicht schon eindrucksvoll genug gewesen, plötzlich weit von meinem Zuhause entfernt in einem hochmodernen Flugzeug aufzuwachen und in eine Parallelwelt gebracht zu werden.
Zielstrebig marschierte ich durch den weit weniger pompösen Hintereingang und bahnte mir einen Weg durch das Labyrinth aus scheinbar endlosen Fluren. Ich war selbst erstaunt darüber, wie gut ich mich hier inzwischen zurechtfand.
Das Büro des Chiefs, der für sämtliche Special Teams hier verantwortlich war, befand sich auf einer Empore über der technischen Einsatzzentrale, die mir jedes Mal wie die Kommandozentrale einer Weltraumstation vorkam. Mehrere Leute saßen darin im Kreis vor verschiedenen Flachbildschirmen und murmelten scheinbar unbeteiligt vor sich hin. Inzwischen wusste ich, dass sie Anweisungen an die Teams weitergaben, die gerade im Einsatz waren. Die Mitte der Zentrale wurde von einem riesigen, hoch entwickelten Spezialmonitor beherrscht, der Landkarten der Anderswelt und der Dortwelt zeigte, wie meine Heimatwelt hier genannt wurde.
Vor der Tür mit der Aufschrift »General Stanson« hielt ich kurz inne, um mich zu sammeln. Der Chief war mir bisher immer äußerst freundlich und zuvorkommend begegnet. Trotzdem strahlte er auch etwas aus, das mich jedes Mal aufs Neue nervös werden ließ. Es war die Aura seiner unangefochtenen Autorität, mit der ich nicht umzugehen wusste. Das lag nicht etwa an mangelndem Respekt meinerseits, sondern viel mehr an der Erfahrung aus meiner Vergangenheit, solchen Personen grundsätzlich mit Vorsicht zu begegnen.
Dann mal los, dachte ich und straffte meine Schultern, bevor ich an die Tür klopfte.
»Guten Tag, Jay«, erklang die ruhige Stimme des Generals, der hinter mir im Flur stand.
Überrascht drehte ich mich um. Der Chief lächelte zwar, aber es war nicht zu übersehen, dass er angespannt war. Das lag wohl weniger an meiner Person als an den beiden Herren, die ihn begleiteten. Die Männer trugen maßgeschneiderte Anzüge und an ihrer Brust schillerte ein Emblem, das mir entfernt bekannt vorkam. Es war golden und sah aus wie eine Kugel, die von einer Banderole umfasst war. Allerdings konnte ich mich nicht daran erinnern, wo ich es schon einmal gesehen hatte.
Ich musste mich wirklich zusammenreißen, den Blicken dieser fremden Männer möglichst neutral zu begegnen. Während ich keine Ahnung hatte, mit wem ich es da zu tun hatte, schienen die beiden nämlich genau zu wissen, wer ich war. Also – wer ich tatsächlich war. Denn eine einfache Praktikantin hätten sie wohl kaum mit derart unverhohlener Skepsis betrachtet, wie sie es mir gegenüber gerade taten. Die Mienen der beiden Herren verrieten überdeutlich, dass sie nicht besonders viel von mir hielten. Ich hob stolz mein Kinn und trotzte der Skepsis.
Zum Glück unterbrach der Chief die angespannte Atmosphäre, bevor ich unbedachte Worte sagen konnte, die ich im Nachhinein vermutlich bereut hätte.
»Meine Herren, bitte, gehen Sie schon einmal vor«, sagte der General und wies auf sein Büro. »Ich komme sofort.«
Die Männer neigten leicht ihr Haupt und schritten wortlos an uns vorbei. Als sich die Tür hinter ihnen schloss, zog ich eine Grimasse.
»Was sind das denn für Schnösel?«, murmelte ich und erschrak im gleichen Moment darüber, als mir wieder bewusst wurde, dass der Chief ja neben mir stand.
»Das sind zwei der obersten Senatoren der Instanz«, antwortete er gelassen.
»Oh!« Da fiel mir auch gleich wieder ein, woher ich die Embleme an den Anzügen der beiden Männer kannte. Es war das Symbol für die Instanz. Das höchste Gericht der Anderswelt. Jetzt verstand ich auch, warum sie über meine wahre Identität Bescheid wussten.
»Was kann ich für dich tun, Jay?«, fragte der General.
»Ähm.« Ich sah kurz zwischen ihm und der Bürotür hin und her. Dort drinnen wartete bestimmt ein wichtiges Gespräch auf den Chief, dagegen kam mir mein eigenes Anliegen geradezu unbedeutend vor. »Ich kann auch später …«
»Schon gut.« Er lächelte aufmunternd. »Also, was ist los?«
Das war wieder einmal typisch für den General. Obwohl er offenbar wichtige Angelegenheiten zu erledigen hatte, nahm er sich Zeit für mich. Ich konnte mir gut vorstellen, warum Team 8 seinem Vorgesetzten solch unerschütterlichen Respekt entgegenbrachte. Dieser Respekt basierte auf gegenseitiger Hochachtung, entstanden aus ungebrochenem Vertrauen. Ein persönlicher Umgang, der mir bekanntlich vollkommen fremd war.
Ich räusperte mich und zupfte einen imaginären Fussel von meiner Jacke. »Also, ich wollte Sie bitten, meine Schonzeit zu beenden.«
»Genau das wollte ich heute noch mit Leannán besprechen.« Er musterte mich kurz. »Wie geht es dir?«
»Blendend! Ich könnte Bäume ausreißen. Mir ging es nie besser. Und ehrlich gesagt, treibt es mich auch allmählich in den Wahnsinn, völlig tatenlos herumzuhocken. Ich will helfen und ich muss wirklich dringend in den Smaragdwald. Immerhin habe ich der Königin der Meermenschen ein Versprechen gegeben. Und …«
Der Chief unterbrach mich mit einem Lachen. »In Ordnung, du hast mich überzeugt. Ich bin nicht sicher, inwieweit wir dich in die Aktivitäten der Agency einbinden können. Ich denke, wir werden uns zunächst darauf konzentrieren, deine Fähigkeiten zu trainieren.«
»Endlich!« Ich seufzte erleichtert. Dann senkte ich die Stimme. »Es ist nämlich schon wieder passiert. Das Wasser verfolgt mich in meinen Träumen.«
»Nun, dann ist es wirklich an der Zeit, daran zu arbeiten. Doch bevor wir damit beginnen, solltest du unbedingt dein Versprechen einlösen.« Der Chief zwinkerte mir zu und ging an mir vorbei. »Bis bald, Jay!«
KAPITEL 2
Der Smaragdwald war noch schöner, als ich ihn in Erinnerung hatte.
Die Sonne drängte sich mit ihren Strahlen durch das Blätterdach der Bäume. Farne und lange Gräser leuchteten geheimnisvoll am Boden auf. Es duftete nach Holz und frischen Kiefernnadeln. Der Gesang von Vögeln vermischte sich mit dem Rauschen der Blätter im Wind und begleitete mich auf meinem Weg.
Das Gefühl von Freiheit erfasste mich. So war das bei mir schon immer gewesen, wenn ich mich inmitten der Natur aufhielt. Ich fühlte mich akzeptiert und verstanden. Hier dachte niemand Schlechtes über mich. Die Natur urteilte nicht.
Ich wanderte an dem zugewucherten Pfad vorbei, der zu Ivans bescheidenem Häuschen führte. Vielleicht würde ich ihm auf dem Rückweg einen kleinen Besuch abstatten, doch im Moment genoss ich es, einfach nur schweigend auf dem schmalen Weg entlangzulaufen und den Klängen des Waldes zu lauschen.