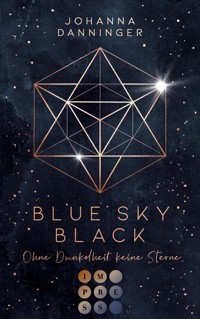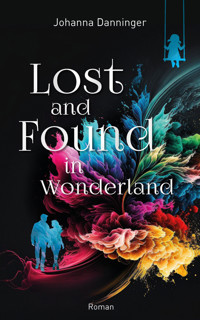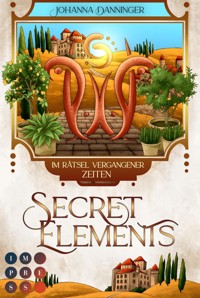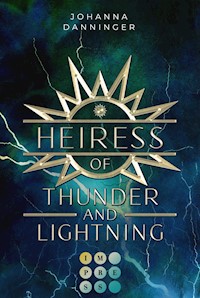4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Vertraue den Elementen, deren Zauber dich umgibt …** Jay will alles dafür geben, die Menschenwelt und die Anderswelt von der Dunkelheit zu befreien. Vor allem jetzt, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben erfährt, wie es sich anfühlt, wahre Freunde zu haben. Das Vertrauen und die Unterstützung, die Jay erlebt, überwältigt sie geradezu. Sogar der sonst so verschlossene Lee scheint sich ihr endlich mehr und mehr zu öffnen. Umso schlimmer ist es für Jay, dass sie tief in ihrem Herzen ein Geheimnis vor ihm verborgen halten muss. Und genau das nutzt die Dunkelheit, um Jay zu beeinflussen… //Alle Bände der »Secret Elements«-Reihe: -- Secret Elements 0: Secret Darkness: Im Spiegel der Schatten (Die Vorgeschichte) -- Secret Elements 1: Im Dunkel der See -- Secret Elements 2: Im Bann der Erde -- Secret Elements 3: Im Auge des Orkans -- Secret Elements 4: Im Spiel der Flammen -- Secret Elements 5: Im Schatten endloser Welten -- Secret Elements 6: Im Hunger der Zerstörung -- Secret Elements 7: Im Rätsel vergangener Zeiten -- Secret Elements 8: Im Zeichen des Zorns -- Secret Elements 9: Im Licht göttlicher Mächte -- Die E-Box mit den Bänden 0-4 der magischen Bestseller-Reihe -- Die E-Box mit den Bänden 5-9 der magischen Bestseller-Reihe//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Johanna Danninger
Secret Elements 4: Im Spiel der Flammen
**Vertraue den Elementen, deren Zauber dich umgibt …**Jay will alles dafür geben, die Menschenwelt und die Anderswelt von der Dunkelheit zu befreien. Vor allem jetzt, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben erfährt, wie es sich anfühlt, wahre Freunde zu haben. Das Vertrauen und die Unterstützung, die Jay erlebt, überwältigt sie geradezu. Sogar der sonst so verschlossene Lee scheint sich ihr endlich mehr und mehr zu öffnen. Umso schlimmer ist es für Jay, dass sie tief in ihrem Herzen ein Geheimnis vor ihm verborgen halten muss. Und genau das nutzt die Dunkelheit, um Jay zu beeinflussen…
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Leben ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten endlich aufgeschrieben zu werden!
KAPITEL 1
Mein Puls raste.
Ich presste mich mit dem Rücken an die Wand. Pures Adrenalin rauschte durch meine Adern. Die Waffe vibrierte leicht in meinen zitternden Händen. Völlige Stille lag über dem verlassenen Bürogebäude.
Wo zur Hölle steckten die anderen?
Nervös überprüfte ich die Anzeige meines Multifunktionsarmbands. Ich war online und es gab keinerlei Störmeldungen. Trotzdem reagierte niemand auf meine Kontaktversuche. Ich war auf mich allein gestellt.
Hastig tippte ich auf dem Display des Armbands herum und rief den Gebäudeplan auf, um mich zu orientieren. Ich war nicht mehr weit entfernt. Nur zwei Räume trennten mich vom Ziel.
Ich verstärkte den Griff um die Pistole, schloss die Augen und atmete ein paar Mal tief durch, um das Rauschen in meinen Ohren zu unterdrücken. Das Amulett pulsierte auf meiner Brust. Die Elemente waren bereit. Sie wollten mir helfen, mich unterstützen. So sehr wollten sie es, dass ich Mühe hatte, sie unter Kontrolle zu halten. Ich durfte mich von den Kräften des Orinions nicht verleiten lassen. Sie hätten verraten, wer ich wirklich war.
Schritte näherten sich. Sie klangen vorsichtig, doch laut genug. Ich lauschte angestrengt und konnte hören, wie die Person eilig den Nachbarraum betrat und irgendwo stehen blieb. Ich nutzte den Moment und sprang aus meiner Deckung hervor und durch den Türrahmen. Bevor mein Gegner reagieren konnte, rammte ich ihm den Lauf meiner Pistole hart in den Bauch und schlug ihm blitzschnell seine Waffe aus den Händen. Er krümmte sich ächzend, holte aber gleich zum Gegenschlag aus. Sein Ellbogen traf mit einem dumpfen Geräusch auf meine Rippen. Das Adrenalin überdeckte den Schmerz, aber die Wucht reichte aus, um mich nach hinten taumeln zu lassen.
Sofort stürzte sich mein Gegner auf mich und ließ seine Fäuste auf mich niederprasseln. Ich nutzte meine Unterarme, um seine Schläge abzufangen. Er war ein guter Kämpfer, keine Frage, doch er schaffte es nicht, meine Abwehr zu durchbrechen.
Bei der erstbesten Gelegenheit, die sich mir bot, stieß ich ihn mit einem beherzten Tritt von mir. Ich gab ihm keine Chance, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, und drängte ihn mit einer unerbittlichen Schlagabfolge immer weiter in eine Ecke des unmöblierten Zimmers. Er begann zu stolpern und stieß mit dem Rücken gegen die Wand. Ich holte ein letztes Mal aus und schlug ihn mit dem Griff meiner Waffe fest gegen die Schläfe, worauf er bewusstlos zu Boden sank.
Ich blickte prüfend auf ihn hinab. Sein Brustkorb hob und senkte sich kaum merklich. Vorsichtig stieß ich mit meiner Stiefelspitze gegen seinen rechten Fuß, doch er zeigte keinerlei Reaktion.
Alles klar.
Ich hielt meine Waffe bereit und spitzte die Ohren. Nichts war zu hören. Nur das rasende Pochen meines Herzschlags.
So leise wie möglich ging ich weiter. Der Raum hatte drei Türen. Durch eine davon war mein Gegner gekommen, durch die zweite ich. Hinter der dritten sollte sich ein Durchgangszimmer befinden, durch das ich mein Ziel erreichen würde.
Behutsam drückte ich die angelehnte Tür auf. Sie knarzte kaum hörbar, doch ich zuckte zusammen, als hätte sie mich angeschrien. Ich drückte mich seitlich gegen die Wand, während ich mit einem Arm die Tür so weit wie möglich öffnete. Dahinter herrschte undurchdringliche Dunkelheit.
Ich aktivierte die Taschenlampe meines Armbands und umfasste den Griff meiner Pistole mit beiden Händen, ehe ich mich aus meiner Deckung hervorwagte und den fensterlosen Raum betrat. Eilig schwenkte ich den Lichtkegel meiner Lampe nach allen Seiten und erfasste die Lage. Im Gegensatz zum Raum davor befanden sich hier ein paar Möbelstücke, hinter denen man sich gut verstecken konnte.
Ich überprüfte jeden Winkel, jeden einzelnen Schatten, und erst als das Zimmer vollständig gesichert war, erlaubte ich mir wieder zu atmen. Dann wandte ich mich der letzten Tür zu.
Angespannt leuchtete ich über den abblätternden Lack. Ich drückte auf die Klinke. Die Tür war abgesperrt, doch das spröde Holz des Türrahmens sagte mir, dass mich das nicht wirklich aufhalten konnte.
Ich machte einen Schritt zurück und trat mit aller Kraft gegen die Türplatte. Das Holz krachte laut, als das Schloss durch die Wucht herausgebrochen wurde. Die Tür schwang auf und knallte gegen die Wand. Sollte sich noch einer meiner Feinde in der Nähe befinden, hatte ich ihm gerade in aller Deutlichkeit meine Position verraten.
Sofort ging ich los und betrat das letzte Zimmer. Schwaches Mondlicht fiel durch ein schmutziges Fenster. Der Raum war leer, bis auf einen kleinen Tisch, der in der Mitte stand. Darauf lag das Zielobjekt.
Erleichtert eilte ich darauf zu. Ich hatte es geschafft! Direkt vor mir lag die Aktenmappe mit dem vergilbten Papiereinband, deren hochbrisante Informationen es zu bergen galt. Der Schein des Mondes warf einen geradezu mystischen Schimmer auf das Papier.
Ich erstarrte.
Der Anblick dieses Schriftstücks löste eine Flut von Erinnerungen in mir aus, die erbarmungslos über mich hereinbrachen.
Das Buch der Worte … Alfred … die Füchsin …
Unaufhaltsam tauchten die Bilder dieser schrecklichen Nacht vor drei Wochen vor meinem inneren Auge auf. Ich sah erneut dabei zu, wie die Füchsin mit gierigem Blick das kostbarste Buch der Welt hochhob. Wie sie, ohne mit der Wimper zu zucken, dem Bibliothekar Alfred einen Dolch in die Brust rammte. Wie mein lieber Freund leblos zu Boden sank.
Und dann sah ich die Füchsin vor mir stehen. Das glühende Mal der Dunkelheit auf ihrer Stirn, die undurchdringliche Schwärze ihrer Augen, das amüsierte Lächeln auf den blutroten Lippen. Sie freute sich über den Schock, der mit der Wahrheit über mich hereingebrochen war.
Töte sie!
Wieder und wieder hallten diese Worte durch meinen Kopf.
Du musst sie töten!
Aber ich war nicht dazu imstande gewesen, konnte mich weder bewegen, noch einen klaren Gedanken fassen. Stattdessen hatte ich reglos dagestanden und zugelassen, dass die Füchsin mitsamt dem Buch der Worte floh.
Die Frau, deren Körper die Dunkelheit sich zu eigen gemacht hatte.
Den Körper meiner Mutter …
Da holte ein flammender Schmerz mich plötzlich zurück in die Gegenwart. Er brannte sich zwischen meinen Schulterblättern ein und breitete sich wie eine Welle in mir aus. Ich wurde nach vorn geworfen und wollte mich mit den Händen am Tisch abfangen, doch meine Arme reagierten nicht mehr. Meine Muskeln waren auf einmal wie versteinert. Steif wie ein Brett kippte ich um und blieb hilflos auf dem Boden liegen.
Der anfängliche Schmerz ließ nach und nur ein dumpfer Nachhall blieb davon übrig. Ich konnte mich nicht bewegen. Ein leichtes Zittern hatte meinen Körper erfasst. Es fühlte sich merkwürdig an, als würde er mir nicht mehr gehorchen.
Ein paar Stiefel schoben sich in mein Blickfeld. Sie gehörten zu dem Kerl, den ich kurz zuvor bewusstlos geschlagen hatte. Er ging in die Hocke und beugte seinen Kopf zu mir herab, sodass ich sein dämliches Grinsen erkennen konnte.
»Zu früh gefreut, Winter!«, höhnte Maranon Gedelski.
Klasse! Ausgerechnet der Typ, den ich von meinen Mitschülern am allerwenigsten leiden konnte, hatte mich mit einem Schuss in den Rücken lahmgelegt.
Wütend starrte ich ihn an. Eigentlich wollte ich etwas erwidern, doch es kam nicht mehr als ein merkwürdiges Zischeln aus meinem verkrampften Kiefer hervor.
Maranon legte den Kopf schräg und beugte sich noch weiter zu mir. »Wie bitte? Hast du was gesagt?«
Das Orinion fühlte sich so heiß auf meiner Haut an, dass ich befürchtete, es würde explodieren. Ich war kurz davor, die Kontrolle über das Amulett zu verlieren.
Zum Glück tauchte in diesem Moment Major Kunnar auf und beendete damit die Übung. Er deaktivierte den elektrischen Impuls meiner Trainingsweste, den Maranon durch seinen Treffer mit der Spezialmunition ausgelöst hatte.
So plötzlich, wie sie gekommen war, fiel die Ganzkörperstarre von mir ab. Sofort rappelte ich mich auf und holte bereits tief Luft, um Maranon zu erklären, dass er sich sein Grinsen sonst wohin schieben konnte, als Major Kunnar zwischen uns trat. Er stierte grimmig auf mich herab und hatte dabei die Arme vor der Brust verschränkt, sodass seine Muskelpakete voluminös hervortraten. Seine Glatze spiegelte das düstere Deckenlicht wider. Ich war immer noch stinksauer, darum unterdrückte ich nur mit Mühe den Drang, mich einfach an ihm vorbei auf Maranon zu stürzen.
Während Kunnar mich weiter anstarrte, geriet das Bürogebäude um uns herum in Bewegung. Wände, Türen und Möbelstücke verloren ihre Farbe und sanken in sich zusammen, bis sie völlig mit dem Boden verschmolzen waren. Gleichzeitig schien sich die Zimmerdecke in Luft aufzulösen. Es wurde immer heller. Und innerhalb von Sekunden war die gesamte Projektion verschwunden und wir standen in der schmucklosen Holografie-Halle.
»Verdammt noch mal, Winter!«, bellte Kunnar unvermittelt. »Was ist los mit Ihnen?«
Inzwischen hatte ich den harten Tonfall unseres Ausbildungsleiters zur Genüge kennengelernt. Anfangs war es mir ziemlich schwergefallen, damit klarzukommen. Doch jetzt, acht Wochen später, konnte ich seine Worte in der Regel von mir abprallen lassen.
»Ich wurde erschossen, Sir«, antwortete ich schließlich gepresst.
»Und warum war das der Fall?«
Ich biss mir auf die Unterlippe. So etwas wie gerade eben war mir leider nicht zum ersten Mal passiert. Der Schock saß mir viel zu tief in den Gliedern. Er ließ sich nicht verdrängen, zumindest nicht für lange. Mir kam es fast so vor, als würden sich die Erinnerungen in den Tiefen meines Selbst zusammenballen, um dann immer wieder und in den unpassendsten Situationen stark wie ein Geysir hervorzubrechen.
Major Kunnar durchbohrte mich mit seinen grauen Augen. Ich wusste nicht genau, was er in meinen erkennen konnte. Sicher viel zu viel, für meinen Geschmack. Immerhin war er ein Fínniór zweiten Grades, ein Wahrheitsfinder, der die Gefühle anderer spüren konnte.
Ich reckte das Kinn und erklärte: »Weil ich zu langsam war, Sir.«
Hinter Kunnars breitem Rücken konnte man Maranon leise lachen hören. Der Major registrierte das mit einem Zittern seiner Nasenflügel, wandte sich aber nicht um. Stattdessen sagte er zu mir: »Sie waren keineswegs zu langsam, Winter. Das konnte man bei der Auseinandersetzung mit Gedelski sehen.« Das leise Lachen im Hintergrund verstummte. Kunnar machte eine bedeutungsschwere Pause, bevor er losdonnerte: »Aber wenn Sie schon eine Waffe in der Hand halten, dann benutzen Sie sie gefälligst auch!«
Das Thema »Schusswaffe« war tatsächlich ein Problem für mich. Es war nicht etwa so, dass ich nicht damit umgehen konnte. Ganz im Gegenteil – auf dem Schießstand gelang mir das sogar recht gut. Das Problem bestand eher darin, dass ich sie nicht benutzen wollte. Mit einem einzigen Zucken des Zeigefingers konnte man damit ein ganzes Leben auslöschen. Und das war meiner Meinung nach falsch, feige und brutal.
Nein, so ein Gerät wollte ich nicht benutzen. Nicht einmal in einer Projektion und mit harmloser Elektroimpuls-Munition.
»Ja, Sir!«, rief ich trotzdem artig, damit Kunnar mich in Ruhe ließ.
Er kniff kurz die Augen zusammen und wandte sich schließlich ab.
»Mittagspause!«, brüllte er in einem Tonfall, als wäre das eine Bestrafung für uns.
Mein Blick streifte Maranon. Er hatte die Lippen zu einem dünnen Strich zusammengepresst und marschierte stramm an mir vorbei. Ich folgte ihm mit kurzem Abstand bis zum Hallenausgang. Von unseren Mitschülern war weit und breit keiner zu sehen. Maranon und ich waren offenbar die Einzigen, die es in der Simulation bis zum Ziel geschafft hatten. Die anderen hatten sich wohl zuvor schon gegenseitig eliminiert, weshalb ich auch sonst keinen aus meinem Team mehr per Funk hatte erreichen können.
Ich war immer noch wütend, doch langsam merkte ich, dass Maranon gar nicht der Grund für meine Wut war. Ich war zornig auf mich selbst. Dass ich mich wieder einmal von meinen Erinnerungen hatte gefangen nehmen lassen. Ich durfte nicht zulassen, dass meine Gefühle mich überwältigten. Und zwar nicht nur in Ausbildungssituationen wie gerade eben.
Die Dunkelheit hatte das Buch der Worte an sich gerissen und war dadurch zu einer Bedrohung ungeahnten Ausmaßes geworden. So hatte es zumindest General Stanson benannt. Ich hatte in meiner Zeit in der Anderswelt zwar schon viel über Magie gelernt, doch die Macht dieses Buches blieb mir nach wie vor rätselhaft. Angeblich enthielt es alle Sätze und Formeln, die einst zur Erschaffung der Anderswelt nötig gewesen waren. Für mich klang das nach Zaubersprüchen. Und das wiederum klang für mich nach Märchen.
Sagte die Auserwählte mit dem magischen Amulett um den Hals …
Jedenfalls war die Dunkelheit mit diesem Buch stärker denn je geworden. Dazu kam noch die Kleinigkeit, dass sie sich ausgerechnet den Körper meiner Mutter geschnappt hatte, um mit ihr als Füchsin die Erde zu unterwerfen. Kurz bevor ich das erfahren hatte, war ich noch voller Entschlossenheit gewesen, die Füchsin zu töten. Die Dunkelheit brauchte einen menschlichen Körper, um in unserer Welt existieren zu können. Wenn dieser Körper starb, musste sie verschwinden. Doch damit würde auch meine Mutter unweigerlich sterben, deren Bewusstsein noch in der Füchsin existierte und sich nicht ganz von der Finsternis hatte vertreiben lassen.
Sie war noch da. Das wusste ich. Einen winzigen Augenblick lang hatte sie sich zurück an die Oberfläche kämpfen können und zu mir gesprochen.
Töte sie!
»Warum hast du nicht geschossen?«
Ich fuhr zusammen und fand mich in der Mädchenumkleide wieder. Offenbar hatten meine Beine mich automatisch hierher gebracht, während meine Gedanken wieder ganz woanders gewesen waren. Ich blinzelte meine Freundin Lucy verdattert an, die am Waschbecken stand und mir diese Frage gestellt hatte. Sie tupfte eine heftige Schürfung an ihrem Hals mit einer Kompresse ab. Ihren Lockenschopf hatte sie zu einem wirren Knoten gebunden und die Trainingsausrüstung bereits abgelegt.
»Jay?« Lucy musterte mich besorgt im Spiegel. »Alles klar bei dir?«
»Klar. Ich ärgere mich nur. Das ist alles.«
Ich ging zu meinem Spind und legte das Waffenholster ab. Bis auf Lucy und mich war niemand in der Umkleide. Die anderen Mädchen aus unserer Klasse hatten sich wohl bereits in die Mittagspause verzogen.
»Also, noch mal«, sagte Lucy ernst. »Warum hast du nicht auf Maranon geschossen?«
»Keine Ahnung. Wird nicht wieder vorkommen.« Ich seufzte und löste die dunkelgrüne Armbinde, die mich heute der Gruppe mit dem klangvollen Namen »Team Grün« zugewiesen hatte.
Bei den Simulationen wurden wir meistens in zwei oder maximal vier Teams aufgeteilt, die jedes Mal neu zusammengewürfelt wurden. Wobei Kunnar uns garantiert nicht willkürlich einteilte. Mir war aufgefallen, dass die Teams stets gleich stark waren. Und ich war nie mit Maranon in derselben Gruppe, worüber ich mich wahrlich nicht beschwerte.
Der Kerl verabscheute mich. Er war einer jener Bewohner der Anderswelt, die glaubten, durch ihre Genetik etwas Besseres zu sein. Ich trug die Tätowierung eines Wahrheitsfinders dritten Grades am Handgelenk, was die niedrigste Ausprägung einer Tuatha-Begabung darstellte. Allein das ließ Maranon schon die Nase rümpfen. Außerdem war ich auch noch ein sogenannter Bréag, der, ohne von seiner Begabung zu wissen, bei Menschen in der Dortwelt aufgewachsen war. In Maranons Augen war das die größte Schande überhaupt.
Was würde er wohl sagen, wenn er erfahren würde, dass alles, was er über mich wusste, gelogen war? Wenn ihm jemand verraten würde, dass ich einfach nur ein Mensch war?
Manchmal hätte ich es ihm gern selbst unter die Nase gerieben. Denn er hasste mich wohl nur deshalb so sehr, weil ich ihm ebenbürtig war. Das konnte er mit seiner Grundeinstellung einfach nicht vereinbaren. Ich hätte wahrlich gern sein Gesicht gesehen, wenn ihm bewusst wurde, dass ein stinknormaler Mensch wie ich ihm problemlos die Stirn bieten konnte.
Leider musste ich auf diesen Anblick verzichten. Der einzige Grund, warum ich als Mensch überhaupt an der Ausbildung zu einem Andersweltagenten teilnehmen durfte, unterlag nämlich der obersten Geheimhaltungsstufe der Agency. Nur wenige Bewohner der Anderswelt wussten, dass eine Terrororganisation namens »der rote Orden« auf der Erde ihr Unwesen trieb, die von der Dunkelheit selbst angeführt wurde. Und nur die allerwenigsten wussten, dass ich im Besitz des Orinions war, der mächtigsten Waffe überhaupt. Ein Amulett, geschaffen von der Göttin Danu, welches seinen Träger dazu befähigte, die Kraft der vier Elemente zu nutzen.
Dass meine wahre Identität zu meinem eigenen Schutz verschleiert wurde, konnte ich verstehen. Aber dass die Anderswelt nichts von der aktuellen Bedrohung erfahren sollte, gefiel mir nicht. Ich konnte dieser Entscheidung der Instanz, des höchsten Gerichtes der Anderswelt, absolut nicht zustimmen. Sie wollten angeblich eine Massenpanik verhindern. Schön und gut, aber wie sollte die Bevölkerung sich schützen, wenn sie nicht aufgeklärt wurde?
Die Menschen in der Dortwelt wussten nichts von Magie, Elementargeistern oder Göttinnen. Auch Zwerge, Meerjungfrauen und sonstige Geschöpfe der Anderswelt waren ihnen unbekannt. Sie hätten es nicht nachvollziehen können, mit welchen gefährlichen Mächten die Erde derzeit zu kämpfen hatte. Ich verstand es ja selbst kaum, obwohl ich mitten in diesem Kampf steckte.
Doch die Bewohner Anderswelt würden das ganz genau verstehen. Es war einfach nicht richtig, sie in dem Glauben zu lassen, alles sei in bester Ordnung.
Ich löste das Abzeichen des Team-Leaders von meiner Trainingsweste und sah zu Lucy hinüber. Sie hatte eine braune Salbe über ihre Wunde gestrichen und klebte nun ein Pflaster darüber. Lucy war unter meiner Leitung in »Team Grün« gewesen und mich überkam unwillkürlich ein schlechtes Gewissen. Hatte ich eine falsche Taktik angewandt? War ich schuld daran gewesen, dass wir verloren hatten?
»Wann bist du rausgeflogen?«, fragte ich sie.
Lucy warf einen prüfenden Blick auf ihr Spiegelbild. »Kurz bevor du auf Maranon gestoßen bist. Dieser Idiot hat mich gekratzt wie ein kleines Mädchen!« Sie schraubte das Salbendöschen zu, bevor sie es in das Erste-Hilfe-Schränkchen zurückstellte, das neben dem Waschbecken hing. Ihre Augen trafen im Spiegel auf meine. Sie hob eine Braue. »Schau nicht so bedröppelt. Soviel ich mitgekriegt hab, sind die anderen Teams gar nicht erst bis zum letzten Abschnitt gekommen. Aber das wird uns der liebe Major bestimmt bis ins kleinste Detail erörtern.«
Das würde er gewiss. Und er würde auch nicht die geringste Gelegenheit auslassen, jeden winzigen Fehler sämtlicher Beteiligter in aller Deutlichkeit auszuleuchten. Bei den Nachbesprechungen kam grundsätzlich niemand ungeschoren davon.
»Bist du fertig?«, fragte Lucy mich und schüttelte ihre Locken.
Ich zog meine Trainingsweste aus und hängte sie in den Spind. »Fertig.«
»Gut, ich bin nämlich vollkommen ausgehungert«, jammerte sie und rieb sich wehklagend den Bauch.
»Du bist immer vollkommen ausgehungert«, entgegnete ich.
Lucy zuckte unbekümmert mit den Schultern. »Stimmt.«
***
Der Herbst hatte sich über die Anderswelt gebreitet. Die Tage wurden kürzer und die Natur war allmählich bereit für den Winter.
Ich schritt gemächlich durch den Smaragdwald und betrachtete das wundervolle Farbspiel der herbstlichen Baumwipfel über mir. Ein würziger Duft nach feuchter Erde und Moos lag in der Luft. Dieser Wald war mein heiliger Ort. Hier fühlte ich mich geborgen und verstanden. Niemand erwartete etwas von mir, keiner urteilte über mich. Nur hier hatte ich das Gefühl, einfach sein zu dürfen.
Seit ich das Orinion besaß, hatte sich meine Verbundenheit mit der Natur noch mehr vertieft. Ich verbrachte viel Zeit damit, mich in die Elemente hinein zu spüren und ihnen zuzuhören. Ich beobachtete den beständigen Tanz der Wassermoleküle im Waldsee, lauschte dem bunten Treiben tief unten in der Erde und ließ meine Gedanken vom Wind davontragen. Dabei bemerkte ich mehr und mehr, wie die Elemente fließend ineinandergriffen und miteinander verbunden waren. Trotz ihrer äußerst unterschiedlichen Eigenschaften bildeten sie in den verschiedenen Formen der Natur eine perfekt abgestimmte Einheit. In den Bäumen des Smaragdwalds konnte ich dieses Zusammenspiel sehr gut beobachten. Hier sah ich Wasser, Erde, Luft – und eine vierte Komponente, die mir noch verborgen blieb, deren Anwesenheit mir aber sehr wohl bewusst war: das Feuer.
Es war das letzte Element, dessen Einverständnis ich noch brauchte, um die volle Macht des Orinions nutzen zu können.
Leider wusste niemand, wo sich der Geist des Feuers momentan aufhielt. Was ja nichts Neues war. Das Problem war, dass die Agency diesmal absolut keinen Hinweis darauf hatte, wo man mit der Suche überhaupt anfangen könnte. Und es gab auch keine Geschöpfe dieses Elements, die man hätte fragen können. Die Feuerelfen lebten in Magma – eine denkbar schlechte Umgebung für eine entspannte Unterhaltung.
Vor mir lichtete sich der Wald und ich betrat das steinige Ufer des Sees. Magisch glitzernd breitete er sich vor mir aus. Das Wasser war so klar, dass die Bäume rundherum sich darin spiegelten und die Wasseroberfläche durch das Herbstlaub darüber orangerot zu glühen schien. Ein dunkler Schatten flog über mich hinweg.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sah Kaleidos, der in einer weiten Kurve über den See flog. Manchmal konnte ich es kaum fassen, wie wunderschön der geflügelte Hengst doch war. Das schwarze Fell schimmerte seidig und die Federn glänzten herrlich im Sonnenschein.
Kaleidos setzte ein Stück von mir entfernt zur Landung an und trabte mit gespitzten Ohren zu mir her. Noch bevor er zum Stehen gekommen war, schlang ich meine Arme um seinen Hals und drückte mein Gesicht in seine dichte Mähne. Der Hengst hielt ganz still und tröstete mich auf eine Weise, wie nur er es konnte. Seine dunklen Augen enthielten mehr Verständnis und Rat als jede lange Rede.
Der Hengst hob nervös den Kopf. Ich löste mich von ihm und folgte seinem Blick in Richtung Waldrand. Es dauerte einen Moment, bis ich die leisen Schritte vernahm, die Kaleidos beunruhigten.
Sofort verband ich mich mit den Kräften des Orinions und weitete meine Wahrnehmung auf die Luft aus. Mit ihrer Hilfe konnte ich Bewegungen erkennen, die meinen Augen verborgen waren. Ich tastete mich den Waldweg entlang und fand eine menschliche Gestalt, die schnurstracks in unsere Richtung marschierte. Auch aus der Ferne wusste ich sofort, wer das war. Der schnelle Schritt, der durchgestreckte Rücken und das erhobene Kinn zeigten mir außerdem, dass diese Person leicht verstimmt war.
Ich löste mich von der Energie der Luft und lehnte meine Stirn gegen Kaleidos’ Hals.
»Pass auf«, murmelte ich, »jetzt gibt’s gleich Ärger.«
Der Hengst schnaubte wissend. Kurz darauf hörte man die Schritte energisch über den Kies knirschen.
»Verflucht, Jay!«, polterte Lee. »Was soll das denn schon wieder?«
Ich drehte mich zu ihm und musterte ihn gelassen. Sein schwarzes Haar war vom Herbstwind leicht zerzaust. Die Brauen hatte er finster zusammengezogen.
Lee blieb vor mir stehen und verschränkte die Arme. »Wir hatten eine Vereinbarung! Du sollst mir Bescheid geben, wenn du die Agency verlässt!«
»Das habe ich«, erwiderte ich ruhig. »Ich hab dir einen Zettel unter der Tür durchgeschoben.«
Lee stierte mich an, als hätte er sich verhört. »Einen Zettel? Sag mal, Jay, denkst du, das ist ein Witz? Wenn du dich nicht an unsere Abmachung hältst, muss ich dir eine Ausgangssperre verordnen!«
Ich kniff die Augen zusammen. »Das wagst du nicht …«
»Oh, doch!«
Wir starrten uns einen Moment lang feindselig an, bis Kaleidos mich sanft mit der Nase anstupste. Natürlich hatte der Hengst recht. Lee meinte es nur gut mit mir. Als Captain von Team 8, das mich als Trägerin des Amuletts von Anfang an begleitet hatte, war Lee für meine Sicherheit verantwortlich. Und da die Füchsin sich nach ihrem Gefängnisausbruch irgendwo in der Anderswelt aufhielt, wollte er mich zuerst gar nicht mehr allein in den Smaragdwald gehen lassen. Nach einiger Diskussion hatten wir uns schließlich darauf geeinigt, dass ich mich bei ihm persönlich abmelden sollte, sobald ich die Agency verließ.
Ich atmete tief durch. »Es tut mir leid, okay? Ich wollte dir ja Bescheid sagen, aber ich hab dich nirgends gefunden. Darum der Zettel.«
Als Antwort ergriff Lee meinen linken Arm und deutete vielsagend auf mein Multifunktionsarmband. Erst jetzt sah ich, dass es hektisch blinkte. Er tippte auf das Display und drehte mein Handgelenk so, dass ich den Text darauf lesen konnte.
Wo zum Teufel steckst du???
Die Nachricht war über »Kanal vier« gekommen, den verschlüsselten Kanal, der nur mein Gerät und das von Lee verband.
»Ah, damit kann man Textnachrichten verschicken?«, sagte ich staunend. »Das wusste ich noch gar nicht.«
Lee rollte mit den Augen und zog meinen Arm zu sich, damit er auf dem Display herumtippen konnte. »Denkst du wirklich, die Menschen sind von alleine auf die Idee der Smartwatch gekommen?« Er ließ meinen Arm los. »So, der Vibrationsalarm ist aktiviert.«
Ich überging seinen genervten Unterton und nickte. »Alles klar, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid.«
Lee sah mich nachdenklich an. Doch bevor er dieses leidige Thema noch ausweiten konnte, ergriff ich hastig das Wort: »Hör mal, du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Ich habe viel gelernt und kann inzwischen sehr gut selbst auf mich aufpassen.«
»Ich weiß.«
Überrascht hielt ich inne. Eigentlich hatte ich mich auf eine unserer hitzigen Diskussionen eingestellt und mir schon diverse Argumente zurechtgelegt. Misstrauisch legte ich den Kopf schräg. »Ach ja?«
Lee gab sich ungerührt, konnte aber ein amüsiertes Zucken seiner Mundwinkel nicht ganz unterdrücken. Er trat einen Schritt vor, streichelte gemächlich über Kaleidos’ Hals und tat so, als wäre unser Gespräch hiermit beendet. Ich schaute ihn so lange an, bis er sich doch zu einer Erklärung herabließ.
»Ich habe mir eure heutige Trainingseinheit angesehen«, sagte er in beiläufigem Tonfall. »Für einen waffenlosen Einsatz war das ganz ordentlich.«
Ich schüttelte blinzelnd den Kopf. »Wie bitte? Du warst heute in der Halle und hast zugeschaut?«
»Ja.«
Mir schoss augenblicklich Röte in die Wangen. Irgendwie war es mir peinlich, dass Lee mich bei einem Einsatztraining beobachtet hatte.
»Machst du das öfter?«, fragte ich alarmiert.
»Ab und zu. Als einer eurer Ausbilder muss ich schließlich darüber Bescheid wissen, ob ihr Fortschritte macht.«
Er wich scheinbar unbekümmert meinem Blick aus und ich musterte ihn interessiert von der Seite. Seit unserem Gespräch auf dem Himmelsfelsen hatte sich zwischen Lee und mir vieles geändert. Ich hatte mehr Verständnis für sein manchmal so merkwürdiges Verhalten, und er schien in mir kein dummes Menschenmädchen mehr zu sehen und nicht mehr an meiner Eignung als Trägerin zu zweifeln.
Das neu entstandene Band unseres Vertrauens war zart und reichlich instabil, doch es erfüllte mein Herz mit großer Freude. Lee hatte mich lange nicht als vollwertiges Mitglied von Team 8 akzeptiert, und das hatte mich mehr verletzt, als ich mir selbst eingestehen wollte.
»Warum hast du gezögert?«, fragte Lee plötzlich.
Ich schaute ihn irritiert an. »Was meinst du?«
»Du hättest die Akte locker an dich nehmen können, noch bevor Gedelski geschossen hat. Aber du hast gezögert. Warum?«
Nun war ich es, die seinem Blick auswich. Bisher wusste außer Kaleidos und mir niemand, wer die Füchsin in Wirklichkeit war. Ich hatte schlichtweg Angst vor den Konsequenzen, die man in der Agency ergreifen könnte, sobald die Wahrheit herauskäme. Ich befürchtete, dass man mich aufgrund des Interessenkonflikts aus dem Amt der Trägerin entlassen würde. Das wäre zwar schwierig, weil ich das Amulett aus eigener Kraft nicht mehr abnehmen konnte, aber die Agency könnte mir einfach verbieten, mich am Kampf gegen die Dunkelheit zu beteiligen.
Doch mein Bestreben, die Dunkelheit zu vertreiben, war ungebrochen. Und ich wusste tief in meinem Innersten, dass ich die Einzige war, die das überhaupt schaffen konnte. Ich hatte die Macht dieser finsteren Magie nicht nur einmal zu spüren bekommen und hegte keinen Zweifel daran, dass man ihr nur mit dem Orinion entgegentreten konnte.
Lee sah mich abwartend an, darum antwortete ich leise: »Ich musste plötzlich an Alfred denken.«
Das war zwar nur die halbe Wahrheit, aber mehr wollte ich nicht verraten. Kaleidos wandte mir leicht den Kopf zu. Wie immer schien er genau zu wissen, was gerade in mir vorging. Er missbilligte meine Entscheidung, dass ich die Sache mit meiner Mutter geheim halten wollte – auch wenn er sie akzeptierte.
Ich begann, fahrig mit meinen Fingern die Mähne des Hengstes zu glätten, während Lee mich immer noch schweigend betrachtete. Eine Windbö fuhr über die Baumwipfel hinweg und brachte das Herbstlaub um uns herum zum Tanzen. Als das sanfte Rauschen verklungen war, sagte Lee leise: »Es heißt, die Zeit heile alle Wunden. Vielleicht stimmt das sogar. Wichtig ist aber, dass man sich währenddessen nicht gänzlich in seinem Schmerz verliert.«
Ich sah auf und versank unwillkürlich in dem dunklen Blau seiner Augen. Sie wirkten warm und ganz anders, als ich es von Lee bisher kennengelernt hatte. Ohne die eiserne Kälte, die ihn sonst umgab, waren sie einfach nur umwerfend.
Seine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. »Okay, ich geb’s zu. Der Spruch ist geklaut.«
Ich unterdrückte ein Lachen. »Er klingt trotzdem schön.«
Und er klang vor allem nach Wahrheit.
KAPITEL 2
Am späten Freitagnachmittag machte ich mich nach Unterrichtsschluss auf den Weg zum Mannschaftraum von Team 8. Normalerweise pflegten Agentenanwärter keinen Kontakt zu den Special Forces, darum musste ich ihnen unter der Woche aus dem Weg gehen, um keine lästigen Fragen bei meinen Mitschülern zu erregen. Nur am Wochenende, wenn die anderen Anwärter nach Hause fuhren, durfte ich mich bei Team 8 blicken lassen.
Am Anfang hatte ich diese Regelung total irrsinnig gefunden. Wieso sollte einer meiner Mitschüler auf die Idee kommen, ich wäre die Trägerin, nur weil ich mit Agenten der Special Forces abhing? Okay, dass ich sie bei ihren Einsätzen begleitete, war schon ein bisschen verdächtig, doch das brauchte ja keiner zu wissen.
Inzwischen gab es für mich aber einen anderen Grund dafür, mein enges Verhältnis zu den Mitgliedern von Team 8 zu verheimlichen. Immerhin gehörten zwei von ihnen zu meinen Ausbildern. Eine Freundschaft zu ihnen könnte durchaus Misstrauen bei meinen Mitschülern erregen. Einmal hatte einer der Zwillinge mich außerhalb des Unterrichts mit Lee gesehen, als wir nebeneinander über den Innenhof der Agency gingen. Am nächsten Tag hatte sie mich doch tatsächlich vor der versammelten Klasse gefragt, ob ich denn meine Noten aufbessern wolle. Diese blöde Kuh! Lucy hatte mich damals gerettet. Sie hatte allen erklärt, dass es doch völlig normal sei, mit seinem Nachbarn den gleichen Heimweg zu nehmen. Die Information, dass Lee mein Nachbar war, hatte zwar auch ziemlich dämliche Blicke zur Folge, aber die hatten wohl eher einen neidischen Hintergrund.
Captain Leannán Aherra war so etwas wie ein Superstar in der Agency und sein Team 8 galt als legendär. Die Erfolgsquote bei ihren Einsätzen war unschlagbar. Mittlerweile hatte ich schon die wildesten Geschichten über die verrücktesten Einsätze gehört, die meine Freunde hinter sich gebracht hatten. Ob das alles wirklich so geschehen war, bezweifelte ich, auch wenn ich die Fähigkeiten der Team-Mitglieder nicht infrage stellte. Immerhin hatte ich ihre Einsätze nicht nur einmal live miterlebt. Aber Storys à la »Ich hab gehört, das Captain Aherra einmal ganz allein den Jet gelandet hat. Mit zwei gebrochenen Armen!« klangen tatsächlich leicht übertrieben in meinen Ohren.
Ich öffnete die Tür zu dem großen Mannschaftraum und trat ein. Erfreut stellte ich fest, dass das gesamte Team anwesend war. Sie hatten sich um den Küchentisch versammelt und betrachteten mit unterschiedlichen Mienen die Tischplatte, die gleichzeitig als großer Touchscreen fungierte. Lee stand in der Mitte und wischte mit einer Hand über den Bildschirm. Samira saß zu seiner Linken und beugte sich interessiert nach vorn. Sie zwirbelte eine Strähne ihres langen blonden Haares zwischen den Fingern und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe. Colin stand an Lees anderer Seite. Er hatte eine Hand auf die Stuhllehne vor sich gelegt und fuhr sich mit der anderen über sein helles Haar. Joe hockte neben ihm und stützte gelangweilt sein Kinn auf die Hände. Der beigefarbene Kater Ivan sah ähnlich interesselos drein. Er saß Lee gegenüber direkt auf der Tischplatte und betrachtete immer wieder die Unterseite seiner Vorderpfote.
In der schrecklichen Nacht in der Bibliothek hatte der Kater schlimme Verletzungen davongetragen, die inzwischen allerdings gut verheilt waren. Nur, wenn man genau hinsah, erkannte man, dass sein Fell an einer Stelle seines Kopfes etwas kürzer war. Dort hatte man ihn rasiert, um eine große Platzwunde zu nähen.
»Hey, Leute!«, grüßte ich salopp und setzte mich neben Samira. »Was macht ihr da gerade?«
»Wir haben Informationen zu einem geplanten Bombenattentat in den USA erhalten«, antwortete Samira.
»Zu einem möglichen Attentat«, korrigierte Lee.
Ich betrachtete die überlagerten Fenster auf dem Bildschirm, die hauptsächlich Schriftdokumente darstellten. Das Logo der amerikanischen Behörde »FBI« war auf manchen davon zu sehen. Außerdem ein roter Stempel mit den Worten »Top Secret«, was mich allerdings kaum verwunderte. Die Agency hatte in jeder Regierungsbehörde der Dortwelt die Finger im Spiel. Ein kleiner Stempel konnte sie da wahrlich nicht aufhalten.
»Der rote Orden?«, fragte ich.
Colin wiegte den Kopf hin und her. »Das versuchen wir gerade herauszufinden.« Er deutete auf eine Videodatei. »Zeig mal das hier.«
Lee vergrößerte den Ausschnitt und startete die Videosequenz. Sie war ohne Ton und zeigte den Innenraum eines amerikanischen Diners. Der Blickwinkel der Kamera ließ darauf schließen, dass es sich um eine Observation handelte. Das Zielobjekt schien ein dunkelhaariger Mann zu sein, der allein an einem Tisch saß, an einer Kaffeetasse nippte und in einer Zeitung blätterte. Als er seine Tasse abstellte, konnte man deutlich sehen, dass sein rechtes Handgelenk keine Tätowierung trug, wie sie für einen Tuatha Vorschrift war. Die Zielperson war also ein Mensch. Eine Frau mit blondem Kurzhaarschnitt näherte sich ihm und setzte sich ungefragt an seinen Tisch. Die beiden wechselten ein paar Worte, sie holte einen Umschlag aus ihrer Handtasche hervor und schob ihn dem Mann zu. Dann strich sie sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Ihre Unterarme waren von ihrer Bluse bedeckt, doch an ihrem Finger funkelte ein auffälliger Rubinring.
»Da! Sie gehört eindeutig zum roten Orden«, rief ich aufgeregt.
Das weckte Joe sofort aus seiner Langeweile. »Na, dann schnappen wir sie uns doch gleich!«
Lee bremste ihn in seinem Eifer. »Nicht so schnell …«
Die Frau in dem Video stand auf und verschwand aus dem Blickfeld der Kamera. Der Mann trank seinen Kaffee aus, klappte die Zeitung über dem Umschlag zusammen und ging ebenfalls davon. Die Kamera drehte sich und folgte dem Mann hinaus aus dem Restaurant auf einen überfüllten Gehweg.
Lee stoppte das Video. Er schob das Fenster auf dem Tisch zur Seite und vergrößerte stattdessen ein Schriftstück des FBI, auf dem das Profilbild der Frau zu sehen war. Hastig überflog er die Zeilen und fasste den Text für uns zusammen: »Deborah Flint, 38, ledig. Bis auf drei kleine Verkehrsdelikte sind hier keine Straffälligkeiten verzeichnet. Sie arbeitet als pharmazeutische Assistentin in einem hämatologischen Labor … und wird seit diesem Video rund um die Uhr überwacht. Bisher konnte das FBI jedoch keine Verbindung zu der Terrorgruppe feststellen.«
Ich unterbrach ihn stirnrunzelnd. »Sie arbeitet in einem Labor und hat dem Kerl gerade einen Umschlag zugesteckt. Das soll keine Verbindung sein?«
»Solange niemand weiß, was in dem Umschlag war – Nein.« Lee wischte zu einem anderen Schriftdokument. »Uns reicht das nicht für einen Zugriff aus. Die Agency vor Ort hat diese Frau ebenfalls unter Beobachtung gestellt. Das bedeutet also, wir müssen abwarten.«
»Abwarten?« Ich blies die Backen auf. »Sie gehört zum roten Orden!«
»Sie trägt einen Rubinring«, erwiderte Lee trocken. »Manche Leute tun das allein aus modischen Gründen.«
Ich schüttelte fassungslos den Kopf.
»Sie steht unter Beobachtung«, sagte Colin und lächelte mir aufmunternd zu. »Sollte sie tatsächlich dem roten Orden angehören, werden wir es sicher bald erfahren. Mehr können wir bis dahin nicht tun, sonst würden wir gegen die Kardische Konvention verstoßen.«
Wieder eine dieser dämlichen Regeln der Anderswelt. Laut der Kardischen Konvention durfte die Agency nur in die Angelegenheiten der Dortwelt eingreifen, wenn auch die Anderswelt von der dortigen Bedrohung betroffen war. Was die normalen Menschen in ihrer Welt alles trieben, ging nur die Menschen selbst etwas an. Dass die Agency mit ihrer weit überlegenen Technologie sie in vielen schwierigen Situationen unterstützen könnte, war dabei egal.
Lee tippte ein paarmal auf den Bildschirm und beendete die Projektion. Die Sache galt also hiermit als erledigt. Ich lehnte mich schweigend zurück. Der General hatte eine Sonderkommission eingerichtet, die einzig damit beschäftigt war, in alten Schriftstücken und anderen Überlieferungen nach Informationen über den Feuergeist zu suchen. Solange die Kommission keinen Hinweis fand, dem Team 8 nachgehen konnte, lebten die Special Forces ihren ganz normalen Alltag. Meine Mitschüler stellten sich diesen immer so spannend und aufregend vor, dabei war er in Wahrheit oft zermürbend langweilig. Den größten Teil des Tages verbrachten sie damit, auf einen Auftrag zu warten, der ihnen dann von null auf hundert so ziemlich alles abforderte.
Samira stand auf, um sich Kaffee zu holen, und Ivan sah mich an, als hätte er jetzt erst meine Anwesenheit bemerkt.
»Lange nicht gesehen, Jay«, sagte er mit seinem russischen Akzent. »Wie war deine Woche?«
»Unspektakulär«, antwortete ich schulterzuckend.
Joe nickte. »Das klingt, als hättest du häufig Pflanzenkunde gehabt.«
Lee warf ihm einen scharfen Blick zu.
Joe lachte herzhaft auf. »Sorry, Mann! Ich kann auch nichts dafür, dass du ausgerechnet das ödeste Fach der Agentenausbildung unterrichtest.«
»Öde?«, schnappte Lee.
»Ach, komm schon. Für jemanden ohne Garróiar-Begabung ist der Stoff echt trocken. Ich meine – Zellstruktur und Harzverbindungen? Da hat Colin im Kampftraining schon mehr zu bieten.«
Colin hob abwehrend die Hände. »Hey, zieh mich da nicht mit rein, ja?«
Ich gluckste amüsiert und meinte versöhnlich: »Na ja, Pflanzenkunde ist wirklich sehr theoretisch. Aber es ist schon erstaunlich, wie viel Heilwirkung man durch eine einfache Handhabung von Kräutern erzielen kann. Das Thema ist gar nicht so uninteressant.«
»Das hätte ich auch gesagt, wenn mein Ausbilder vor mir stehen würde«, scherzte Joe augenzwinkernd.
Samira kehrte mit einer dampfenden Kaffeetasse zurück an den Tisch und setzte sich wieder neben mich. »Du hast bald dein erstes Praktikum, oder? Wofür wurdest du eingeteilt?«
»In der Administration. Ein- und Ausreiseverwaltung.«
Sofort verzogen alle Anwesenden mitfühlend das Gesicht – sogar Lee, der sich bei solchen Dingen normalerweise zurückhielt. Joe und Ivan gaben ein mitleidiges Seufzen von sich.
Erschrocken blickte ich in die Runde. »Äh, was soll das denn heißen?«
Joe hüstelte verhalten. »Im Vergleich zur Ein- und Ausreiseverwaltung ist Pflanzenkunde der reinste Actionfilm.«
»Ja, die Verwaltung ist unfassbar langweilig«, bestätigte Ivan.
Colin und Lee nickten. Nur Samira lenkte tröstend ein: »Aber halb so schlimm. Für unseren Geschmack ist wohl alles, was mit Administration zu tun hat, langweilig. Den ganzen Tag am PC sitzen und Formulare ausfüllen, ist eben nichts für uns. Wir sind ja nicht umsonst bei den Special Forces. Aber es gibt genügend Leute, denen diese Art von Arbeit Spaß macht. Und das ist auch gut so, denn ohne Verwaltung würde unser gesamtes System nicht funktionieren.«
Dieses Gespräch konnte meine Vorfreude auf die Praktikumswoche nur leicht trüben. Ich war nämlich der gleichen Abteilung wie Lucy zugewiesen worden. Egal was uns dort erwartete, gemeinsam würden wir uns schon die Zeit vertreiben.
Ivan und Joe verließen die Tischrunde und plumpsten nur wenige Schritte weiter auf die gemütliche Couch. Samira saß mit überschlagenen Beinen neben mir und startete ihr Glassboard, ein durchsichtiges Tablet, um sich die neuesten Herbstmodetrends anzusehen. Lee und Colin hatten sich unterdessen an den Tisch gesetzt und unterhielten sich über die Ermittlungen der Sonderkommission »Fangor«.
Ich hörte den beiden interessiert zu. Die Füchsin hatte nur aus dem Hochsicherheitstrakt entkommen können, weil jemand den inhaftierten Fangor freigelassen hatte. Ein Fangor war ein reptilienartiges Geschöpf, das Säure spucken konnte. Dieses wilde Tier hatte in seiner Wut und Verzweiflung beinahe den gesamten Hochsicherheitstrakt in Schutt und Asche gelegt, sobald sich die Tür zu seiner Zelle geöffnet hatte.
Der Fluchtplan der Füchsin war perfekt und bis ins kleinste Detail durchdacht gewesen. Und das Ganze hatte nur funktioniert, weil sie Unterstützung von einem Mitarbeiter der Agency gehabt hatte. Jemand musste einen Zeitzünder an der Zellentür des Fangors angebracht haben.
Und das erschreckte nicht nur mich zutiefst, sondern lag wie ein Schatten über der gesamten Agency.
Ein Verräter innerhalb der eigenen Reihen! Lee hatte bereits nach dem Hinterhalt auf Sizilien, bei dem Samy entführt worden war, diesen Verdacht geäußert, doch nun war es traurige Gewissheit. Bisher gab es keinen Hinweis darauf, wer der Verräter war oder in welcher Abteilung man nach ihm suchen musste. Jeder kam infrage, vielleicht sogar mehrere Agency-Mitarbeiter.
Die Sonderkommission »Fangor« versuchte, genau das herauszufinden. Sie arbeiteten rund um die Uhr und überprüften jeden einzelnen Mitarbeiter der Agency bis ins kleinste Detail.
»Letzte Woche haben sie mit den Befragungen angefangen«, erzählte Lee. »Ich schätze, wir sind auch bald dran.«
»Befragungen?«, fragte ich neugierig.
»Jeder Mitarbeiter muss zu einem Gespräch mit einem Wahrheitsfinder ersten Grades«, erklärte Colin. »Die ausgewählten Wahrheitsfinder wurden vorher selbst eingehend überprüft, um eine Verbindung zum roten Orden auszuschließen. Darum hat es so lange gedauert, bis die Befragungen starten konnten.«