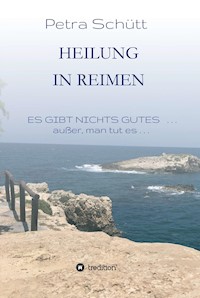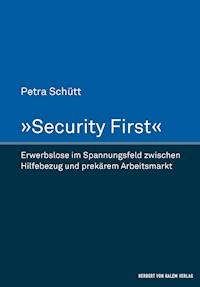
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der Einführung der "GeSetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" erfolgte eine Neuausrichtung des Sozialstaatsmodells vom versorgenden Wohlfahrts- zum Aktivierungsstaat. Diese Transformation des Sozialstaats wird mittels sog. "Work-first"-Programme umgeSetzt, deren Primärziel eine möglichst schnelle Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt ist. In dieser empirischen Arbeit wird gezeigt, wie Erwerbslose den ALG-II-Bezug aktiv, aber eigenwillig als Sicherheitsressource interpretieren und nutzen. Mit der Handlungsstrategie "Security first" wird nicht eine möglichst schnelle, sondern eine möglichst stabile Integration ins Erwerbssystem verfolgt. Es handelt sich um eine eigenverantwortliche Priorisierung von individueller Sicherheit, die dazu dient, die Risiken eines prekären Arbeitsmarkts unter Bedingungen zunehmender Subjektivierung zu begrenzen. Die vorliegende Untersuchung bietet die Grundlage für eine politische Debatte, die jenseits von "Schuldzuweisungen" gegenüber erwerbsfähigen Hilfebedürftigen anSetzt, welche zumeist auf moralisierenden Unterstellungen von defizitären Persönlichkeitsmerkmalen und geringer Erwerbsorientierung basieren. Die Ergebnisse zeigen, wie der Hilfebezug als wichtige Ressource genutzt wird, um bei hoher Eigenverantwortlichkeit und ausgeprägter Erwerbsorientierung auch weiterhin individuell das Ziel der Arbeitsmarktintegration zu verfolgen. Aber: Arbeit nicht um jeden Preis – "Security first"!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als Dissertation 2014 an der Universität Erlangen-Nürnberg (DE-29) angenommen.
Mit freundlicher Unterstützung der Ilse und Dr. Alexander Mayer-Stiftung an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Für Lina und Jürgen
Inhalt
Vorwort und Danksagung
1. Einleitung
1.1 Ausgangsfrage und Zielsetzung
1.2 Vorgehen und Aufbau der Arbeit
1.3 Hintergrund: Evaluationsforschung zum SGB II
2. Der Systemwandel der sozialen Sicherung
2.1 Historische Entwicklung der Armuts- und Arbeitslosenforschung in Deutschland
2.1.1 Vergesellschaftung und soziale Sicherung über Lohnarbeit
2.1.2 Ursachenforschung jenseits (fehlender) Arbeitsmoral und Wirkungsforschung
2.1.3 Neue Perspektive seit den 1980er Jahren
2.2 Die Reformen des SGB: Vom Sozialstaat zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat
2.2.1 Paradigmenwechsel im System der sozialen Sicherung
2.2.2 Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“: Aktivierung zu Eigenverantwortung und Beschäftigungsfähigkeit
2.2.3 Hartz IV: Umsetzung von „Fördern und Fordern“
2.2.4 Entwicklung von Leistungsbezug und Erwerbstätigkeit im SGB II
2.3 Erkenntnisse der Hartz-IV-Wirkungsforschung
2.3.1 Vermittlung als Dienstleistung: Spannungsverhältnis zwischen Unterstützung und Zwang
2.3.2 „Fördern“ aus Sicht der Geförderten
2.3.3 Teilhabedimensionen Bildung, Nahbeziehungen und Gesundheit im ALG-II-Bezug
2.3.4 Zusammenfassung: Ergebnisse der Wirkungsforschung
2.4 Konkretisierung der Fragestellung und Zielgruppe
3. Die Untersuchung begleitende „Sensitizing Concepts“
3.1 Subjekt als Forschungsgegenstand: Eine Begriffsbestimmung
3.2 Subjektivierung … ist überall
3.2.1 Subjektivierung von Arbeit
3.2.2 Subjektivierung als Regierungstechnik
3.2.3 Subjektivierung von Arbeitslosigkeit
3.3 Lebenslagen- und Capability-Ansatz
3.4 Zusammenfassung
4. Methodendesign und Empirie
4.1 Subjektorientierte Sozialforschung
4.2 Grounded Theory: Forschungsprogramm und Auswertungsmethode in einem
4.2.1 Erkenntnisinteresse und Forschungsprozess in der Grounded Theory
4.2.2 Emergenz einer Forschungsfrage
4.2.3 Auswertung nach der Grounded Theory
4.3 Empirische Basis: Qualitative Panelstudie im Zusammenhang mit der SGB-II-Einführung
4.3.1 Samplingverfahren
4.3.2 Erhebungsmethoden: Biografisch-narrative Interviews und Beobachtung
4.4 Die Studie „Security first“: Fallauswahl, Sample, Auswertung
4.4.1 Vorgehen bei der Fallauswahl
4.4.2 Sample „Security first“
4.4.3 Auswertungsschritte
4.5 Gütekriterien der qualitativen Untersuchung
5. Ergebnisse
5.1 Einzelfalldarstellung: Fallbeschreibungen und Auswertungen…………
5.1.1 Fall 1: Herr Mahin
5.1.2 Fall 2: Herr Schultze
5.1.3 Fall 3: Frau Mindels
5.1.4 Fall 4: Frau Hoxana
5.1.5 Fall 5: Frau Keller
5.1.6 Zwischenfazit
5.2 Lebensverhältnisse und deren subjektive Wahrnehmung
5.2.1 Kontextbedingungen
5.2.2 Intervenierende Bedingungen: Grundsicherung und Erwerbssystem
5.2.3 Fazit: Geringe Autonomiespielräume und Prekarität
5.3 „Security first“: Individuelle Handlungsstrategie im Umgang mit Unsicherheit
5.3.1 Erleben von Hilflosigkeit und deren Verarbeitung
5.3.2 Handlungsziel: Stabilität und Sicherheit
5.3.3 Orientierungen bei „Security first“
5.3.4 Funktionen von „Security first“
5.4 Handlungsstrategie „Security first“: Ein Fazit
6. „Security first“ als Verarbeitung und Ausdruck einer Subjektivierung sozialer Sicherheit? Fazit und Ausblick
6.1 Handlungsstrategie „Security first“: Einblick
6.2 Implikationen für weitere Forschungsarbeiten: Ausblick
6.3 Schlussfolgerungen für die Arbeitsmarktpolitik: Weitblick?
Literatur
Vorwort und Danksagung
Dieses Buch ist aus meiner Dissertation entstanden, die an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg unter dem Titel „Security first. Handlungsstrategien zur Bewältigung von Unsicherheiten und Risiken im SGB-II-Leistungsbezug“ eingereicht wurde. Die empirischen Grundlagen für diese Arbeit sind im Rahmen eines Forschungsprojekts am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF München) entstanden. Es handelt sich um ein Teilprojekt der Studie „Armutsdynamik und Arbeitsmarkt: Entstehung, Verfestigung und Überwindung von Hilfebedürftigkeit bei Erwerbsfähigen“. Dieses Gesamtprojekt wurde vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) konzipiert, finanziert und koordiniert. Am Auswertungsschwerpunkt „Kompetenzen, Arbeitsvermögen und Arbeitsorientierung“ des ISF München waren Prof. Dr. Sabine Pfeiffer, Dr. Anne Hacket, Tobias Ritter und ich beteiligt. Neben dem Forschungsteam am ISF München verfolgten das IAB sowie das Hamburger Institut für Sozialforschung eigene Fragestellungen.
Im Laufe des Entstehens dieser Arbeit haben mich viele Kolleginnen und Kollegen unterstützt, bei denen ich mich an dieser Stelle bedanken möchte.
Ein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Rainer Trinczek, der die Arbeit wohlwollend und äußerst kompetent unterstützt hat und mir großen Freiraum gewährte. Ausdrücklich möchte ich mich bei meinem Kollegen und Zweitgutachter Prof. Dr. Hans J. Pongratz für die gewinnbringende Betreuung und konstruktiven inhaltlichen Diskussionen sowie die geschaffenen Freiräume bedanken. Ein akademischer Geburtshelfer im allerbesten Sinne!
Besonders herzlich bedanke ich mich bei meiner Kollegin Prof. Dr. Sabine Pfeiffer für ihre bestärkende und ermutigende Unterstützung. Ihr verdanke ich wichtige Impulse durch die jahrelangen gemeinsamen Forschungsarbeiten, konzeptionellen Überlegungen und inhaltlichen Diskussionen. Ebenso bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Projektteams am ISF München, Dr. Anne Hacket und Tobias Ritter, für die anregende und rundum kollegiale Zusammenarbeit.
Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), speziell den Kollegen PD Dr. Markus Promberger, Leiter des Forschungsbereichs „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“, und Dr. Andreas Hirseland, Projektleiter am IAB, danke ich für das Überlassen der Daten für dieses Vorhaben.
Bei Natalie Grimm vom Hamburger Institut für Sozialforschung bedanke ich mich für die wertvollen Diskussionen und Anregungen während unserer zahlreichen gemeinsamen Arbeitsphasen.
Frank Seiß danke ich für sein umsichtiges und fundiertes Lektorat, Karla Kempgens für die Erstellung des Endlayouts und Endformatierung der Abgabefassung. Ebenso danke ich Lisa Ruedel für ihre enorme Hilfsbereitschaft, wenn es um das nicht zu unterschätzende „Drumherum“ geht. Bei Frau Rothländer vom UVK Verlag möchte ich mich für die nette und umsichtige Betreuung bedanken. Der Ilse und Dr. Alexander Mayer-Stiftung an der Universität Erlangen-Nürnberg danke ich für den Druckkostenzuschuss.
Ebenso bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen am ISF München. Sie alle tragen dazu bei, dass am ISF München Raum für eigenständiges, unabhängiges wissenschaftliches Arbeiten ist. Speziell möchte ich mich bei Dr. Hans Gerhard Mendius, Daniela Wühr und Lisa Abbenhardt für die jeweils lehrreiche und fruchtbare Zusammenarbeit bedanken. Für anregende Diskussionen und ihre freundschaftliche Unterstützung danke ich auch Anja Bultemeier.
Last but not least gilt mein ganz besonderer Dank den Interviewpartnern und -partnerinnen, die mit ihrer unglaublichen Offenheit und mit einem enormen Vertrauensvorschuss Einblicke in ihr Leben, ihre Wünsche, Hoffnungen und Deutungen der Welt gewähren. Diese Begegnungen waren für mich nicht nur als Wissenschaftlerin eine Bereicherung.
München, Juli 2014
Petra Schütt
1. Einleitung
Die Reformen der sozialen Sicherungssysteme der Bundesregierung, die auf den Vorschlägen der Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit aus dem Jahr 2002 (Hartz et al. 2002) beruhten, haben unter anderem die Bedingungen des Hilfebezugs und die Zusammensetzung der Unterstützungsempfänger_innen neu geregelt. Durch die Zusammenlegung der früheren Sozialhilfe mit der Arbeitslosenhilfe zur neuen Grundsicherung im Sozialgesetzbuch II (SGB II, auch Hartz IV, ALG2 oder ALG II) sehen sich die Bezieherinnen und Bezieher von Unterstützungsleistungen nach dem SGB II mit dem neuen Credo „Fördern und Fordern“ konfrontiert. Die Ergebnisse aus der begleitenden Evaluationsforschung der sogenannten Hartz-IV-Reformen zeigen, dass
„den Arbeitsvermittlern […] eine bestimmte Figur des Arbeitslosen vor Augen [schwebt], die sich durch flexible Anpassung an die Anforderungen des Arbeitsmarktes, Bereitschaft zu beruflicher (Abwärts-)Mobilität und Orientierung an bestimmten Standards der Selbstpräsentation auszeichnet. Im Idealfall bringen Arbeitslose diese Eigenschaften und Fähigkeiten bereits mit, in vielen Fällen fehlen sie aber. Hier ist es Aufgabe der Vermittler, an der Herstellung der entsprechenden Verhaltensweisen bei den Arbeitslosen zu arbeiten.“ (Ludwig-Mayerhofer et al. 2007, S. 12)
An diese Überlegungen schließt die vorliegende Untersuchung nun an und versucht sie zu präzisieren. Wie es scheint, orientieren sich die realen Anforderungen an Verhalten und Einstellungen von Arbeitslosen an einer bestimmten, idealtypisch formulierten Sozialfigur. Eine Ausgangsthese dieser Untersuchung ist, dass im Zuge der SGB-II-Reformen die Sozialfigur des Arbeitskraftunternehmers (vgl. Voß und Pongratz 1998) als reale Messlatte für die erwartete und eingeforderte Erwerbsorientierung sowie Erhöhung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit von sogenannten Hartz-IV-Empfänger_innen dient. Der Arbeitskraftunternehmer bezeichnet einen gesellschaftlich neuen Leittypus von Arbeitskraft, der eine Ausrichtung der Lebensführung an den Prämissen Selbstökonomisierung, Selbstkontrolle, Selbstrationalisierung impliziert, um die eigene Arbeitskraft am Arbeitsmarkt, quasi als Unternehmer in eigener Sache, zu erhalten, zu vermarkten und zu verkaufen. Menschen im Leistungsbezug des SGB II sehen sich also mit erhöhten Anforderungen an ihre Handlungs- und Lebensplanungsfähigkeit bei gleichzeitiger Unsicherheit über die weitere (berufliche) Zukunft konfrontiert.
In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die Menschen mit diesen Anforderungen im Rahmen von „Fördern und Fordern“ umgehen, wie sie diese deuten und verarbeiten. Dabei geht es auch darum zu klären, welche Ressourcen den Menschen zur Bewältigung der Herausforderung des Selbstmanagements und der Herstellung von Arbeitsmarktgängigkeit zur Verfügung stehen.
Klar formuliertes Ziel der Reformen ist es, dass Menschen im ALG-II-Bezug ihren „Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können“ (§ 1 SGB II). Zur Erreichung dieser Zielvorgabe werden arbeitsmarktpolitische Instrumente und Maßnahmen eingesetzt, die zur Erhöhung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit von Menschen im ALG-II-Bezug beitragen sollen. Implizit bedeutet die Forderung nach einer Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit von arbeitslosen Menschen zum einen eine Defizitunterstellung dergestalt, dass die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen im SGB-II-Leistungsbezug für eine erfolgreiche Integration am Arbeitsmarkt nicht ausreichend sei. Zum anderen unterstellt sie, dass Beschäftigungsfähigkeit eine individuelle Eigenschaft von Menschen sei, deren Ausbildung in den Händen jedes Individuums liege, ebenso wie die entsprechende Verantwortlichkeit (vgl. Kraus 2008, S. 7). Die neue Formel für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt klingt simpel: Arbeitslose müssen ihre individuelle Ware „Arbeitskraft“ nur marktgerecht herstellen, dann – in Anlehnung an einen Werbeslogan –klappt’s auch auf dem Arbeitsmarkt.
Dahinter verbirgt sich die Forderung, dass die gesamte Lebensführung von erwerbsfähigen Arbeitslosen auf eine möglichst schnelle (Re-)Integration ins Erwerbsleben ausgerichtet sein soll. Auch wenn dabei spezifische Belastungsmomente (z.B. psychosoziale Notlagen, Verschuldung etc.) nicht negiert werden, so wird doch ein passives Verbleiben in Arbeitslosigkeit nicht (mehr) akzeptiert, vielmehr wird an die Arbeitslosen appelliert, das unternehmerische Potenzial in sich selbst zu aktivieren. In den Medien gibt es parallel zu dieser Anforderung zumindest phasenweise einen Diskurs, in dem Hartz-IV-Empfänger_innen als „neue Unterschicht“ und als „arbeitsscheu, dumm, fettleibig, fernsehsüchtig, antriebslos, bewegungsfeindlich usw.“ (Danilina et al. 2008, S. 14) (dis)qualifiziert werden. Auch damit müssen sich Hilfeempfänger_innen auseinandersetzen. Die wohlfahrtsstaatliche Interventionspraxis zielt nach Ansicht von Danilina nicht auf die Veränderung der sozialen Verhältnisse, sondern auf eine Persönlichkeitserziehung, die Leistungswillen und Selbstdisziplinierung als Voraussetzung von Arbeitsfähigkeit einfordert (vgl. Danilina et al. 2008, S. 15). Sowohl diskursiv als auch mittels normativer Regelungen wird von arbeitslosen Subjekten die Formierung eines „unternehmerischen Selbst“ (vgl. Bröckling 2007) eingefordert, dessen warenförmige Ausprägung in der Sozialfigur des Arbeitskraftunternehmers von Voß/Pongratz (1998) seine Entsprechung findet. Die damit verbundene Re- und Neu-Formierung auf der Subjektebene erfordert Subjektivierungsprozesse, wie sie bezogen auf die Arbeitswelt unter dem Begriff der „Subjektivierung von Arbeit“ diskutiert werden. Den dort ausgemachten Subjektivierungsprozessen wird attestiert, dass sie einerseits tief im Subjekt, die Rede ist von der „inneren Landnahme“ (vgl. Dörre 2009b, S. 37), und andererseits auf institutioneller Ebene wirken. Der Begriff der „inneren Landnahme“ beschreibt eine Form der kapitalistischen Verwertung von Arbeitskraft, die zunehmend auch auf jene Aspekte des Subjekts zurückgreift, die sich diesem ökonomischen Verwertungsprozess der menschlichen Arbeitskraft bisher entzogen haben. Dieses subjektgebundene Arbeitsvermögen (vgl. Pfeiffer 2004) ist einem ökonomischen Verwertungszugriff von außen nicht vollständig zugänglich. Die Ausweitung des Ökonomisierungsprozesses auf immer mehr Aspekte des Selbst kann nur in und von den Subjekten selbst vollzogen werden. Auf institutioneller Ebene werden diese Subjektivierungsprozesse durch Prozesse der Kommodifizierung von Arbeitskraft unterstützt und befördert (vgl. Polanyi 2001 [1944]).
Arbeitslosigkeit wird oft wie die andere Seite von Erwerbsarbeit behandelt. Diskursiv herrscht noch immer das Leitbild einer „Normalerwerbsbiografie“ (vgl. Kohli 1985) vor, obwohl die aktuelle Forschung zum Wandel von Arbeit zeigt, dass dieses Leitbild längst erodiert. Biografien sind in modernen Gesellschaften häufig Friktionen, Diskontinuitäten und Prozessen von Entgrenzung unterworfen (vgl. u.a. Dörre et al. 2008b; Kratzer 2003; Vogel 2009). Trotz der faktischen Brüchigkeit dieses Leitbildes und vieler Erwerbsbiografien werden Arbeitsuchende in einer dichotomen Betrachtung von „drinnen“ und „draußen“ vielfach jenseits der Erwerbsgesellschaft positioniert. Konzeptuell wird zwar durchaus die Frage gestellt, ob Arbeitslosigkeit Teil einer Erwerbsbiografie oder jenseits davon zu sehen ist (vgl. Schütt et al. 2009). In der Forschung werden diese beiden Sphären jedoch meist noch getrennt betrachtet. Für die arbeitslosen Subjekte stellt sich diese Frage allerdings nur bedingt. Ob gewollt oder ungewollt, Arbeitslosigkeit ist Teil der eigenen Erwerbsbiografie. Den Individuen bleibt es selbst überlassen, wie sie Phasen von Arbeitslosigkeit in die eigene Erwerbsbiografie integrieren – oder ob sie dies bleiben lassen und nicht-arbeitsorientierte Lebenskonzepte verfolgen, evtl. gar als Akt von Widerständigkeit (vgl. Bescherer et al. 2009, S. 150). Die Aufgabe der Herstellung einer Erwerbsbiografie wird erschwert, da es an den Rändern der Arbeitswelt manchmal an Eindeutigkeit von Zuständen mangelt. Bin ich noch erwerbslos oder schon erwerbstätig, wenn ich ein Einkommen habe, bei dem ich zusätzlich auf staatliche Grundsicherung angewiesen bin? Bin ich noch im Erwerbsleben oder bereits außerhalb, wenn das nächste befristete Leiharbeitsverhältnis bereits fix ist und der Wechsel der eigentliche Dauerzustand ist?
Diese Fragen verdeutlichen die enge Wechselbeziehung zwischen den Sphären von Erwerbsarbeit und Arbeitslosigkeit sowohl auf der Subjektebene als auch auf institutioneller und normativer Ebene. Wir leben nicht in einer Gesellschaft jenseits von Erwerbsarbeit; Erwerbsarbeit ist nach wie vor Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlich normativ strukturierten Lebensverlaufs. Ausdruck dieser engen Verwobenheit von Arbeitsmarkt und sozialpolitischer Gestaltung ist die im Zuge der SGB-II-Reformen vollzogene Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe (vgl. auch Abschnitt 2.2.3) und die damit eingeführte enge Verzahnung von Grundsicherung und arbeitsmarktbezogener Aktivierung: Alle Bezieher_innen von staatlichen Unterstützungsleistungen nach dem SGB II, die mindestens drei Stunden am Tag einer Erwerbsarbeit nachgehen können, sind erwerbsfähig, aktivierbar und arbeitsuchend.1 Diese Menschen müssen sich immer wieder mit Fragen auseinandersetzen, die sich um die Integration in den ersten Arbeitsmarkt drehen: Wie komme ich wieder rein ins Arbeitsleben? Und: Warum bin ich noch immer nicht drinnen?2
Die überwiegend konzeptionell getrennte Behandlung von Arbeits- und Arbeitslosenforschung – auch in der subjektorientierten Forschung – wird den oben beschriebenen Veränderungsprozessen oft nicht mehr gerecht. Auf der Ebene des Subjekts sind diese Sphären nur analytisch trennbar. Beide Erfahrungswelten sind auf verschiedenen Ebenen wirksam und sowohl deutungs- als auch handlungsrelevant.
Aus diesem Grund zieht diese Untersuchung den Schluss, sowohl Konzepte der Arbeitsforschung als auch der Arbeitslosenforschung anzuwenden. Aus der Arbeitsforschung finden Konzepte wie das des Arbeitskraftunternehmers (vgl. Voß und Pongratz 1998) und das des Arbeitsvermögens (vgl. Pfeiffer 2004) als Analyseinstrumente zum Verstehen von erwerbsbiografischen Handlungs- und Deutungsmustern von Langzeitarbeitslosen Eingang in die Studie. Neben der Armuts- und Arbeitslosenforschung sind ebenso der Lebenslagen- sowie der Capability-Ansatz, die in der Tradition soziologischer Biografie- und Ungleichheitsforschung stehen, als sogenannte „Sensitizing Concepts“ einbezogen. Die Nutzung aktueller Konzepte der Arbeitsforschung scheint fruchtbar, da diese den Wandel und die veränderten Bedingungen in Erwerbsarbeit wie zunehmende Unsicherheit, steigende Anforderungen an Flexibilität und Mobilität auf der Angebotsseite sowie Vermarktlichung der Arbeitsbeziehungen empirisch erfassen und konzeptionell verarbeiten. Denn vergleichbare Anforderungen werden als Folge der Hartz-Reformen auch an Arbeitslose gestellt, da der Prozess der Überwindung von Hilfebedürftigkeit in den Fokus geraten ist und Arbeitslosigkeit, unter Rückgriff auf das „adult worker model“3, nun als temporäres Ereignis innerhalb einer Erwerbsbiografie verhandelt wird. Des Weiteren scheint es gerade vor dem Hintergrund zunehmend diskontinuierlicher Erwerbsverläufe sinnvoll, Konzepte der Arbeitsforschung auf Phasen von Nichterwerbstätigkeit anzuwenden und deren Erklärungskraft somit für die gesamte Erwerbsbiografie nutzbar zu machen (vgl. Pfeiffer et al. 2006, S. 7–11; Pfeiffer et al. 2009). Die Debatten um Entgrenzung, Subjektivierung und Entberuflichung finden zwar vor dem Hintergrund vorhandener Erwerbsarbeit statt (vgl. Kratzer 2003; Kratzer und Sauer 2005; Pongratz und Voß 2003a; Severing 2001; Drinkuth 2007), auf der Phänomenebene ist aber auch der Raum von fragiler (prekärer) oder nicht mehr gegebener Teilhabe an Erwerbsarbeit betroffen (vgl. Castel und Dörre 2009; Schütt et al. 2009). Eine Ausgangsannahme der Untersuchung ist es, dass die Ähnlichkeit der adressierten Sozialfiguren, auf der einen Seite selbstverantwortliche, unternehmerische Arbeitslose (vgl. Bröckling 2007) und auf der anderen Seite die Sozialfigur des „Arbeitskraftunternehmers“, nicht zufällig ist. Sie entsteht aus systemimmanenten Interdependenzen von Wohlfahrtsstaat und Arbeitsmarkt und ist einem sich auf immer mehr Teilbereiche ausweitenden Ökonomisierungsdiktat moderner kapitalistisch verfasster Gesellschaften geschuldet. Dem wird auf theoretischer Ebene unter Rückgriff auf die Ausführungen von Michel Foucault zu Subjektivierung und Governmentalität Rechnung getragen (vgl. Foucault 1991, 2000a; Lemke et al. 2000, 2001; Bröckling 2007; Menz 2009). Mit Bezug auf Judith Butler und Louis Althusser wird ein besonderes Augenmerk auf die Analyse der subjektiven Verarbeitung der Aktivierungsrhetorik gelegt (vgl. Butler 2001; Alkemeyer und Villa 2010; Villa 2011). Denn Grundlage und Voraussetzung der Herstellung von Arbeitskraft ist auch die „richtige“ Deutung der diskursiven Aktivierung des „unternehmerischen Selbst“ bzw. der Arbeitskraftunternehmerin. Diese theoretischen Folien dienen dazu, ein tieferes Verständnis der Beziehung von Macht und Subjekt sowohl bezogen auf den Wohlfahrtsstaat als auch auf den Arbeitsmarkt zu erlangen, deren wechselseitige Beziehung auf der Ebene der Subjekte zu fassen und damit neben den Wirkmechanismen von Subjektivierungsanforderungen und Selbst-Technologien auch die Produktion von Eigensinn in den Blick nehmen zu können.
1.1 Ausgangsfrage und Zielsetzung
Für diese Untersuchung ist die Annahme konstitutiv, dass im Rahmen der Arbeitsmarktreformen Arbeitslose aufgefordert werden, eine Form der Arbeitsmarktgängigkeit und Marktausrichtung zu entwickeln, wie sie der Sozialfigur des „Arbeitskraftunternehmers“ (Voß und Pongratz 1998) entspricht.4 Die empirische Untersuchung zielt auf den Zusammenhang zwischen der regierungsprogrammatischen Anforderung an Arbeitslose, sich wie Arbeitskraftunternehmer am Arbeitsmarkt zu verhalten, und deren subjektivem Vollzug – oder eben auch Nicht-Vollzug – durch erwerbsfähige Arbeitslose. Dabei wird davon ausgegangen, dass Subjekte diskursiv erzeugt werden und als solche Wirkung entfalten. Die Forschungsfrage konzentriert sich darauf, was die diskursiv angesprochenen Subjekte mit diesen Anforderungen machen, wie sie diese erleben und umsetzen (vgl. Keller et al. 2012, S. 14). Insofern soll die empirische Untersuchung einen Beitrag „zum subjektiven Niederschlag“ (Künkler 2008, S. 43) unternehmerischer Anforderungen leisten. Konkret wird die subjektive Perspektive von Langzeitarbeitslosen mittels biografisch-narrativer Interviews in den Blick genommen.
Im Mittelpunkt steht die Binnensicht der Adressaten der Arbeitsmarktreformen nach dem SGB II: Wie sieht die Alltagswirklichkeit von Hilfebeziehern aus? Wie deuten sie ihre Lage, welche Konsequenzen ziehen sie daraus? Wie schätzen die Arbeitslosen selbst diese Situation ein? Welche Erklärungsmuster haben sie? Wie reagieren sie auf das System des Förderns und Forderns? Wie reagieren sie auf die Anforderungen von Selbstverantwortlichkeit und Eigeninitiative unter Bedingungen von zunehmender Unsicherheit? Welche Handlungsspielräume sehen sie für sich? Sind sie in der Lage, nicht nur den gestiegenen Mobilitäts- und Flexibilitätsansprüchen zu begegnen, sondern auch die damit einhergehenden subjektiven (Un-)Sicherheitskonstellationen lebensweltlich und biografisch zu bewältigen?
1.2 Vorgehen und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit lässt sich in drei größere Abschnitte unterteilen, einen Teil, der den konzeptionellen Zugang zum Forschungsgegenstand umreißt (Kapitel 2 und 3), einen methodischen Teil zur Erläuterung des Zugriffs auf das Material und der Auswertungsschritte (Kapitel 4) sowie den empirischen Hauptteil, in dem die Ergebnisse dargelegt werden (Kapitel 5).
Im konzeptionellen Teil der Arbeit wird die Armuts- und Arbeitslosenforschung in ihrer historischen Entwicklung vorgestellt, um die Veränderungen der gesellschaftlichen und soziologischen Betrachtung von Arbeitslosigkeit nachzuzeichnen: von einer anfänglichen Unterstellung fehlender Arbeitsmoral über den Blick auf die Wirkung von Arbeitslosigkeit hin zu einer dynamischen Betrachtung von Arbeitslosigkeit im Verlauf einer Biografie (2.1). Daran anschließend wird näher auf den Wandel vom aktiven zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat eingegangen, sowohl auf programmatischer als auch auf normativer Ebene. Ebenso wird die Entwicklung des Leistungsbezugs und der Erwerbstätigkeit seit der Einführung des SGB II vorgestellt (2.2). Wichtige Ergebnisse der begleitenden Evaluierungsforschung, die die Perspektive der Leistungsempfänger_innen zum Gegenstand haben, werden in Abschnitt 2.3 vorgestellt. Vor diesem Hintergrund werden Fragestellung und Zielgruppe der Untersuchung nochmals konkretisiert (2.4).
Im Anschluss an den aktuellen Stand der Forschung im Rahmen der SGB-II-Reformen werden die für diese Arbeit relevanten theoretischen Konzepte vorgestellt, welche entsprechend der hier angewandten Auswertungsmethode der Grounded Theory als sogenannte Sensitizing Concepts fungieren. Diese teilen sich in drei Hauptstränge: Zunächst wird das Subjektverständnis, das der Arbeit zugrunde liegt, aufgefächert (3.1). Daran anschließend werden Konzepte vorgestellt, die sich mit Subjektivierungsprozessen in der Sphäre der Erwerbswelt, als Form der Regierungspraxis und im Bereich von Arbeitslosigkeit befassen (3.2). Abschließend werden zwei Konzepte aus der Armuts- und Reichtumsberichterstattung präsentiert, die sich mit der Erfassung von individuellen Ressourcenausstattungen und Handlungsoptionen beschäftigen (3.3).
Das Konzept der Subjektivierung von Arbeit wird zunächst allgemein charakterisiert, anschließend werden speziell die Konzepte des Arbeitskraftunternehmers – im Kontext der Anforderungen an Arbeitskraft – und des Arbeitsvermögens – als subjektbezogene Ressourcenseite von Arbeitskraft – ausgeführt (3.2.1). Diese Subjektivierungskonzepte aus der Arbeitsforschung werden unter Rückgriff auf die Gouvernementalitätsanalytik nach Foucault um die Komponente der Regierungstechnik ergänzt, in der auch das Konzept des „unternehmerischen Selbst“ zu verorten ist (3.2.2). Es geht hier darum, Subjektivierung als Machttechnik zu verstehen und den Wandel des Wohlfahrtsstaates unter dieser Perspektive näher zu beleuchten. Der praxistheoretische Zugang zu Subjektivie-rungsprozessen über Althusser sowie die daran anknüpfenden Ausführungen von Butler zum Prozess der Subjektivation spielen eine wichtige Rolle bei der Frage, wie subjektiver Eigensinn entsteht bzw. entstehen kann. In dem Abschnitt zur „Subjektivierung von Arbeitslosigkeit“ wird auf die regierungsprogrammatischen Appelle im Rahmen des SGB II eingegangen. Diese Ausführungen werden ergänzt durch eigene konzeptionelle Überlegungen, die – in der Verbindung von Subjektivierung von Arbeit und Arbeitslosigkeit – eine doppelte Subjektivierung von Hilfeempfängern ausmachen (3.2.3). Schließlich findet eine Auseinandersetzung mit Konzepten der Armutsforschung statt, die jenseits einer rein monetären Betrachtung liegen und sowohl Restriktionen als auch Ressourcen und Optionen in den Blick nehmen (3.3).
Als methodischer Zugang für diesen Forschungsansatz wird die Grounded Theory (vgl. Glaser et al. 2008) gewählt, da diese es erlaubt, die subjektive Binnenperspektive zu erfassen (4.1) und – methodologisch angeleitet – den Forschungsblick offen lässt, um das Ziel eines Aufdeckens und Freilegens von bisher nicht bekannten Sinnzusammenhängen zu ermöglichen. In einer kritischen Diskussion zur Grounded Theory wird erläutert, welche Auswertungsschritte entlang der Methode verfolgt werden und an welchen Stellen aus welchen Gründen davon abgewichen wird (4.2). Dazu gehört auch eine methodologische Auseinandersetzung mit dem theoretischen Vorwissen, das im Sinne von „Sensitizing Concepts“ Eingang in die empirische Untersuchung findet. Dieser Diskussion folgt ein Überblick über die Erhebung, eine Beschreibung des der Untersuchung zugrunde liegenden Gesamtsamples (4.3) sowie die Vorstellung der ausgewählten Fälle und der Auswertungsarbeiten (4.4). Dieses Kapitel schließt mit einer Prüfung der Untersuchung in Bezug auf zentrale Gütekriterien qualitativer Untersuchungen (4.5).
Den Kern der Ergebnisdarstellung bilden die Resultate zur Deutung und Verarbeitung der Aktivierungsanforderungen (Kapitel 5). In der hier vorliegenden Arbeit wird eine spezielle Handlungsstrategie im Umgang mit den Aktivierungsanforderungen des SGB II vorgestellt. Im Rahmen dieser Strategie ist die regierungsprogrammatische Anforderung von „Work first“ trotz eines hohen Commitments zu Erwerbsarbeit, Selbstverantwortung und Aktivierung nicht das primäre Handlungsziel der Empfänger_innen von Unterstützungsleistungen. Insofern bieten die erarbeiteten Ergebnisse nicht nur interessante Erkenntnisse für eine subjektorientierte Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenforschung, sondern auch für die arbeitsmarktpolitische Praxis.
Um den Zugang zum Material in seiner Vielfältigkeit zu erleichtern, werden exemplarisch fünf Fälle vorgestellt. In ihnen kommen sowohl die fallspezifischen Besonderheiten als auch die übergreifenden Problemstellungen zum Ausdruck (5.1). Die Auseinandersetzung mit dem Appell zu einer möglichst schnellen Arbeitsmarktintegration findet unter bestimmten Lebensverhältnissen (5.2) statt. Hierbei spielen Kontextbedingungen wie die Ressourcenausstattung (5.2.1) sowie Interventionen durch das Wohlfahrtsregime und das Erwerbssystem (5.2.2) eine wesentliche Rolle für die Handlungsspielräume (5.2.3). Eine bestimmte Handlungsstrategie, die sich unter diesen Bedingungen im Spannungsfeld von Hilfebedürftigkeit und Eigenverantwortlichkeit bewegt, ist Gegenstand des Abschnitts 5.3. Ein zentrales Element, das die Fälle verbindet, sind Erfahrungen von Hilflosigkeit und eine eigensinnige Form der Verarbeitung dieser Erfahrungen (5.3.1). Im Zuge der Verarbeitung von Unsicherheitserfahrungen tritt eine spezifische Handlungsstrategie hervor, die vor allem die Herstellung von Stabilität und Sicherheit verfolgt. Als Bezeichnung für dieses Handlungsmuster wurde das Label „Security first“ gewählt (5.3.2). Welche Orientierungen dieser Strategie zugrunde liegen und welche Funktion sie für die Individuen erfüllt, wird in den Abschnitten 5.3.3 und 5.3.4 erläutert. In einem Fazit wird die Handlungsstrategie zusammengefasst (5.4).
Das Kapitel 6 stellt eine Zusammenfassung dar und greift die zentralen Ergebnisse der Untersuchung auf, erörtert sie in Verbindung mit den SGB-II-Reformen und beleuchtet sie im Hinblick auf ihren konzeptionellen Beitrag für die Forschung (6.1). Darauf aufbauend werden thematische Schwerpunkte für weiterführende Forschung aufgezeigt, die weiterer Klärung bedürfen (6.2). Die Arbeit endet mit Schlussfolgerungen für die Praxis der Arbeitsmarktpolitik auf Basis der vorgestellten Erkenntnisse (6.3).
1.3 Hintergrund: Evaluationsforschung zum SGB II
Die vorliegende Arbeit ist aus einem großen qualitativen Forschungsprojekt heraus entstanden. Sie stellt eine eigenständige Fragestellung der Autorin dar, die, auf den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchung aufbauend, eigene Erkenntnisinteressen verfolgt. Bei der vorangegangenen Studie handelt es sich um ein Projekt des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg (IAB). Es ist Teil der gesetzlich verankerten Wirkungsforschung zur staatlichen Arbeitsförderung, welche nach § 282 SGB III ständige Aufgabe des IAB ist. Mit Reformierung und Einführung des SGB II wurde dieser Forschungsauftrag auf die Hartz-IV-Gesetze ausgedehnt und in § 55 SGB II festgehalten:
„Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und zur Sicherung des Lebensunterhalts sind regelmäßig und zeitnah zu untersuchen und in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nach Paragraf 282 des Dritten Buches einzubeziehen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (heute: Bundesministerium für Arbeit und Soziales) und die Bundesagentur können in Vereinbarungen Einzelheiten der Wirkungsforschung festlegen. Soweit zweckmäßig, können Dritte mit der Wirkungsforschung beauftragt werden.“
Konkret wurde diesem Forschungsauftrag im Rahmen des Projekts „Armutsdynamik und Arbeitsmarkt: Entstehung, Verfestigung und Überwindung von Hilfebedürftigkeit bei Erwerbsfähigen“, im Folgenden „Projekt Armutsdynamik“ genannt, nachgegangen. Hierbei handelt es sich um die einzige qualitative Panelstudie, in deren Fokus die subjektive Perspektive der Adressaten der SGB-II-Reformen steht.
Das Forschungsprojekt wurde am IAB im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ (Leiter PD Dr. Markus Promberger) konzipiert. Es untersucht „lebensweltbezogene Muster und Dynamiken der Entstehung und möglichen Verfestigung, aber auch der Überwindung von Hilfebedürftigkeit sowie die soziale Lage erwerbsfähiger Hilfebedürftiger“ (Hirseland et al. 2006, S. 2). Die Untersuchung ist als „hypothesen- und theoriegenerierende Explorationsstudie“ (ebd.) angelegt. Deren empirische Basis ist ein qualitatives Panel, dessen erste Phase (2006 bis 2008) aus zwei biografisch-narrativen Befragungswellen samt dazugehörigen Beobachtungsprotokollen besteht. In einer zweiten Phase (2008 bis 2012) wurden wiederum zwei Befragungswellen durchgeführt. In dieser zweiten Projektphase wurden die inhaltlichen Themenstellungen um die Erfassung von Teilhabestrukturen und Teilhabepotenzialen im Hilfebezug erweitert. In einem Zeitraum von knapp sechs Jahren konnten 152 Personen befragt werden, davon konnten mit 80 Befragten mindestens drei Interviews geführt werden. Über alle vier Wellen hinweg ist hierbei ein enormes Datenkorpus von insgesamt 453 biografisch-narrativen Interviews samt dazugehörigen Beobachtungsprotokollen entstanden (vgl. Pfeiffer et al. 2012, S. 52–53).
Der Gesamtfragestellung wurde in drei Teilprojekten nachgegangen, die von unterschiedlichen Forschungsteams bearbeitet wurden. Die erste Teilfragestellung „Armutsdynamik – Kontinuität und Diskontinuität im Reformprozess der Hilfesysteme“ wurde vom Forschungsteam am IAB5, das auch die Projektkoordination innehatte, bearbeitet. Ein weiteres Teilprojekt, das am Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS)6 angesiedelt war, befasste sich mit prekären Erwerbsbiografien am Rande der Hilfebedürftigkeit, also Menschen, die entweder trotz Erwerbstätigkeit im Hilfebezug stehen oder zwischen SGB-II-Hilfebezug und Erwerbstätigkeit pendeln. Die dritte Fragestellung hatte ihren Schwerpunkt im Bereich „Kompetenzen, Arbeitsvermögen und Arbeitsorientierung“ im Hilfebezug und fokussierte auf Struktur und Dynamik subjektgebundener Kompetenzen mit Blick auf deren Integrationspotenziale (vgl. Hirseland et al. 2006, S. 18). Dieser Auswertungsschwerpunkt wurde am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF München) unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Pfeiffer bearbeitet.7
Aus dem zuletzt genannten Teilprojekt „Kompetenzen, Arbeitsvermögen und Arbeitsorientierung“ (kurz „Arbeitsvermögen“) ist die vorliegende Arbeit hervorgegangen. Sie folgt einer eigenständigen Fragestellung der Autorin, die auf den Erfahrungen während der Erhebungen basiert und sich in Auseinandersetzung mit dem Material konkretisiert hat. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Menschen – vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Kompetenzen – die Anforderungen hinsichtlich unternehmerischen Handelns, Selbstverantwortung und Eigeninitiative deuten und verarbeiten. Dieser Fokus auf die Binnenperspektive der Subjekte war nicht Gegenstand der bisherigen Untersuchungen im Rahmen des Projektverbundes „Armutsdynamik“. Auch wenn diese Arbeit im Umfeld der SGB-II-Evaluationsforschung entstanden ist, möchte die Autorin betonen, dass sie explizit nicht als solche einzuordnen ist. Es wird nicht nach den Outcomes im Sinne der Reformziele (z.B. Übergangsquoten in den ersten Arbeitsmarkt) gefragt, der Forschungsblick zielt vielmehr in die Blackbox der subjektiven Deutungen und Verarbeitungen der Aktivierungsmaßnahmen hinein, die genau zwischen der Anwendung des Implementationsinstrumentariums und dem – wie auch immer – gemessenen Output liegen (vgl. Baethge-Kinsky et al. 2006, S. 1–2).
1 Damit wurde der Kreis der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, der dem Aktivierungsregime nicht unterliegt, im Zuge der Reformen deutlich verkleinert. Nur noch ein eng eingegrenzter Personenkreis wird nicht als für den Arbeitsmarkt zu aktivierende Individuen betrachtet und bezieht Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist im SGB XII geregelt, die dort in § 19 erläuterten Leistungsempfänger sind Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht voll erwerbstätig sein können, d.h. nur unter drei Stunden am Tag (aufgrund von Kinderbetreuung, Schwangerschaft, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, zudem Kinder und Menschen mit einem Lebensalter von über 65 Jahren).
2 Diese Frage wurde schon 1995 gestellt, vgl. Mutz et al. 1995, S. 299.
3 Im Gegensatz zum sog. Ernährermodell (engl. male breadwinner model) mit seiner klassischen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern geht das „adult worker model“ davon aus, dass Erwachsene, egal welchen Geschlechts, ob Eltern oder Nicht-Eltern, ihren Lebensunterhalt jeder für sich selbst im Rahmen eines Vollzeitjobs bestreiten (vgl. Giullari und Lewis 2005; Annesley 2007; Hirseland et al. 2010, S. 73).
4 Diese Sozialfigur präsentiert eher ein Leitbild aus unternehmerischer Perspektive, als dass sie eine empirisch breite Basis spiegeln wollte (vgl. Pongratz und Voß 2004d).
5 IAB-Team: PD Dr. habil. Markus Promberger, Dr. Andreas Hirseland, Dr. Ulrich Wenzel und Philipp Ramos Lobato.
6 HIS-Team: PD Dr. habil. Berthold Vogel, Natalie Grimm, Jonte Plambeck und Marco Sigmann.
7 ISF-München-Team: Prof. Dr. habil. Sabine Pfeiffer, Dr. Anne Hacket, Tobias Ritter und Petra Schütt.
2. Der Systemwandel der sozialen Sicherung
Wie bereits in der Einleitung dargelegt, hat sich in Deutschland in den letzten zehn Jahren ein enormer Wandel des Systems der sozialen Sicherung vollzogen. Der Sozialstaat hat sich zum modernen Wohlfahrtsstaat gewandelt, ein wesentliches Element ist die Neuausrichtung des sozialen Sicherungssystems nach den Prinzipien des Workfare und eine Erweiterung um das Leistungsprinzip (vgl. Schneider 2011, S. 23). Was ist das qualitativ Neue daran? Wie eng sind Arbeitslosigkeit und ihre gesellschaftliche Deutung mit dem Erwerbssystem, der Erwerbsgesellschaft verbunden? Was ist der Grund dafür, dass nun im Zuge der Neuausrichtung von „Re-Kommodifizierung“ die Rede ist? Um das qualitativ Neue dieses Wandels von Welfare zu Workfare erfassen zu können, lohnt zunächst ein Rückblick in die Geschichte sozialstaatlicher Armuts- und Arbeitslosenpolitik und ein Blick auf deren sozialwissenschaftliche „Verarbeitung“. Zum Verständnis der aktuellen Debatten rund um das Phänomen Arbeitslosigkeit ist es hilfreich, die Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit seit Beginn der Industrialisierung, also über einen langen Zeitraum, in dem sich Erwerbsarbeit zunehmend als zentraler Vergesellschaftungsmodus herausgebildet hat, in groben Linien nachzuzeichnen.
Auf Basis dieser Entwicklungslinien ist der Systemwandel, wie er mit den Hartz-Reformen eingeleitet wurde, verstehbar und die Qualität des Paradigmenwechsels nachvollziehbar. Dabei ist von Interesse, wie dieser Systemwechsel in normative Regelungen umgesetzt wird und wie die arbeitsmarktpolitischen Ansatzpunkte im Detail geregelt sind. Knapp zehn Jahre, nachdem die Reformen angestoßen wurden, können den formulierten Zielen auch die entsprechenden Arbeitsmarktdaten gegenüber gestellt werden. Dieser quantitative Blick auf die Entwicklung von Arbeitslosigkeit wird abschließend durch qualitative Ergebnisse der Wirkungsforschung zu aktivierender Arbeitsmarktpolitik ergänzt. Wie sind Vermittlungsprozesse konkret ausgestaltet? Wie wird der Spagat zwischen „Fördern und Fordern“, zwischen Eigenverantwortung und Restriktion, im Vermittlungsprozess im Alltag gelebt und erlebt? Wie werden die Instrumente und Maßnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik umgesetzt und wie wirken sie aus Sicht der Betroffenen? Auf Grundlage der historischen Einbettung der Veränderungen sowie des Stands der einschlägigen Forschung werden die Fragestellung sowie die Untersuchungsgruppe dieser Studie noch einmal spezifiziert.
2.1 Historische Entwicklung der Armuts- und Arbeitslosenforschung in Deutschland
Die folgende Darstellung der historischen Entwicklung der Armuts- und Arbeitslosenforschung in Deutschland dient als Einführung und Hinführung zu den aktuellen Debatten und den diskutierten Veränderungen. Hier lassen sich drei historische Phasen unterscheiden. Zunächst geht es um die Phase der Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Armut und Arbeitslosigkeit in erster Linie als individuelles Versagen interpretiert wurden. Im Zuge wirtschaftlicher Veränderungen, allen voran der Weltwirtschaftskrise um 1929, veränderte sich dann die Sichtweise auf die „Schuldfrage“; die Arbeitsmarktforschung nahm strukturelle sowie konjunkturelle Armuts- und Arbeitslosenrisiken in den Blick und die Auswirkungen von derart „unverschuldeter“ Arbeitslosigkeit gerieten ins Visier der Forschung. Wegweisend für diese Art von Wirkungsforschung war die 1933 erschienene Untersuchung „Die Arbeitslosen von Marienthal“ der Forschungsgruppe um Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel. Nach dem Zweiten Weltkrieg fristete die Arbeitslosenforschung in der jungen Bundesrepublik Deutschland aufgrund der niedrigen Arbeitslosenzahlen bis in die 1970er Jahre ein eher unscheinbares Dasein, erst Anfang der 1980er führten steigende Arbeitslosenquoten zu einem Wiedererstarken des Interesses an dem Phänomen Arbeitslosigkeit. In dieser Zeit gewann eine dynamische, lebenslauforientierte Betrachtung von Arbeitslosigkeit an Boden. Von 1993 bis 2011 lag die Arbeitslosenzahl in der Bundesrepublik über drei Millionen, die Arbeitslosenquoten bewegten sich in diesem Zeitraum zwischen 7,7 und 11,7 Prozent (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2012, S. 44 und 56). Diese dauerhaft hohe Arbeitslosigkeit bildete eine enorme Herausforderung für die sozialen Sicherungssysteme und war der Hintergrund für die unter Bundeskanzler Schröder (1998 bis 2005) angestoßene Modernisierung des deutschen Sozialstaates.
2.1.1 Vergesellschaftung und soziale Sicherung über Lohnarbeit
Die soziologische Arbeitslosenforschung8 ist aufs engste mit einer Entwicklung verbunden, in der sich Erwerbs- und Lohnarbeit als die Form der sozialen Absicherung etablierte. Mit der gesellschaftlichen Neubewertung von (Lohn-)Arbei ging eine Stigmatisierung und Kriminalisierung von armen Arbeitslosen einher (vgl. Promberger 2005a).
Vor allem anhand der Geschichte der Zucht- und Arbeitshäuser in Europa lässt sich der Wandel des Stellenwerts von Lohnarbeit und seiner institutionellen Einbettung nachvollziehen. Diese Häuser erfüllten im Laufe der Zeit zentrale Funktionen zur Verwaltung, Verfügbarmachung und Zurichtung von menschlicher Arbeitskraft, wie beispielsweise Marzahn (1984) ausführt:
„Auf der ökonomischen Ebene bedeutet das Zucht- und Arbeitshaus eine Entlastung der Armenkassen und damit eine allgemeine Zentralisierung, Rationalisierung und Ökonomisierung des Armenwesens. Darüber hinaus war es ein Beitrag zur Arbeiterbeschaffung […]. Auf der ordnungspolitischen Ebene war das Zucht- und Arbeitshaus ein Instrument zur Sozialdisziplinierung, dessen sich das aufsteigende Bürgertum immer mehr bemächtigte […]. Auf der ideologischen Ebene erzwang, demonstrierte und verbreitete das Zucht- und Arbeitshaus pädagogisierend jene neuen Orientierungen und Normen, deren Verinnerlichung den freien Lohnarbeiter erst funktionstüchtig und verwertbar macht.“ (Marzahn 1984, S. 67, Hervorhebungen im Original)
Mit der Herausbildung der Sozialstaatlichkeit wurden arbeitslose Individuen zum Subjekt (sozial)staatlicher Regulierungen. Sich nicht aus eigener Kraft versorgen zu können wurde durch Zwangsunterbringung im Arbeitshaus und den Zwang zur Arbeit sanktioniert. Arbeitslose Subjekte entsprachen nicht dem impliziten positiven Spiegelbild „bürgerlichen Erwerbssinns, Geschäftigkeit und Selbständigkeitsstrebens, den Normen und Leitbildern des neuen Zeitalters“ (Marzahn 1984, S. 30). Der individuelle Zwang zur Existenzsicherung über Lohnarbeit wurde akut durch die Ablösung der Karitas, der christlichen Hilfe und Sorge für Arme und Bedürftige, und die Entstehung eines disziplinierenden Sozialstaats (vgl. Kostanecki 2004, S. 805). So fungierte die frühbürgerliche Sozialpolitik als „Geburtshelfer der bürgerlichen Gesellschaft“ (Ritz und Stamm 1984, S. 93). In der Folge stand ein immer größerer Anteil der Bevölkerung der industriellen Produktion als Lohnarbeiter zur Verfügung (vgl. auch Schütt et al. 2009).
2.1.2 Ursachenforschung jenseits (fehlender) Arbeitsmoral und Wirkungsforschung
Zunächst wurde Arbeitslosigkeit also im Zusammenhang mit der Verelendung von Armen, deren moralischen Defiziten sowie der Etablierung und Aufrechterhaltung der Vergesellschaftungsform Lohnarbeit thematisiert (vgl. Ritz und Stamm 1984, S. 93). Ein erster Perspektivenwechsel ist festzustellen, als zuneh mend Lohnarbeitswillige von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Nun gerieten auch externe Faktoren wie z.B. saisonale oder konjunkturelle Schwankungen oder Rationalisierungseffekte in den Fokus der Analysen (vgl. Bonß und Heinze 1984, S. 12; Bodenstein und Stojentin 1909), wie etwa folgende Passage einer internationalen Vergleichsstudie von 1896 verdeutlicht:
„Und wenn die Industrie schwere Krisen durchzumachen hat […], so liegen von heute zu morgen tausende von Arbeitern brotlos auf der Straße, nicht zu gedenken der Lohnkämpfe, die oft noch größere Kalamitäten zur Folge haben.“ (Meyerinck 1896, S. 1–2)
Wirtschaftliche Krisen waren stets mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen verbunden. Im Verlauf der Weltwirtschaftskrise 1929/1930 stieg die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zur Arbeitslosigkeit deutlich an.9 In der Folge wurden Unterstützungsbedürftige getrennt nach Armen auf der einen und Arbeitslosen auf der anderen Seite betrachtet. Arbeitslosigkeit wurde nun auch jenseits subjektabhängiger Faktoren untersucht, aber auch die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen gerieten ins Blickfeld. Hauptsächlich wurden folgende thematischen Schwerpunkte der Folgen von Arbeitslosigkeit behandelt:
materielle Einschränkungen,
Auswirkungen auf soziale Beziehungen,
individuelle Auswirkungen (Gesundheit, Selbstwertgefühl, Handlungsmotivation, Aktivitätspotenzial) und
Veränderungen der politischen Einstellungen.
Viele dieser Untersuchungen stellten die erheblichen Belastungen sowie die Veränderungen der Lebenssituation heraus, die mit Arbeitslosigkeit einhergehen. Vor allem wurde das Herausfallen aus der Erwerbstätigkeit in Zusammenhang mit dem Fehlen der Vergesellschaftung über Arbeit eingehender betrachtet (vgl. Bonß und Heinze 1984, S. 15–16; Schütt et al. 2009, S. 152). In dieser Zeit entstand die berühmte Marienthal-Studie, in der in einem österreichischen Industriedorf die Folgen von langanhaltender Massenarbeitslosigkeit umfassend untersucht wurden. Neben einer ausführlichen Erfassung der Lebensumstände, der psychologischen Folgen von Arbeitslosigkeit und des veränderten Erlebens von Zeitstrukturen wurden in der Marienthal-Studie auch vier Haltungstypen der Arbeitslosen extrahiert: die ungebrochene, die resignierte, die verzweifelte und die apathische Haltung (vgl. Jahoda et al. 1933). Diese Haltungstypen beschreiben auch für die aktuelle Aktivierungsdebatte interessante Aspekte unterschiedlich gelebter Alltagspraxis, wie zum Beispiel die aktive Arbeitssuche beim ungebrochenen Typ oder die „Aufrechterhaltung des Haushalts und der Pflege der Kinder, die nur der apathische Typ nicht mehr erfolgreich bewältigt“ (Pfeiffer et al. 2009, S. 170), da sie Hinweise darauf geben, dass die Betroffenen mit Arbeitslosigkeit unterschiedlich umgehen und sie unterschiedlich bearbeiten.
Seit der Marienthal-Studie und anderen klassischen Studien10 zur Arbeitslosigkeit gehört es zum sozialwissenschaftlichen Kanon, dass nicht erwartete oder unerwünschte Arbeitslosigkeit bei Betroffenen zu erheblichen sozialen, psychischen und sogar manifesten somatischen Einschnitten führt (vgl. Alheit und Glaß 1986, S. 20). Die sich seit den 1930er Jahren vor allem außerhalb von Deutschland11 entwickelnde Arbeitslosen- bzw. Arbeitslosigkeitsforschung ist bis heute von zwei voneinander abgrenzbaren Untersuchungslinien gekennzeichnet: „die dominant psychologisch/sozialpsychologisch orientierte Arbeitslosenforschung“ sowie die „eher ökonomisch/sozialpolitisch akzentuierte Arbeitslosigkeitsforschung“ (Bonß und Heinze 1984, S. 13–14). Während erstere die psychischen und sozialen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit sowie individuelle Verarbeitungsstrategien der Betroffenen untersucht, konzentriert sich die zweite Forschungstradition auf die ökonomischen und sozialen Ursachen von Arbeitslosigkeit sowie die politischen und ökonomischen Möglichkeiten ihrer Eindämmung (vgl. ebd.).
In der Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg waren Arbeitslosen- und Arbeitslosigkeitsforschung in Deutschland kaum noch existent. Falls doch, wurden die Menschen in Armut auf Restbestände von Nicht integrierbaren marginalisiert (z.B. Strang 1970, S. 38–39).12 Dort wo Arbeitslosigkeit auftrat, war sie entweder friktional (Stahl- und Kohlekrise) oder saisonal bedingt und ihre Folgen wurden – auch mit Blick auf den Systemkonkurrenten Deutsche Demokratische Republik – durch den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente deutlich abgemildert.13 Erst 1975 stieg die Arbeitslosenquote erstmals wieder auf 4,7 Prozent. Zunächst wurden die Veränderungen am Arbeitsmarkt aber, ähnlich wie in der Politik, von der soziologischen Forschung kaum als systematisches Problem wahrgenommen. Noch wurde der Traum von „immerwährender Prosperität“ (Lutz 1989) gelebt, für den das Vertrauen prägend ist, prinzipiell jede(n) in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (vgl. Behrendt 1977). Mit zunehmender Massenarbeitslosigkeit entstand die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit, aus konjunktureller wurde strukturelle Arbeitslosigkeit. Im Zuge dieser Veränderungen wurde in den 1980er Jahren zum einen die Gruppe der Arbeitsuchenden differenzierter (z.B. nach Geschlecht, Alter, Ausbildungsstand etc.) analysiert, zum anderen erlebte die sozialpsychologisch motivierte Arbeitslosenforschung eine Renaissance.14 Folgende Merkmale zeichnen die Arbeitslosen- bzw. Armutsforschung dieser Zeit aus: eine dichotome Betrachtung nach „Arbeit haben oder nicht“, Betrachtung der Armut als dauerhafter Zustand (Stichwort Armutskarrieren) und die Erhebung von großen, zeitpunktbezogenen (quantitativen) Querschnittsdaten (vgl. Schütt et al. 2009, S. 154–155).
2.1.3 Neue Perspektive seit den 1980er Jahren
Gegen Ende der 1980er Jahre fand ein Wandel hin zu einer dynamischeren Betrachtung von Armut und Arbeitslosigkeit statt, deren Erkenntnisse sowohl auf die Arbeitslosen- und Arbeitslosigkeitsforschung als auch auf die Arbeitsforschung insgesamt großen Einfluss haben. Diese neuen Impulse setzte vor allem der Bremer Sonderforschungsbereich „Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf“15. Erst die Analyse von sogenannten Sozialhilfekarrieren im Zeitverlauf zeigte, dass und wie Biografien von Menschen im Sozialhilfebezug von Mobilität (hohe Einkommensmobilität, Auf- und Abstiegskarrieren sowie aktives Handeln im Hilfebezug) und durch „Verzeitlichung“16 von Armut gekennzeichnet sind. Der Umgang mit Arbeitslosigkeit erweist sich dabei als wesentlich von den Erfahrungs- und Deutungsmustern der Hilfebezieher_innen geprägt (vgl. Leibfried et al. 1995; Allmendinger und Hinz 1999, S. 15–25). Die Arbeiten im Rahmen dieses Sonderforschungsbereichs zeigen, dass die Annahme homogener, deutlich abgrenzbarer armer Bevölkerungsschichten kaum noch haltbar ist. Diesem Umstand wird mit der These der „Entgrenzung von Armut“ Rechnung getragen, d.h. nicht mehr nur Menschen an den sogenannten Rändern der Gesellschaft sind von Armut betroffen, sondern auch viele Personen außerhalb des unteren Segments können nicht dauerhaft am gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben und sind teilweise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Der Personenkreis, mit dem sich Armutsforschung befasst, erweitert sich; die gesellschaftlichen Veränderungen des sozialen Wandels mit seinen zunehmenden Individualisierungsprozessen17 versucht man mit Begriffen wie „neue Armut“, „Zwei-Drittel-“ oder „Drei-Viertel-Gesellschaft“ zu fassen (vgl. Hauser und Neumann 1992, S. 241 ff.; Leibfried et al. 1995; Sen 1997; Schütt et al. 2009, S. 155).
Kronauer und Vogel resümieren vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Arbeitslosenforschung Anfang der 1990er Jahre ein Verschwinden der begrifflichen Eindeutigkeit, sowohl bezogen auf Arbeitslosigkeit als auch bezogen auf die Arbeitsgesellschaft selbst:
„Je mehr wir über einzelne Aspekte der Arbeitslosigkeit und spezifische Gruppen von Arbeitslosen erfuhren, desto schwieriger wurde es, noch Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit zu erkennen, oder mit anderen Worten, desto mehr entzog sich die ‚Arbeitsgesellschaft‘, die diesen Erfahrungen ihren Stempel aufdrückt, dem Blick.“ (Kronauer und Vogel 1993, S. 14)
Auch gesellschaftstheoretisch orientierte Arbeitslosenforschung setzt sich seitdem zunehmend mit dem Grundverständnis von Arbeit auseinander. Es gilt, Arbeit als Kategorie neu zu reflektieren, da die klassischen Konzepte von Lohnarbeit, Arbeiterklasse, Arbeitsteilung, Beruflichkeit etc. die notwendige analytische Schärfe nicht mehr bieten (vgl. Montada 1994; Daheim et al. 1992). Kritik am Arbeitsbegriff selbst kommt insbesondere durch die feministische Forschung und deren Forderung nach einer Neubewertung der Reproduktionsarbeit auf (vgl. Becker-Schmidt et al. 1983). Diese Phase der kritischen Auseinandersetzung mit dem Arbeitsbegriff und dessen Verknüpfung mit Erwerbs- oder Lohnarbeit greift tief in das bisherige (Selbst-)Verständnis der Arbeitsgesellschaft ein. Auf der Suche nach neuer Orientierung treten auch Einschätzungen zu Tage, die Erwerbsarbeit als zentralen Vergesellschaftungsmodus zum Auslaufmodell erklären. Angesichts von jobless growth in den westlichen Industrienationen wird die Frage nach der „Krise der Arbeitsgesellschaft“18 gestellt und Rifkin (1995) ruft gar das „Ende der Arbeit“ aus. Andere Diskussionen setzen sich mit der Zukunft von Erwerbsarbeit – und damit auch der Erwerbsgesellschaft – unter den veränderten Bedingungen auseinander, indem sie für eine Erweiterung und Erneuerung des Arbeitsbegriffes plädieren (vgl. u.a. Jäger und Pfeiffer 1996; Schmidt 1999).
Im Zuge der Diskussionen um den Begriff der Arbeit, dessen Neubewertung und der Kritik an der Einengung auf lohnabhängige Erwerbsarbeit verliert die Arbeitslosigkeit – als negativ von der Erwerbsarbeit abgeleiteter Begriff – ebenfalls an Kontur. Eigenarbeit, bürgerschaftliches Engagement, Reproduktionsarbeit und „Tätigsein“ neben Erwerbsarbeit werden in die Debatte zur Konturierung einer neuen Arbeitsgesellschaft eingebracht; die Dichotomie zwischen Erwerbsarbeit und Arbeitslosigkeit scheint nicht mehr haltbar. Dementsprechend richtet die Forschung einen integrativen Blick auf unterschiedliche Tätigkeiten, Fähigkeiten und Aneignungssphären in Erwerbs- und Lebenswelt und beginnt den alten Dualismus von Arbeit und Nicht-Arbeit zu überbrücken (vgl. u.a. Barlösius und Ludwig-Mayerhofer 2001; Pfeiffer et al. 2009; Dörre et al. 2008b; Castel und Dörre 2009; Grimm und Vogel 2010).
Dieser Perspektivwechsel tritt in neueren Konzepten der Armuts-, Arbeitslosen- und Arbeitsforschung hervor (vgl. Pfeiffer 2004, S. 139), wie beispielsweise in dem auf Verwirklichungschancen abzielenden Capability-Ansatz von Sen (2000; Arndt et al. 2006) und in dem Exklusionsansatz zur sozialen Ausgrenzung (vgl. Kronauer 2002; Bude und Willisch 2006). Auch das Drei-Zonen-Modell19 von Castel (2000), die Prekarisierungskonzepte (etwa von Bourdieu 1998, auch Castel und Dörre 2009) oder das Forschungsprogramm, das sich mit der Entgrenzung von Arbeit und Leben auseinandersetzt (vgl. Kratzer 2003), sind Ausdruck dieser Neuorientierung, nachdem, angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen, Begriffe wie Normalbiografie oder Normalarbeitsverhältnis nicht mehr adäquat erscheinen. Der eigene (Arbeits-)Gegenstand muss neu erarbeitet werden. Dies betrifft beispielsweise auch das Verständnis davon, was Handlungsmächtigkeit in Arbeitslosigkeit für die Betroffenen bedeutet und wie sie erfahren wird. Die vier Haltungstypen der Marienthal-Studie haben bereits gezeigt, dass Arbeitslosigkeit sehr unterschiedlich „verarbeitet“ wird und dass an einem reinen Belastungsdiskurs, aber auch an „einem auschließlich (sic!) arbeitsorientierten Analyse- und Erklärungskonzept im Feld der Wirkungsforschung“ (Wacker 1983, S. 86) Zweifel angebracht sind.
Die aktuellen Konzepte der Arbeitslosigkeits-, Arbeitslosen- und Arbeitsmarktforschung verweisen auf die Notwendigkeit einer neuen Sensibilität für die Übergänge, Randbereiche und Interdependenzen von Arbeit und Nicht-Arbeit. Diese Übergänge sind oft fließend, die Menschen an den Rändern sind meist sowohl „drinnen“ als auch „draußen“. Die Unsicherheit an der Peripherie der Arbeitswelt wirkt in diese hinein und verstärkt auch dort Unsicherheit (vgl. u.a. Vogel 2006; Altenhain et al. 2008; Grimm und Vogel 2010).
Dieser Wandel in der soziologischen Armuts- und Arbeitslosenforschung mit der zunehmenden Verflüchtigung von eindeutigen Grenzen ist Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in den letzten zehn bis 15 Jahren auch im Selbstverständnis und der Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips in Deutschland vollzogen haben. Dieser Paradigmenwechsel ist Gegenstand der folgenden Ausführungen.
2.2 Die Reformen des SGB: Vom Sozialstaat zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat
Die Veränderungen am Arbeitsmarkt stellten und stellen in ihrem Zusammenspiel mit dem weltweiten Wettbewerbsdruck nicht nur die soziologische Forschung, sondern vor allem den Sozialstaat vor neue Herausforderungen. Die Entwicklung des Sozialstaates ist seit jeher eng mit der kapitalistischen Organisation von Arbeit verknüpft. Ursprünglich als Schutz vor Verelendung der Arbeiterschaft eingeführt und mit befriedenden oder kontrollierenden Zwecken verknüpft, ist das System von Beginn an auf die Ausgestaltung subjektiver Rechte (vgl. Honneth 2011, S. 423) und eine De-Kommodifizierung20 von Arbeitskräften ausgelegt (vgl. Trinczek 2011, S. 608). Diese Ausstattung mit individuellen Rechten führt zu einer „Individualisierung der Erwerbstätigen“ (Honneth 2011, S. 425). Um die Jahrtausendwende erodiert der Schutzmechanismus infolge der „Schrumpfung der Reallöhne, der Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen und der Ausweitung struktureller Unsicherheit“ aber zunehmend, „was von soziologischer Seite als Entgrenzung der Arbeitsbedingungen beschrieben wird, nämlich die wachsende Zumutung, sich als Arbeitnehmer ‚marktgängig‘ zu verhalten und Leistungsanforderungen individuell zu verinnerlichen“ (Honneth 2011, S. 457).
„Vor diesem Hintergrund steigen die Anforderungen an die Sozial-, Bildungsund Arbeitsmarktpolitik. Es wird zunehmend schwieriger diese in einer Weise auszubalancieren, um zugleich Flexibilität und Effizienz als auch Autonomie, Wohlfahrt und Sicherheit für möglichst viele Menschen zu steigern.“ (Struck und Seifert 2009, S. 7)
Der beitragsfinanzierte Sozialstaat alter Prägung gerät mit der zunehmenden Destabilisierung der (männlichen) Normalerwerbsbiografien (vgl. Kohli 1985) in Bedrängnis. Infolgedessen kommt es zu einem Paradigmenwechsel von einem versorgenden Sozialstaat zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat. Normatives Leitbild dieser Logik ist der „selbstverantwortliche Arbeitsbürger“ (Dingeldey und Gottschall 2001, S. 36), der sich zunehmend unabhängig von sozialstaatlichen Transferleistungen versorgt. Das System der sozialen Sicherung hat seit seiner Entstehung in enger Verbindung mit dem Erwerbssystem gestanden und immer auch arbeitsmarktpolitische Zwecke verfolgt. Seine Rolle hat sich aber im Laufe der Zeit verändert: Bot es zunächst – nicht nur, aber auch – Schutz vor Verelendung, so wurde es mit zunehmender Produktivität und in Wirtschaftskrisenzeiten zum Verwahrungssystem gewendet (Arbeitskräftereserve oder Frühverrentung), um schließlich im Zuge der jüngsten Sozialstaatsreformen Arbeitskräfte und solche, die es werden sollen, wieder freizusetzen (vgl. auch Manske 2005).21
2.2.1 Paradigmenwechsel im System der sozialen Sicherung
Der Wandel vom aktiven Sozialstaat zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat fußt auf einer Krise des Sozialstaats. Als Hauptursache hierfür werden zunehmende Finanzierungsprobleme ausgemacht, ausgelöst – so die gängige Deutung – durch geringes Wirtschaftswachstum und eine immer höhere Staatsverschuldung. Diese wiederum sei verursacht durch stetig ansteigende Sozialausgaben, hohe Arbeitslosigkeit, eine erhöhte Lebenserwartung der Bevölkerung und Globalisierungseffekte (vgl. Bundesrepublik Deutschland 2003, S. 6). Zu Beginn der 1990er Jahre wurde in allen sozialen Bereichen der Rotstift angesetzt, wodurch auch eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft drohte (vgl. Dahme 2008, S. 13). Im Jahr 1997 war denn auch „Reformstau“ das Wort des Jahres (Gesellschaft für deutsche Sprache 1997) und der europäischen Sozialdemokratie wurden schließlich im Juni 1999 durch das sogenannte „Schröder-Blair-Papier“ staatliche Modernisierungsziele ins Stammbuch geschrieben. Bereits in diesem Papier wurden ein Rückzug des Staats und die Erhöhung der Eigenverantwortung der Einzelnen als Orientierungen in Bezug auf die soziale Sicherung benannt, an einer angebotsorientierten Politik22 solle festgehalten werden:
„Ein Sozialversicherungssystem, das die Fähigkeit, Arbeit zu finden, behindert, muß reformiert werden. Moderne Sozialdemokraten wollen das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung umwandeln.“ (Schröder und Blair 1999)
Das neue Leitbild des aktivierenden Staates wurde 1999 in einem Kabinettsbeschluss mit dem Titel „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ (Bundesregierung 1999) fixiert und mit den entsprechenden Schlüsselbegriffen versehen. So werde „gemeinsam mit einer aktiven Gesellschaft“ ein Weg beschritten, der „ein hohes Maß an Flexibilität und Reformbereitschaft“ (ebd., S. 1) voraussetze. Die Verantwortung zwischen Staat und Gesellschaft solle neu geteilt werden, dabei gelte es, eine neue Balance „zwischen staatlichen Pflichten und zu aktivierender Eigeninitiative und gesellschaftlichem Engagement“ (Bundesregierung 1999, S. 2) herzustellen. Dem Staat wurde die Rolle eines Moderators und Aktivators zugeschrieben, seine Stunden als Entscheider und Produzent von gesellschaftlichen Entwicklungen seien gezählt. „Aktivierender Staat bedeutet, die Selbstregulierungspotentiale der Gesellschaft zu fördern und ihnen den notwendigen Freiraum zu schaffen“ (Bundesregierung 1999, S. 2). Dieser Rückzug wurde mit der Aufforderung an die Arbeitsverwaltung verknüpft, leistungsstärker und kostengünstiger zu arbeiten. Im Februar 2002 wurde die Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ unter Vorsitz des VW-Managers Peter Hartz einberufen, die ihren Bericht mit weitreichenden Reformvorschlägen zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit am 16. August 2002 vorlegte (vgl. Hartz et al. 2002).
Die Einführung der „Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ zwischen 2003 und 2005 war also eine Reaktion auf neue Herausforderungen an Wohlfahrtsstaaten und stellte gleichzeitig eine Neuausrichtung des bundesdeutschen Sozialstaatsmodells vom versorgenden Wohlfahrtsstaat zum Aktivierungsstaat dar (vgl. Dingeldey 2007). Ähnliche Reformen waren in den USA unter Bill Clinton (Personal Responsibility and Work Opportunities Reconciliation Act 1996) und von Tony Blair in Großbritannien unter dem Label „New Deal“ bereits angestoßen worden (vgl. Peck und Theodore 2000, S. 120–121). Kern dieser Welfare-to-work-Reformen war die Umsetzung in sogenannten „Work-first“-Programmen, deren Primärziel die möglichst schnelle Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ist. Brown (1997) fasst die „Work-first“-Programmatik folgendermaßen zusammen:
„[…] that any job is a good job and that the best way to succeed in the labor market is to join it, developing work habits and skills on the job rather than in a classroom.“ (Brown 1997, S. 2)
Im „Nationalen Beschäftigungspolitischen Aktionsplan 2003“ wurden die für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik relevanten Maßnahmen – in Verbindung mit der „Agenda 2010“ – ausgeführt, unter anderem ist die Einforderung von Eigenverantwortung und Eigenbeteiligung bereits hier prominent vertreten.
„Die ‚Agenda 2010‘ enthält daher eine Strategie für den notwendigen Umbau der sozialen Sicherungssysteme und für die Senkung der Lohnnebenkosten. Hierzu gehört auch, Fehlentwicklungen in den Sozialversicherungen zu korrigieren und die richtigen Anreize zu setzen. Zukünftig werden von jedem Einzelnen mehr Eigenverantwortung und Eigenbeteiligung gefordert.“ (Bundesrepublik Deutschland 2003, S. 6)
Anschließend wird dargelegt, welche Interessen im Zentrum der nun angestoßenen Aktivierungspolitik stehen:
„Zusätzlich werden mit dem ‚Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt‘ Beschäftigungshemmnisse im Arbeits- und Sozialrecht abgebaut. Die Flexibilitätsinteressen der Unternehmen, die sozialen Sicherheitsbedürfnisse der Arbeitnehmer und die Interessen der Arbeitsuchenden müssen immer wieder neu in ein Gleichgewicht gebracht werden.“ (Bundesrepublik Deutschland 2003, S. 7)
Über die angestoßene Reformierung der Arbeitsmarktpolitik hält die Ökonomie Einzug in die öffentliche Verwaltung (vgl. hierzu auch Krönig 2007, S. 13) und der Wohlfahrtsstaat scheint „alternativlos“23 gezwungen, sich den Anforderungen der (Welt-)Märkte anzupassen (vgl. Butterwegge 2006, S. 238). Auf europäischer Ebene wird die Flexicurity-Debatte angestoßen, eine Debatte um ein beschäftigungspolitisches Leitbild, mit dem die Flexibilitätsanforderungen der Unternehmen und das Sicherheitsbedürfnis der Beschäftigten gleichzeitig verfolgt werden sollen.24 Im Zuge dieser Flexibilisierungsstrategien werden marktförmige Regulationsmechanismen in die Grundstruktur des Sozialstaates eingeflochten: Aus dem Arbeitsamt wird die Bundesagentur für Arbeit und diese soll sich nun als Dienstleistungserbringer um ihre arbeitslosen Kundinnen und Kunden bemühen. Das neue Dienstleistungslabel ist Ausdruck einer zunehmenden Ökonomisierung von Politik und gesellschaftlichen Teilsystemen, die hiervon bisher eher am Rande betroffen waren (vgl. auch Haug 2008, S. 88). Dahme et al. sehen hierin die Entstehung eines Wettbewerbsstaats:
„Die Wettbewerbsphilosophie der Angebotspolitik wird über die Wirtschaft hinaus auch auf andere gesellschaftliche Bereiche ausgedehnt (z.B. die öffentliche Verwaltung, das Bildungssystem wie den Gesundheits- und Sozialsektor), um deren Effizienz zu steigern und um in nichtökonomischen Bereichen ökonomisches Denken zu verwurzeln.“ (Dahme et al. 2008, S. 13)
Die Agentur für Arbeit soll dazu am Leitbild eines modernen Dienstleisters ausgerichtet werden. Damit wird der Kritik sowohl am paternalistischen Charakter der sozialen Sicherung als auch an dem mangelnden Dienstleistungscharakter des deutschen Sozialstaats begegnet.25 Dabei wird der frühere Interventionsauftrag der Arbeitsverwaltung in eine personenbezogene Dienstleistung gewandelt, deren Ziel es ist, das Arbeitskräfteangebot mittels Druck auf die Angebotsseite (Arbeitskräfte) zu erhöhen. Die Umsetzung des Paradigmenwechsels hin zu einer sanktionierenden Aktivierungspolitik vollzieht sich auch in einer „Dienstleistungssemantik“ (Hielscher 2007, S. 355), die den Umbau der Bundesagentur für Arbeit zu einem „leistungsfähigen und kundenorientierten Dienstleister“ (Deutscher Bundestag 2003) heraufbeschwört. Die Transformation des Sozialstaatsprinzips, von Welfare (engl. Wohlfahrt) zu Workfare26, lässt sich am Beispiel der semantischen Neuausrichtung des Arbeitsamts zur Bundesagentur für Arbeit auf den verschiedenen Ebenen darstellen (siehe Tabelle 1), wobei offen bleiben muss, inwiefern sich die Bundesagentur für Arbeit auch in ihrer Binnenorganisationsstruktur dem programmatisch induzierten Wandel anpasst.
Tabelle 1: Semantische Transformation von der Behörde Arbeitsamt zum Dienstleister „Bundesagentur für Arbeit“
Quelle: eigene Darstellung
Während die Arbeitsverwaltung an Effizienzkriterien ausgerichtet wird, erfolgt parallel auf der arbeitsmarktpolitischen Ebene eine Umdeutung der Ursachen von Arbeitslosigkeit: Unterstellt wird nicht mehr unfreiwillige Arbeitslosigkeit infolge fehlender Nachfrage, die Neuinterpretation nimmt nun einen Mismatch von (Arbeitskraft-)Angebot und Nachfrage an, dem auf der Angebotsseite nicht nachgefragte oder zu geringe Qualifikationen, zu hohe Lohnvorstellungen und geringe Flexibilitäts- sowie Mobilitätsbereitschaft zugrunde liegen (vgl. Bartelheimer 2008b, S. 11; Bartelheimer 2010, S. 5–6; Scherschel und Booth 2012, S. 21). Arbeitsuchende sollen individuell zur Arbeitsaufnahme motiviert werden. Der Arbeitsgegenstand und Ansatzpunkt dieser neuen Dienstleistungsarbeitsverwaltung ist das individuelle Erwerbs(such)verhalten. Die einzelnen Subjekte sollen sich den Anforderungen des Arbeitsmarktes anpassen und ihre individuelle Beschäftigungsfähigkeit erhöhen, welche als defizitär erachtet wird (vgl. Peck und Theodore 2000, S. 120; Bartelheimer 2008b, S. 14–17), das dahinter liegende Ziel ist die Ausweitung des potenziellen Arbeitskräfteangebots am Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite werden für die Unternehmen Anreize geschaffen, um Arbeitslose und vor allem Langzeitarbeitslose zu beschäftigen, indem der Einsatz von Leiharbeit erleichtert und der Ausbau von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gefördert wird (u.a. Mini- und Midi-Jobs).28
2.2.2 Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“: Aktivierung zu Eigenverantwortung und Beschäftigungsfähigkeit
Frigga Haug (2008) stellt in ihrer Auseinandersetzung mit den Reformvorschlägen der sogenannten Hartz-Kommission die Frage, ob wir einen neuen Menschentyp schaffen (wollen), der „fit, fähig, flexibel und fantastisch“ (Haug 2008, S. 90) sein soll. Welcher Sozialfigur sollen die „neuen“ aktivierten Arbeitslosen entsprechen? Bereits im Summary des Kommissionsberichts ist die Leitlinie der neuen Arbeitsmarktpolitik mit „Eigenaktivitäten auslösen – Sicherheit einlösen“ (Hartz et al. 2002, S. 19) bezeichnet und im Zentrum dieser Leitidee steht die „eigene Integrationsleistung der Arbeitslosen“ (ebd.). Wie umfassend die damit verbundenen Anforderungen an Arbeitslose zu verstehen sind, zeigt sich wohl am deutlichsten anhand der Wortneuschöpfungen „Ich-AG“ und „Familien-AG“29 der Autoren des Hartz-Berichts (Hartz et al. 2002, S. 30). Das Ich als Aktiengesellschaft, als Wirtschaftsunternehmen – diese Wortzusammensetzung bringt zum einen zum Ausdruck, dass nicht nur die individuelle Arbeitskraft, sondern das ganze Ich – samt zugehöriger Familie – am Markt verhandelbar sein muss. Zum anderen soll dieses Ich wie ein Wirtschaftsunternehmen am Markt auftreten und sich selbstständig vermarkten. Es ist quasi aus der Abhängigkeit von Beschäftigungsverhältnissen freigestellt und soll nun als Unternehmer am Arbeitsmarkt agieren (vgl. Wolf 2008). Das Individuum soll, gleich einem Manager seiner selbst, die einzelnen Wertbestandteile (Aktien) des Ichs erkennen, marktgängig machen, als Portfolio zusammenstellen und verkaufen. Hierzu bedarf es einer erweiterten Selbstkontrolle der Subjekte, einer Anpassung der eigenen Arbeitsfähigkeiten, der Lebensführung und des Leistungsangebots entsprechend den Markterfordernissen, also: das Leben geführt wie ein Unternehmen, der Alltag organisiert wie ein „Normalarbeitstag“ (vgl. Deutschmann 1990). Diese Erwartung an Arbeitslose, eine Art Unternehmerpersönlichkeit zu entwickeln, ein „unternehmerisches Selbst“ (Bröckling 2007) auszubilden, ist natürlich eine enorme Anforderung, sie ist zugleich auch Ausdruck eines Zutrauens, dass Arbeitslose dieses Potenzial haben und ihr Leben eigenverantwortlich gestalten und führen können.
Gleichwohl steht hier vor allem die Zurichtung des Selbst als Arbeitskraft im Zentrum der Arbeitsmarktpolitik. Dabei geht es um eine Arbeitskraft, die deutlich mehr Eigeninitiative, Selbstverantwortung und Subjektqualitäten in die Waagschale wirft, als dies zuvor unterstellt wurde. Damit adressiert diese neue Arbeitsmarktpolitik einen Typ von Arbeitskraft, wie er auch in der modernen Arbeitswelt von den Unternehmen (ein)gefordert wird. Diesem Arbeitskräftetypus kommt die von Voß und Pongratz (1998) beschriebene Sozialfigur des „Arbeitskraftunternehmers“ wohl am nächsten (siehe auch Abschnitt 3.2.1.1).
In der Arbeitswelt wird unter dem Leitbild des Arbeitskraftunternehmers die „Produktion der Produktion“ (Voß und Pongratz 1998, S. 142), d.h. die aktive Herstellung der Arbeitstätigkeit durch die Arbeitenden selbst, zunehmend zur expliziten Anforderung.30 Vergleichbares geschieht im Hilfebezug, so die These dieser Arbeit, unter dem Leitbild „Fordern und Fördern“. Die Reformen des SGB II (vgl. Abschnitt 2.2.3) werden als Anforderung an Arbeitslose interpretiert, eine dem Arbeitskraftunternehmer entsprechende Form menschlicher Arbeitskraft auszubilden.
Die Reformen selbst schließen an jene Forschungsergebnisse an, die die Dynamik von Armutslagen zeigen konnten (vgl. Leibfried et al. 1995; siehe auch Abschnitt 2.1.3), indem nun der Prozess der Überwindung von Hilfebedürftigkeit ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerät. Arbeitslosigkeit wird nicht mehr als statische Zustandsbeschreibung begriffen, der Fokus wird nun darauf gelegt, dass Arbeitslosigkeit aktiv von den Arbeitslosen selbst beendet werden kann und dass im Laufe einer Erwerbsbiografie Phasen von Arbeitslosigkeit einen eher episodenhaften Charakter einnehmen können. Sie knüpfen auch an das „adult worker model“ (Doppelversorgermodell, vgl. Fußnote 3, S. 17) an, ein Lebensführungsmodell, das die egalitäre Rollenteilung innerhalb von Partnerschaften unterstellt und in dem die wohlfahrtsstaatliche Absicherung der Einzelnen über die eigene Erwerbstätigkeit erfolgt (vgl. Oschmiansky und Kühl 2011).
Bettet man diese Entwicklung in den historischen Verlauf des Sozialstaats ein, so liegt auf den ersten Blick der Verdacht nahe, dass wir es mit einer Rücknahme jener institutionalisierten Schutzrechte zu tun, die Arbeitskräfte davor bewahren, um jeden Preis ihre Arbeitskraft zu Markte tragen zu müssen.31 Allerdings hatte der Wohlfahrtsstaat alter Prägung schon immer eine doppelte Funktion, die De-Kommodifizierung ebenso wie auch die „Transformation von Nicht-Lohnarbeitern in Lohnarbeiter“ (Lenhardt und Offe 1977, S. 69). Die Einschätzung, die Reformen seien eine simple Re-Kommodifizierung im Sinne eines Rückfalls in frühindustrielle Zeiten, indem die Ware Arbeitskraft wieder der Marktsteuerung von Angebot und Nachfrage ausgesetzt wird (vgl. hierzu Butterwegge 2006, S. 138), scheint zweifelhaft. Wie Leisering bereits 2001 dargelegt hat (vgl. Leisering 2001), vollzieht sich schon seit geraumer Zeit ein grundlegender Wandel des Wohlfahrtsstaats in Richtung Re-Kommodifizierung, allerdings in erweiterter Form nun auch tief im Subjekt.
Wie ist das zu verstehen? Die qualitativ neue Form der Re-Kommodifizierung zeigt sich darin, dass Marktgängigkeit nicht bloß als Anforderung an die Subjekte herangetragen wird, indem einer De-Kommodifizierung der institutionelle Boden entzogen wird. Die Zurückeroberung durch die Marktmechanismen erfolgt in Form einer „inneren Landnahme“ (in Anlehnung an Rosa Luxemburg, vgl. Dörre 2010). Diese „innere Landnahme“ findet im Rahmen von Subjektivierungsprozessen statt. Die Umsetzung von Eigeninitiative und -verantwortung soll von den Subjekten nicht nur selbst vollzogen, sondern auch selbst gewollt werden. Subjektivierung meint hier: Das Interesse sozialstaatlichen Handelns soll von den Subjekten internalisiert werden und zu ihrem individuellen Interesse werden, zumindest aber hingenommen und nicht in Frage gestellt werden. Der „Funke des Leistungsprinzips“ (Honneth 2011, S. 426) soll von den Erwerbstätigen auf die Nicht-Erwerbstätigen überspringen. Die Subjekte, ob erwerbstätig oder arbeitsuchend, sollen die Anforderung von individueller Selbstvermarktung, Selbstmanagement und Selbstoptimierung selbst als legitim erachten. Und tatsächlich deuten die unten referierten Forschungsergebnisse im Rahmen der SGB-II-Begleitforschung darauf hin, dass dieser Funke längst übergesprungen ist; dass sich Arbeitslose als sehr aktiv präsentieren und ihren Beitrag leisten wollen (vgl. u.a. Bescherer et al. 2008; Hirseland und Ramos Lobato 2010; Pfeiffer et al. 2012; siehe auch Abschnitt 2.3).
Hartz IV scheint unter diesem Blickwinkel eine Art Rosskur32 für den deutschen Arbeitsmarkt zu sein, unter Anwendung der Heilmittel Dynamisierung und Flexibilisierung. Man könnte es auch anders formulieren: mittels Destabilisierung und Re-Kommodifizierung. Der Sozialstaat wandelt seine Gestalt und wird zu einem aktivierenden Wohlfahrtsstaat, dabei wendet er nun das ökonomische Prinzip33 auf einen davon bisher ausgenommenen Bereich (Sozialhilfe) an und radikalisiert dieses auf dem Arbeitsmarkt, indem vormals sozialpolitisch regulierte Bereiche dereguliert werden. Aus der Perspektive kapitalistischer Verwertungslogik ist daran charmant, dass man nicht nur zwei Fliegen mit einer Kommmodifizierungsklappe schlägt, indem die Reformen Eigenverantwortung verstärkt aktivieren und zugleich Selbstökonomisierungsprozesse anstoßen. Im Grunde hat man einen Dreizack zur Hand: Die Reformen entfalten nicht nur Wirkung im Segment der Arbeitslosigkeit, sondern bis in den Kern der Arbeitswelt hinein und erzeugen bzw. verstärken bei Leuten, die Arbeit haben, Verunsicherung und Angst um den eigenen Arbeitsplatz, also an an einem Ort, der unmittelbar gar nicht adressiert ist. Beschäftigte, die um ihren Arbeitsplatz fürchten, haben ja auch eine erhöhte Konzessionsbereitschaft.34 Ob intendiert oder nicht, der Verunsicherungswirkung wird verbal und regulatorisch kaum entgegengetreten.