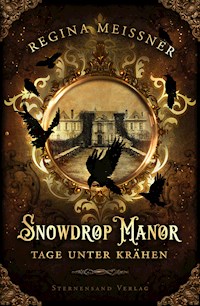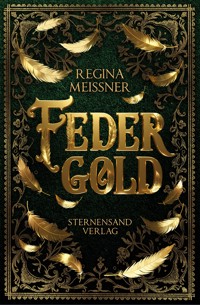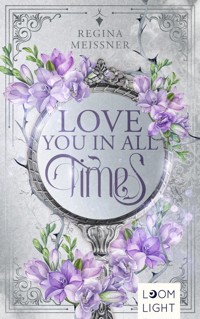4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Von Schatten gefangen.In die Dunkelheit getragen.Ivory ist an dem Ort, vor dem sie sich ihr Leben lang gefürchtet hat: Embonis. Dort soll sie ihre Aufgabe erfüllen und das Tor zur Menschenwelt öffnen. Als sich ein folgenschwerer Fehler ereignet, scheint die Katastrophe unaufhaltsam. Doch Ivorys Kampfgeist ist ungebrochen, auch wenn die Erinnerung an Kil wie ein Phantom durch ihre Gedanken spukt.»Seductio - Von Dunkelheit getragen« ist der zweite Teil der Seductio-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kilian
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kilian
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 2
Kilian
In einer vollkommen dunklen Kammer erstrahlte plötzlich ein helles Licht. Sein Funke verbreitete sich rasch, schon bald ließen sich die Konturen des Raumes erkennen. Vor einem kleinen Fenster standen ein ramponierter Tisch und ein Stuhl. Anstelle eines Bettes gab es nur eine Art Pritsche, auf der eine löchrige Decke lag, die von Zeiten erzählte, die lange zurücklagen. Der Teppich, der den schimmeligen Boden bedeckte, war lilafarben und an den Enden leicht ausgefranst.
Er stand mit beiden Beinen auf ihm und hielt die Öllampe fest in der Hand. Eigentlich durfte er sich nicht hierhin zurückziehen, zumindest sollte er es nicht. Vor vielen Jahren hatte Glancore diese Kammer bewohnt, seitdem stand sie leer. Wahrscheinlich wusste der Fürst schon lange nicht mehr, dass es das Zimmer am Ende des Ganges überhaupt gab. Nur wenige Bedienstete maßen den gesamten Flur mit ihren Schritten. Es hieß, Glancores Tür wurde nur passiert, wenn in der Nähe Reinigungsarbeiten zu verrichten waren. Ihm schien ein solches Verhalten nur recht. Ihn kümmerten die Gerüchte um das Verschwinden des Kammerdieners nicht, viel mehr halfen sie ihm, einen Ort aufzubauen, an dem er allein sein konnte. Stunden des Nachdenkens hatte er hier bereits verbracht und mehr als einmal daran gedacht, über seinen Stand hinaus zu handeln. Glancores Schicksal verhalf ihm zu ein wenig Privatsphäre. Seufzend ließ er sich auf die Pritsche sinken, die Öllampe wurde auf den Tisch gestellt. Es tat gut, die Füße hochzulegen, vor allem nach diesem anstrengenden Tag. Ihm war bewusst geworden, dass man wochenlang auf etwas hinfiebern konnte, das dann immer zu schnell kam. Mühsam schälte er sich aus dem Mantel und beäugte die verblichene Jeans skeptisch. Er sollte sich umziehen. Die freie Wahl der Kleidung stellte einen der vielen Vorteile der Menschenwelt dar. Im einundzwanzigsten Jahrhundert war so ziemlich alles erlaubt. Er hatte wenig Lust, sich in umständliche Roben zu hüllen – aber genau so würde es kommen. Gerade daher genoss er die gestohlene Zeit, die er in Glancores Kammer verbrachte. Nach und nach streckte er seinen Körper, bis er ganz auf dem Rücken lag. Früher einmal hatte er die Betten der Bediensteten als Qual empfunden, mittlerweile schätzte er ihre Härte. Es ließ sich besser nachdenken, wenn man nicht in einem Meer aus Decken versank. Nach einer Zeit der Stille drehte er sich nach links und erhob sich so weit, als dass er seine Hand als Stütze für den Kopf benutzen konnte. Wie spät es wohl sein mochte? Allerhöchste Zeit, schrie die alarmierte Stimme in seinem Bewusstsein, aber er ignorierte sie, obgleich er merkte, dass sein Herz nicht mehr so regelmäßig und stetig schlug wie noch vor ein paar Stunden. Wie lange würde er es dieses Mal schaffen? Er wollte die Fragen, die durch seinen Kopf schossen, ausblenden, doch mit jeder verstrichenen Sekunde wurden sie größer. Zornig presste er die Lippen aufeinander, seine Hand ballte sich schon zu einer Faust. Das Gefühl konnte plötzlich auftreten, von jetzt auf gleich. Manchmal kündigte es sich leise an und war unter Kontrolle zu bekommen, andere Male prasselte es auf ihn ein wie ein Unwetter. Es war falsch gewesen, derart menschlich zu werden. Er hatte es gewusst und es dennoch getan. War der Drang nun die Strafe für sein törichtes Verhalten? Immerhin war er auf den ältesten Trick hereingefallen. Doch das Gefühl, ganz zu sein, war einfach zu mächtig. Er zwang sich dazu, aufzustehen. Manchmal half es, im Geiste Listen aufzustellen. Listen zu banalen Themen. Trivialität unterdrückte den Drang in einem gewissen Maß. Noch konnte man dagegen ankämpfen. Seine Stirn legte sich in Falten, als er sich auf den klapprigen Stuhl setzte. Länder, überlegte er, schüttelte dann aber den Kopf. Zu oft hatte er sich alle Orte der Welt in Erinnerung gerufen. Neue Themen mussten her. Doch während er nachdachte, schlich sich das Gefühl tiefer in seine Eingeweide. Wie eine giftige Schlange umschloss es den Bereich, an dem der Mensch eine Seele hatte, und vergiftete sein Herz. Kilian bekam Atemnot, seine Kehle wurde eng. Würgend und spuckend presste er beide Hände an seinen Hals, hustete, versuchte, den Drang irgendwie zu unterdrücken. Doch genau in diesem Moment trafen ihn die Bilder. Eines nach dem anderen stahl sich in sein Bewusstsein. Einzeln waren sie wie kleine Messerstiche, zusammen töteten sie. Kils Augen wurden glasig und leer, er fand sich in Krämpfen wieder. Die Sehnsucht nach etwas Menschlichem war größer und mächtiger als all seine Gedanken zusammen. Gleich, wie erbost er dagegen anzukämpfen suchte, das Gefühl hatte ihn. Vor seinen Augen erschienen Bilder der Menschen, die er getötet hatte, doch nicht wie sonst empfand er Reue. Viel mehr löste der Gedanke an Animus eine Sehnsucht in ihm aus, die zu groß war, als dass er sie hätte ertragen können. Blind fanden seine Finger den Weg in die Hosentasche. Zitternd umgriff er das winzige, gläserne Fläschchen, in dem sich nicht mehr als wenige Tropfen einer Flüssigkeit befanden. Gierig drehte er den Verschluss lose. Noch bevor der Deckel scheppernd auf den Boden fiel, setzte er die Flasche an seine Lippen. Es glich einem Hauch von nichts, und doch konnte er erst aufatmen, als der letzte Tropfen seinen Gaumen heruntergeflossen war. Kilian brauchte keinen Spiegel, um zu wissen, dass sich die Farbe seiner Augen änderte. Das Leere, Tote verschwand und verwandelte sich in etwas, das man annähernd als menschlich bezeichnen konnte. Wütend darüber, schwach gewesen zu sein, schleuderte er die Flasche aus seiner Hand. Sie prallte gegen die hölzerne Pritsche und rollte schließlich über den gesamten Boden. Kil stampfte zweimal mit dem Fuß auf. Er schaffte es einfach nicht, standhaft zu bleiben. Aber konnte er es sich selbst übel nehmen? War es nicht normal, dass man gegen Umwelt und Anlage schutzlos schien? Schweißtropfen hatten sich auf seiner Stirn gebildet. Als er aufstand, fühlte er sich lebendig. Keineswegs gut, denn dazu war das Mittel nicht in der Lage. Es überdeckte nur, es hüllte ein und machte taub. Kilian hasste sich dafür, dass der Inhalt eines Fläschchens über seinen Zustand entschied. Doch wer einmal von der verbotenen Frucht gekostet hatte, kam nie mehr von ihr los.
Ich weiß, dass ich träume, entscheide mich aber dagegen, aufzuwachen. Ich stehe auf einer großen, grünen Wiese, die friedlich wirkt. Erste kleine Blumen kämpfen sich ihren Weg durch die Erde. Vereinzelt haben sich schon Knospen geöffnet. Vorsichtig streiche ich mit meiner Hand über die zarten Gewächse. Während ich in völliger Stille den Frühlingstag genieße, kitzelt mich die Sonne. Es ist schön, von etwas so Mächtigem angestrahlt zu werden. In diesem Moment frage ich mich, wieso ich den Mond immer magischer als die Sonne fand. Ist es manchmal nicht besser, dem Licht zu folgen? Genüsslich schließe ich die Augen. Für einige Momente scheint die Zeit stillzustehen. Ich vergesse das Leben, aus dem ich komme, ich vergesse den Schmerz, der mir einst den Atem raubte. Stattdessen nehme ich diesen ersten Frühlingstag ganz in mir auf, koste ihn mit all meinen Sinnen. Das Zwitschern der Blaumeisen wird zu meiner persönlichen Melodie. Summend versuche ich, den Tönen gerecht zu werden, doch sie klingen falsch aus meinem Mund. Umständlich trenne ich mich von der dünnen Jacke, die ich trage. Mit dem Stoff fällt auch eine Last von mir, von der ich gar nicht weiß, dass ich sie noch immer mit mir herumtrage. Nur kurz öffne ich die Augen.
Der Stand der Sonne hat sich verändert; der glühende Ball am Himmel ist tiefer gesunken. Auch der Himmel ist nicht mehr so blau wie eben. Der Morgen geht in einen Nachmittag über. Von fern höre ich das Plätschern eines Wasserfalls. Eine fremde Macht treibt mich in die Höhe. Wie bezaubert bin ich von der Melodie der Tropfen, die einzeln ihren Weg auf die Erde finden, aber nur zusammen wirklich gigantisch sind. Mit nackten Füßen folge ich dem Geräusch. Eine Abkühlung tut an heißen Tagen gut. Schemenhaft erkenne ich bald den Wasserfall, vor dem eine Reihe Steine liegt. Weil ich das Kind in mir nie besiegt habe, hüpfe ich übermütig von einem zum anderen und lache, als ich schwanke. Irgendwie hat mich die Gefahr schon immer fasziniert.
Als meine Hände beinahe den Wasserfall berühren, passiert es. Von fern her dringt eine Stimme an mein Ohr.
»Folgst du mir?«
Augenblicklich spannt sich alles in mir an. Meine Ohren spitzen sich ganz von selbst, obgleich ich meine Antwort schon kenne.
»Wohin du auch gehen willst.«
Ich schlucke schwer, kann nichts dagegen tun, dass sich die Bilder plötzlich in mein Gedächtnis drängen. Sie kriechen aus allen Ritzen, setzen sich fest und bringen mich zum Wanken. Meine Beine fühlen sich wie Pudding an, unnötigerweise suche ich nach Halt, bevor ich vornüber auf die Steine falle.
Wut steigt in mir auf. Wut auf das, was geschehen ist. Wut auf Kilian Aven, dem ich zu Unrecht traute. Aber mein Zorn verpufft so schnell, wie er gekommen ist. An seine Stelle tritt ein Gefühl, das ich bisher nicht gekannt habe.
Mein Herz bricht.
Ein salziger Geruch stieg in meine Nase. Irritiert schlug ich die Augen auf. Nach einem Moment des Schocks realisierte ich, dass ich auf dem kalten Gefängnisboden lag. Irgendwie musste es mir gelungen sein, einzuschlafen. Kaltes Licht schien durch das Fenster und ließ mich frösteln. Die salzige Nuance ließ sich nicht aus meinem Geruchsfeld vertreiben. Verwirrt blickte ich um mich herum. Der dicke Wachmann von gestern Abend saß noch immer vor der Zelle, mit dem Unterschied, dass er mir den Rücken zugekehrt hatte. Ich musste die Zeit, in der er mich schlafend vermutete, unbedingt nutzen. Mehr Privatsphäre würde ich hier nicht bekommen. Meine Haare hingen mir ins Gesicht, weswegen ich sie mir so gut es ging hinter die Ohren steckte. Dabei stieß meine Hand gegen mein Gesicht. Als hätte mich ein gefährliches Insekt gestochen, zuckte ich zusammen. Wieso waren meine Wangen nass? Was war …? In diesem Moment setzte der Schmerz ein. Ich erinnerte mich nicht nur an den Traum, sondern auch an alles, was geschehen war. Die eisige Hand des Verlustes legte sich um meine Kehle und raubte mir den Atem.
»Du bist wach«, brummte der Wächter prompt. Schwerfällig drehte er sich zu mir um, inspizierte mich genau. Ein wenig zu spät wandte ich mich von ihm ab. Das Licht hier unten war nicht das beste, dennoch hätte er meine Tränen bemerken können. Hektisch fuhr ich mir mehrmals über die Augen, betend, dass sie noch nicht gerötet waren. Der Traum hatte mir all meine Schwächen offenbart, er verletzte mich und machte mich zu etwas, das ich nie sein wollte: schwach. Entschlossen reckte ich den Kopf. Nie im Leben würde ich Schwäche vor den Decessaren zeigen. Obwohl mein Körper zitterte, drehte ich mich um, sodass ich den Wachmann anschauen konnte. Sekundenlang starrten wir uns einfach nur an, bis er schließlich den Blick senkte.
Wenigstens ein kleiner Erfolg.
»Mir wurde gesagt, dass du Essen brauchst«, brummte der Wachmann. Ich sah, wie er auf einen hölzernen Teller und einen Becher zeigte, die neben seinem Stuhl standen. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass meine Kehle wie ausgetrocknet war. Gierig fingen meine Augen das Wasser ein, welches sich in dem Gefäß befand. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sich der Mann erhoben und mir den Becher gereicht hatte. Obwohl ich so durstig war und die Flüssigkeit am liebsten an mich gerissen hätte, achtete ich genau darauf, den Decessar in keiner Weise zu berühren. Elegant glitten meine Finger an ihm vorbei und schlossen sich nur um das Gefäß. Ich trank schneller, als ich schlucken konnte. Wohltuend rann das Wasser meine Kehle hinab. Bevor ich mich dazu zwingen konnte, mir den Rest für später aufzuheben, war der Becher leer. Erschrocken blickte ich auf das hölzerne Gefäß.
»Leer?«, grunzte der Wachmann, wartete die Antwort jedoch nicht ab. Seine speckigen Finger hatten sich schon durch das Gitter gequetscht und nach dem Becher gegriffen. Verzweifelt suchte ich den Boden nach einer Karaffe oder Ähnlichem ab, aber anscheinend hatte man nicht vor, mir mehr als ein Glas Wasser zu überlassen.
»Hier ist dein Essen.« Unwirsch griff der Mann nach dem Teller. Er musste ihn schräg halten, sodass er durch die Stäbe passte. So berührten seine ungewaschenen Finger das Brot, das alles andere als frisch aussah. Ich nahm den Teller entgegen. Das Brot war so hart, dass ich es mit meinen Fingern nicht in kleine Brocken reißen konnte. Es wäre besser gewesen, es in dem Wasser einzuweichen. Vergeblich versuchte ich, ein Stück abzubeißen, dabei kam ich mir vor, als wollte ich eine Mauer einreißen. Mein Magen rumorte. Ich knetete das Brot in meinen Händen weich und nahm es schließlich so lange in den Mund, bis meine Spucke einen Teil davon durchweicht hatte. Appetitlich sah anders aus, doch so war ich wenigstens in der Lage, das erste Stück abzubeißen. Dies hatte zur Folge, dass sich Trockenheit in meiner Kehle ausbreitete. Nur mit Mühe schaffte ich es, das alte Brot herunterzuschlucken.
»Wie lange willst du denn noch auf dem Stück herumkauen?«, beschwerte sich der Wächter. Seit ich den Teller entgegengenommen hatte, waren seine Schweinsaugen nicht von mir gewichen. Sein penetranter Blick machte mich wütend. Verbissen kaute ich weiter auf dem Brot herum.
»Was ist jetzt? Hast du fertig gegessen?«
»Sieht es so aus?«, fauchte ich. Noch immer hielt ich mehr als ein Drittel des Brotes in den Händen.
»Dann gib mir doch wenigstens den Teller!« Ich sah, wie sich seine speckigen Finger durch das Gitter drängten. Ich wich zurück; die Wut in mir löste meine Zunge.
»Hol ihn dir doch!« Herausfordernd warf ich den Holzteller auf den Boden. Klappernd prallte er auf die Steine. Die Augen des Wachmannes funkelten gefährlich.
»Das werde ich dem Fürsten sagen! Dein Benehmen ist nicht tragbar!« Zornig hatte er sich erhoben. Wild funkelnd schaute er mich an, doch ich hatte lediglich Spott für ihn übrig.
»Sag es ihm doch! Was kann schon passieren? Dass er mich verbannt? In die Menschenwelt?« Ich lachte laut auf.
»Die M…menschenwelt?«, stammelte er. Die Stimme des Wachmannes klang nun beinahe ängstlich. Allerdings hielt dies nur eine Sekunde lang an. Mit stockendem Atem sah ich, wie der dicke Mann enger an das Gitter trat. Mit seinen Armen rüttelte er an den Stäben, trat auf sie ein und griff durch sie, um nach mir zu packen. Purer Wahnsinn stand in seinem Gesicht, es hatte sich in eine Fratze des Zorns verwandelt. Aus Selbstschutz und weil ich ihn nicht einschätzen konnte, rettete ich mich in die äußerste Ecke der Zelle.
»WER HAT DIR DIE ERLAUBNIS GEGEBEN, VON DER MENSCHENWELT ZU SPRECHEN?«, schrie er. Seine wahnsinnige Stimme hallte von den nackten Wänden wider. Obwohl ich mir vorgenommen hatte, mich nicht ängstlich zu zeigen, zuckte ich zusammen. »DU GLAUBST WOHL, DASS DU DICH AN GAR KEINE REGELN HALTEN MUSST, ODER?« Erneut trat er wild gegen das Gitter. Speichel lief seine Mundwinkel hinunter; er schien den Verstand verloren zu haben. »WENN DU STERBLICH WÄRST, WÜRDE ER DICH TÖTEN! ER WÜRDE DICH IN STÜCKE REIßEN!«
»Wenigstens müsste ich dich dann nicht mehr sehen«, entgegnete ich mutig und wartete, bis er mich fassungslos ansah. Triumphierend wandte ich mich ab.
»Du wirst schon noch sehen, was du davon hast! Mit so einem Benehmen ist noch niemand durchgekommen. Wenn der Fürst erst …«
Betont langsam drehte ich mich um. Wenn ein Mensch sich aufregte, spürte man den Zorn in jeder Faser des Körpers, vor allem jedoch änderte sich seine Gesichtsfarbe. Der natürliche Hautton wechselte in ein dunkles Rot. Wenn ein Schatten sich aufregte, blieb er blass.
»Du machst mir keine Angst«, zischte ich leise.
»Das ist doch die Höhe!« Energisch ballte er seine Hand zu einer Faust. »So ein Benehmen muss ich mir von dir nicht gefallen lassen! Ich werde es …«
»Ja, ja, du wirst es dem Fürsten sagen«, beendete ich seinen Satz. Überrascht riss der nicht allzu intelligente Wachmann die Augen auf.
»Woher …«
In dieser Situation verhielt ich mich aufbrausend, mutig und wagte viel. Trotzdem musste ich mir eingestehen, dass meine Courage nicht halb so ausgeprägt gewesen wäre, hätte sich nicht das stabile Gitter zwischen uns befunden.
»Sei vorsichtig. Wenn du dich nicht ruhig verhältst …«
Mittlerweile gingen seine Drohungen spurlos an mir vorüber. Wieso sollte ich mich von einem Mann einschüchtern lassen, dessen Intelligenzquotient irgendwo im Nirwana angesiedelt war?
»Ist noch was?«, fragte ich patzig. Die Arme hielt ich vor meinem Oberkörper verschränkt.
»Was … hast du da eigentlich an?«, brach es plötzlich aus ihm heraus. Irritiert blickte er zweimal an mir herunter. In diesem Moment wurde mir bewusst, was er meinte. Meine Kinnlade klappte herunter. Gestern Nacht, im Licht einer einzigen Fackel, war es schwierig gewesen, meine Garderobe auszumachen, doch nun, wo die Sonne zwar schwach, aber sichtbar durch das Fenster schien, konnte der Wachmann meine Hosen genau unter die Lupe nehmen.
»Das ist … das ist nun so modern«, stammelte ich.
»Modern?«, schrie er. »Es soll modern sein, sich wie ein Mann zu kleiden?« Spott sprach aus seiner Stimme, Missgunst und eine Spur von Wut. Anscheinend hatte man die Schatten in Embonis nicht allzu gründlich über unsere Welt aufgeklärt. Jedenfalls nicht alle.
Vielleicht war es das Schweigen, das mich es bemerken ließ. Vielleicht hatte ich es die ganze Zeit verdrängt. Jetzt aber wurde mir sein ganzes Ausmaß bewusst.
»Ähm …«, stammelte ich und versuchte, mit der Wache Kontakt aufzunehmen. Wie der Zufall es wollte, hatte der Mann sich aber von mir abgewandt.
»Entschuldigung, ich …« Ich hasste mich dafür, ihn um einen Gefallen bitten zu müssen, gerade weil ich mich eigentlich so undankbar und störrisch wie möglich zeigen wollte. Doch mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde der Drang in mir heftiger. Verzweifelt biss ich die Zähne zusammen.
Vielleicht gab es noch eine andere Möglichkeit … Nur für den Hauch eines Moments schaute ich auf das ohnehin schon nasse Stroh. Nein, nie im Leben! Angewidert schüttelte ich den Kopf.
»Ich …« Ich rang mit mir, doch meine Blase gewann.
»Entschuldigung, aber ich … müsste mal … austreten.« Beschämt senkte ich den Blick; ich konnte die Röte auf meinen Wangen spüren. Endlich drehte sich der Wachmann um.
»Hä?«, hakte er unwissend nach. Zorn stieg in mir auf, weil ein Teil von mir glaubte, dass er mich sehr wohl verstanden hatte und mein Unwohlsein so nur verstärken wollte. Nervös trat ich von einem Bein aufs andere.
»Ich muss … auf die Toilette … den Abort. Wenn du verstehst, was ich meine.«
Mir war das Ganze schrecklich peinlich. Der Moment, in dem mich der dicke Mann nur belustigt angaffte, zog sich wie Kaugummi.
»Kannst du das nicht einfach …«, startete er einen Versuch und deutete auf das Stroh.
»GANZ SICHER NICHT!«, fiel ich ihm ins Wort.
»Na, von mir aus. Aber dann beeil dich gefälligst!«
Dankbar nickte ich. Meine Blase drohte zu platzen. Der Weg nach draußen kam mir endlos vor.
»Koral, ich brauche den Schlüssel!«, schrie die Wache prompt durch den Gang. Das Echo seiner Stimme war gigantisch und machte mir ein erneutes Mal bewusst, dass ich mich an einem Ort befand, der so leer war wie die Seele eines Schattens.
Es dauerte exakt zwölf Sekunden, bis Schritte zu vernehmen waren. Ein anderer Wachmann, der auf den Namen Koral hörte, bog um die Ecke. Zwischen seinen klobigen Fingern lag ein wuchtiger Schlüsselbund.
»Was ist los?«, brummte er und sah den Dicken auffordernd an. Dann traf sein Blick mich.
»Wo kommt die denn her?«, fragte er seinen Kollegen, starrte aber weiterhin auf mich. Augenblicklich fühlte ich mich unwohl. Am liebsten hätte ich mich unsichtbar gemacht. Ich wusste, was so ein Blick bedeutete. Ich hatte ihn hunderttausend Mal in Filmen gesehen und ebenso oft wurde ich von meiner Tante vor ihm gewarnt.
Koral hatte die Augen zusammengekniffen und den Kopf schief gelegt. Seine Zunge trat ein Stück aus dem Mund hervor. Er sah wie ein Raubtier aus, das sich auf Beutefang befand. Und die Beute – ich schluckte – war ich.
»Das Weib ist gerissen!«, polterte der Dicke in diesem Moment. »Sie will mir nicht sagen, was sie ausgefressen hat.«
Noch immer maß mich Koral mit seinen Blicken.
»Sie hat seltsame Sachen an«, ließ er in Richtung seines Kollegen verlauten. »Aber sie hat ein hübsches Gesicht«, fuhr er fort und starrte mir ohne Scham auf den Busen.
»Keine Ahnung. Ist mir noch nicht aufgefallen.«
»Und warum brauchst du jetzt den Schlüssel?«
»Sie muss einem Bedürfnis nachgehen.«
Korals Lippen spitzten sich, als er verstand. Betont langsam fuhr er sich durch seine langen, aschblonden Haare, die er im Nacken unordentlich verknotete. Zum ersten Mal erhaschte ich einen uneingeschränkten Blick auf sein Gesicht. Die Nase war um zwei Nummern zu groß gewachsen, dafür schienen die Augen viel zu klein.
»Lass mich das machen. Ich begleite sie«, bot er an. Nur mühsam konnte ich einen Aufschrei unterdrücken. Zum Glück schüttelte der dicke Wachmann den Kopf. »Befehl des Fürsten. Ich bin für die Kleine verantwortlich.« Bedauernd sah er ihn an.
»Aber mir kann niemand verbieten, dass ich dich begleite, Cal, oder?« Sadistisches Verlangen sprach aus Korals Stimme.
»Ich weiß zwar nicht, was du davon hast, aber nein«, gab er sich geschlagen. Erst nun wurde ihm der Schlüssel ausgehändigt. Mit angehaltenem Atem sah ich, wie die Tür geöffnet wurde. Ich traute mich nicht, den jungen Wachmann aus den Augen zu lassen.
»Na los, komm schon raus! Oder musst du jetzt nicht mehr?«
Doch. Das ist ja das Problem.
Ich schluckte schwer. Meine Beine fühlten sich wie Pudding an, als ich langsam auf die offene Tür zutrat. Die Ivory von gestern hätte ihre Fluchtmöglichkeit genutzt. Ohne Umschweife wäre sie an den Männern vorbeigerannt und hätte sich ihren Weg durch das unterirdische Gefängnis freigekämpft. Die Ivory von gestern hätte es vielleicht sogar zum Tor und zurück zu den Menschen geschafft. Nun gelang es mir kaum, einen Fuß vor den anderen zu setzen.
»Wird’s bald? Wir haben nicht ewig Zeit!« Vorsichtig schob ich mich durch das Gitter. Sogleich ergriff der dicke Wachmann noch meinen linken Arm. Diebisch grinste er mich an.
»Falls du auf dumme Ideen kommst«, kommentierte er und verstärkte seinen Griff um ein Vielfaches. Mir wurde schwindelig. Ich hatte Mühe, mit Cals Schritten mitzuhalten. Koral lief unauffällig hinter uns her, und das war das Schlimmste. Bestimmt starrte er mir ungeniert auf den Arsch! Verzweifelt versuchte ich mit einer Hand, mein Oberteil nach unten zu ziehen.
Die Gänge kamen mir kürzer vor als gestern. Binnen weniger Minuten hatten wir die Treppe erreicht.
»Koral?«, fragte Cal. Ich drehte mich nicht um.
»Geh voraus. Ich will nicht, dass sie sofort wegläuft, sobald sie das Tageslicht sieht. Zur Not musst du sie festhalten!«
Koral unterdrückte einen Fluch. Dennoch stahl er sich an mir vorbei. Gänsehaut benetzte meinen Körper und war noch da, als Koral längst weitergegangen war.
Als Cal die Tür aufgeschlossen hatte und wir herausgetreten waren, stach das Licht unangenehm in meinen Augen. Ich war bereits an die Dunkelheit des Gefängnisses gewöhnt. Schnell ließ ich die Lider sinken. Kurz darauf merkte ich, dass wir den Hügel hinunterliefen. Als ich die Augen wieder öffnete, merkte ich, dass Embonis ähnlich verlassen aussah wie gestern. Nur vereinzelt stieg Rauch aus den Schornsteinen auf. Wir durchquerten das überschaubare Dorf, betraten schließlich ein Stück Wald.
»Da vorn ist ein Fluss«, erklärte der Wachmann, der mich festhielt. »Ich werde dich bis dorthin begleiten. Da kannst du dann … wie auch immer. Falls dir einfällt, wegzulaufen …« Er klopfte auf seine Hosentasche. Verwundert runzelte ich die Stirn. Die Decessaren lebten wie im achtzehnten, höchstens neunzehnten Jahrhundert, demnach würde er kaum eine moderne Schusswaffe bei sich tragen. Um was handelte es sich dann? Ein Messer? Eine Bombe?
»Na wird’s bald!«, riss er mich aus meinen Gedanken. Ich zuckte zusammen. Den Fluss, von dem er gesprochen hatte, sah ich erst nach einigen Schrecksekunden. Es war ein komisches Gefühl, wieder frei laufen zu dürfen. Zwar war ich mir der aufmerksamen Blicke in meinem Rücken bewusst, dennoch genoss ich die eingeschränkte Freiheit, welche mir zuteilwurde. Wackeligen Schrittes ging ich auf den kleinen Fluss zu. Ich nutzte die Gunst der Stunde, um mich zudem behelfsmäßig zu waschen. Zwischendurch schaute ich immer wieder zu den zwei Wachmännern. Ich hatte Angst, dass Koral auf dumme Gedanken kam. Jedes Mal, wenn ich ihn brav neben dem dicken Mann sah, atmete ich erleichtert aus.
»So, das reicht jetzt!«, sagte dieser auf einmal. Entschlossen trat er auf mich zu. Ich kniete noch, als er mich schon am Arm nach oben zog.
»Aua!«, klagte ich. Unwirsch zwang er mich zum Weitergehen. Sein verseuchter Atem löste Übelkeit in mir aus. Angewidert verzog ich das Gesicht.