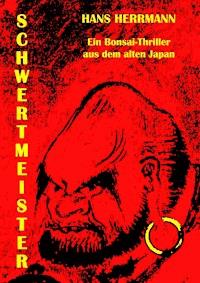1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Zweiter Weltkrieg; die neutrale Schweiz hat sich eingeigelt. Hauptmann Felix Weidlin bekommt vom Oberbefehlshaber der Schweizer Armee den Auftrag, in den Alpen nach dem optimalen Standort für den Bau eines geheimen Generalsbunkers zu suchen. Dabei soll er sich an einer alten Älplersage orientieren, die Hinweise auf eine rätselhafte, nahezu unauffindbare Örtlichkeit enthält. Weidlin bricht auf in die Bergwelt. Schon bald geschieht Seltsames: Warum verschwindet auf einmal ein Bunkerbau-Ingenieur, und warum schaltet sich der militärische Nachrichtendienst ein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Ähnliche
Hans Herrmann
Seefeld
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Manchmal denke ich, ich bin verrückt. Denn was ich seinerzeit während des Zweiten Weltkriegs im Berner Oberland erlebte, hat mit der Realität, wie wir sie kennen, wenig zu tun.
Aber was ist Realität? Wir kennen sie nicht wirklich, wir geben nur vor, sie zu kennen, weil wir wissenschaftsgläubig geworden sind und denken, die Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, die Ingenieurswissenschaften und die Informatik, weiter die Medizin und die Psychologie hielten Antworten auf alle unsere Fragen bereit – wenn nicht heute, dann sicher morgen.
Ja, die Welt ist längst entzaubert, ihre Magie verschwunden. Jedenfalls für einen Grossteil der Menschen in den westlichen Gesellschaften. Vielleicht, weil sie nur die Oberfläche sehen. Der tiefere Blick ist jenen vorbehalten, die sich an den Grenzen des Denkbaren bewegen. Sie hören nicht auf, Fragen zu stellen – wie neugierige Kinder, die den vorgestanzten Antworten der Erwachsenen stets ein neues «Warum?» entgegenstellen. Das Geheimnis beginnt dort, wo die Wissenschaft keine Antworten mehr weiss, vielleicht auch nie wissen wird. Dort, wo die objektive Wahrheit des Wissens übergeht in die subjektive Wahrheit des Staunens.
Interessanterweise sind es gerade die angeblich so «nüchternen» Naturwissenschaften, die uns immer wieder neue Welten des Wunderbaren erschliessen und in Bereiche vordringen, denen der menschliche Verstand kaum gewachsen ist. Einen solchen Bereich bilden zum Beispiel die unendlichen Weiten des Weltalls. Hier endet die Ratio, hier beginnt das Staunen. Hier rechnet man in astronomischen Zahlen, die das Gehirn nicht wirklich fassen kann. Hier tummeln sich Diamantplaneten, Alkoholwolken, Quasare, Pulsare, Rote Riesen, Weisse Zwerge und Schwarze Löcher mit ihren unergründlichen Rätseln. Hier gibt es mystische Phänomene wie die Zeitdilatation, die Ausdehnung des Alls, den Urknall, der vielleicht doch keiner war, und die Möglichkeit von parallelen Universen, in denen Abermillionen von Doppelgängern unserer selbst existieren.
In den Weiten und Tiefen des Alls ist nichts so, wie wir es im Augenblick zu verstehen glauben. Denn wir werden niemals in der Lage sein, diese Codes eines grossen Geheimnisses mit unseren dürftigen technischen Möglichkeiten und unserem begrenzten Verstand wirklich zu ordnen, zu entschlüsseln und zu verstehen.
Dies alles halte ich mir jeweils vor Augen, wenn ich wieder einmal daran zweifle, ob meine Erlebnisse, die nunmehr gut vierzig Jahre zurückliegen, wirklich real waren oder ob ich sie mir nur einbilde. Und komme immer wieder zum Schluss: Nein, ich bin nicht verrückt. Und ja, ich habe diese höchst seltsamen Vorkommnisse wirklich erlebt. Und dabei Dinge gesehen, auf die es bis heute keine Antworten gibt. Sie sind deswegen nicht weniger real.
Damals, während des Krieges, war mein Auftrag geheim. Jetzt, nach mehr als vier Jahrzehnten, fühle ich mich nicht mehr an das Gebot der Verschwiegenheit gebunden und erlaube mir daher, meine Erlebnisse aufzuschreiben und öffentlich zu machen. Ich tue dies erstens im Bestreben, sie vor dem Vergessen zu bewahren. Und zweitens in der Hoffnung, der Leserin und dem Leser ein klein wenig von dem zurückzugeben, was uns in der heutigen Gesellschaft so sehr abhandengekommen ist: die Lust am Unerklärlichen, am Mystischen, Geheimnisvollen. Und die Fähigkeit, das Unerklärliche als das zu nehmen, was es ist und schon immer war: ein fester und unverzichtbarer Bestandteil unserer Realität, unseres Lebens, unserer ganzen Existenz.
Kapitel 1
Wie an Schnüren fiel der Regen auf die Kuhweide und den Feldweg. Eine dunkelgraue Wolkendecke verhüllte den Himmel. Am frühen Nachmittag war es bereits düster wie zur Abenddämmerung. Rechterhand hörte ich das Rauschen des angeschwollenen Flusses, links erhob sich nass und abweisend ein Hügelzug mit Grasland, Tannenwald und einigen Emmentaler Bauernhäusern.
Meine Offiziersstiefel schmatzten bei jedem Schritt auf dem schlammigen Weg. Geradeaus zeichneten sich in den aufsteigenden Dunstschwaden die Umrisse eines Wachhäuschens ab. Es handelte sich um einen aus Balken und Brettern mehr schlecht als recht zusammengezimmerten Unterstand für einen militärischen Wachposten.
Der Soldat warf hastig seine Zigarette in eine Pfütze, als er mich aus dem Regen nahen sah, und nahm Haltung an.
«Plantonwache Aufklärerkompanie 3/8», meldete er laut und grüsste militärisch. Er war mittelgross und kräftig. Unter dem Stahlhelm blickten mich zwei dunkle, fast schwarze Augen aufmerksam an. Den Karabiner hatte er geschultert.
«Danke», sagte ich, blieb stehen und grüsste zurück. «Wie heissen Sie?»
«Gefreiter Röthlisberger, Herr Hauptmann», gab er zur Antwort.
«Hauptmann Weidlin vom Korpsstab. Ich kontrolliere die Wachen. Sagen Sie mir, Gefreiter Röthlisberger – wie lautet Ihr Auftrag?»
«Zur Sicherung der Brunnenschächte bewache ich den Feldweg mit Blick Richtung Süden und halte alle mir unbekannten Personen an.»
«Und wenn Ihnen eine angehaltene Person verdächtig vorkommt?»
«Dann rufe ich den Wachkommandanten.»
«Wie denn?»
«Indem ich laut rufe, Herr Hauptmann.»
«Wird Sie der Kommandant hören? Wo ist die Wachzentrale?»
Nun wurde der Gefreite verlegen. «Dort, im Schopf beim Bauern.» Er deutete nach vorn, wo sich in einiger Entfernung ein Bauernhof mit Hauptgebäude, Wohnstock und mehreren Nebengebäuden befand.
«Das ist alles andere als in Rufweite», erwiderte ich tadelnd. «Wenn Sie hier stehen und einen feindlichen Saboteur in Schach halten, können sie rufen, so viel Sie wollen, es wird Ihnen keiner zu Hilfe kommen.»
Der Gefreite schwieg betreten.
«Ist ja nicht Ihre Schuld, dass diese Wache so lausig organisiert ist», beruhigte ich ihn. «Ihre Vorgesetzten sollten aber wissen, dass dieser Weg wichtig ist, auch wenn es sich nur um einen Feldweg handelt. Deshalb muss er immer zu zweit bewacht werden. So kann der eine Soldat einen Verdächtigen festhalten, während der andere Hilfe holt. So einfach ist das. Ich werde veranlassen, dass hier ein zweiter Posten aufgestellt wird, sobald ich wieder im Stab bin. Jetzt will ich aber erst mal eine rauchen. Darf ich Sie um eine Zigarette bitten? Und rauchen Sie doch auch gleich eine mit.»
«Aber Herr Hauptmann…»
Ich winkte ab. «Keine Sorge, das ist keine Falle. Ich weiss, dass Sie wissen, dass man auf der Wache nicht rauchen darf. Und doch tut man’s gelegentlich, wenn einen niemand sieht, oder? Sie haben ja vorhin auch geraucht. Los, geben Sie schon. Tut gut, ein bisschen Rauch bei diesem elenden Füsilierwetter.»
Röthlisberger klaubte eine Packung Parisienne hervor, klopfte eine Zigarette halb heraus und hielt mir das Päckchen hin. Ich zog die Zigarette heraus und steckte sie mit meinem Feuerzeug an, während er sich ebenfalls einen Glimmstängel zwischen die Lippen schob und mit einem Streichholz zum Glühen brachte.
«Ich war früher Nichtraucher, aber im Dienst kommt es ganz gelegen, ab und zu eine Rauchpause einzuschalten», sagte ich, nachdem wir die ersten drei, vier Züge schweigend inhaliert hatten.
«Jawohl, Herr Hauptmann.»
«Was machen Sie beruflich, Gefreiter Röthlisberger?»
«Ich bin Bauer», sagte er.
«Na, dann ist es jetzt schon das zweite Jahr, dass Sie wegen dieses Kriegs die Heuernte verpassen. Oder bekommen Sie für Juni Urlaub?»
«Diesmal wohl nicht. Zum Glück sind Vater und Mutter noch rüstig und können meiner Frau helfen. Dann sind auch noch die Kinder da. Die beiden ältesten können schon zünftig mit anpacken.»
«Wie viele Kinder haben Sie denn?»
«Fünf, Herr Hauptmann. Drei Buben und zwei Mädchen.»
«Schön, schön. Aber für Familienväter ist es jetzt besonders hart, im Militär zu sein, wenn man Frau und Kinder für Wochen und Monate nicht zu sehen bekommt. Ich selbst habe es im Moment besser. Ich bin trotz meiner dreissig Jahre noch ledig.»
Der Blick meines Gegenübers verdüsterte sich. «Sie haben recht, Herr Hauptmann. Es ist verdammt hart, so lange von Hof, Frau und Kind getrennt zu sein. Dafür haben wir mit Guisan einen ausgezeichneten General, der weiss, was er tut und unseren Bundesräten die Stirn bietet. Vor allem denen, die sich mit den Sauschwaben arrangieren wollen.»
Ich zuckte bei diesem Schimpfwort, mit dem man damals die Deutschen zu bezeichnen pflegte, innerlich zusammen. Auch ich war dezidiert gegen Adolf Hitler und die Nationalsozialisten, denen Europa diesen Krieg zu verdanken hatte. Ich hatte in Deutschland jedoch gute Freunde, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte und an die ich gerade in diesen schlimmen Zeiten oft denken musste (s. «Das Jahr des Jüngers», Scratch Verlag 2019). Zudem war und ist mir die deutsche Kultur und insbesondere die deutsche Literatur nahe; umso unverständlicher war es für mich, wie sich dieses Kulturvolk von der Barbarei des braunen Diktators hatte anstecken und in den Krieg reissen lassen.
Ich warf den Zigarettenstummel in eine Pfütze, wo er mit einem leisen Zischen erlosch.
«Danke für die Parisienne, ich gehe jetzt», sagte ich. «Ich werde dafür sorgen, dass hier ein zweites Wachhäuschen aufgestellt wird, mit Blick in die Gegenrichtung. Könnte ja sein, dass sich ein feindlicher Aufklärer nicht von Süden, sondern von Norden her anpirscht.»
Der Gefreite spickte seine Zigarette ebenfalls weg, meldete den Posten ab, ich grüsste und ging zurück in Richtung Aeschau.
Es war Ende Mai 1941. Seit einem Jahr – seit dem Fall Frankreichs – war die Schweiz vollständig von den Achsenmächten umzingelt: von Hitlers Reich im Norden, Osten und Westen, von Mussolinis Diktatur im Süden. Es war, so dachten wir, nur noch eine Frage der Zeit, bis die deutschen Truppen auch die Schweiz angreifen würden, unsere kleine neutrale Insel mitten im unterworfenen Europa. Dass Hitler nicht nur angreifen, sondern auch gewinnen würde, war mehr als wahrscheinlich, denn seine Wehrmacht schien unbesiegbar zu sein, wie man nach den Blitzkriegen in Polen, Dänemark, Frankreich und auf dem Balkan gesehen hatte. Die Deutschen verfügten über motorisierte Verbände, Panzer, Flugzeuge und Fallschirmjäger, hinzu gesellten sich kampferprobte und siegesgewohnte Infanteristen. Wir dagegen, wir hatten fast nichts – nur unsere Kanonen, Karabiner und den unbedingten Willen, unsere Freiheit so teuer als irgend möglich zu verkaufen.
Zusammengehalten wurden Armee und Volk in dieser Krise vom charismatischen General Henri Guisan, einem Waadtländer, der eleganter Gentleman, schneidiger Offizier und volksnahe Vaterfigur zugleich war. Sein Plan war, sich einem angreifenden Feind nicht bereits im Mittelland, sondern erst in den Alpen mit der vollen Stärke entgegenzustellen und dieses schwer einzunehmende Territorium bis zum Äussersten zu verteidigen. Zu diesem Zweck hatte man den Alpen- und Voralpenraum zum sogenannten Reduit ausgebaut, zur Festung mit Sperren, Bunkern, Munitionslagern und Lebensmitteldepots.
Die Zugänge zum Reduit waren streng bewacht und gut gesichert. Einer dieser Zugänge befand sich in der Bubenei im oberen Emmental, nahe des voralpinen Hohgantmassivs, das Teil des natürlichen Festungswalls war. Bei der Brücke, die vom Dorf Schüpbach über die Emme zum Weiler Aeschau führte, hatte die Armee eine Sperrstelle errichtet. Am linken Ufer, also feindseitig, bestand diese aus einbetonierten Stahlträgern und einer Panzermauer; das rechte Ufer war mit einer Höckersperre abgeriegelt.
Links und rechts der Brücke sicherte je ein in den Fels gebauter Bunker die Befestigung. Beide waren mit einer Panzerabwehrkanone und einem Maschinengewehr bestückt. Vor und hinter der Brücke sowie über das ganze Gebiet verteilt befanden sich Wachposten, die nach Spionen, Saboteuren und allfälligen Angreifern Ausschau hielten. Auch die Brunnenschächte auf der Kuhweide wurden bewacht, denn hier befand sich ein grosses Wasserfassungsgebiet. Die Pumpwerke versorgten die Bundesstadt Bern über eine lange Zuleitung mit Trinkwasser.
Ich tat Dienst im Stab des Feldarmeekorps 2; dieser Einheit war auch die Sperrstelle Bubenei unterstellt. Meine Aufgabe bestand unter anderem darin, regelmässig den Wachdienst im ganzen Einsatzgebiet des Korps zu kontrollieren. Gegenwärtig befand sich mein Quartier im Gasthof Zum Roten Thurm im nahen Dorf Signau.
Von Röthlisbergers Wachhäuschen auf der Kuhweide machte ich mich dicht am linken Emmeufer auf den Rückweg. Der Pfad führte durch den vollgesogenen Uferwald, in dem es nach nassem Laub und Erde roch. Es goss weiterhin, der Regen hatte an Heftigkeit sogar noch zugenommen. An manchen Stellen des Waldstreifens war der Fluss nahe daran, über das Ufer zu treten. Rasch schritt ich aus; ich hatte wenig Lust, mich von den entfesselten Fluten mitreissen zu lassen.
Auf dem kleinen Platz vor der Post in Aeschau stand eine schwarze Limousine. Es war ein Buick, eine Nobelkarosse der allerersten Klasse. Jeder kannte dieses Fahrzeug – es war der persönliche Wagen des Generals. Was wollte Guisan hier? Dann aber sah ich, dass der Wimpel am Kühler nicht aufgesteckt war; der Buick war also ohne den General unterwegs.
Warum aber machte der Wagen ausgerechnet hier halt? Die Sperrstelle in der Bubenei war strategisch zwar wichtig, aber so wichtig auch wieder nicht, dass sich gleich jemand aus Guisans persönlichem Stab herbemühen musste, um nach dem Rechten zu sehen.
Ich näherte mich dem Buick. Da öffnete sich die Tür, und ein junger Offizier trat aus dem Wagen. Er grüsste, stellte sich als Hauptmann Bamgartner vor und fragte: «Sind Sie Hauptmann Felix Weidlin?»
«Der bin ich», bestätigte ich.
«Sehr gut. Wegen Ihnen bin ich hier, Herr Kamerad. Ich gehöre dem persönlichen Stab des Generals an und habe den Auftrag, Sie abzuholen und nach Interlaken zu bringen. Sie werden von General Guisan erwartet.»
«Vom General persönlich? Was verschafft mir die Ehre? Aber so kann ich ihm unmöglich vor die Augen treten. Ich muss mich zuerst ein wenig frisch machen, etwas Trockenes anziehen und meinen Burschen anweisen, mir die Stiefel zu putzen.»
«Selbstverständlich, so viel Zeit bleibt auf jeden Fall. General Guisan erwartet Sie erst um 17 Uhr. Wo befindet sich Ihr Quartier?»
«In Signau, gleich da vorne.»
«Dann nichts wie los. Auf diesen geflügelten Rädern sind wir im Nu dort. Darf ich bitten?»
Er öffnete die Tür und wies einladend auf den breiten Hintersitz im Wagen. Ich nahm Platz, Baumgartner ging um den Wagen herum und setzte sich neben mich auf die andere Seite.
«Nach Signau», befahl er dem Fahrer, der bisher still wie eine Statue am Steuer gesessen hatte.
Mit einem sanften Brummen sprang der Motor an, der Wagen nahm Fahrt auf. Es war ein wunderbares Gefühl, in diesem kraftvollen und noblen Gefährt durch die Gegend zu brausen. Wenn ich nur nicht so platschnass gewesen wäre. Und ich mich nicht etwas bange gefragt hätte, was Guisan eigentlich von mir wollte. Ich war mir keiner Vernachlässigung meiner Dienstpflichten bewusst, zudem wäre so etwas nicht von höchster Stelle geahndet worden. Es musste also etwas anderes dahinterstecken. Aber was denn?
Baumgartner hüllte sich auf mein Nachfragen in Schweigen. «Ich weiss es nicht, Herr Hauptmann. Ich weiss nur, dass ich Sie zu Guisan bringen soll», sagte er.
Ich hatte nicht lange Zeit, mir Gedanken zu machen. Nach ein paar Minuten schwenkte der Buick bereits auf den Platz vor meinem Hotel ein.
«Brauchen Sie lange, Herr Hauptmann? Je nachdem gönne ich mir im Restaurant noch einen Kaffee», sagte Baumgartner.
«Geht ganz schnell», sagte ich.
«Nun, dann nehme ich den Kaffee trotzdem. Ich lade Sie ein, wenn Sie fertig sind. Bis später in der Gaststube. Und lassen Sie sich ruhig Zeit.»
Kapitel 2
Die Fahrt nach Interlaken verlief still. Baumgartner versuchte zwar, Konversation zu machen, bekam von mir aber nur einsilbige Antworten zu hören. Deshalb gab er es bald auf. Ich blickte hinaus in den Regen und gab mich meinem Unbehagen hin. Es kam schliesslich nicht alle Tage vor, dass ein kleiner Hauptmann zum General gerufen wurde, ohne zu wissen, worum es ging. Das Ganze wirkte auf mich sonderbar geheimniskrämerisch.
Als wir in Interlaken ankamen, hatte es aufgehört zu regnen. Die Wolkendecke riss auf, hier und da zeigte sich auch schon wieder der blaue Himmel.
General Henri Guisan residierte mit seinem persönlichen Stab in der Villa Cranz, einem herrschaftlichen Sitz, der vormals einer Fabrikantenfamilie gehört hatte. Als wir vorfuhren, gingen die beiden Wachposten in die Achtungstellung und präsentierten das Gewehr. Im Innern der Villa herrschte geschäftiges Treiben von Männern in Uniform; so viele hochrangige Offiziere aufs Mal vom Obersten bis hinauf zum Korpskommandanten hatte ich zuvor noch nie gesehen.
Es war 16:45 Uhr. Baumgartner führte mich in ein Vorzimmer und bat mich, Platz zu nehmen. Dann verabschiedete er sich und überliess mich meinen Grübeleien.
Punkt 17 Uhr trat ein Major aus der Tür, die zum Büro des Generals führte.
«Hauptmann Weidlin?»
Ich erhob mich und grüsste stramm.
«Enchanté, ich bin Major Barbey, chef de l’Etat-major particulier du général», erwiderte er halb deutsch, halb französisch. Ich hatte bereits von ihm gehört: Bernard Barbey war vor dem Krieg in Paris ein gefeierter Romanschriftsteller gewesen. Jetzt war der wieder in die Schweiz zurückgekehrte Waadtländer die rechte Hand von General Guisan. Es hiess, dass er grossen Einfluss auf den Oberbefehlshaber der Armee habe, seine Befehle redigiere, diese zum Teil in Guisans Namen verfasse und auch seine Reden schreibe.
«Bitte sehr, Herr Hauptmann, der General erwartet Sie.» Barbey wies auf die Tür, hielt sie mir auf und schloss sie hinter mir, ohne selbst wieder einzutreten. Ich war mit dem General allein.
Henri Guisan sass an seinem Schreibtisch in einem dunkel getäfelten, altertümlich wirkenden Raum, in dem es nach Zigarettenrauch roch; der General war Kettenraucher, auch wenn er sich nur selten mit Zigarette in der Hand fotografieren liess. Auf seinem mit Schreibutensilien und Akten überstellen Schreibtisch stand eine unpassend moderne, maschinengrün gestrichene Bürolampe, auf einem Tischchen gleich daneben befand sich das Telefon.
Ich hatte den General schon oft auf Bildern in den Zeitungen gesehen, war ihm in natura bisher aber noch nie begegnet. Der Waadtländer Gutsbesitzer wirkte weit mehr wie ein britischer Gentleman denn wie ein Schweizer Bauer: weltmännisch, sehr gepflegt, schlank, drahtig und für seine 67 Jahre bemerkenswert spannkräftig. Sein Schnurrbart war sorgfältig nach englischer Art gestutzt, seine Augen blickten gütig, aber seinem entschlossenen Mund war anzusehen, dass er auch durchgreifen konnte. Er trug die feldgraue Uniform mit einer Eleganz, die andere nicht einmal im Smoking hinbekamen.
Ich salutierte. «Mon général, capitaine Weidlin à votre disposition.»
«Merci, Monsieur Weidlin», sagte Guisan, indem er charmant meinen Dienstgrad durch die zivile Ansprache ersetzte. Er erhob sich und reichte mir unmilitärisch, aber mit festem Druck die Hand.
«Kommen Sie, gehen wir doch an meinen Besuchertisch, da haben wir mehr Platz», sagte er in leicht welsch gefärbtem Deutsch und deutete auf einen Tisch beim grossen Fenster, durch das man die Parkbäume sah.
Wir setzten uns, und Guisan bestellte bei einer Ordonnanz Kaffee. Der junge Uniformierte legte tadellose Manieren an den Tag. Seinen Rang konnte ich nicht erkennen, er trug über dem Hemd mit den Gradabzeichen einen blütenweissen Servierkittel.
«Sie fragen sich jetzt natürlich, warum ich Sie habe rufen lassen», sagte Guisan, als die dampfenden Tassen vor uns standen.
«Ja, Herr General – und ich verhehle nicht, dass ich sogar etwas beunruhigt bin.»
«So? Warum denn? Haben Sie ein schlechtes Gewissen?»
«Nein, nicht wirklich. Vielleicht ist aber durchgesickert, dass ich es mit den Dienstvorschriften nicht immer sehr genau nehme und einen manchmal etwas zu kameradschaftlichen Umgang mit den niederen Dienstgraden pflege.»
«Aber mon cher – um solche Petitessen wird sich doch nicht der General persönlich kümmern wollen», lächelte Guisan.
«In bestimmten Fällen vielleicht schon, mon général», erwiderte ich.
«Sie wissen doch, Monsieur Weidlin – toute l’armée weiss es – dass ich es selber nicht so mit dem preussischen Drill habe und mich ab und zu auch gerne unter die Soldaten mische. Nein, ich habe ein anderes Anliegen. Ich möchte Sie in meinen persönlichen Stab berufen.»
Damit hatte ich nicht gerechnet. Es hiess, dass im persönlichen Stab des Generals die Elite der jungen Schweizer Offiziere versammelt sei, was vermutlich sogar stimmte. Ich selbst zählte mich nicht zur Elite. Ich war ein ganz gewöhnlicher Akademiker mit einem Abschluss in Theologie und einer grossen Leidenschaft für Literatur, Volkskunde und Mittelalter. Auf militärischem Gebiet war ich nicht sonderlich bewandert; dass ich es bis zum Hauptmann gebracht hatte, war meinem theologischen Hintergrund zuzuschreiben, nicht meiner besonderen Eignung zum Waffenhandwerk. Ursprünglich war ich in der Armee zum Feldprediger geschult worden und hatte daraufhin den Hauptmannsrang geschenkt bekommen. Dann aber war ich aufgrund einer Empfehlung zum Offizier für Sonderaufgaben in den Stab des Feldarmeekorps 2 berufen und in die Waffengattung der Infanterie umgeteilt worden.
«Mon général, ich fühle mich geehrt», sagte ich. «Zugleich frage ich mich, womit ich diese Auszeichnung verdient habe. Ich habe keine militärischen Verdienste vorzuweisen. Ich tue einfach meine Pflicht wie alle anderen auch.»
«Ich brauche Sie ja auch nicht als strategischen Berater, davon habe ich genug, und jeder meint, es besser zu wissen», erwiderte Guisan. «Ich brauche Sie für einen besonderen Auftrag. Dafür scheinen Sie mir der Richtige zu sein. Vom Stabschef Ihres Kommandanten höre ich, dass Sie breite Interessen haben, ungelöste Rätsel und Geheimnisse lieben, gut mit Menschen umgehen können, beharrlich sind und schwierige Aufgaben mit Fantasie lösen.»
«Ich hoffe, dass Sie vom Stabschef auch wirklich das Richtige hören, Herr General.»
«Doch, davon bin ich überzeugt», erwiderte Guisan. «Der Mann, der meinen Auftrag ausführen soll, sind Sie. Weil ich nicht nur das Richtige höre, sondern auch weiss, dass Sie der Richtige sind.»
«Ich stehe selbstverständlich zur Verfügung, mon général.»
«Gut, gut. Es ist ja schliesslich auch nicht einfach ein Wunsch von mir, sondern ein dienstlicher Befehl. Zugleich aber auch eine spannende Herausforderung.»
Er nahm einen Schluck Kaffee, griff nach einer Karte, entfaltete sie und legte sie in meine Richtung gedreht auf den Tisch. Die Karte zeigte die Schweiz, deren Territorium mit dicken Linien in mehrere Segmente unterteilt war.
«Wie Sie sehen, Monsieur Weidlin, ist dies unser bedrohtes Vaterland und das Dispositiv, das wir zu seiner Verteidigung erarbeitet haben.»
Er begann, die Karte genauer zu erläutern, und verdeutlichte das Gesagte mit dem Zeigefinger.
«Dies ist der verteidigte Grenzraum; dahinter sehen wir die vorgeschobene Stellung zum Reduit, und hier schliesslich» – sein Finger wanderte zum Alpenmassiv – «haben wir das Reduit selbst, die Schweizer Alpenfestung, mit Hunderten von Sperren, Bunkern und Geschützständen, mit Unterkünften, Beobachtungsposten, Flugplätzen und Proviant für zwei Monate. Wir werden uns und unser Land im Fall einer Invasion so teuer als möglich verkaufen.»
Ich nickte nur. Jeder im Land wusste Bescheid. Guisan hatte vor einem Jahr auf der Rütli-Wiese, der mythischen Geburtsstätte der Schweiz, seinen Truppenkommandanten die Reduit-Strategie in einer denkwürdigen Rede auseinandergesetzt. Die Wirkung dieses Auftritts war enorm. Angesichts des vorangegangenen deutschen Sieges über Frankreich war sich die Schweiz zuerst nicht einig gewesen, ob man sich nun den neuen Machtverhältnissen in Europa anpassen oder ob man sich verteidigen solle. Nach Guisans Rede auf dem Rütli rückte die Nation zusammen. Von nun an stand alles unter dem Gedanken des unbedingten Widerstands gegen den aggressiven nördlichen Nachbarn.
«Wir haben im Alpenraum alles, was es für eine erfolgreiche Verteidigung braucht», nahm Guisan nach einem kurzen Moment des Schweigens den Faden wieder auf. «Oder fast alles. Sogar ein Bunker für die Landesregierung existiert. Nur eines fehlt noch: ein Rückzugsort für die Armeeleitung, ein Generalsbunker. Ein solcher wird demnächst gebaut. Nur der Ort steht noch nicht fest. Er soll möglichst sicher und unzugänglich sein, ein letztes Refugium für den Fall, dass grosse Teile der Armee unterworfen werden. Gelingt es dem Generalstab und mir, uns rechtzeitig in ein Versteck abzusetzen, können wir von dort aus den letzten Widerstand organisieren.»
«Ich verstehe», sagte ich, obwohl ich das Wichtigste nicht verstand – nämlich, was dieser Plan mit mir zu tun haben sollte. Auf eine Erklärung brauchte ich aber nicht zu warten.
«Sie, Herr Hauptmann, sollen den geeigneten Ort für den Generalsbunker finden», erklärte Guisan.
«Herr General – Sie wissen, dass ich Geisteswissenschaftler bin, nicht Ingenieur. Warum soll gerade ich nach dem besten Standort für Ihren Schutzraum suchen?»
«Weil es sich hier um eine spezielle Suche handelt. Es geht hier vorerst nicht um geologische und bautechnische Fragen. Sondern um die Frage nach der grösstmöglichen Abgeschiedenheit in den Bergen. Am einsamsten ist es wohl an einem Ort, der erstens abgeschieden ist und den zweitens niemand kennt.»
«Einen unbekannten Ort dürfte es bei uns in der Schweiz kaum geben, jeder Quadratzentimeter unseres Landes ist genau vermessen», wandte ich ein.
Der General lächelte fein. «Ja, soweit stimmt das schon. Aber vielleicht gibt es einzelne Eisfelder und Steinwüsten im Gebirge, die nicht wirklich erkundet sind, weil sie abseits der Alpinistenrouten liegen. Wer kann schon sagen, ob nicht vielleicht irgendwo ein verborgener Ort liegt, den seit Generationen niemand mehr betreten hat? Gewissermassen ein natürlicher Bunker, der zwar existiert, von dessen Existenz aber niemand mehr weiss? Das wäre doch ein perfekter Rückzugsort.»
«Wäre, mon général, wenn es ihn gäbe.»
«Es gibt ihn, Monsieur Weidlin, es gibt ihn. Haben Sie schon einmal von der Verlorenen Stadt gehört?»
«Nein, Herr General.»
Guisan lachte. «Was sehen Sie mich so an? Sie denken wohl, Sie seien in einer Märchenstunde bei Onkel Henri gelandet. Ich kann es Ihnen nicht verdenken. Sie haben nämlich sogar recht.»
Er machte eine kleine dramaturgische Pause, liess mich ein paar Sekunden zappeln und fuhr dann mit seinen Erklärungen fort.
«Es geht hier tatsächlich um eine Art Märchen, nämlich um die Geschichte von der Verlorenen Stadt, die sich die Berner Bergbauern rund um den Thunersee erzählen. Dieser Sage zufolge soll in den Bergen einst eine Stadt gestanden haben, mit einer grossen und prächtigen Alp vor den Toren. Während Jahrhunderten wurde auf den saftigen Wiesen Alpwirtschaft betrieben. Dann aber wurden die Menschen überheblich und versündigten sich. Gott bestrafte sie, indem er ihnen Plagen sandte. Jene, die die Zeichen des göttlichen Zorns erkannten und Reue zeigten, verliessen die Stadt. Jene aber, die verstockt blieben, versanken mitsamt der Stadt im Innern des Bergs, wo sie angeblich noch heute ihr lärmiges Unwesen treiben. Wo sich die unterirdische Stadt befindet, geriet in Vergessenheit. Es muss aber ein wahrer Kern in dieser Sage stecken. Bestimmt ist die Rede von einem unbekannten Höhlensystem. Wäre die Verlorene Stadt nicht geradezu ideal als letzter Rückzugsort des Generalstabs?»
«Vielleicht», erwiderte ich unsicher. «Aber nur, wenn es diese Stadt beziehungsweise dieses Höhlensystem wirklich gibt. Mehr als eine Sage haben wir im Moment nicht.»
Guisan nickte. «Gerade das…»
Es klopfte.
«Ja bitte – entrez!»
Die Ordonnanz im weissen Kittel trat herein. «Haben Sie alles, mon général? Soll ich Ihnen frischen Kaffe bringen?»
«Danke, Armand, wir haben, was wir brauchen.»
Der Bursche des Generals zog sich zurück.
«Ein guter Mann, der Gefreite Armand Stucki», sagte Guisan, als wir wieder unter uns waren. «Seine Mutter ist eine Welsche, der Vater Berner. Armand hat in Genf eine Butlerschule besucht. Deshalb ist er mir als Leibbursche empfohlen worden. Er ist anstellig und verschwiegen. Wer zum Umfeld des Generals gehört, muss natürlich schweigen können. Ich mache Sie bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass unser Gespräch eine sehr vertrauliche Angelegenheit ist.»
«Natürlich, Herr General.»