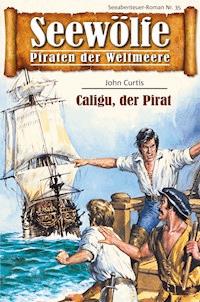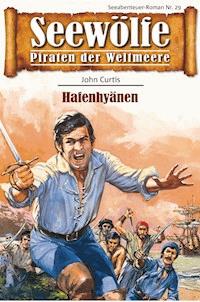
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Die Männer des Seewolfs meutern. Sie wollen endlich an Land. Geld haben sie wie Heu. Jetzt haben sie Lust, auch mal was zu erleben. Aber in der kleinen Hafenstadt warten die Hafenhyänen auf solche ausgehungerten Typen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, um sie zu betrügen - und wenn die Beute groß genug ist, auch mal einen umzulegen. Vielleicht hat Gordon Watts einmal zu oft geprahlt, denn er verschwindet spurlos. Und Hasard, der Seewolf, muß feststellen, daß er seine Leute doch nicht so gut kennt, wie er geglaubt hat. Voll Zorn stellt er fest, daß jemand im Laderaum der "Isabella III" die Perlentruhe aufgebrochen und ausgeräubert hat...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2013 Pabel-Moewig Verlag GmbH,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-271-1Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
1.
Der Alcalde Calvo Ramirez Santana schnippte mit den Fingern.
„Bringt sie her!“ befahl er, und seine Brauen zogen sich bei diesen Worten unheilverkündend zusammen.
Teniente Morales, der Führer der dreißig Mann starken Truppe, die die Streitmacht der winzigen Garnison Culebra bildete, scheuchte mit einer Handbewegung zwei seiner Soldaten los. Dann sah er den Alcalden an.
„Senor – ich rate zur Vorsicht. Ich kenne die Nicaraos. Mit Gewalt ist bei denen nichts zu erreichen, sie sind zu stolz, um sich irgendeiner Gewaltaktion zu beugen. Ich schlage nochmals vor ...“
Der Alcalde beugte sich in seinem schweren lederbezogenen Armstuhl, der etwas erhöht stand und schon fast wie ein Thron wirkte, vor.
„Ich habe Sie nicht um Ihre unmaßgebliche Meinung gefragt, Teniente!“ sagte er scharf. „Ich weiß allein, wie ich diese braunhäutigen Schufte anzupacken habe. Diese Aina ist die Tochter des Häuptlings – ein besseres Pfand könnten wir gar nicht in der Hand haben. Sie weiß erstens alles, was ich erfahren will, und zweitens wird sie reden. Außerdem habe ich einen Boten zum Häuptling der Nicaraos geschickt und ihm mitgeteilt, daß sich seine Tochter in meiner Gewalt befindet. Verlassen Sie sich darauf, er wird dieses Mädchen zu retten versuchen, ich kenne die Stellung, die eine Häuptlingstochter bei diesen Indianern einnimmt. Er darf sie nicht opfern, wenn er bei seinem Volk nicht das Gesicht verlieren will. Er wird uns gegen das Leben von Aina sagen, wo sich die Goldader befindet.“
Der Leutnant versuchte es noch einmal.
„Senor, Sie vergessen, was sich beim letzten Markttag ereignet hat. Emilio Torro und Alfonso Ortiz haben die Indianer mit ihren Leuten überfallen und alle jungen Mädchen, die sie erwischen konnten, in ihre Bordelle verschleppt. Wäre ich nicht mit meinen Soldaten dazwischengegangen, dann hätten sie die Häuptlingstochter ebenfalls dorthin gebracht. Nur Ihr ausdrücklicher Befehl, Senor, hat mich daran gehindert, auch die anderen Mädchen aus den Klauen dieser üblen Burschen zu befreien. Ich halte es mit meiner Ehre als spanischer Offizier nicht für vereinbar, Kerle wie diesen Torro oder Ortiz auch noch zu unterstützen, ich ...“
Der Alcalde war aufgesprungen. Während der Teniente sprach, hatte sich sein Gesicht mehr und mehr verfinstert.
„Schweigen Sie, Leutnant!“ brüllte er, und die Adern an seiner Schläfe schwollen bedrohlich an. „Damit Sie es ein für allemal wissen: Diese Indios zählen für mich nicht zu den Menschen. Ich werde auch diese Aina heute hierbehalten. Sie wird mir den Abend versüßen, und wenn sie genug Wein getrunken hat, wird sie mit Wonnen tun, was ich von ihr verlange. Diese braunhäutige Katze wird mir aus der Hand fressen, Teniente. Sie kann stolz darauf sein, daß ich, der Alcalde von Culebra, ihr überhaupt die Gnade erweise, mit mir das Lager teilen zu dürfen. Ihre bisherige Widersetzlichkeit bei den Verhören hätte jede andere schon längst auf die Folterbank gebracht. Ich habe mit dieser Aina bis jetzt mehr Nachsicht geübt als mit irgendeinem anderen Indio. Wenn sie allerdings auch jetzt nicht reden sollte, dann kenne ich ein paar Mittelchen, um ihr den hübschen Mund zu öffnen.“
Er richtete sich hoch auf, was bei seiner Leibesfülle statt imponierend schon fast komisch wirkte.
„Und damit Sie es nun endlich begreifen, Teniente: Culebra ist Hoheitsgebiet Seiner Katholischen Majestät. Wir sind hier die Herren, was wir wünschen, das hat zu geschehen. Was es auf dieser Halbinsel an wertvollen Dingen oder Bodenschätzen gibt, das gehört der Spanischen Krone, deren Bevollmächtigter ich bin. Ich rate Ihnen dringend, Teniente, sich diesem Standpunkt anzupassen. Andernfalls sind Sie die längste Zeit der Befehlshaber dieser Garnison gewesen!“
Teniente Morales hatte alle Farbe verloren. In ohnmächtiger Wut ballte, er die Hände, aber er tat es hinter seinem Rücken. Er kannte die Macht des Alcalden, und er wußte, wozu dieser Mann fähig war. Er wurde auch jeder Entgegnung enthoben, denn in diesem Moment brachten die beiden Soldaten, denen er den Befehl gegeben hatte, Aina zu holen, das Mädchen herein.
Der Teniente wandte sich unwillkürlich um. Und wieder mußte er sich eingestehen, daß er nie zuvor ein hübscheres Mädchen gesehen hatte. Aina hatte ein fein geschnittenes Gesicht, ausdrucksvolle Augen und Züge, einen seltsam festen und doch zugleich weichen Mund. Ihr junger, schlanker Körper besaß eine Geschmeidigkeit, wie der Teniente sie bei keiner Weißen jemals gesehen hatte.
Unwillkürlich fiel sein Blick auf den Alcalden. Der Teniente sah die unverhohlene Gier, mit der Calvo Ramirez Santana die Indianerin anstarrte, er sah, wie sich der Alcalde die Lippen leckte.
Die beiden Soldaten hielten das Mädchen gepackt. Sie zerrten es vor den Alcalden und zwangen es dort in die Knie.
Das war dem Teniente zuviel.
„Laßt sie los!“ fuhr er die beiden an, und die Soldaten gehorchten. Aina erhob sich. Ihre dunklen Augen richteten sich auf den Alcalden.
Der Alcalde kam sofort zur Sache.
„Wo ist das Gold? Ich befehle dir, mir augenblicklich zu sagen, wo das Gold in euren Bergen liegt. Wenn du auch jetzt nicht redest, werde ich dir die Zunge lösen lassen. Wenn du mir aber sagst, was ich wissen will, werde ich dich fürstlich belohnen. Also?“
Der Alcalde hatte spanisch gesprochen, er wußte, daß Aina die spanische Sprache ziemlich gut verstand, zumindest aber den Sinn seiner Worte erfaßte. Das Mädchen schwieg und starrte ihn aus den dunklen Augen nur an. In ihren Zügen prägte sich überdeutlich die Verachtung, die sie für diesen Mann empfand.
Der Alcalde bemerkte es, und plötzlich sah er rot. Er war ohnehin eine jähzornige Natur und in seinen Ausbrüchen völlig unberechenbar. Mit einer Schnelligkeit, die man ihm bei seiner Körperfülle nicht zugetraut hätte, schoß er auf Aina zu. Er packte sie an den Haaren und riß sie brutal zu Boden. Dann klatschten seine dicken Hände in das Gesicht des Mädchens. Anschließend versetzte er ihr einen derben Tritt in die Seite, der sie über den Boden katapultierte.
„Reißt diesem Miststück die Kleider vom Leibe!“ brüllte er die beiden Soldaten an, die erschrocken zurückgewichen waren und die Szene aus großen Augen beobachtet hatten.
Erst der wütende Befehl des Alcalden riß sie aus ihrer Erstarrung. Sie warfen sich auf die Indianerin, die sich eben aufrichten wollte. Dem Mädchen lief das Blut aus Mund und Nase, so heftig hatte Santana zugeschlagen.
Die beiden Soldaten, packten die immer noch etwas benommene Aina und fetzten ihr die wenigen Kleidungsstücke vom Leib. Sie gaben keine Ruhe, bis Aina splitternackt auf dem Boden lag. Dann rissen sie sie hoch und schleppten sie vor den Alcalden.
Santana starrte Aina drohend an.
„Willst du jetzt endlich reden?“ brüllte er unbeherrscht. „Oder soll ich die Folterknechte rufen?“
Er war mit einem einzigen Schritt bei dem Mädchen, packte ihre Schultern und drehte sie herum, als die beiden Soldaten sie losließen.
„Da, ich habe das Feuer im Kamin schon anheizen lassen“, sagte er drohend und zwang die Indianerin, die lodernden Flammen anzustarren. „Wenn du jetzt nicht redest, werde ich dir deine verfluchte Indioschnauze aufreißen lassen!“
Aina sah in die Flammen, aber in ihrem Gesicht bewegte sich kein Muskel. Sie wischte nicht einmal das Blut ab, das ihr immer noch aus der Nase lief. Nur in ihren dunklen Augen glomm ein unheilvolles Licht. Aber das bemerkte der Alcalde nicht. Er registrierte nur, daß Aina auch jetzt weiterhin hartnäckig schwieg.
Er ließ sie los.
„Ruft die Folterknechte!“ schrie er außer sich vor Wut. „Sie sollen ...“
Teniente Morales fiel ihm ins Wort.
„Senor, das können Sie nicht tun, das ist gegen ...“
Santana fuhr herum. Seine Augen waren nur Schlitze.
„Sie wird gefoltert. Hier und jetzt. Ich will es sehen, ich will hören, wenn diese Inidanernutte schreit, wenn sie mich darum bittet, reden zu dürfen!“
Er stand vor dem Leutnant und hatte die Hände zu Fäusten geballt. Die beiden Soldaten, die das Mädchen gerade wieder hatten packen wollen, starrten den Alcalden an. Keiner achtete in diesem Moment auf Aina.
Einer der beiden Soldaten, die Aina bisher festgehalten hatten, lief los, um die Folterknechte zu holen. Aina wußte, daß ihr nur noch wenige Augenblicke blieben.
Sie warf sich herum und rammte dem neben ihr stehenden Soldaten ihren Ellenbogen in den Leib. Gleichzeitig riß sie ihm das dolchartige Messer aus dem Gürtel, das er bei sich getragen hatte.
Der Soldat schrie auf, aber noch im Fallen packte er Aina und zog ihr die Beine unter dem Körper weg.
Die Indianerin stürzte, die Hand, in der sie das Messer hielt, zuckte hoch. Die Klinge blitzte im Schein der Kerzen, die das Arbeitszimmer des Alcalden erhellten. Dann fuhr die Klinge dem Soldaten in die Brust,
Aina sprang auf. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie der Teniente auf sie zustürzte, und geschickt wich sie zur Seite aus. Abermals schnellte ihre Rechte hoch, und dann brüllte der Alcalde plötzlich auf.
Das Messer flog auf ihn zu, die spitze Klinge bohrte sich durch den Stoff seines leichten Gewandes in seine Brust.
Der Alcalde taumelte, seine dicken Finger fuhren durch die Luft und suchten nach einem Halt. Er sah noch, wie die Indianerin auf das Fenster hinter seinem Armstuhl zusprang, hörte noch, wie die Scheibe splitternd unter dem Anprall ihres Körpers zerbarst. Dann wurde ihm schwarz vor Augen, und er brach zusammen.
Auf seiner Brust breitete sich rasch ein roter Fleck aus, der schon innerhalb weniger Sekunden die ganze linke Seite seines Gewandes ausfüllte.
Teniente Morales stand wie erstarrt. Das alles war so schnell gegangen, daß er seinen Augen und Sinnen einfach nicht traute.
Er starrte seinen Soldaten an, den die Indianerin niedergestochen hatte, und er wußte sofort, daß diesem Mann nicht mehr zu helfen war. Dann war er mit einem Sprung bei dem Alcalden, beugte sich zu ihm hinunter und drehte ihn vorsichtig auf den Rücken.
Der Alcalde atmete noch, aber er verlor viel Blut.
Teniente Morales richtete sich, ruckartig auf.
„Überfall!“ brüllte er. „Hierher! Einen Arzt, die Indianerin hat den Alcalden ...“
Schritte wurden laut. Der Soldat und die beiden Folterknechte, die Santana hatte rufen lassen, stürzten herein.
Leutnant Morales ließ ihnen keine Zeit zu irgendwelchen überflüssigen Fragen.
„Packt mit an!“ befahl er. „Wir müssen den Alcalden in sein Schlafgemach bringen. Und du“, er wandte sich an den entsetzt auf seinen toten Kameraden blickenden Soldaten, „schaffst den Arzt zur Stelle. Beeil dich! Gib Alarm, die Wachen sollen das Mädchen einfangen! Los, ab!“
Der Soldat stürzte davon, während der Teniente und die beiden Folterknechte den bewußtlosen Alcalden in sein Schlafgemach trugen.
Aina taumelte hoch. Sie wußte, daß sie keine Zeit verlieren durfte, denn die Spanier würden sie erbarmungslos jagen, weil sie einen Soldaten getötet hatte.
Glücklicherweise hatte das Arbeitszimmer des Alcalden zu ebener Erde gelegen, der Sturz aus dem Fenster hatte ihr nichts getan. Lediglich an den Händen und Armen blutete sie aus einigen Schnittwunden, die ihr die splitternde Scheibe gerissen hatte.
Die Indianerin lief zum Hafen hinunter. Aina wußte ganz genau, daß sie auf der Halbinsel, auf Culebra, nicht bleiben konnte, ohne ihren ganzen Stamm in Gefahr zu bringen. Man würde sie suchen, überall, Aber es gab eine kleine Insel und auf dieser Insel ein ganzes System von Höhlen – die von den Spaniern so heiß gesuchte Goldmine der Nicaraos. Eine der Goldminen – die größte. Dort konnte sie sich verstecken, und dort würde man sie auch niemals finden. Außerdem hatte die Sache noch einen weiteren Vorteil für Aina. Wenn ihr Vater erfuhr, was sich bei dem Alcalden ereignet hatte, dann würde er wissen, wohin Aina geflohen war.
Aina überlegte das alles, während sie keuchend zum Hafen lief. Sie brauchte ein Boot, koste es, was es wolle! Ohne Boot war sie verloren.
Sie erinnerte sich, daß seit dem heimtückischen Überfall auf die Frauen und Mädchen ihres Volkes während des Markttages noch etliche Auslegerboote im Hafen liegen mußten. Die Spanier hatten sie beschlagnahmt, trotz des Protestes ihres Vaters. Die Frage war nur, wie sie an eins dieser Boote gelangen sollte.
Ich muß schnell sein, viel schneller als die verfluchten Gringos! dachte sie. Sie konnte sich genau vorstellen, was im Palazzo des Alcalden jetzt geschah, daß man die Wachen alarmieren würde, daß die Soldaten zuerst am Hafen nach ihr suchen und alles aufbieten würden, um sie wieder einzufangen. Was dann jedoch auf sie wartete, darüber gab sich Aina keinen Illusionen hin.
Sie beschleunigte ihren Lauf. Ihr Puls flog, das Herz schlug ihr bis zum Hals. Als sie die engen Gassen des kleinen Ortes auf der Halbinsel verließ und bereits das dunkle Wasser des Hafens vor sich sah, hörte sie die Trompeter der Spanier Alarm blasen.
Stimmen drangen undeutlich an ihre scharfen Ohren, dann erschollen Kommandos.
Aina warf sich in einen der dunklen Torbögen, die zu den letzten Häusern Culebras gehörten. Erst jetzt bemerkte sie, daß sie immer noch splitternackt war.
Aina war es gleichgültig, Sie hatte nur ein Ziel: zu überleben und Rache zu nehmen an diesem fetten Spanier, der sie blutig geschlagen hatte. Sie, Aina, die Tochter des Häuptlings der Nicaraos.
Aina lauschte. Erst undeutlich, dann aber mit jeder Sekunde stärker, vernahm sie die polternden Schritte, mit denen die Soldaten vom Palazzo heranstürmten.
Sie überlegte fieberhaft. Nein, es blieb nur eine einzige Möglichkeit, sie mußte es einfach riskieren!
Die Indianerin sprang auf. Die kurze Pause hatte sie erfrischt. Ihr biegsamer, junger Körper schnellte über die Gasse und verschwand sogleich im Dunkel der Nacht.
Aina wußte genau, wo sich die Boote befanden, und sie wußte auch, daß bei ihnen einer der Soldaten Wache hielt.
Sie brauchte nur Minuten, um vom Rand des Ortes zum Liegeplatz der Boote zu gelangen. Sie sah den Wachsoldaten schon von weitem im Licht einer blakenden Öllaterne, die an einem der Holzpfähle hing.
Lautlos glitt sie weiter. Ihre nackten Sohlen verursachten kein Geräusch auf dem Kopfsteinpflaster, das die Spanier für ihre schweren Pferdefuhrwerke angelegt hatten.
Sie erreichte einen Bretterstapel, stoppte, duckte sich und horchte auf das Gebrüll der Soldaten, die nun schon bedenklich nahe waren.
Ohne zu überlegen, schnellte sie sich vorwärts und sprang den Soldanten an, der sich gerade wegen des Gebrülls und der Rufe seiner Kameraden umgedreht hatte und ihr auf diese Weise den Rücken zukehrte. Sie tat es mit solcher Wucht, daß der Wachsoldat vornüberkippte, seine Muskete fallen ließ und vor Schreck einen lauten Schrei ausstieß. Dann warf er sich jedoch herum und wollte nach seiner Muskete greifen. Aber Aina war schneller. Sie packte die Waffe am Lauf, riß sie hoch und schmetterte sie dem Soldaten auf den Schädel. Der Mann sackte zusammen, sein Körper zuckte noch ein paarmal, dann lag er still.
Aina tastete ihn blitzschnell ab, und sie fand, wonach sie suchte. Mit einem Ruck entriß sie ihm das dolchartige Messer, das in seinem Gürtel steckte. Sie sprang auf und jagte auf den Steg hinaus, an dem die Auslegerboote lagen.
Sie warf sich in das letzte von ihnen, durchtrennte blitzschnell die Leinen, die es am Steg hielten, stieß sich ab und griff sofort nach dem Paddel, das im Boot lag.
Von Land her wehte eine starke Brise, erste Regentropfen fielen. Aina hockte im Heck des Auslegerbootes und paddelte um ihr Leben. Sie wagte es nicht, mit dem Setzen des Dreiecksegels Zeit zu verlieren. Sie kannte die Reichweite der spanischen Musketen nur zu genau.
Das wüste Gebrüll am Ufer ließ das Indianermädchen zusammenzucken. Ein paar Musketen wurden abgefeuert, spanische Flüche und Befehle drangen über das nachtschwarze Wasser zu ihr hinüber.
Aina ließ das Paddel fallen. Wahrscheinlich hatten die Gringos kein Boot – sie hatte jedenfalls keins bemerkt –, mit dem sie die Verfolgung aufnehmen konnten. Und mit den Auslegerbooten verstanden diese weißen Tölpel sowieso nicht umzugehen. Aina verzog verächtlich die Lippen.