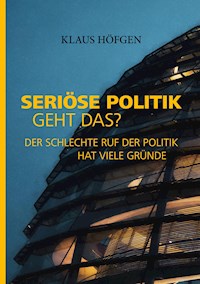
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seriöse Politik ist ein anspruchsvolles Ziel. Um es zu realisieren, sind einige Entwicklungen im politischen Raum erforderlich. Allerdings werden diese nicht einfach durchzusetzen sein, denn es gibt Gewohnheiten, die von den Beteiligten als selbstverständlich und natürlich angesehen werden. Aber es besteht die Möglichkeit, wirksame Schritte zu gehen. Ausgehend von knackiger Kritik vollzieht dieses Buch die Wendung zu einem konstruktiven Resultat. Wir sehen viele Probleme im politischen Raum, doch es werden auch praktikable Lösungen deutlich, beispielsweise bei Investitionen, deren Kostenüberschreitung häufig zu großer Aufregung führt. Seriöse Politik wird sich im Verhältnis zwischen Politikern und der Bevölke-rung niederschlagen. Dazu gehört ein offener Dialog, der seine Bezeichnung auch verdient. Wenn dieser wieder in Gang kommt, dann wird sich auch die zwischen Politikern und Bürgern entstandene Entfremdung zurückentwickeln. Nichtwähler werden dann wieder zu Wählern. Dies allein ist schon ein lohnendes Ziel seriöser Politik!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Prolog
1. Seriöse Politik – unmöglich! Das grundsätzliche Dilemma
1.1 Die politischen Diskrepanzen
1.1.1 Unterschiedliche Interessen
1.1.2 Lösungssuche zwischen Laien und Profis
1.1.3 Gegenseitige Unterstellungen bestimmen die Tagesordnung
1.1.4 Nachhaltigkeit herrscht nur im Streit
1.1.5 Macht als politisches Ziel
1.2 Die wichtigen Streitfelder
1.2.1 Zusammenleben der Menschen
1.2.2 Finanzierung der einzelnen Vorhaben
1.2.3 Politische Absichten
1.2.4 Aussparen kritischer Themen
1.2.5 Nachhaltigkeit in der Sache
1.2.6 Politische Vorherrschaft
1.3 Wirkungen
1.3.1 Öffentliche Meinung
1.3.2 Einfluss der Kriterien
1.3.3 Politik kommt kaum ohne Schulden aus
1.3.4 Abkehr der Bevölkerung von der Politik
1.3.5 Die Schuld auf andere schieben
1.3.6 Äußere Impulse ignorieren
1.3.7 Wahrheit ist keine Erfindung der Politik
2. Seriöse Politik – unmöglich? Die Analyse
2.1 Das politische Personal
2.1.1 Die politischen Parteien
2.1.2 Persönliche Interessen
2.1.3 Macht und Einfluss
2.1.4 Verantwortung und Haftung
2.1.5 Die Wirklichkeit umgeht die Wahrheit
2.2 Die öffentliche Berichterstattung
2.2.1 Öffentliche Berichterstattung beeinflusst das Verhalten der Politiker
2.2.2 Öffentliche Berichterstattung greift aktiv in die Politik ein
2.3 Die konkreten Aufgaben
2.3.1 Investitionen
2.3.2 Außenpolitik und Verteidigung
2.3.3 Gesundheit
2.3.4 Bildung
2.3.5 Verkehr
2.3.6 Soziales
2.3.7 Wirtschaft
2.3.8 Kultur
2.3.9 Europa und die Vereinten Nationen
2.4 Beispiele für ausgeuferte Investitionen
2.4.1 Stuttgart 21 – Bahnhof in Schwaben
2.4.2 BER – Flughafen Berlin Brandenburg
2.4.3 A 44 – Autobahn von Kassel nach Eisenach
2.4.4 Kleinere kommunale Investitionen
2.5 Krisen
2.5.1 Krieg
2.5.2 Energiekrisen
2.5.3 Hunger
2.5.4 Krankheiten und Pandemien
2.5.5 Bankenkrisen
2.5.6 Eurokrise
2.5.7 Flüchtlingskrisen
2.5.8 Klimakrise
2.5.9 Terrorismus
3. Seriöse Politik – möglich? Die Chancen
3.1 Die Interessen der Politiker
3.1.1 Fokus auf die Aufgabe lenken
3.1.2 Investitionen: Geld von der Macht trennen
3.1.3 Verantwortung: Geld mit Macht verbinden
3.1.4 Qualität erzeugen
3.2 Das Interesse des Landes
3.2.1 Verantwortungsbewusste Politiker
3.2.2 Ausgleich der innenpolitischen Interessen
3.2.3 Integration der nationalen Interessen in die europäische Entwicklung
3.2.4 Rangfolge zwischen Inhalten und Rechtssicherheit
3.3 Die politischen Abläufe
3.3.1 Parlamentarischer Algorithmus
3.3.2 Nutzen der Gewaltenteilung
3.3.3 Fachliche Beratung nutzen
3.3.4 Permanentes Prüfen der Voraussetzungen
3.4 Kommunikation
3.4.1 Grundsätzliche Anforderungen
3.4.2 Kommunikation innerhalb der Politik
3.4.3 Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern
3.5 Konflikte
3.5.1 Grundlagen
3.5.2 Konflikte in der Politik
3.5.3 Auswege aus Krisen
4. Seriöse Politik – möglich! Die Realisierung
4.1 Management von Investitionen
4.1.1 Aufgaben der Beteiligten
4.1.2 Projektorganisation
4.1.3 Ausschreibungen und Auftragsvergaben
4.1.4 Kostenplanung und Kontrolle
4.1.5 Terminplanung und Kontrolle
4.1.6 Qualitätsplanung und Kontrolle
4.2 Konsolidierung der Haushalte
4.2.1 Konsequentes Vorgehen
4.2.2 Berücksichtigung der Einflussfaktoren
4.2.3 Wirkungsdauer der Maßnahmen
4.2.4 Die optimale Lösung
4.3 Energie
4.3.1 Ein sinnvoller Energiemix
4.3.2 Kernenergie – ein Tabu?
4.3.3 Die „sauberen“ Energien
4.4 Verkehr – nah und fern
4.4.1 Bestehende Systeme aufeinander abstimmen
4.4.2 Stärken und Schwächen der Systeme
4.4.3 Perspektiven im Nah- und Fernverkehr
4.4.4 Neue Verkehrskonzepte
4.5 Europäische Integration
4.5.1 Zusammenführen der Staaten
4.5.2 Nutzen für Menschen, Unternehmen, Volkswirtschaften
4.5.3 Divergente Strömungen
4.5.4 Besteht akuter Änderungsbedarf?
4.5.5 Ausblick
Epilog
ANHANG
A Daten und Informationen
A.1 Stuttgart 21: Die Entwicklung der Kosten
A.2 Varianten von Betriebshöfen
B Realisierung von Investitionen
B.1 Die Aufgaben des Bauherrn
B.2 Die Aufgaben des Projektmanagements
B.3 Die zusätzlichen Aufgaben der Planer
B.4 Projektorganisation (Organigramm)
B.5 Entscheidungs- und Genehmigungsverfahren
B.6 Projektleitungssitzungen
B.7 Bauleitungssitzungen
B.8 Rechnungsprüfung und Zahlungsabwicklung
B.9 Ablagesystem und Enddokumentation
B.10 Verhandlungsprotokoll
B.11 Werkvertrag
B.12 Kostengruppen
C Europa
C.1 Mitgliedsländer der EU
C.2 Beitrittskandidaten der EU
D Personen
E Ausgewählte Literatur
PROLOG
Als Wähler sind wir Produzenten von Politik, denn wir setzen sie mit unserer Wahl in Gang. Für Nichtwähler gilt das nicht. Als Bürger sind wir zugleich auch Konsumenten von Politik, denn sie soll ja für uns gestaltet werden. Zwischen diesen Erscheinungsformen von Produzent und Konsument lässt sich ein Feld spannen, auf dem wir viele Fragen stellen können, beispielsweise die Frage nach Seriosität in der Politik. Und jetzt geht es los: Seriosität in der Politik – kann das ernst gemeint sein, oder ist es ironisch, gar sarkastisch? Muss man der Politik also unterstellen, dass sie unseriös agiert?
Wenn man Politik an ihren eigenen Ergebnissen und an den Wegen dorthin misst, dann wird man bei näherer Betrachtung womöglich die erste Frage mit „Vielleicht“ und die zweite mit „Ja“ beantworten. Natürlich sind die Aufgaben der Politik nicht immer einfach zu erfüllen, aber die Regelmäßigkeit der Fehlleistungen ist auffällig. Es gibt nicht allzu viele dieser Resultate, die man wirklich als gelungen bezeichnen kann.
Ein Beispiel für ein gelungenes Resultat der Politik in Deutschland ist das Grundgesetz, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat und bis heute mit wenigen, wenn auch wichtigen Veränderungen gültig geblieben ist. Der Weitblick, der hinter diesem Grundgesetz erkennbar ist und ihm seinen Erfolg beschert hat, stellt in der deutschen Nachkriegspolitik eine der größten und rühmlichsten Leistungen dar. Die Menschen, die das Grundgesetz geschaffen haben, haben damit gezeigt, dass erfolgreiche, weitblickende und seriöse Politik möglich ist. Aber sie ist eben nicht selbstverständlich.
Auch ein anderes erfreuliches Resultat der Politik will ich nicht verschweigen. Gemeint ist die Wiedervereinigung Deutschlands, die, ausgelöst von den Leipziger Montagsdemonstrationen, von der Politik zunächst begleitet und schließlich vollendet wurde. Viele Menschen haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, natürlich sind der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der Außenminister Hans-Dietrich Genscher zu nennen, doch sie waren nicht allein. Innerhalb Deutschlands gab es außer ihnen viele weitere treibende Kräfte, aber auch die anderen – vielleicht die wichtigsten – dürfen wir nicht vergessen: Michail Gorbatschow und weitere exponierte Politiker aus der damaligen UdSSR, aus den USA, aus Frankreich und aus Großbritannien.
Menschen begegnen sich in den unterschiedlichsten Situationen, privat, geschäftlich oder in einem ganz anderen Umfeld. Diese Begegnungen fallen oft erfreulich, gelegentlich auch weniger erfreulich aus. Bei vielen Gelegenheiten lassen sich Grundlagen erkennen, wie das Zusammenleben der Menschen funktioniert, warum es „läuft“ oder eben nicht.
Dieses Miteinander hat viel mit Kommunikation zu tun, an ihr lässt sich die Qualität des Umgangs zwischen den Menschen gut festmachen. Die Möglichkeiten der Kommunikation werden wir später noch näher betrachten.
Solche Erkenntnisse erscheinen uns selbstverständlich, und sie sind es auch. Warum aber gehen die Menschen innerhalb der Politik anders miteinander um? Diese Politik ist offenbar ein spezieller Raum, der seine eigenen Gesetze entwickelt hat – wobei man den Begriff „Gesetze“ in mehrfacher Bedeutung verstehen kann. Eine Betrachtung dieses Raums könnte, so lässt sich vermuten, ein interessantes Unterfangen sein. Man muss hier wohl mit Ergebnissen rechnen, die zur Wunschvorstellung eines humanen und sozialen Miteinanders gesellschaftsfähiger Menschen nicht so recht passen. Und trotzdem funktioniert Politik – oder funktioniert sie in Wirklichkeit etwa nicht?
In der Hoffnung, eine Antwort auf diese Frage zu finden, habe ich meine Reise durch die verwinkelten Wege der Politik begonnen. Die analytische Vorgehensweise, derer ich mich dabei bedient habe, mag nicht neu sein; ich habe, um eine auch im politischen Raum gern zitierte Floskel zu benutzen, das Rad nicht neu erfunden. Und möglicherweise habe ich nicht einmal alle Einflüsse berücksichtigt, die sich in der Politik breitgemacht haben. Ein gewisser Erkenntnisgewinn lässt sich, so hoffe ich, dennoch verzeichnen. Die gewonnenen Erkenntnisse und einige mögliche Konsequenzen daraus möchte ich gern mit meinen Lesern teilen und zur Diskussion stellen.
Die hier vorgelegte Betrachtung der Politik gliedert sich in vier übergeordnete Abschnitte: Sie widmen sich nacheinander dem grundsätzlichen Dilemma, der Analyse, den Chancen und ihrer Realisierung. Geht man zum Arzt, dann heißen diese Segmente zum Vergleich: Krankheit, Diagnose, Therapie und Heilung.
Beim Lesen der ersten beiden Abschnitte werden mir Personen, die sich angesprochen fühlen, vielleicht eine überzogene Kritik vorwerfen, manche mögen meine Beobachtungen und Analysen gar als das pure Bedienen von Klischees empfinden.
Das sehe ich allerdings aus einer ganz anderen Blickrichtung. Es ist doch immer erforderlich, die Wirklichkeit deutlich zu machen – auch wenn „Wirklichkeit“ im Gegensatz zu „Wahrheit“ ein subjektiver Begriff ist (wie wir später noch sehen werden) – um die Dringlichkeit des Handelns zu betonen und schließlich Konsequenzen aus den Problemen und Defiziten der Gegenwart zu ziehen. Die Wirklichkeit verlangt jederzeit eine möglichst große Objektivität und Neutralität. Ich habe versucht, beides zu erreichen über eine Mischung aus eigener Erfahrung, Beobachtung und vielen Gesprächen, die auch unterschiedliche Ansichten zuließen.
Ich sehe keinen Anlass, Personen, Parteien oder Vorgehensweisen besonders schonend zu behandeln. Allerdings habe ich mich bemüht, anständig mit den Menschen umzugehen, sozusagen „hart, aber fair“. Meine Hoffnung richtet sich auf eine Versöhnung im dritten und vierten Abschnitt sowohl mit meinen Kritikern als auch den kritisierten Politikern. In diesen Abschnitten versuche ich, Möglichkeiten für messbare Fortschritte zu entwickeln, deren Umsetzung ich für notwendig, aber auch für machbar halte.
Im vierten Teil werde ich solche Möglichkeiten vor allem am Beispiel eines gelingenden Managements von Bauinvestitionen zeigen, nachdem wir in den ersten beiden Teilen des Buches einige besonders abschreckende Beispiele aus diesem Feld kennengelernt haben. Die Argumentation ist hier etwas losgelöster vom politischen Alltagsgeschäft als in den vorangehenden Teilen, gleichwohl sollte deutlich werden, dass die hier vorgestellten Werkzeuge einer seriösen Politik sehr dienlich sein können.
Die gute Nachricht heißt demnach: Es gibt zwar Probleme, es gibt aber auch Lösungen. Und noch eines: Die Probleme wurden von Menschen erzeugt, das bedeutet, dass sie auch von Menschen gelöst werden können. Der Weg von der Erkenntnis bis zur Umsetzung konkreter Schritte ist jedoch nicht nur weit, er wird vermutlich auch steinig werden. Auch darüber sollte man sich bewusst sein, wenn man sich für diesen Weg entscheidet.
Wir müssen also klug handeln, wenn wir in der Politik tragfähige und nachhaltige Lösungen für das Land erreichen wollen. Kluges Handeln sehen wir doch gern als notwendige und zielführende Aktivität an. Jetzt stellt sich allerdings die Frage: Wie handelt man wirklich klug? Um sie zu beantworten, greife ich auf ein Zitat zurück, das Konfuzius zugeschrieben wird:
„Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
Erstens durch Nachahmen, das ist der leichteste. Zweitens durch Nachdenken, das ist der edelste. Und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“
Mir scheint, dass eine gesunde Mischung aus diesen drei Handlungsmöglichkeiten eine gute Perspektive verspricht, um Politik zu entwickeln!
Beim Lesen der folgenden Betrachtungen der Politik wird Ihnen, lieber Leser, auffallen, dass sich der Hinweis auf die Entfremdung zwischen der Politik und den Bürgern wie ein roter Faden durch einige Abschnitte zieht. Die volle Bedeutung dieses roten Fadens habe ich erst während des Schreibens erkannt. Weil ich ihn für besonders wichtig und folgenschwer halte, habe ich mich nicht gescheut, den Hinweis darauf an mehreren Stellen zu wiederholen. Es gibt offenbar viele Gründe für die genannte Entfremdung, aber das Ergebnis ist immer das gleiche: Politiker und Bürger kommunizieren nicht mehr auf Augenhöhe. Wohin das am Ende noch führen kann, steht noch längst nicht fest, denn die Entfremdung schreitet immer weiter fort, und das macht sie so brisant.
Eines sei an dieser Stelle noch vermerkt: Im folgenden Text tauchen der Einfachheit halber Begriffe wie „Politiker“, „Bürger“ und ähnliche auf. In solchen Fällen ist die weibliche Form selbstverständlich gleichermaßen gemeint.
1. SERIÖSE POLITIK – UNMÖGLICH!
DAS GRUNDSÄTZLICHE DILEMMA
In Deutschland und in anderen europäischen Ländern leidet die Politik unter einem schlechten Ruf. Die Öffentlichkeit – repräsentiert durch viele einzelne Menschen, aber auch durch die Medien – spricht den politisch Handelnden vieles ab: Kompetenz und Ehrlichkeit, Willen zu Kooperation und Zielorientierung; wahrlich kein gutes Zeugnis, das Politik und Politikern ausgestellt wird. Dazu beklagen sich immer wieder geplagte Bürger über Unzulänglichkeiten bei vielen Behörden, die man mit der Politik in einen Topf wirft, sodass ein höchst unerfreuliches Gemenge entsteht, das zu dieser schlechten Beurteilung führt.
Die Politik hat die Aufgabe, Sachfragen zu lösen – Politiker haben vor allem das Ziel, Wahlen zu gewinnen. Das muss nicht zwangsläufig ein Widerspruch sein – wir werden in diesem Buch sehen, dass es das nicht muss –, in der Realität aber liegt genau hierin das grundsätzliche Dilemma der Politik. Diese, so sehen es viele Menschen, verliert sich im Streit der Ideen und im Streit zwischen den Parteien, denn es geht um Macht. Dieser Macht wird der sachliche Diskurs untergeordnet, und das erzeugt bei den Menschen im Lande Verdruss, aufgrund dessen sie sich von der Politik abwenden. So entwickelt sich ein Trend, der etwa bei Wahlen immer deutlicher wird, denn die Menschen machen nicht mehr mit, sie belegen die Wahl mit ihrem Boykott, und langsam, aber stetig werden es immer mehr. In der Folge trennt sich die Sphäre der Politik und der Politiker immer weiter von derjenigen des müden Volkes. Die Nichtwähler sind in Deutschland zu einer der größten „Parteien“ geworden. Dieser Entwicklung werden wir nicht beliebig lange tatenlos zusehen können!
Auch ich selbst habe das Problem der zunehmenden Divergenz zwischen Politik und Bevölkerung zusammen mit einigen Mitstreitern erlebt und erlebe es teilweise auch heute noch. Wenn man sich als Bürger über Politik äußert, dann ist das sehr häufig mit Kritik verbunden. Das Schimpfen über Zustände und Entscheidungen, die wir oft als Fehlentscheidungen wahrgenommen haben, war nach unserer Auffassung irgendwann nicht mehr genug. Deshalb kam zwangsläufig der Zeitpunkt, an dem es hieß: Wir wollen nicht mehr unzufrieden bleiben und aus einer passiven Position heraus kritisieren, jetzt greifen wir aktiv ein. Also gründeten wir im Jahr 2010 eine neue politische Einheit in Form einer lokalen Wählergemeinschaft1, traten bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2011 an und erreichten 5,6 % der gültigen Wählerstimmen.
Was hat sich seitdem geändert? Um es kurz zu machen – wenig! Alle von uns befürchteten Unzulänglichkeiten des politischen Raums haben sich in kurzer Zeit bestätigt, manche nicht ganz so schlimm wie erwartet, andere aber noch viel schlimmer. Für diesen Zustand haben wir eine ganze Reihe verschiedener Ursachen identifiziert, aber auch wir sind nicht in der Lage, diese Ursachen in kurzer Zeit zu beheben, schon gar nicht als relativ kleine Fraktion in einem relativ kleinen Parlament. Eines hat sich allerdings geändert: Bei der folgenden Wahl im Jahr 2016 erhielten wir 12,7 % der Stimmen und 2021 waren es 18,2 %; die Menschen honorieren, dass wir uns um ihre Angelegenheiten gekümmert haben. Aber viele Lösungen blieben trotzdem auf der Strecke.
Deshalb kam bald die Frage auf, ob es denn überhaupt einen Sinn haben kann, weiterzumachen. Diese Frage haben auch viele Bürger gestellt, die uns als potenzielle Wähler begleiten. Ihnen tat es leid um den Aufwand, den wir zu betreiben hatten und mit dem wir zunächst nur geringen Erfolg für unsere Kommune erzielen konnten. Um Erfolg zu erzielen, mussten wir eine gute Portion Geduld aufbringen. Diese Phase war wesentlich davon bestimmt, auf uns aufmerksam zu machen und erste Impulse in die Gemeinde hinein zu senden. Langsam entwickelten sich die Dinge: Zuerst gab es nüchterne Akzeptanz, dann gefälliges Kopfnicken und schließlich auch offene Zustimmung in der Bevölkerung. Diese Zustimmung empfinden Angehörige anderer politischer Einheiten im Ort offenbar automatisch als Ablehnung ihrer selbst; leider reagieren sie deshalb gelegentlich ziemlich sensibel. Wir sehen uns dagegen weniger als Konkurrenten der anderen parlamentarischen Teilnehmer, sondern eher als eine Ergänzung des bisherigen politischen Spektrums, gewissermaßen als Teil einer Vervollständigung, die zumindest aus unserer Sicht dringend erforderlich geworden war.
Inzwischen ist deshalb auch klar geworden, dass es durchaus Sinn hat, weiterzumachen, denn eines haben wir erkannt: Wenn wir uns zurückziehen, dann kommen andere, und ob die größeren Erfolg erzielen, bleibt offen. Und wenn keine anderen kommen, dann bleibt es bei den „Etablierten“, den großen traditionellen Parteien, die es auch im Land und im Bundesgebiet gibt, und die längst gezeigt haben, dass sie Erfolg überwiegend für sich selbst bei der nächsten Wahl suchen, seltener aber für die Menschen, von denen sie gewählt wurden. Dieses Urteil klingt sehr hart, scheint aber auf allen politischen Ebenen gültig zu sein, für die Kommunen, für die Länder und für den Bund. Auf der europäischen Ebene in Straßburg, Brüssel und Luxemburg herrschen offenbar ähnliche Verhältnisse.
Im Bereich der parlamentarischen Politik fällt es immer sofort auf, wenn zwei oder mehrere Parteien in einer politischen Sachfrage der gleichen Meinung sind. Das Gleiche gilt für einzelne Politiker unterschiedlicher Parteien oder Fraktionen. Eine ähnliche Sicht der Dinge ist sofort verdächtig! Übereinstimmungen kann es doch eigentlich nur innerhalb einer Fraktion geben, allenfalls findet man sie noch in Koalitionsverträgen, und da sind es ja auch nur faule Kompromisse! So jedenfalls verstehen die Parteien im Normalfall ihr Verhältnis zueinander. Auf dieser Grundlage lassen sich auch trefflich Koalitionen und Oppositionen beschreiben.
Die Wirklichkeit soll sich in „unterscheidbaren Merkmalen“ darstellen, dafür gibt es ja schließlich unterschiedliche Parteien, die sich auch immer wieder unter Betonung ihrer Unterscheidungsmerkmale zur Wahl stellen. Auf diese Weise kann man natürlich sofort Lösungen finden: Man betont die Diskrepanzen, die sich teilweise ganz von selbst ergeben, und wenn nicht, dann hilft man eben ein wenig nach. Hauptsache: unterscheiden und abgrenzen!
Allerdings darf man nicht allein aus Prinzip streiten, denn das kommt schlecht an beim Wahlvolk. Also sucht man sich Felder, auf denen man den Streit gefällig ausfechten kann. Und die bieten sich in reicher Zahl. Praktisch in jedem einzelnen Ressort kann man unterschiedlicher Meinung sein, wenn man sich nur ein wenig bemüht. Am deutlichsten zeigt sich dies beim jährlichen Spektakel der Haushaltsdebatten. Die jeweils Regierenden preisen ihre Vorstellung von Einnahmen und Ausgaben bis hin zur „Alternativlosigkeit“ an, während die Opposition ganz andere Pfeile im Köcher hat, und die tragen allesamt denselben Namen: „Gegenteil“. So funktioniert Politik in Deutschland, und alle finden es schrecklich!
Bei solchem Agieren verwundert es nicht, dass die Bürger nur noch den Kopf schütteln können über „die da oben“, die offenbar eher ein Theaterstück aufführen als fundierte Sachpolitik zu machen. Dieser schlechte Ruf der Politik hat längst Konsequenzen. Es geht nicht mehr nur um die öffentliche Meinung, es geht auch um handfeste Probleme. Sie zeigen sich beispielsweise an maroden Haushalten auf allen politischen Ebenen. Vielfach resultieren sie aus den Geschenken, die die Parteien vor der Wahl versprechen und die sie irgendwann und in irgendeiner Form liefern müssen. Niemand anderes – ob Unternehmer oder Privatperson – kann sich ein solches Gebaren leisten, denn beiden würde sehr schnell der Geldhahn zugedreht.
Diese negative Beschreibung der Politik mag in einigen Fällen vielleicht als übertrieben erscheinen, in anderen Fällen ist sie es sicher nicht, denn vieles gelangt nicht einmal in die Öffentlichkeit. Wie viel der angebrachten Kritik auch tatsächlich berechtigt sein mag, eine fatale Wirkung hat das Verhalten der Handelnden in diesem Gewerbe in jedem Fall. Die folgenschwerste Wirkung ist die Entfremdung zwischen Politikern und Bürgern. Eine Entfremdung, die sich aufgrund vieler Entscheidungen, die wir als Fehlentscheidungen wahrnehmen, inzwischen als Dauerzustand verfestigt hat.
Eine solcher Zustand ist gefährlich, wenn er über längere Zeit anhält – für die Politik, für die Menschen, für das ganze Land. Möglichst bald muss irgendjemand anfangen, daran etwas zu ändern, Dynamik zu erzeugen und Seriosität zu fordern. Sonst gewinnen eines Tages diejenigen die Macht, die einen anderen Staat wollen als diesen, den sich die Menschen über mehrere Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg so erfolgreich erarbeitet haben. Der Generation des Aufbaus dürfen wir sehr dankbar für ihre Leistung unter schwierigsten Bedingungen sein. Nun liegt es an uns, den Sinn dieser Leistung zu erhalten, indem wir ihre Errungenschaften auch für die Zukunft absichern. Wir haben also eine konkrete Aufgabe zu erfüllen!
1.1 Die politischen Diskrepanzen
Politik besteht aus vielen Komponenten: Neben den unmittelbaren Effekten politischer Handlung sind nämlich auch Einflussgrößen wirksam, die sich erst aus der primären Politik ergeben. Zunächst gibt es eine Gemengelage unterschiedlicher Interessen, die auf der politischen Bühne aufeinanderprallen. Die daraus entstehenden Diskrepanzen müssen nicht zwangsläufig unproduktiv sein, münden häufig aber in den Streit, der viel Energie von den Beteiligten fordert und wenig Energie für tatsächliche Lösungen übrig lässt.
Einen „guten Willen“ sollte man eigentlich jedem unterstellen können, trotzdem lässt sich eine tragfähige Übereinkunft in solchen Streitfragen häufig nicht herstellen. Mit Kommunikation allein kommt man auch nicht immer zum Ziel, weil man einander nicht richtig versteht, gelegentlich redet man einfach aneinander vorbei. Ursache dafür ist vielfach die Tatsache, dass sich Laien mit Profis unterhalten, ohne dass diese sich um eine allgemeinverständliche Wortwahl bemühen. Dass so ein hinreichendes Verständnis entstehen kann, ist kaum zu erwarten, und eine verträgliche Lösung kann dadurch vollständig verhindert werden.
In anderen Fällen sprechen die beteiligten Politiker auf der gleichen Ebene miteinander, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist. Wenn aber nun unterschiedliche Auffassungen zum Thema auftreten, dann leidet die Kommunikation erneut. Weil man sich nicht sofort einigen kann, unterstellt man sich gegenseitig Unwillen, Ignoranz oder schlechte Absichten, so, wie das eben in unseren Parlamenten Usus ist. Der Wille und damit die Chance, gemeinschaftlich Lösungen zu erreichen, nehmen von Anfang an Schaden, und die Qualität des Erreichten bleibt entsprechend gering.
Grundsätzlich behauptet jeder Politiker, gute und einvernehmliche Ergebnisse zu wollen, und diese Absicht darf man den meisten sogar glauben. Ein Ergebnis ist besonders dann gut, wenn es nicht nur seine Mehrheit gefunden hat, sondern auch inhaltlich so angelegt ist, dass man es mit Recht als „nachhaltig“ bezeichnen kann. Die Erfahrung zeigt, dass solche Ergebnisse leider viel zu selten erreicht werden – am ehesten noch in Krisenzeiten, wenn es eben überhaupt nicht mehr anders geht und man sich gezwungenermaßen zusammenraufen muss. Meist ist die einzige erreichbare Nachhaltigkeit aber darin zu finden, dass man sich auch zukünftig über das jeweilige Thema streiten kann.
Und schließlich gibt es in der Politik das grundsätzliche Streben nach Macht. Diese Macht versuchen alle Parteien an sich zu ziehen; alle wollen das jeweilige Thema mit ihrem eigenen Namen verbinden und aus einem erfolgreichen Ergebnis in der Zukunft immer wieder schöpfen. Vor allem eignet es sich dafür, vor der nächsten Wahl darauf hinzuweisen: „Wer hat dieses tolle Ergebnis erreicht? Natürlich wir, die ABC-Partei!“ Damit versucht man, ein gutes Wahlergebnis für die eigene Partei zu erreichen, und das bedeutet wiederum Macht.
Politische Ziele werden immer wieder auf Machterhalt oder Machtzuwachs reduziert, und die Inhalte bleiben auf der Strecke. Dies ist der hohe Preis der politischen Macht. Grundsätzlich ist Macht aber nichts Unanständiges. Unanständig wird sie erst dann, wenn man ihr die eigentlichen Inhalte – gelegentlich sogar die eigenen inhaltlichen Ziele – unterordnet.
1.1.1 Unterschiedliche Interessen
Auf dem politischen Feld gibt es viele Mitspieler, die fast ebenso viele, oft schwer vereinbare Interessen verfolgen. Mit dieser Aufstellung nimmt das Unheil seinen Lauf. Interessen findet man im politischen Raum überall, seien es parteipolitische, wirtschaftliche, ethische oder auch persönliche, sehr häufig spielt der Faktor Macht eine entscheidende Rolle. Die Liste der unterschiedlichen Arten von Interessen lässt sich fast beliebig verlängern und auf alle Ressorts in den Regierungen und Parlamenten ausdehnen. Dabei entsprechen den Spielplätzen der Auseinandersetzung ebenso viele Sektoren unserer Gesellschaft, wie beispielsweise Finanzmärkte, der Arbeitsmarkt, aber auch religiöse Plattformen oder der sportliche Bereich, parteipolitische Aktivitäten und Auseinandersetzungen kommen hinzu.
Im Einzelfall möchte eine Gruppe etwas erneuern, dies führt fast immer zu Investitionen oder zu einem sonstigen Einsatz finanzieller Mittel. Andere wollen genau diese Ausgaben einsparen, um die frei werdenden Mittel für andere Zwecke einzusetzen oder einfach den Haushalt zu sanieren, gerade so, wie es die jeweilige Gruppe für sinnvoll und zielführend hält. Diese unterschiedlichen Interessen führen zu ebenso vielen unterschiedlichen Ansprüchen, und weil man die meist schwer zusammenbringen kann, beginnt spätestens an dieser Stelle der politische Streit.
Warum mündet alle politische Aktivität immer wieder im Streit? Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin, dass es keine neutralen Instanzen gibt, wenn man von den Gerichten einmal absieht. Aber man geht eben nicht mit jedem einzelnen Thema zu den Gerichten, was diese schließlich auch maßlos überlasten würde. Also streitet man sich munter weiter und kommt entweder zu gar keiner Lösung oder zu einem Kompromiss, dem man in vielen Fällen das Attribut „faul“ anhängen muss. Die ursprüngliche Absicht geht über dieser Prozedur teilweise oder sogar ganz verloren.
Der permanente Streit zwischen den politischen Akteuren wird von den Medien immer wieder gern aufgenommen, und damit kommt eine neue Komponente ins Spiel, über die man dann auch wieder trefflich streiten kann. Die Kontroverse ist das Steckenpferd der Medien, denn darüber lässt sich besonders genüsslich berichten. Hier zeigt sich die volle Schlagkraft des alten Journalisten-Leitspruches „Only bad news are good news.“ Ein Pingpongspiel dieser Art ist zum Standard unserer Politik geworden; wen wundert es, dass sich das Wahlvolk von dieser Politik und den beteiligten Politikern abwendet?
Häufig sind die unterschiedlichen Interessen einfach parteipolitischer Natur. In den Parlamenten muss man dann langwierige – gelegentlich auch langweilige – Debatten führen oder ertragen, je nachdem, wo man gerade seine eigene Position sieht. Argumente werden dann nicht immer am Thema selbst entwickelt, sondern sie werden aus Prinzip als Gegenargumente aufgebaut, um den zu erwartenden Streit zwischen den Fraktionen zu füttern. Die Interessen, die hinter einem anfänglichen Impuls gesteckt haben, werden immer weiter verwischt, und schließlich werden die Formulierungen so weit verfremdet, dass der mehrheitsfähige Kompromiss die ursprüngliche Absicht überhaupt nicht mehr abbildet. Insofern können politischen Diskrepanzen durchaus zerstörerischen Charakter haben.
Auf den ersten Blick erscheint der Kompromiss als ein tugendhaftes Ergebnis politischer Arbeit. Wenn man aber auf die Folgen blickt, die aus dem Verlust ursprünglicher Absichten entstehen können, dann verliert der Kompromiss gelegentlich einen erheblichen Anteil seiner Strahlkraft. Insofern muss man den Begriff „Kompromiss“ immer auch mit „Verwässerung“ übersetzen. Hier gelangt die parlamentarische Demokratie in einen Grenzbereich, in dem sich folgerichtig die Frage erhebt, ob diese politische Form überhaupt erstrebenswert ist. Diese Frage wird man erst dann beantworten können, wenn man mögliche Alternativen zur Diskussion stellt. Allerdings sind alle bislang bekannten Alternativen noch schlimmer; schon Churchill sagte dazu: „Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen!“
Überlagert werden die zwischen den Parteien bestehenden unterschiedlichen Interessen häufig noch von Ansprüchen, die von außen an die Politik herangetragen werden. Die Absender kommen aus ganz verschiedenen Richtungen, beispielsweise aus der Wirtschaft oder der Industrie, von den Gewerkschaften, von kulturellen Vereinigungen und solchen des Sports oder aus anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Alle haben ein Anliegen, für das sie eine Patenschaft in der Politik suchen, und häufig geht es auch noch um Geld. Dadurch kommen vielfältige Versuchungen auf den einzelnen Politiker wie auf die Parteien zu. Gern macht man es dort jedem recht, das funktioniert natürlich fast nie, denn wenn man die Interessen des einen stützt, dann muss man die Interessen eines anderen stören. Deshalb stellen diese externen Interessen eine ganz besondere Anforderung an die Politik dar.
1.1.2 Lösungssuche zwischen Laien und Profis
Wenn in politischen Gremien nach Lösungen gesucht wird, dann sprechen meist wenige Profis mit vielen Laien. Schauen wir uns die Parlamente an, dann stellen wir fest, dass beispielsweise im Bundestag viele Verwaltungsbeschäftigte, viele Lehrer und viele Juristen sitzen, insgesamt stellen diese drei Gruppen eine große Zahl der Bundestagsabgeordneten. Die Juristen können ihr Fachwissen bei der Gesetzgebung einbringen, die Lehrer vielleicht in Fragen der schulischen Bildung. Sie sind aber nicht diejenigen, die etwa in Fragen des Verkehrs, der Wirtschaft oder der verteidigungspolitischen Strategie einen fachlich kompetenten Beitrag leisten können. Bei den anderen vertretenen Berufen bestehen natürlich analoge Defizite.
Hinter dieser fehlenden fachlichen Kompetenz steckt weder eine böse Absicht der Genannten noch ist diese Beurteilung böse gemeint. Niemand kann für alle Fragen der Politik zugleich Fachmann sein. Darin steckt zweifellos ein Dilemma, denn daraus folgt, dass in den Parlamenten überwiegend Politiker sitzen, die vom aktuellen Thema in Wirklichkeit keine Ahnung haben. Das mag keine besonders spektakuläre Erkenntnis sein, aber die Konsequenzen werfen wichtige Fragen auf.
Welche Folgen fehlende Kompetenz in einem bestimmten Thema haben kann, habe ich selbst mit einigem Schrecken erkennen müssen, denn das gleiche Phänomen wie im Bundestag tritt natürlich auch in den Landtagen oder in den kommunalen Parlamenten auf. Plötzlich standen Themen zur Entscheidung an, von denen ich selbst überhaupt nicht behaupten konnte, eigene Kompetenz einzubringen. So entsteht ein ungutes Gefühl im Vorfeld der Entscheidung, weil man gewissermaßen keine wohlbegründete eigene Meinung hat.
Wie verhält man sich nun bei Abstimmungen? Man möchte sich schließlich nicht der Peinlichkeit aussetzen, teilzunehmen, ohne wirklich zu wissen, ob das eigene Verhalten überhaupt mit dem eigenen Leitbild übereinstimmt. Deshalb ist zunächst einmal zu klären, wie man eine solche Situation seriös bewältigen kann, ohne mit sich selbst eine moralische Grundsatzdiskussion beginnen zu müssen. Prinzipiell gibt es dabei drei Möglichkeiten:
1. Man kennt sich im Thema aus.In diesem Fall lässt sich das Vorgehen gut handhaben, denn man hat ausreichende Kompetenz, um seriös mit „Ja“ oder „Nein“ abzustimmen, oder sich gegebenenfalls auch der Stimme zu enthalten. Das Abstimmungsverhalten ist deshalb seriös, weil man es aus eigener Kenntnis gut begründen kann.
2. Man kennt sich nicht aus, ist aber inhaltlich und zeitlich in der Lage, sich hinreichende Information zu beschaffen.Auch in diesem Fall kann man sich eindeutig entscheiden und sich bei der Abstimmung entsprechend verhalten. Er unterscheidet sich vom ersten Fall nur dadurch, dass man vorbereitend einen größeren Aufwand zu betreiben hat.
3. Man kennt sich nicht aus, ist auch inhaltlich und/oder zeitlich nicht in der Lage, sich hinreichende Information zu beschaffen.Jetzt kann man sich nicht mehr eindeutig bei der Abstimmung entscheiden, denn man verfügt nicht über die notwendige Kompetenz. Deshalb wird man auch kaum in der Lage sein, eine Abstimmung mit „Ja“ oder „Nein“ ernsthaft zu begründen, weder anderen noch sich selbst gegenüber. Hier kommt das eigene Gewissen ins Spiel, dem man sich zu Beginn der Legislaturperiode verpflichtet hat. In diesem Fall bleibt deshalb nur die Möglichkeit zur Enthaltung, sofern man seriös handeln und seinen eigenen Grundsätzen treu bleiben will.
Der dritte Fall tritt naturgemäß bei kleineren Fraktionen relativ häufig auf, weil sie nur über geringe Kapazität zur Recherche verfügen. Gelegentlich muss man deshalb über die Fähigkeit einiger Politiker staunen, sich in kurzer Zeit einen genauen Überblick über ein ursprünglich fremdes Thema zu verschaffen, der sie in die Lage versetzt, schnell zu einer Entscheidung zu finden! Gewiss, man kann sich bei Kollegen der eigenen oder einer anderen Fraktion Hinweise holen und im Vertrauen auf deren Kompetenz sein eigenes Abstimmungsverhalten anpassen. Man kann diese Hinweise natürlich auch aus anderen Quellen schöpfen. Der Anspruch, eine sichere Entscheidung auf einer stabilen eigenen Meinung zu begründen, sollte jeden Mandatsträger unabhängig von seiner jeweiligen Fraktion antreiben2. Auch wenn er sich schließlich einem Fraktionszwang unterwerfen sollte, so stellt das Bewusstsein über das eigene Handeln doch eine wichtige moralische Grundlage für seine künftige politische Arbeit dar.
Die den Entscheidungen vorausgehenden Diskussionen finden, wie bereits erwähnt, meist zwischen einigen Fachleuten und vielen Laien statt. Dass die sich dabei ergebenden unterschiedlichen Diskussionsebenen und das unterschiedliche Verständnis der Teilnehmer ein grundsätzliches Problem darstellen, muss man bei der Beurteilung der Qualität einer Debatte berücksichtigen. Diese Diskrepanzen lassen sich auch nicht einfach auflösen, denn die jeweilige Sachkenntnis ist in der ganz persönlichen Vergangenheit eines Politikers entstanden, sie lässt sich deshalb in der Gegenwart nicht einfach zu einem allgemeingültigen parlamentarischen Maßstab erheben.
Man wird das Problem der unterschiedlichen Fachkompetenz zwischen Laien und Profis in der Politik kaum beheben können, aber man sollte sich stets über diese Bedingung bewusst sein, wenn man den politischen Diskurs bewertet. In jeder einzelnen Frage muss deshalb geprüft werden, inwieweit fachliche Unterstützung von außen Abhilfe schaffen kann.
1.1.3 Gegenseitige Unterstellungen bestimmen die Tagesordnung
Eine Lieblingsbeschäftigung parlamentarischer Politiker scheint die Suche nach Schuldigen in den Reihen der anderen zu sein, wenn es darum geht, eine offensichtliche Fehlentwicklung zu beschreiben. Diese Prozedur erleben wir täglich in den Parlamenten der Republik. Politiker stellen nämlich früher oder später fest, dass sie jedes Thema negativ darstellen können, wenn sie nur kreativ genug vorgehen. Das geschieht meist dann, wenn ein Politiker einer konkurrierenden Partei einen Vorschlag gemacht hat. Damit ist das Zeichen zur Attacke gegeben, und die Angehörigen der anderen Parteien erklären, warum der Vorschlag unsinnig ist, nicht zum Ziel führt oder sonstige Schwächen aufweist. Alles Negative, alles das, was nicht funktioniert, alles, was ein Vorschlag an Schwächen enthält, lässt sich von der Konkurrenz wunderbar erklären. Kann man das bei Übereinstimmungen etwa nicht? Doch, man kann, aber man muss es auch wollen!
Vielfach unterstellt man sich gar unlautere Absichten, und damit sind die Gräben tief genug, um sich eine Weile mit dem Thema zu beschäftigen, natürlich nie ohne den Hinweis auf all das, was an den Vorstellungen der anderen problematisch ist. Es bleibt aber nicht allein beim inhaltlichen Kritisieren der Vorschläge, nein, es wird sogar noch eine böse Absicht angenommen. Alle diese kleineren und größeren Gefechte beschäftigen ganze Verbände von Parteistrategen, die der Sache selbst aber gar nicht dienen wollen, sondern lediglich ein Thema nutzen, um die eigene Position besser darzustellen und die eigene Macht zu stärken. Und wenn niemand der Sache dienen will, dann kann der Sache natürlich auch nicht gedient werden – so einfach ist das.
Wortreich wird von den Strategen der Parteien erklärt, dass die eigene Fraktion alles viel besser kann und weiß, nur stimmt dies leider fast nie. Es ist ein Kampf um des Kampfes willen. Darunter haben alle diejenigen zu leiden, die nicht in das Geschehen eingreifen können, nämlich die Bürger, die Arbeitnehmer, die Unternehmer, die Steuerzahler – sie alle haben die Zeche zwar zu zahlen, aber wirklicher Einfluss bleibt ihnen verwehrt. Auch darum wenden sich immer mehr wahlberechtigte Bürger von der Politik ab.
Wie man Angehörige anderer Parteien behandelt, hängt davon ab, ob man sich mit ihnen in einer Koalition befindet oder ihnen oppositionell gegenübersteht. Der Disput wird also nicht an der Sache festgemacht, sondern an der jeweiligen politischen Konstellation. Wenn eine Koalition nach der nächsten Wahl wieder aufgelöst werden muss, dann braucht der bisherige Partner auch nicht mehr geschont zu werden, denn jetzt ist er ja nicht mehr Partner. Es gilt also wieder: Feuer frei! Verstehen kann das niemand, insbesondere nicht der Wähler.
1.1.4 Nachhaltigkeit herrscht nur im Streit
Bei vielen Themen sprechen die Protagonisten der Parteien gerne von Nachhaltigkeit, insbesondere wenn es um Umweltschutz geht oder um die Schonung von Ressourcen. Das ist grundsätzlich auch angemessen, nur bedeutet Nachhaltigkeit in der Politik oft nicht das, was man sich als Bürger darunter vorstellt. Beispielsweise war man sich im Fall der technischen Nutzung von Kernenergie nach der Katastrophe von Fukushima sehr schnell einig, dass der Ausstieg aus dieser Technologie beschlossen werden müsse. Ein solcher Ausstieg erfordert natürlich das zeitgleiche Bereitstellen alternativer Energien, damit im Lande – und vor allem bei der Industrie – nicht die Lichter ausgehen.
Diese Aufgabe ließ sich nicht erfüllen, denn die Windenergie, die man sich von den in der Nordsee erstellten Anlagen versprochen hat, lässt sich noch nicht in die Regionen transportieren, in denen sie vor allem benötigt wird, etwa ins Ruhrgebiet oder in die Ballungszentren Süddeutschlands. Es fehlen einfach die notwendigen Leitungen. Weil dieses Problem nicht so schnell lösbar ist, wie es sich die Politiker (in seltener Einigkeit!) vorgestellt haben, bietet das Thema wieder ein herrliches Schlachtfeld für den Streit. Und dann ist sie wieder da, die Nachhaltigkeit in der falschen Sache.
Einen Klassiker des politischen Streits erleben wir jedes Jahr bei den Haushaltsberatungen. Auch dabei sind die Fronten zwischen Koalition und Opposition meist sehr klar gezogen. Die Vorschläge der Regierenden werden automatisch von der Opposition abgelehnt, wie auch umgekehrt die Ideen der Opposition bei der Koalition keine Chance haben. (Fast) immer und immer wieder ist es so. Auch hier herrscht Nachhaltigkeit allein im Streit – die Bürger, die Wähler können sich darauf verlassen! Weil dieses Verhalten alles ist, nur eben nicht konstruktiv, wenden sich immer mehr Wähler von der Politik ab. Man kann es inzwischen verstehen.
Besonders finanzielle Fragen sind fast automatisch mit Streit verbunden. Eine Seite behauptet, sparen zu wollen, die andere will aber investieren, um beispielsweise die Konjunktur zu beleben. Abbau von Schulden versus Schaffen von Arbeitsplätzen – ein nicht enden wollender Dissens, bei dem die Beteiligten zwei Themen gegeneinander auszuspielen versuchen, die bei Licht betrachtet, nur wenig miteinander zu tun haben. Beide Seiten haben das Ziel, die Wähler zu beeindrucken, aber das können sie nicht, solange sie ihre Absichten nicht ernsthaft und redlich begründen.
Ähnlich verhält sich die EU bei der Frage, wie die wirtschaftliche Gesundung der südeuropäischen Schuldenländer zu erreichen ist. Ist der Erfolg der Rettungsschirme eher im „Kaputtsparen“ oder in geldverschlingenden Impulsen für die marodierenden Volkswirtschaften dieser Länder zu finden? Eine brennende Frage kommt dabei immer deutlicher in den Fokus: Lässt sich die Rettungsaktion überhaupt ohne Schuldenschnitt realisieren? Falls sich jemand für meine Meinung interessiert: Der Schuldenschnitt wird nicht vermeidbar sein, denn die zu erwartende Leistung der überschuldeten Länder reicht nicht aus, um ihre Wirtschaft aus eigener Kraft und im notwendigen Maß zu entwickeln.
Diese Entwicklung verläuft kontinuierlich in die beschriebene Richtung, wiederum geradezu nachhaltig, denn sie ist nur schwer umkehrbar. Umkehrbar wird sie erst dann, wenn die beteiligten Kräfte ihren Streit beenden und zu einer konstruktiven Politik finden.
1.1.5 Macht als politisches Ziel
Viele Ungereimtheiten des politischen Tagesgeschäftes lassen sich auf das Streben nach Macht zurückführen. Grundsätzlich verfolgen Politiker und Parteien eigene Ziele in der Sache, dies ist der Ursprung ihrer politischen Arbeit. Diese Ziele lassen sich natürlich dann am besten erreichen, wenn man über Mehrheiten verfügt, denn damit verfügt man auch über Macht. Macht ist eine Voraussetzung, politische Ziele zu realisieren. Man kann eigene Macht in manchen Fällen nur dann einsetzen, wenn man bei einem aktuellen Thema genügend Gleichgesinnte aus anderen Parteien findet; auch dann lässt sich eine Mehrheit aufbauen. Der Druck der eigenen Fraktion setzt dieser Möglichkeit allerdings meistens enge Grenzen. Nun erhebt sich die Frage, wie man denn an Macht gelangen kann, wenn es über die Wahl nicht geklappt hat und sich keine Mitstreiter in anderen Fraktionen finden lassen!
Dazu bieten sich einige Möglichkeiten, aber man ahnt es bereits, diese lassen sich nur schwer mit seriösen Mitteln realisieren, denn es lauern Versuchungen des Lobbyismus, der Vorteilsnahme oder der Korruption. Und dann ist die Gefahr groß, dass es schnell um die Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt geschehen ist. Auch hier haben wir ein Dilemma, unter dem die parlamentarische Demokratie ständig leidet, denn die Politik kann unter diesen Umständen kaum sauber bleiben. Die handelnden Politiker kommen wieder in Verruf, obwohl sie kaum eine Ausweichmöglichkeit ausfindig machen können. Macht ist eben in der Politik durch nichts zu ersetzen, lautet die bittere Erkenntnis!
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, in einem demokratisch gewählten Parlament auf seriöse Weise Macht zu erhalten? Es bleibt nur die Wahl, ausschließlich die Wahl. Man muss also strategisch vorgehen, um Macht zu bekommen. Das bedeutet, dass in der aktuellen Legislaturperiode bereits mit Blick auf die nächste gearbeitet werden muss, indem man überzeugende, vermeintlich schnell umsetzbare Konzepte präsentiert. Dann, so hofft man, lassen sich Überzeugte bei den Wählern gewinnen.
Mit Macht muss man nicht zwangsläufig „schmutzig“ umgehen, aber es ist eine Herausforderung, Macht mit sauberen Mitteln aufzubauen. Diese edle Art des Machtgewinns ist den meisten Politikern aber zu aufwendig, und deshalb wenden sie sich gelegentlich den weniger sauberen Methoden zu. Das kann zu spektakulären Skandalen führen, und Wähler neigen dann gern zur Übertreibung, denn sie halten umstandslos alle Politiker für korrupt und an nichts anderem als an Macht interessiert. Natürlich sind nicht alle Politiker korrupt, aber leider sind es in diesem Sinn zu viele.
Bei allen Machtbestrebungen geht es darum, Mehrheiten zu erzielen. Neben den weniger seriösen Methoden gibt es aber auch eine Möglichkeit, ganz sauber Mehrheit und Macht zu gewinnen. Und das ist Überzeugungsarbeit. Die eigene Argumentation muss schlüssig und folgerichtig sein, so wird sich ihr die Mehrheit weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit verschließen können. Das ist die einzige Möglichkeit, ohne eine anfangs bestehende Mehrheit Macht zu erlangen, und sie ist anspruchsvoll. So ließe sich Politik seriös gestalten!
1 Die KWG (Kaufunger Wählergemeinschaft) ist in der Gemeindevertretung der östlich von Kassel gelegenen Gemeinde Kaufungen die einzige Fraktion, die über keinen Überbau in Form einer bundes- oder landesweit agierenden Mutterpartei verfügt. Diese Eigenschaft wurde von den Gründern bewusst so gewählt, um die eigenen Aktivitäten in vollkommener Unabhängigkeit zu entwickeln.
2 Vgl. Artikel 38. Dieser Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich auf den Bundestag. Er legt fest, dass die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen sind.
1.2 Die wichtigen Streitfelder
Politischen Streit kultivieren Politiker und Parteien fast überall, wo sich die Gelegenheit bietet, jedenfalls auf einem breiten Themenspektrum. Solcher Streit bietet eine gute Möglichkeit, sich von den konkurrierenden Parteien abzugrenzen und die Vorzüge der eigenen Konzepte anzupreisen. Immer wieder behaupten Parteipolitiker, sich vordergründig um die Menschen zu kümmern, in Wirklichkeit kümmern sie sich aber um sich selbst, denn alle Aktivität hat das Ziel, die eigene Position und damit die Macht der Parteien und die persönliche Macht zu stärken. Dabei ist es nicht immer einfach, eine glaubhafte Gegenposition zu den Angehörigen anderer Parteien und deren Konzepten aufzubauen. Aber Einigkeit mit den Angehörigen anderer Parteien einzuräumen, stellt für viele Politiker ein Problem dar, denn man möchte viel lieber Unterschiede demonstrieren. Deshalb klingen die Versuche der Abgrenzung gelegentlich ein wenig holprig.
Weil bei parlamentarischen Entscheidungen häufig Geld eine wesentliche Rolle spielt, ist die Finanzierung von Vorhaben ein beliebtes Feld, um sich und seine Partei von den anderen abzugrenzen. Wie sind also entstehende Kosten zu decken? Es gibt immer verschiedene Wege; alternativlos ist ein bestimmter Weg normalerweise nicht, obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel dies gelegentlich verkündet hat. Wichtige Aspekte rücken in den Fokus: Wo ist die nachhaltigste Lösung zu finden, welche Wirkung entsteht auf den Haushalt, wem nützt die Entscheidung und wem schadet sie – dies sind Fragen, die häufig auch durch die parteipolitische Brille betrachtet und dann entsprechend beantwortet werden.
So schwierig es gelegentlich ist, diese wichtigen Themen zu präsentieren, so leicht fällt es den Parteipolitikern, sie in die Strategie der eigenen Partei einzuordnen. Diese Aufgabe ist man schließlich gewohnt: Es geht nicht um die Sache selbst, sondern um ihre Darstellung. Schwer fällt es aber, die sinnvollen von den weniger sinnvollen Themen zu trennen, oder die folgenschweren von den weniger folgenschweren, denn um dies zu beurteilen, müsste man die Konsequenzen der Entscheidung kennen, und die sind anfangs nicht ohne Weiteres zu überblicken. Deshalb bedient man sich in dieser Phase gerne einfacher Behauptungen, deren Beweis man zunächst schuldig bleiben muss, weil einfach noch zu wenig über die Sache selbst bekannt ist.
Eine andere Taktik ist es, unbequeme Themen einfach auszusparen. Sie wird vielfach dann angewendet, wenn die Folgen entweder noch gar nicht bekannt oder aber unbequem und unpopulär sind. Immer wieder werden das Erscheinungsbild von Partei und Person zum Gradmesser dafür, ob und wie ein Thema oder eine eigene Meinung dazu bekannt gegeben wird.
Seit einigen Jahren ist es, wie bereits erwähnt, in politischen Kreisen modern geworden, über Nachhaltigkeit zu sprechen. In Wirklichkeit ist Nachhaltigkeit schon immer wichtig gewesen, aber erst in jüngerer Zeit haben die Parteien das Thema für ihre Zwecke entdeckt. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat einen wesentlichen Beitrag zu dieser Gewichtung des Themas geleistet. Leider wird über Nachhaltigkeit vielfach nur gesprochen, seltener jedoch entsprechend gehandelt. Dieses Verhalten legen allerdings auch alle anderen in den Parlamenten vertretenen Parteien gleichermaßen an den Tag.
In Wirklichkeit verfolgt jede politische Partei bei allen politischen Diskussionen, Debatten und Streitfällen das Ziel, politische Vorherrschaft zu erlangen. Grundsätzlich kann man daran nichts aussetzen, wenn nicht zugleich die Sache selbst auf der Strecke bleibt, und das ist leider viel zu häufig der Fall. Die politische Vorherrschaft ist wiederum gleichbedeutend mit Macht. Im politischen Alltag ist alle Rhetorik auf dieses Ziel abgestimmt. Das heißt, in der parlamentarischen Politik ist der Schein viel wichtiger als die konkrete Umsetzung und konkrete Ergebnisse. Die Inhalte treten in den Hintergrund, im Vordergrund steht das Stärken der eigenen Position, gerne auch in Form von Resultaten bei der nächsten Wahl, sei es im Bund, in den Ländern oder in den Kommunen.
1.2.1 Zusammenleben der Menschen
Immer wieder geben Politiker vor, für die Menschen zu handeln, und diese Behauptung wird gerne mit blumigen Worten vorgetragen. Dabei versuchen sie, den Eindruck zu erwecken, als lebe die Bevölkerung von Gnaden der aktuellen Regierung und der sie tragenden Parteien. Die Menschen selbst bleiben in diesem Spiel oft im Hintergrund, sie müssen dafür herhalten, einfach nur das Argument für die jeweilige Absicht der Politiker und der Parteien zu sein. Entscheidend ist aber, dass die Bedingungen für das Zusammenleben der Menschen im ganzen Land verbessert und optimal gestaltet werden, und dazu ist es notwendig, dass die Politik sich tatsächlich um die Belange der Menschen kümmert, durch faktisches Handeln und nicht allein durch Rhetorik.
Dieses Zusammenleben spielt sich in vielen Ebenen von Gesellschaft, Wirtschaft und anderen Sektoren ab, und dabei geht es stets um Gerechtigkeit. Alle Menschen sind nach dem Willen des Grundgesetzes gleich3. Übliche Gerichtsprozesse verhandeln beispielsweise private Streitigkeiten zwischen Nachbarn, wirtschaftliche Streitigkeiten zwischen konkurrierenden Unternehmen oder strafrechtliche Fälle der unterschiedlichsten Art. Das Grundgesetz ist von allen einzuhalten, also auch von Politikern, und Gerichte wachen darüber, dass dies auch so geschieht. So weit die Absicht. Aber wird sie auch wirklich konsequent umgesetzt?
Die Menschen versuchen, mit den Gesetzen – so gut sie können – umzugehen, am liebsten haben sie „mit dem Gesetz nichts zu tun“, aber wie ist es um die Politik bestellt? Nach den ursprünglichen Absichten der Gesetzesväter und Gesetzesmütter hat die Politik für die Menschen zu agieren. Tatsächlich handeln die Politiker aber offensichtlich eher für sich und ihre Parteien. Zwischen den Menschen Gerechtigkeit zu schaffen ist eine der wichtigsten Aufgaben von Politik und Justiz, doch bei der Umsetzung gibt es erhebliche Defizite. Natürlich sieht jeder betroffene Bürger das Problem durch seine subjektive Brille, das ist selbstverständlich. Die Politik hat aber die Aufgabe, durch weitsichtiges und gerechtes Handeln dafür zu sorgen, dass die Menschen tatsächlich gleich behandelt werden, so wie es das Grundgesetz verlangt.
Zu diesem Zweck sollte die Politik eigentlich den Rahmen schaffen, der das Zusammenleben der Menschen unter den vorgegebenen Regeln ermöglicht. In den Parlamenten geht man die Aufgabe auch an, aber bei fast jedem Thema entwickelt sie sich schnell zum Streit.
Ein Beispiel für diese Fehlentwicklung ist die Steuerung der Rentenversicherung, die seit vielen Jahrzehnten auf der Basis eines Generationenvertrages aufbaut, nach dem eine Generation für die vorhergehende Generation die Rente zahlt.
Bei diesem Konzept verzichtet man in der politischen Diskussion offenbar gänzlich darauf, die demografische Entwicklung einzubeziehen. Dies wird besonders an der jüngeren Entscheidung zur Rente mit 63 Lebensjahren deutlich, die man in Deutschland jetzt unter der Bedingung in Anspruch nehmen kann, dass man zuvor 45 Jahre gearbeitet und entsprechende Beträge eingezahlt hat. Die Folge ist ein weiterer Zerfall des Geldes, das für die zukünftigen Rentner gebraucht wird. Wegen der älter werdenden Menschen wird es künftig auch mehr Rentner geben. Zugleich werden die nachwachsenden Jahrgänge immer geburtenärmer, dies bedeutet schon heute, dass die Rentenversicherung in absehbarer Frist zusammenbrechen wird, wenn man nicht bald gegensteuert und eine neue Grundlage schafft. Viele Fachleute haben schon darauf hingewiesen, dass immer weniger junge Menschen für immer mehr ältere Menschen die Rente zahlen müssen, aber niemand im politischen Raum reagiert auf dieses Desaster!
Dieses Beispiel kann man als Klassiker ansehen, wenn es um das Unverständnis der Politik für Geld geht. Das Problem erschöpft sich allerdings nicht darin, es hängt auch mit der fehlenden Haftung zusammen. Politiker tragen eine große Verantwortung für das Geld der Staatsbürger, aber sie können dieser Verantwortung nicht vollständig gerecht werden. Denn sie stehen eben nicht in der Haftung für die Ergebnisse, die aus ihrer Handlung entstehen. Deshalb verhalten sie sich anders, als dies im privaten Bereich oder insbesondere in Unternehmen üblich ist; in der Politik wird offenbar eine menschliche Schwäche ausgelebt. Kein Mensch würde andernorts solche Risiken eingehen und leichtfertig Entscheidungen fällen, die ohne solide Grundlage herbeigeführt werden. Auch ein Politiker handelt privat anders!
Auf diese Weise wird eine Form des Zusammenlebens erzeugt, das die Menschen überhaupt nicht wollen. Sie werden in das Korsett eines Systems gedrängt, das ihnen viele Freiheiten nimmt, und das zugleich der Armut im Alter Vorschub leistet. Und dabei spielt ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt eine wichtige Rolle: Die öffentliche Verwaltung, die die Interessen der Menschen vertreten soll – dies betrifft natürlich auch die Rentenversicherung – verschlingt überdimensionale Mengen finanzieller Mittel, denen keinerlei messbare Wertschöpfung gegenübersteht.
1.2.2 Finanzierung der einzelnen Vorhaben
In diesem Bereich finden wir einen der wesentlichen Schwachpunkte der parlamentarischen Demokratie. Weil man sich in vielen Fällen um einen Konsens bemühen muss, ist das Ergebnis häufig ein Kompromiss, und leider tragen Kompromisse oft das Attribut „faul“. Die Sache selbst wird aufgeweicht, und damit ist die vorgesehene Finanzierung eines Vorhabens nicht mehr sachgerecht realisierbar. Dies führt mit schlafwandlerischer Sicherheit zu Prognosen, nach denen die vorgesehenen Kosten überschritten werden. Und diese Prognosen stellen sich praktisch immer als zutreffend heraus.
Zu den bekanntesten Beispielen hierfür muss man fast alle von der sogenannten öffentlichen Hand – also vom Bund, den Ländern und den Kommunen – ausgeführten Investitionsvorhaben zählen.
Der bezeichnete Schwachpunkt kommt bereits bei der Planung der öffentlichen Vorhaben zum Tragen, die wir als Projekte bezeichnen. Zu Beginn der Planung beispielsweise eines Bauvorhabens finden wir Wunschlisten der sogenannten Bauherren vor, wobei der Bauherr eigentlich „das Volk“ ist. Aber die Vertreter in Behörden, Politik oder anderen öffentlichen Stellen empfinden sich selbst als Bauherren! Und so handeln sie auch – herrschaftlich, als seien sie die Eigner der einzusetzenden Mittel. Sie sind aber tatsächlich lediglich die Verwalter dieser Mittel, das sollten sie sich gelegentlich bewusst machen! Als gefühlte Bauherren setzen diese Behördenvertreter und Politiker teilweise gewaltige finanzielle Mittel für die Projekte ein, die aber deren Zielsetzung keineswegs immer entsprechen. Dafür gibt es eine Unzahl von Beispielen, von einigen wird später noch die Rede sein.
Zu dieser Handlungsweise der gefühlten Bauherren, die man als Überschreitung ihres Mandates auffassen muss, gesellt sich unheilvoll fehlende Kompetenz in Sachen Projektmanagement. In den meisten Fällen glauben die Beteiligten der verantwortlichen Stellen, dieses Management wird vom Planer beziehungsweise vom Architekten wahrgenommen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall: Vielmehr umfasst dessen Auftrag neben der Planung selbst und gegebenenfalls der Bauleitung lediglich die Steuerung der Beteiligten und der Vorgänge auf der Baustelle, nicht aber das volle Management des Projektes. Dies kann der Planer auch gar nicht ausüben, weil es ihn unweigerlich in einen Interessenkonflikt stürzen würde, denn er arbeitet auf Basis der HOAI4. Das bedeutet wiederum, dass sich sein Honorar an der investierten Summe bemisst, also hat er beispielsweise kein Interesse daran, die Kosten zu begrenzen, würde er damit doch zugleich sein Honorar begrenzen. Hier besteht ein grundsätzliches Problem in der Systematik der Abwicklung öffentlicher Investitionsvorhaben. Zugleich haben wir damit einen wichtigen Grund dafür gefunden, warum öffentliche Projekte meist viel teurer werden als zu Beginn angenommen.
Die sachgerechte Finanzierung öffentlicher Projekte scheitert auch immer wieder daran, dass man sich hinter Zuschüssen verbarrikadiert, die jeweils von der nächsten Instanz angeboten werden. Beispielsweise werden kommunale Investitionen vom zuständigen Bundesland gestützt, diejenigen des Landes vom Bund. Eine adäquate Kontrolle der eingesetzten Mittel wird aber nicht durchgeführt, und deshalb verschuldet sich der Staat insgesamt immer weiter. Es gibt zwar Rechnungshöfe, deren Aufgabe es ist, rechtzeitig auf ausufernde Kosten hinzuweisen, deren Aktivität nützt allerdings wenig, weil sie vom Gesetzgeber keine hinreichende Handlungskompetenz erhalten haben. Auch das alljährlich erstellte Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler gibt viele Hinweise auf dieses Problem, doch eine faktische Wirkung ist auch hier nicht zu verzeichnen.
Die Finanzminister in Bund und Ländern, ebenso die Kämmerer in den Kommunen, bemühen sich zwar, auf ausgeglichene Haushalte hinzuarbeiten, aber zugleich setzen die Regierungen Förderprogramme in Gang, deren Entwicklung sie in vielen Fällen überhaupt nicht absehen können, wie die späteren Ergebnisse zeigen. Außerdem gibt es immer wieder unvorhergesehene Ereignisse, beispielsweise ein Hochwasser, den Zusammenbruch einer „systemrelevanten“ Bank oder sonstige volkswirtschaftliche Schicksalsschläge, die die Sparabsichten empfindlich stören oder gleich gänzlich verhindern. In diesen Fällen verschieben Politiker die guten Absichten gern in die nächste Legislaturperiode, und dann geht das ganze Spiel von vorne los.
Hätte man rechtzeitig Rücklagen gebildet, müsste man nicht ständig seine eigenen Ziele neu definieren. Auch darin liegt ein wichtiger Grund für das Glaubwürdigkeitsproblem der Politik: Man sorgt nicht vor und beklagt sich hinterher über Zwischenfälle, die viel Geld kosten. Die Protagonisten in der Politik müssen aber irgendwann verstehen, dass man Zwischenfälle sehr wohl vorhersehen kann, wenn auch nicht immer den Zeitpunkt ihres Eintretens. Insofern handelt es sich um hausgemachte finanzielle Probleme, auch wenn die Politik dies immer wieder bestreitet.
3 Vgl. GG Artikel 3. Dieser Artikel des Grundgesetzes gehört zu den Grundrechten. Er legt fest, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind.
4 Die HOAI ist die Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen. Sie stellt eine Grundlage für das Ermitteln von Honoraren bei Investitionsprojekten dar.





























