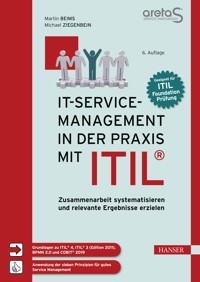Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Gestalten Sie den Service, den Ihre Kunden wirklich brauchen. Stellen Sie Ihr Service Management auf neue Herausforderungen und kürzere Innovationszyklen ein. - Sie erhalten wertvolle Praxistipps für die Gestaltung moderner Service-Organisationen mit Leitplanken statt starrer Vorgaben. - Sie erfahren, warum die Mitarbeiter im Service der Schlüssel zum Erfolg sind. - Mit zahlreichen konkreten Anleitungen und Werkzeugen zur sinnvollen Nutzung der Prinzipien - Ihr exklusiver Vorteil: E-Book inside beim Kauf des gedruckten Buches Service ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Jeder von uns nimmt täglich verschiedene Services in Anspruch: Vom Friseur über öffentliche Verkehrsmittel bis hin zu Telefon, Internet und komplexen B2B Services. Das Management solcher Service ist dabei reifer geworden, aber auch komplexer. Und so existiert inzwischen eine unübersichtliche Vielzahl von Methoden, Werkzeugen und Techniken, die sich auch noch nach Branchen unterscheiden. Sie alle spiegeln den Versuch wider, die unterschiedlichsten Erfahrungen in konkrete Handlungsanweisungen zu überführen. Manager wie Mitarbeiter in Serviceorganisationen erhoffen sich davon Unterstützung in der täglichen Arbeit. In der Praxis führt das aber zu unübersichtlich vielen Regeln und Ausnahmen. In dieser Situation helfen wenige einfache, aber starke Prinzipien, die – mit gesundem Menschenverstand eingesetzt – Sinn und Nutzen stiften. Das Buch stellt diese Prinzipien mit Hilfe von Beispielen aus der Praxis vor und gibt Ihnen Anstöße und Tipps zur praktischen Anwendung. AUS DEM INHALT // Der Service der Zukunft/Die Welt des Kunden verstehen/Den Menschen in den Mittelpunkt stellen/Systeme zur Zusammenarbeit schaffen/Vom Ende her denken/Relevante Ergebnisse erzeugen/Mit Vertrauen und Verantwortung führen/Einfach machen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin BeimsRoland FleischerNico Kroker
Service als Prinzip
7 Management-Prinzipien für glückliche Kunden
Die Autoren:Martin Beims, AlzenauDr. Roland Fleischer, MaintalNico Kroker, Goldbach
Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen infolgedessen keine juristische Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht.Ebenso übernehmen Autoren und Verlag keine Gewähr dafür, dass beschriebene Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt deshalb auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2022 Carl Hanser Verlag München, www.hanser-fachbuch.deLektorat: Brigitte Bauer-SchiewekCopy editing: Petra Kienle, FürstenfeldbruckLayout: Manuela Treindl, FürthUmschlagdesign: Marc Müller-Bremer, München, www.rebranding.deUmschlagrealisation: Max KostopoulosTitelbild: © www.diekommunikative.de, Artdirektion: Anke Beckmann, Illustrator: Bastian KrausAusstattung patentrechtlich geschützt. Kösel FD 351, Patent-Nr. 0748702
Print-ISBN: 978-3-446-46385-1E-Book-ISBN: 978-3-446-46614-2E-Pub-ISBN: 978-3-446-46616-6
Inhalt
Titelei
Impressum
Inhalt
Vorwort
1 Der Service der Zukunft
2 Die Welt des Kunden verstehen
2.1 Verstehen als Prozess
2.2 Service Design
2.2.1 Informieren im Service Design
2.2.2 Experimentieren im Service Design
2.2.3 Verifizieren im Service Design
2.3 Marketing
2.3.1 Informieren im Marketing
2.3.2 Experimentieren im Marketing
2.3.3 Verifizieren im Marketing
2.4 Verkauf
2.4.1 Informieren im Verkauf
2.4.2 Experimentieren im Verkauf
2.4.3 Verifizieren im Verkauf
2.5 Leistung
2.5.1 Informieren in der Leistung
2.5.2 Experimentieren in der Leistung
2.5.3 Verifizieren in der Leistung
2.6 Community
2.6.1 Informieren für die Community
2.6.2 Experimentieren in der Community
2.6.3 Verifizieren der Community
3 Den Menschen in den Mittelpunkt stellen
3.1 Die Rolle der Menschen im Service
3.2 Wunschkunden
3.3 Bedürfnisse, Motive und Verhalten
3.4 Werte und Prinzipien
3.5 Kunden im Service
3.6 Mitarbeiter im Service
4 Vom Ende her denken
4.1 Ende ohne Ende
4.2 Das Geschäftsmodell
4.3 Das Servicemodell
4.4 Das Liefermodell
4.5 Das Betriebsmodell
4.6 Das richtige Maß
5 Relevante Ergebnisse zählen
5.1 Warum wir Ergebnisse brauchen
5.1.1 Ergebnisse
5.1.2 Relevanz
5.1.3 Zählen
5.2 Ergebnisse im Service
5.2.1 Vereinbarungen
5.2.1.1 Servicevereinbarungen
5.2.1.2 Interne Liefervereinbarungen
5.2.1.3 Projektaufträge
5.2.1.4 Vereinbarungen mit Mitarbeitern
5.2.2 Ergebnis-Checks
5.2.2.1 Operative Ergebnis-Checks
5.2.2.2 Taktische Ergebnis-Checks
5.2.2.3 Strategische Ergebnis-Checks
5.3 Arbeiten mit Kennzahlen
5.4 Wertschöpfung im Service
5.5 Service Controlling
5.6 Servicekosten
5.7 Servicepricing
5.8 Budget
6 Systeme zur Zusammenarbeit schaffen
6.1 Systeme
6.2 Organisation
6.2.1 Lebenszyklus und Wahl der Systeme
6.2.2 Hierarchie versus Selbstorganisation
6.3 Aufbauorganisation
6.3.1 Vertikale und horizontale Zusammenarbeit
6.4 Ablauforganisation
6.5 Kommunikation
6.6 Projekte, Programme und Co
7 Mit Vertrauen und Verantwortung führen
7.1 Eine Begriffsbestimmung
7.2 Verantworung übernehmen
7.3 Verantwortung übergeben
7.4 Team- und Mitarbeiterentwicklung
8 Einfach machen
8.1 Einfach ist nicht kompliziert
8.2 Komplizierte Systeme vermeiden
8.3 Komplizierte Systeme erkennen
8.4 Komplizierte Systeme vereinfachen
8.5 Komplexität beherrschen
8.6 Fertig statt perfekt
8.7 Einfach machen und das universelle Servicemodell
8.8 Letzter Aufruf für deine Servicereise
9 Die Autoren
Literatur
Wenn in diesem Buch bei personellen Bezeichnungen die männliche oder weibliche Form gewählt wurde (z. B. Kunde, Chefin), so sind damit in gleicher Weise die Mitarbeiter der jeweils nicht genannten Geschlechter gemeint.
Wenn von Unternehmen die Rede ist, so sind damit in gleicher Weise auch andere Organisationen wie Behörden, Körperschaften usw. gemeint
Die Herausforderung
Der Markt für Service verändert sich seit einigen Jahren deutlich. Die Innovationszyklen, also die Zeit, in der sich Dinge verändern, werden immer kürzer. Durch die globale Verfügbarkeit relevanter Informationen sehen Kunden immer schneller und immer mehr neue Dinge, die für ihr Geschäft nützlich sein könnten. Als Konsequenz daraus verändern sich die Bedürfnisse ebenfalls immer schneller und immer häufiger. Wer erfolgreich Service anbieten möchte, muss darauf reagieren, denn die inzwischen globale Verfügbarkeit vieler Services verändert auch die Marktsituation der Anbieter. Kunden haben heute viel mehr Möglichkeiten und eine viel niedrigere Schwelle, die Entscheidung zu treffen, Service an anderer Stelle zu beziehen
Aber nicht nur die Kunden erwarten ein hervorragendes Serviceerlebnis. Auch die Bedürfnisse und Anforderungen der Mitarbeitenden haben sich verändert. Klassische Hierarchien mit Befehl und Kontrolle funktionieren heute immer seltener. Stattdessen geht es darum, wie Menschen so eingebunden werden können, dass sie ihren besten Beitrag entsprechend ihrer Fähigkeiten leisten können.
Viele Organisationen machen sich mehr Gedanken darüber, wie Service effizient gesteuert werden kann, und konzentrieren sich folglich auf Prozesse, Richtlinien, Verfahren und Strukturen. Dabei geht aber oft der Blick für den Kunden und seine Bedürfnisse verloren. Das geht so weit, dass Kundenbedürfnisse nicht erfüllt werden, mit dem Hinweis, dass das so nicht im System gebucht werden könne. Auf der anderen Seite verlieren die Mitarbeitenden im Service durch zu viele Regeln die Begeisterung für den Service. Anstatt die wesentlichen Kundenbedürfnisse zu befriedigen, werden immer mehr Zusatzleistungen erbracht, die aber kaum zum Nutzen oder zur Zufriedenheit beitragen. Mit solchen Herausforderungen haben wir es beinahe täglich zu tun, wenn wir mit unseren Kunden über deren Servicethemen sprechen.
Wir stellen fest, dass Frameworks wie ITIL und Co viel zur Professionalisierung des Service Management beigetragen haben und immer noch beitragen. Auf der anderen Seite fühlen sich Mitarbeitende aufgrund dieser starren Vorgaben nicht mehr wohl. Vorher definierte Prozessaufgaben werden stupide abgearbeitet und das aktive Einbringen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nicht mehr möglich.
Nach und nach wurde uns klar: „Das wollen und müssen wir anders machen!“. Wir wollten nicht länger die Probleme bewundern und haben uns daher entschlossen, unsere Erfahrungen zusammenzutragen und in ein schlüssiges Konzept für besseren Service zu überführen. Die Idee der Serviceprinzipien ist dabei schon 2018 geboren worden. Es hat aber etwas Zeit gebraucht, die Schätze, die sich in den Prinzipien verbergen herauszuarbeiten und nutzbar zu machen. Das haben wir mit diesem Buch getan.
Idee des Buchs
Wir wollen in diesem Buch keine allgemeingültigen Rezepte für guten Service postulieren. Das würde der Vielfalt im Service und in den Anforderungen der Kunden nicht gerecht werden. Wir wollen stattdessen Ideen, Denkanstöße und auch konkrete Werkzeuge an die Hand geben, die auf dem Weg zu einer guten Servicekultur nützlich sind.
Wir suchen in diesem Buch nach einem Weg, auf die Professionalisierung durch klassische Frameworks und Methoden aufzubauen, und überlegen, wie wir Service kundenorientiert gestalten können, ohne dass die Mitarbeitenden in zu starre Vorgaben und Korsette gezwängt werden.
Statt starrer Frameworks und Vorgaben wollen wir durch klar formulierte und nachhaltige Prinzipien inklusive konkreter Tipps und Werkzeuge Leitplanken der Zusammenarbeit schaffen. Dazu haben wir gemeinsam mit unseren Kunden und basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung die sieben Serviceprinzipien entwickelt, die wir in diesem Buch vorstellen und besprechen.
Danke
An allererster Stelle geht unser Dank an das großartige aretas Team. Alle haben geduldig unsere „Manuskriptabgabepanik“ ausgehalten und uns immer wieder durch Reviews, Feedback, Fragen und eine riesige Portion Inspiration unterstützt. Ohne euch hätten wir das Buch vermutlich heute immer noch nicht fertig. Petra Schipper, Pia Birner, Patrick Amrhein und Sören Scharf, wir sind überglücklich, ein so großartiges Team an unserer Seite zu haben. Danke!
Ein zusätzlicher Dank geht an Sören, der neben seinen Projekten unermüdlich an der grafischen Gestaltung der Illustrationen gearbeitet und so dafür gesorgt hat, dass auch diese dem Anspruch unseres Buchs entsprechen.
Und da sich so ein Buch vor allem in der Freizeit schreibt, ein herzliches Dankeschön auch an unsere Familien, die unsere manchmal schlechte Laune und Gereiztheit ausgehalten und uns unermüdlich motiviert haben, es zu Ende zu bringen. Danke Melanie, Michaela und Silvi, Jana, Anne, Finn und Frank.
Wir leben in aufregenden Zeiten. Sowohl technologische als auch gesellschaftliche Entwicklungen vollziehen sich scheinbar immer schneller. Das Internet mit den Möglichkeiten der Vernetzung von Menschen und Maschinen verändert unsere Welt nachhaltig und rasant. Begriffe wie Big Data, Industrie 4.0, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und andere Hypes machen deutlich, wie eng viele aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen mit der technischen Entwicklung verknüpft sind. Seit den frühen achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts schreitet die Digitalisierung unaufhaltsam voran. Wir digitalisieren einfach alles. Es begann mit dem Austausch von Nachrichten. Aus dem Brief wurde die E-Mail. Seitdem wurde so vieles digitalisiert, dass es uns kaum noch auffällt: Wir hören digitale Musik, schauen hochauflösende Videostreams und lassen uns von digitalen Karten leiten. Sogar die soziale Interaktion haben wir digitalisiert. Wir schreiben Kurznachrichten auf dem Smartphone und posten unsere Urlaubsbilder auf sogenannten sozialen Plattformen. Kaum ein Bereich in unserem Umfeld bleibt von der Digitalisierung unberührt.
Die Geschäftsmodelle vieler moderner Konzerne basieren ausschließlich auf digitalen Produkten und Leistungen. Wir schaffen uns ein digitales Abbild der Welt. Für Unternehmen bedeutet das neue, oft viel direktere Geschäftsmodelle. Informationen werden zum zentralen Produktionsfaktor und sind inzwischen wesentlich bedeutender für den Geschäftserfolg als Rohstoffe oder Anlagegüter. Die Besitzer der Informationen werden zum Großgrundbesitzer der modernen Geschäftswelt. Lange waren es eher die Interaktionen mit dem Menschen, die Gegenstand der Digitalisierung waren. Inzwischen rücken die Dinge in den Vordergrund. Viele Geräte im privaten Bereich stellen eigene Informationen bereit und sind digital per App steuerbar. Ob Leuchten, Heizungsthermostate, Türöffner oder Sicherheitskameras wir haben alles unter digitaler Kontrolle. Geräte und Maschinen liefern dabei sowohl Informationen zu ihrer Identität und ihren Eigenschaften als auch Informationen zu ihrer Umgebung, z. B. Messwerte von Sensoren. Diese Informationen der Objekte und Geräte können über das globale Datennetzwerk abgerufen und beeinflusst werden. Diese Vernetzung von Objekten und Geräten ist das Internet der Dinge (engl.: Internet of Things – IoT). Es stellt eine Verbindung zwischen realer und virtueller Welt her. Informationen werden durch viele verteilte Dinge bereitgestellt. Digitale Dienste erlauben die Informationsverarbeitung und die aktive Steuerung dieser Dinge. Im Zusammenspiel der Dinge im Internet der Dinge mit den Diensten im Internet der Dienste werden völlig neue Wirtschaftsräume erschlossen.
In der Industrie wird die Produktion unter dem Stichwort Industrie 4.0 digitalisiert. Komponenten und Produkte kennen ihre Eigenschaften, ihre nächste Station in der logistischen Kette und den Kunden, für den sie produziert werden. Maschinen lesen die Informationen an Werkstücken, um die exakten Arbeitsabläufe darauf abzustimmen. Anschließend geben sie Informationen an das Werkstück zurück. Ein manueller Eingriff ist in dieser Welt nur noch selten nötig. Die Kommunikation erfolgt zwischen Maschinen und Werkstücken. Das ermöglicht zum Beispiel die automatisierte Fertigung deutlich kleinerer Stückzahlen.
Anfangs haben wir vor allem Informationen aus Interaktionen mit Menschen digitalisiert, die wiederum dem Menschen nutzen sollen. Je vollständiger unser digitales Abbild der Welt wird, desto weniger Interaktion mit dem Menschen ist nötig. Die Auswahl aus mehreren Optionen, sogenannte Mikroentscheidungen, treffen Computer schon heute meist besser als Menschen. Denken Sie nur an selbstfahrende Autos. Wie lange wird es dauern, bis Computer in der Lage sind, komplexe, zukunftsoffene Entscheidungen für uns zu treffen? Was heißt das für uns? Wie viele und welche Entscheidungen wollen wir uns abnehmen lassen? Immer mehr Daten zu Personen, Orten, Objekten und Produkten sind digital verfügbar, doch was nutzt uns die umfangreiche digitale Abbildung der Welt, wenn sie Mängel oder Lücken hat? Vollständige und richtige Daten spielen eine immer größere Rolle. Je stärker Geschäftsprozesse digitalisiert werden, desto größer der potenzielle Schaden durch fehlerhafte Daten. Je mehr Komponenten in die Kommunikation eingebunden werden, desto wichtiger werden darüber hinaus einheitliche Regeln für Identifizierung und Kommunikation. In der digitalen Welt haben wir gigantische Datenmengen angehäuft und die Datenmengen wachsen weiter. Die aktuellen Speichermöglichkeiten halten mit dieser Entwicklung noch Schritt. Die Herausforderung besteht darin, diese Daten durch entsprechende Technologien und Analysewerkzeuge auszuwerten und zu wertvollen Informationen zu verbinden. Der Mensch scheint in dieser digitalisierten Welt nur noch eine Nebenrolle zu spielen, doch der Eindruck täuscht. Zum einen ist diese Entwicklung kein Selbstzweck, sondern dient der Realisierung von Nutzen für Kunden, zum anderen müssen die Infrastrukturen für die Digitalisierung erstellt, erhalten und weiterentwickelt werden. Die Digitalisierung hat so weitreichende Konsequenzen wie die Industrialisierung in ihrer Zeit, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch ganz praktisch in den einzelnen Unternehmen. Während die IT früher Support für die Kernprozesse eines Unternehmens lieferte, rückt sie mit digitalen Services direkt in den Fokus und an die Touchpoints mit dem Kunden. Statt im Hintergrund zu agieren, treten (IT-)Serviceorganisationen auf die Bühne und werden sichtbar für alle Beteiligten, besonders für die Kunden. Gleichzeitig verändert sich die Art der Interaktion der Kunden mit den jeweiligen Fachbereichen. Sie treten im Gegenzug in den Hintergrund und liefern Backstage die Daten und Informationen für digitalisierte Services an den Touchpoints (Bild 1.1)
Bild 1.1Frontstage – Backstage
Kunden erwarten Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Lösungsorientierung, aber in einer digitalisierten Welt bekommt besonders Service darüber hinaus eine neue Bedeutung. Kunden haben meist keinen Bezug zu Big Data, Cloud Computing oder Industrie 4.0. Dafür spüren sie negative Auswirkungen der noch nicht ausgereiften oder fehlenden Digitalisierung umso mehr. Im Service entstehen viele Probleme dadurch, dass Informationen die Kunden nicht erreichen oder schlecht bis gar nicht zugänglich sind. Häufig sorgt hier mangelnde Datenintegration für einen verbesserungswürdigen Informationsaustausch. Eine solche fehlende Synchronisation von Kundendaten kann für viel Unmut sorgen. Oft ist die interne Distanz zwischen den einzelnen Fachbereichen noch zu ausgeprägt, sodass der Informationsaustausch nur ungenügend funktioniert. Häufig herrscht an dieser Stelle eine starre Silostruktur und die Teams leben nur selten eine horizontale Vernetzung. Eine gemeinsame Betrachtung von Digitalisierung und erstklassigem Service mit Blick auf den Nutzer ist daher für alle Branchen unabdingbar. IT und Fachbereiche müssen diese gemeinsame Arbeit am und mit dem Kunden erst lernen. In Zukunft werden andere Kenntnisse und Fertigkeiten nötig sein als heute. Während die IT stärker auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden achten muss und vor allem kommunikative Fähigkeiten in den Fokus rücken, müssen die Fachbereiche oftmals den Umgang mit den Mitteln der IT, vor allem in Bezug auf die Umsetzung der Geschäftslogik in die IT-Systeme, erlernen. Kein modernes Unternehmen kann im digitalen Wandel auf wirksame IT-Systeme verzichten. Mittlerweile existiert kaum ein Unternehmensprozess, der ohne Unterstützung von IT-Services auskommt. Allerdings ergeben sich aus dieser Situation neue Abhängigkeiten. Die Grenze zwischen Geschäftsprozessen und IT-Services verwischt. Damit rücken aber auch die Prozesse und Methoden des IT Service Managements immer weiter in den Fokus des Geschäfts und werden zum Teil direkt zu Teilen des Geschäftsprozesses. In der gemeinsamen Sicht auf den Service wird IT Service Management zu einer Teildisziplin des Service Managements für die gesamte Organisation. IT Service Management geht im Enterprise Service Management auf. Gleichzeitig können wir uns die einseitige Sicht auf interne Prozesse und Strukturen nicht mehr erlauben. Das führt dazu, dass wir bei allen Überlegungen den Kunden viel stärker in die Betrachtung einbeziehen müssen. Effektives Service Management, das sich kontinuierlich weiterentwickelt und an neue Rahmenfaktoren anpasst, ist deshalb in Zeiten des digitalen Wandels unabdingbar.
Generation Y
Wir müssen aber auch noch einer anderen Entwicklung ins Auge sehen. Alternde Bevölkerung, sinkende Geburtenrate, Fachkräftemangel – die demografische Entwicklung wirkt sich massiv auf das Wirtschaftsleben in Deutschland aus. Unternehmen haben immer größere Schwierigkeiten, junge, gut ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Dies bedeutet für die Arbeitgeber, dass sie attraktiv bleiben und mit bestimmten Faktoren wie Gehalt, Arbeitszeiten, Unternehmenskultur und Arbeitsbedingungen positiv aus der Masse hervorstechen müssen. Unternehmen kämpfen bereits heute um die besten Talente. Unternehmen stehen nicht nur im wirtschaftlichen Wettbewerb zueinander, auch der Wettbewerb um qualifiziertes Personal nimmt an Schärfe zu. Gab es früher ein Überangebot an Bewerbern, hat sich dies heute in vielen Geschäftszweigen wie etwa der IT- und Technikbranche und der Kreativwirtschaft geändert: Nur wer den Bewerbern die besten Bedingungen bietet, hat die Chance, die vielversprechendsten zukünftigen Fachkräfte zu gewinnen. Doch was macht einen guten Arbeitgeber aus? Was lockt begabte Berufseinsteiger heute in die Unternehmen? Was motiviert ein Talent, sich für einen Job zu entscheiden? Die sogenannte Generation Y (geboren zwischen 1980 und 1990) strebt nicht nur auf den Arbeitsmarkt, sondern inzwischen vermehrt auch in Führungspositionen. Dabei ist der Name Programm: Die Generation Y – aus dem Englischen „why“ – hinterfragt geltende Regelungen, beäugt feste Strukturen kritisch und verlässt eingetretene Pfade. Damit einher geht ein fulminanter Wandlungs- und Modernisierungsprozess des gesamten Arbeitsmarkts. Aufgewachsen mit großen Freiheiten und fern von existenziellen Nöten, zugleich gewohnt an digitale Medien, die Flexibilität von Ort und Zeit, die sie bieten, und den sofortigen Zugriff auf jede erdenkliche Art an Information suchen sie nach individueller Freiheit und sind bereit, die Gestaltung ihrer Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Das gilt genauso für die Generation Z, die inzwischen auch auf den Arbeitsmarkt drängt. Charakteristisch ist der Wunsch, in einem intakten, von Vertrauen geprägtem Umfeld zu arbeiten, um die berufliche Tätigkeit als einen positiven Teil des Lebens begreifen zu können. Eine wichtige Stellung nimmt hier zum Beispiel die Gestaltung der Arbeitszeiten ein. Gerade in kreativen, denkintensiven Berufen fordern immer mehr Arbeitnehmer Flexibilität. Eine reine Nine-to-five-Anwesenheitspflicht gilt zunehmend als unattraktiv. Wer allerdings glaubt, allein mit mehr Freiheiten und flexibler Arbeitszeitgestaltung den Kampf um die besten Talente zu gewinnen, irrt. Denn allgemein geht es für die Millennials im Erwerbsleben um sehr viel mehr. So sehnen sich viele von ihnen nach einem tieferen Sinn, dem die ausgeübte Tätigkeit dient. Neben Gehalt, mehr Freiheiten und modernen Arbeitsstrukturen sind Unternehmen also gut beraten, diesem Verlangen nachzukommen. Welchen Wert liefert das Unternehmen für die Gesellschaft, welchen Beitrag kann und soll jeder einzelne Arbeitnehmer zu diesem Ergebnis leisten? „Diese Fragen treiben viele junge Menschen um, moderne Unternehmen sollten daher ihr eigenes Tun hinterfragen und Antworten dazu liefern. Dafür reicht es nicht, eine Vision zu entwerfen und diese der Organisation überzustülpen. Werte haben einen sehr persönlichen Bezug und können nicht allgemeingültig vorgegeben werden. Aus der Frage, was das Unternehmen eigentlich leisten möchte, gilt es daher, Prinzipien für die gemeinsame Arbeit zu entwickeln und diese statt starrer Regeln in der eigenen Kultur zu verankern“. So besteht vielfach der Wunsch nach Selbstverwirklichung, flachen Hierarchien und vor allem auch nach Entscheidungsfreiräumen. Angehörende der Generation Y begnügen sich oftmals nicht mehr damit, sich in bestehende Strukturen einzufügen, sie wollen lieber selbst Verantwortung tragen und eigene Ideen einbringen. Voraussetzung hierfür ist – neben Werten und Prinzipien, die charakteristisch für das Unternehmen stehen – vor allem Vertrauen und eine damit einhergehende Wertschätzung, um an den unternehmerischen Entscheidungsprozessen partizipieren zu können. Die Wunschliste junger Berufstätiger umfasst heutzutage also nicht mehr nur einen sicheren Arbeitsplatz und finanzielle Unabhängigkeit, sondern ist vor allem durch die arbeitskulturellen Bedingungen geprägt. Dank ihrer guten Verhandlungsposition auf dem Bewerbermarkt wohnt den unter 40-Jährigen ein neues Selbstbewusstsein inne, das vorherige Generationen so nicht kannten. „Die Ypsiloner sehen sich keinesfalls mehr als die dem Chef gehorchenden Befehlsempfänger von einst, sondern sie wollen mitgestalten, verkrustete Strukturen aufbrechen und ihr tägliches Handeln mit einem tieferen Sinn, mit gesellschaftlichem Mehrwert versehen“. Somit unterliegt der gesamte Arbeitsmarkt immensen Veränderungsprozessen – die Ansprüche von Mitarbeitern und Bewerbern steigen. Um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, sind Unternehmen daher gut beraten, sich den Anforderungen der modernen Arbeitswelt anzupassen. Der Anspruch auf Sinn, Eigenverantwortung und Teilhabe ist bezeichnenderweise im Service nicht nur ein einseitiger Wunsch der Talente, sondern essenzielle Bedingung für guten Service.
Was ist eigentlich Service?
Die Erbringung von Dienstleistungen ist vermutlich so alt wie das Zusammenleben von Menschen in Gruppen. Während die ersten Dienstleistungen vor allem dem Zusammenhalt innerhalb der Gruppe dienten, wurden daraus im Laufe der Entwicklung der Zivilisation eigenständige Berufe und Wirtschaftszweige. Mit dieser Entwicklung hat sich auch der Begriff des Service differenziert.
Während in einigen Branchen Services Zusatzleistungen beschreiben, etwa im Handel und in der Logistik, oder Service Teil der Leistungskette ist, wie im Restaurant, ist der Servicebegriff in anderen Branchen mit den Wartungs- und Reparaturleistungen nach dem Verkauf verbunden (Aftersales). In der IT wird häufig die komplette Leistungskette bestehend aus Systemen und Dienstleistungen als Service verstanden. In der Medizin ist überhaupt nicht von Service die Rede, obwohl die Leistungen den Supportleistungen der IT enorm ähneln. Spannenderweise wird in der deutschen Sprache teilweise zwischen Service und Dienstleistung unterschieden, wobei die Dienstleistung eine nicht produkthafte Leistung beschreibt. Der Service ist dann lediglich ein Moment besonderer Aufmerksamkeit gegenüber dem Kunden. So ist es auch gut zu verstehen, dass der Begriff Service bei jedem eine andere Assoziation hervorruft, je nachdem, in welchem Kontext er oder sie zuhause ist. Die Zahl der Definitionen des Servicebegriffs ist daher verständlicherweise groß. Das Wort Service kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und heißt, wörtlich übersetzt, einen Sklavendienst leisten.
Nach Prof. Dr. Jan Lies [Lies, 2012] ist ein Service ein Dienst, den jemand freiwillig leistet. Der Service ist gekennzeichnet durch die nicht produktualisierte (Wirtschafts-)Leistung, die entweder die Kernleistung eines Unternehmens darstellt oder die erstellten Produkte als Zusatzleistung unterstützt. In der Literatur finden wir viele weitere zum Teil ähnliche Definitionen [Bruhn/Hadwich, 2018], [Pepels, 2007].
In der Literatur zum IT Service Management wird ein Service definiert als ein Mittel zur Erzeugung von Nutzen für einen Kunden, ohne dass dieser die spezifischen Kosten und Risiken der Leistungserbringung trägt“ [Service Operation, 2011].
Ich begrüße die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem für mich essenziellen Thema sehr und ich verdanke dem Studium der Literatur einige sehr erhellende Momente. Ich könnte an dieser Stelle die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Definitionen herausstellen, wichtige Differenzierungen vornehmen oder Kritik an der einen oder anderen Definition üben. Gemeinsam mit meinen Kollegen habe ich einen anderen Weg gewählt. Nicht, weil ich denke, dass die Definitionen falsch sind, sondern weil wir gemeinsam in vielen Jahren Beratung im Service erfahren haben, dass die Definitionen in der Praxis nur begrenzten Nutzen haben.
Wir können uns dem Service auch aus dem Erleben in alltäglichen Situationen nähern. Jeder von uns kennt Beispiele von gutem und schlechtem Service. Ohne dass wir eine klare Definition des Service bräuchten, bewerten wir in diesen Situationen den Service.
Beispiele:
Den Friseurbesuch bewerten wir nicht nur nach der Qualität des Haarschnitts, sondern auch nach dem Ambiente, der Freundlichkeit des Personals oder der guten Tasse Kaffee während der Wartezeit.
Eine Onlinebestellung bewerten wir nicht nur danach, ob die bestellte Ware pünktlich ankommt, sondern auch danach, wie einfach der Bestellvorgang war und ob unsere bevorzugte Bezahlmethode genutzt werden konnte.
In einigen Fällen lassen sich klare Qualitätsanforderungen formulieren, z. B. die Lieferzeit für eine Bestellung, die Reaktionszeit bei Beschwerden oder die Dauer bis zur Behebung von Störungen. Die Qualität eines Service muss immer exzellent sein. Kein Unternehmen kann sich schlechten Service auf Dauer leisten. Die Frage ist auch nicht, ob gut oder nicht, sondern welche Eigenschaften in welcher Ausprägung. Ob eine Hotline mit einem Tagesbetrieb von 08:00–17:00 oder mit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung gut ist, hängt von den konkreten Erwartungen des Kunden ab. Wenn Sie diese Frage mit jeder beliebigen Serviceeigenschaft erörtern, ist die Antwort immer die gleiche: Fragen Sie Ihren Kunden.
In anderen Fällen machen wir gut oder schlecht an der persönlichen Reaktion des Serviceerbringers fest, z. B. die unfreundliche Reaktion eines Kellners, das Beharren auf kleinlichen Vorschriften. Generell gilt hier, dass Unternehmen die Erwartung der Kunden an das Serviceerlebnis aktiv steuern müssen. Für viele hat bewusst oder unbewusst das Serviceerlebnis einen mindestens genauso hohen Stellenwert wie die Servicequalität. So subjektiv diese Bewertung auch sein mag, so real ist die Wirkung. Kunden, die einen Service als unzureichend empfinden, werden nach einem anderen, besseren Service Ausschau halten. Obgleich das im B2B-Bereich ungleich komplizierter ist als im B2C-Umfeld, ist das Ergebnis am Ende das gleiche.
Für uns steckt hier ein Element, das alle Servicedefinitionen vereint: Service wird erlebt. Service ist daher für uns: „Jede erlebbare Leistung, die dem Kunden einen Nutzen bietet.“ Ganz gleich, ob wir von einem Haarschnitt sprechen, einer Behandlung beim Arzt oder Physiotherapeuten, einer Probefahrt eines neuen Autos, einer Produktdemo oder einem Wartungsdienst für eine Maschine. Ich könnte die Liste der Services aus allen beschriebenen Bereichen noch lange fortführen.
Diese Betrachtung schließt die unterschiedlichen existierenden Definitionen ein, hat jedoch weitreichende Konsequenzen für die Anwendung von Modellen, Prozessen und Prinzipien für Service. Die wichtigste Konsequenz ist die, dass sich Unternehmen, ganz gleich, ob Hersteller von Produkten oder Dienstleister aller Art, sich in den Dienst des Kunden stellen müssen – ganzheitlich.
Das erfordert Kundenorientierung und ist eine Frage der Unternehmenskultur oder besser eine Frage der Servicekultur. Sabine Hübner sagt in ihren Keynotes folgenden Satz dazu: „Servicekultur ist die Summe der Geschichten, die zu den Leistungen eines Unternehmens erzählt werden.“
Guter Service basiert auf einer Reihe simpler Prinzipien. Diese stellen wir in den folgenden Kapiteln vor (Bild 1.2).
1. Die Welt des Kunden verstehen
Erst wenn ein Unternehmen Verständnis für die Abläufe und das Geschäft des Kunden erlangt, kann ein Service als Antwort auf konkrete Bedürfnisse des Kunden entstehen. Damit gelingt es, die Wertschöpfung des Kunden zu verbessern. Dafür sind Erfahrungen der Probleme und Potenziale des Kunden aus erster Hand erforderlich. Ein möglichst direkter Austausch mit dem Kunden und aktives Zuhören sind dafür Voraussetzung. Der Dienstleister übernimmt so Verantwortung für das Ergebnis beim Kunden.
2. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Services werden von Menschen für Menschen erbracht. Daher ist der Mensch, vor Prozessen, Frameworks und Systemen, entscheidend für den Erfolg der Leistungserbringung. Untaugliche Mittel und Verfahren sind die Hauptursache für Ineffizienz und Mitarbeiterunzufriedenheit. Auf der anderen Seite sind soziale und emotionale Aspekte wichtig für die Akzeptanz des Service beim Kunden. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Tauglichkeit in der Wahrnehmung des Kunden. Konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen lässt so eine Win-Win-Situation entstehen.
Bild 1.2Sieben Serviceprinzipien
3. Vom Ende her denken
Nur wer das Gesamtbild kennt, kann sicher jedes Puzzleteil an seinen Platz legen. Da jedes Serviceereignis einmalig ist, müssen alle notwendigen Details der Leistungserbringung schon bei der Planung des gesamten Service berücksichtigt werden. Vom Ende her denken heißt, sowohl Ziele und Ergebnisse der Serviceerbringung zu kennen als auch eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie der Kunde die Leistung erlebt. Dadurch entsteht Klarheit in Bezug auf die Anforderungen an den Service, die Serviceorganisation und ihre Prozesse sowie notwendige Maßnahmen.
4. Relevante Ergebnisse zählen
Die Aufgabe eines Unternehmens ist es, Ergebnisse mit einem konkreten Nutzen für die Kunden zu erzeugen. Es ist dem Kunden gegenüber verpflichtet, diesen Nutzen nachzuweisen. Dazu ist es notwendig, den Nutzen messbar zu machen, um sinnvoll steuern zu können. Messbare Ergebnisse haben einen positiven Effekt auf die Zufriedenheit und Motivation der Servicemitarbeiter, da sie so erkennen, was sie erreicht haben und erreichen können. Das sorgt für bessere Services, weil sichtbar gemacht wird, was noch nicht optimal ist, und Optionen zur Verbesserung identifiziert werden.
5. Systeme zur Zusammenarbeit schaffen
Systeme und Strukturen ermöglichen es, Aufgaben unabhängig von Einzelnen nachvollziehbar, wiederholbar und steuerbar zu etablieren. Das verbessert die Effizienz und ist darüber hinaus Voraussetzung für sinnvolle Automatisierung. Dazu muss zunächst Zusammenarbeit im Team und über Teamgrenzen hinweg organisiert und anschließend systematisiert werden, um Silos und Monopole zu verhindern.
6. Mit Vertrauen und Verantwortung führen
Besonders im Service ist es wichtig, dass Mitarbeiter, die den Service leisten, ihre Aufgaben kennen und Verantwortung übernehmen. Das beinhaltet die Verantwortung für das Ergebnis sowie das Kundenerlebnis. Gelingen kann das nur durch Klarheit in der Verantwortungsübergabe und durch gelebtes Vertrauen in die Leistungen der Mitarbeiter. Dazu gehört auch eine Kultur der Ergebniskontrolle im Sinne eines zielgerichteten und wertschätzenden Feedbacks, welches der stetigen Verbesserung der Leistungen und des Kundenerlebnisses dient. Vertrauen wächst mit der Verbindlichkeit in der Verantwortungsübergabe.
7. Einfach machen
Meist machen wenige Varianten den Großteil des Volumens der Aufgaben aus. Es ist besser, diese gut zu machen, als alle Varianten abzubilden und dafür die häufig anfallenden Aufgaben unnötig umständlich zu machen. Je einfacher Service gestaltet wird, desto weniger fehleranfällig, leichter zu nutzen, zu steuern und zu automatisieren ist dieser. Einfach machen bedeutet aber auch, mit kleinen Schritten zu starten, die Wirkung zu beobachten und bei Bedarf Korrekturen und Erweiterungen vorzunehmen. Geschwindigkeit geht hier vor Vollständigkeit. So kommt die Organisation schnell ins Handeln und kann aus den Erfahrungen lernen.
„Am Beginn des Verstehens steht immer, dass wir zunächst aushalten, nicht zu verstehen.“
Ute Lauterbach (* 1955), deutsche Autorin und Alltagsphilosophin [Lauterbach 2001]
Jeder will zufriedene Kunden, Kunden, die gerne wiederkommen und ihr Geld gerne für eine gute Leistung ausgeben. Aber auch zufriedene Kunden verlagern Geschäfte zu Wettbewerbern oder beenden die Zusammenarbeit. Einfach so, ohne vorher mit ihrem Dienstleister darüber zu sprechen. Kunden sind nicht loyal, Frechheit!
Warum handeln Kunden so? Dafür gibt es sicher nicht nur einen Grund. In fast jedem Fall ist dieses Kundenverhalten jedoch ein Hinweis darauf, dass das Interesse am Kunden und seiner konkreten Situation nicht ausreichend war. Wer glaubt, er wüsste schon, was seine Kunden brauchen, und diese wären nur zu blind, das zu erkennen, begibt sich auf den Weg der Ignoranz und dieser führt unweigerlich zum Verlust weiterer Kunden.
Ein alltägliches Serviceerlebnis
Wir waren vor ein paar Jahren auf der Suche nach einem Kredit für den Kauf eines Hauses. Wir hatten uns schon viele Gedanken gemacht, wie viel wir bereit waren, monatlich für die Rückzahlung des Kredits auszugeben, hatten auch schon die marktüblichen Konditionen recherchiert und eine einigermaßen klare Vorstellung von den Rahmenbedingungen eines solchen Kredits. Wir hatten uns eine Obergrenze für die monatliche Belastung überlegt, um auch beim Wegfall eines Gehalts gut über die Runden zu kommen. Mit dieser Vorbereitung gingen wir zu unserer Bank. Der Bankberater hörte sich unsere Wünsche aufmerksam an, fragte hier und da nach und machte uns direkt ein Angebot. Das Angebot lief darauf hinaus, dass wir einen Teil der Summe über einen noch abzuschließenden Bausparvertrag finanzieren sollten, der bei Ablauf der Zinsbindung den Rest der Schuld tilgen sollte. Das Konstrukt hörte sich logisch an, hat uns aber dennoch verwirrt. Der monatliche Betrag überstieg das von uns gesetzte Limit um sage und schreibe 80 %. Ich wies den netten jungen Mann also auf diesen Umstand hin, aber statt unsere Wünsche adäquat zu berücksichtigen, argumentierte er für die im Endeffekt günstigeren Gesamtkosten und ließ sich auch durch unsere Einwände nicht beirren. Genauso erging es uns bei mehreren Banken. Unseren Kredit haben wir schließlich bei einer Bankberaterin abgeschlossen, die uns zugehört, nach unseren Beweggründen gefragt und ein entsprechendes Angebot gemacht hat. Sie hatte verstanden.
Ein Verkäufer kann ein Produkt, das dem Kunden nicht gefällt oder das nicht ganz seinen Erwartungen entspricht, einfach zurücknehmen. Im besten Fall bietet er eine Alternative an. Ok, war wohl nichts, neuer Versuch. Auch bei Gewerken kommen Nacharbeiten häufig vor. Egal, ob es sich dabei um die neu entwickelte Software, die Leistungen des Innenarchitekten, den neuen Flyer oder den Berliner Flughafen handelt. In allen Fällen finden diese Nacharbeiten an Produkten statt, die auch nach der Leistung noch Bestand haben. Ob Wandlung oder Nacharbeit, beides geht mit Kosten einher. Allerdings machen diese in der Regel nur einen kleinen Teil des Werts von Produkt oder Gewerk aus.
Bei Dienstleistungen geht das nicht. Mit Erbringung der Leistung ist die Arbeit vollbracht. Eine Wandlung ist nicht mehr möglich. Der finanzielle Verlust liegt hier bei 100 %. Ein Dienstleister muss zudem tiefer in die Trickkiste greifen, um einen unzufriedenen Kunden dennoch weiterhin zu seinen Kunden zählen zu können. Das gilt insbesondere, wenn die Leistungserbringung im direkten Kundenkontakt erfolgt. Eine schlechte Leistung kann das Vertrauen des Kunden in die Leistung des Mitarbeiters beschädigen, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat oder nicht. Hier wird es schnell persönlich. Bei einem fehlerhaften Produkt sagen wir hingegen beinahe entschuldigend: „Das ist wohl ein Montagsgerät.“ Eine persönliche Schuldzuweisung findet nicht statt.
Daher ist es im Service essenziell, die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden zu verstehen, bevor die Leistung erbracht wird. Dienstleister müssen alles daransetzen, die Welt ihres Kunden zu verstehen. Der kontinuierliche Austausch mit Kunden muss Teil der Unternehmens-DNA sein. Dabei geht es nicht um eine allgemeine Marktanalyse oder um Kundenumfragen, sondern um das persönliche Gespräch oder noch besser darum, in die Welt des Kunden einzutauchen und am eigenen Leib zu erleben, was ihn beschäftigt.
Ich persönlich würde den interaktiven Austausch mit echten Menschen jederzeit anderen Methoden vorziehen. Im persönlichen Dialog wird die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit gelegt, indem Beziehungen aufgebaut und gefestigt werden. Im besten Fall gibt es in einem Unternehmen auf allen Ebenen und an allen Touchpoints mit den Kunden Menschen, die aktiv an der Partnerschaft mit den Kunden arbeiten und persönliche Kontakte pflegen [Schüller, 2014]. Indirekte Befragungsmethoden werden der Wichtigkeit der einzelnen Kunden oft nicht gerecht.
Der persönliche Kontakt tritt jedoch immer weiter in den Hintergrund. Stattdessen steht uns inzwischen eine beinahe unerschöpfliche Quelle persönlicher Informationen aus allen Bereichen des sozialen Lebens unserer Kunden zur Verfügung. Dank der weiten Verbreitung aller Arten sozialer Medien sind wir in der Lage, unsere Kunden zu durchleuchten und beinahe intim kennenzulernen. Durch persönlichen Kontakt gelingt uns Ähnliches nur bei unseren engsten Freunden. Willkommen im Zeitalter der Digitalisierung!
Sobald wir Angebote aus dem Internet nutzen, entsteht ein digitales Abbild unserer Persönlichkeit. Das geschieht nicht nur, wenn wir Persönliches in sozialen Medien teilen, sondern auch durch den Besuch von Websites und die Nutzung von Suchmaschinen. Jede Aktivität wird, auf die eine oder andere Weise, registriert und analysiert. Werbung und andere Inhalte werden auf Basis der Vorlieben unserer digitalen Persönlichkeit zusammengestellt. Wir bekommen also vor allem das zu sehen, was unserer digitalen Persönlichkeit gefällt oder gefallen könnte.
Kritiker sehen darin vor allem die Risiken eines Eingriffs in die Privatsphäre und die Möglichkeiten der Manipulation. Aus der Sicht eines Unternehmers finden sich hier jedoch nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Individualisierung von Produkten und Leistungen, die perfekt auf die persönlichen Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Die Gesellschaft ist gerade dabei, die Grenzen des digitalen Territoriums abzustecken. Die Regeln für das Zusammenleben in der digitalen Welt werden sich dabei sicher weiterentwickeln.
Ganz gleich, wie dieser Prozess verläuft und zu welchem Ende er gelangt, der Zweck eines Unternehmens bleibt, Nutzen für seine Kunden und damit in der Regel Nutzen für die Gesellschaft zu stiften. Damit das gelingt, muss jeder Hersteller von Produkten und jeder Dienstleister die Welt des Kunden verstehen, um genau die Lösungen anzubieten, die ihre Kunden benötigen. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, einen Mehrwert zu bieten, verschwinden, völlig zurecht, vom Markt.
2.1Verstehen als Prozess„Verstehen ist Wissen plus praktische Erfahrung“
unbekannter Verfasser
Um wirklich zu verstehen, genügt es nicht, sich Wissen anzueignen. Es bedarf immer des praktischen Erlebens. Das wird in der wissenschaftlichen Arbeit inzwischen seit mehreren Jahrhunderten erfolgreich praktiziert.
Wissenschaftler beginnen immer damit, zu einem noch nicht vollständig beschriebenen Phänomen Daten zu sammeln. Danach werden die Daten ausgewertet, strukturiert und in einen logischen Zusammenhang gebracht. Aus der Analyse der Daten entsteht ein Modell, welches das Phänomen erklärt. Dieses Modell wird nun durch Experimente hinterfragt. Zweck der Experimente ist es immer, das Modell zu falsifizieren, also zu beweisen, dass das Modell nicht geeignet ist. Wenn das Modell sich als nicht geeignet erweist, dann wird es entsprechend der gewonnenen Erkenntnisse angepasst und erneut Experimenten unterworfen. Auf diese Weise wird das Modell immer besser. Solange es jedoch den Experimenten standhält, gehen alle von der Richtigkeit des Modells aus und arbeiten damit weiter.
In den letzten Jahrzehnten sind eine ganze Reihe von Methoden entstanden, die nach genau diesem Mechanismus funktionieren: der PDCA-Zyklus von W.E. Deming [Deming, 1982], die Lean-Startup-Methode von E. Ries [Ries, 2017], das Design Thinking von IDEO [Brown, 2009] und das Agile Project Management mit Scrum, um nur einige zu nennen. Sie alle nutzen Varianten des fundamentalen Prozesses, mit dem sich die Menschheit seit der Entdeckung des Feuers weiterentwickelt hat. Genau diesen Zyklus machen wir uns zunutze, um die Welt des Kunden zu verstehen. Er besteht aus drei Schritten (Bild 2.1):
Bild 2.1Informieren, Experimentieren, Verifizieren
1. Informieren
Wenn wir uns einer Aufgabe nähern, dann ist es entscheidend, die Aufgabe genau zu beschreiben. Ganz gleich, ob es sich bei der Aufgabe um ein Problem handelt, das es zu lösen gilt, oder um eine andere Herausforderung, der wir uns stellen wollen. Die Beschreibung ist essenziell, da wir damit entscheiden, welche Aufgabe wir eigentlich lösen wollen und wie genau diese Aufgabe aussieht. Damit engen wir automatisch den Lösungsraum ein. Das ist gut, weil wir uns damit auf das Wesentliche konzentrieren. Das birgt aber auch die Gefahr, dass wir uns auf das Falsche konzentrieren. In diesem Schritt ist es hilfreich, eine klare Abgrenzung zu machen und auch zu beschreiben, was nicht Aufgabe ist oder was eben nicht mehr zur Aufgabe gehört. Dieser Schritt wird oft als Scoping (engl. Scope: Umfang, Geltungsbereich) bezeichnet. Je besser wir die Aufgabe verstehen, desto besser können wir sie auch beschreiben.
Daher sollten Informationen gesammelt werden, mit denen sich die Situation beschreiben lässt. Manche Informationen sind z. B. über eine Recherche im Internet frei zugänglich, andere Informationen entspringen unserer eigenen Erfahrung, Analyse oder Forschung. Die wichtigsten Informationen bekommen wir aber immer von unseren Kunden, weil die Aufgaben, die wir im Service lösen müssen, immer die Aufgaben des Kunden sind. Seine Situation zu verstehen, ist der Kern aller unserer Bemühungen.
Nach der Auswertung der gesammelten Informationen kann eine Hypothese erarbeitet und formuliert werden. Diese Hypothese ist die Basis für die Suche nach Lösungen und deren Umsetzung. Nicht selten stellen wir hier fest, dass wir neue oder andere Werkzeuge und Methoden brauchen, um die Aufgabe zu bewältigen. Notwendiges Wissen bezüglich der Werkzeuge und Methoden können wir uns mit Hilfe von Büchern, Fachartikeln, Webinaren oder YouTube-Videos selbst erarbeiten oder wir besuchen einschlägige Trainings. Mit der Hypothese und den erforderlichen Methoden und Werkzeugen im Gepäck, können wir uns auf den Weg machen, die Aufgabe zu lösen.
2. Experimentieren
Anders als im wissenschaftlichen Kontext müssen wir nicht die Lücke im Modell suchen, aber das Experiment machen wir schon. Dabei beginnt es wie bei jedem guten Experiment damit, dass Ideen gesammelt werden, um die Aufgabe zu lösen. Dabei gilt: a) Keine Idee ist zu weit hergeholt und b) je mehr desto besser. In der Phase des Experimentierens ist vor allem Kreativität gefragt und der Mut, sich auf neues Terrain vorzuwagen und einen Lösungsansatz zu finden. Erst am Ende der Ideenfindung wird eine Idee ausgewählt und in Form eines Modells umgesetzt. Jetzt sind Erfahrung und Expertise nötig, um ein erfolgversprechendes Modell zu erstellen. Modell meint hier kein theoretisches oder konzeptionelles Produkt, sondern ein ganz konkret nutzbares Ergebnis – ein Prototyp, eine Landingpage, ein Gesprächsskript für die Telefonakquise, was auch immer als Antwort auf die Aufgabe geeignet erscheint.
3. Verifizieren
Gerade, wenn die Aufgabe neu ist, neue Methoden oder Werkzeuge erfordert und wir nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können, ist es entscheidend, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Fehler und Rückschläge gehören dazu. Ziel ist es, herauszufinden, ob das Modell als Lösung für die Aufgabe geeignet ist oder eben nicht. Genau wie in der Phase des Informierens, ist es hier von großer Bedeutung, den Kunden einzubeziehen. Die Lösung muss nicht unseren eigenen Ansprüchen genügen, sondern denen des Kunden. „Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.“ Es erfordert etwas Mut, ein Modell, einen Prototyp, eine Landingpage oder irgendein anderes Ergebnis, welches offensichtlich noch nicht „fertig“ ist, von einem Kunden bewerten zu lassen. Es bleibt uns natürlich immer selbst überlassen, welches Qualitätsniveau wir als ausreichend erachten, um damit den Kunden zu konfrontieren. Wenn unser qualitativer Anspruch an dieser Stelle jedoch zu hoch ist, kann es passieren, dass wir uns mit viel Aufwand verlaufen und die qualitative hochwertige Leistung am Kundenbedarf vorbeigeht. Verifizieren bedeutet daher, anhand klarer Kriterien Fehlschläge zu erkennen und so schnell wie möglich zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, mit einem angepassten Modell weiterzumachen oder lieber ganz von vorne neu zu starten. Frei nach dem Motto: „Wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, steig ab!“
Der Nutzen dieses einfachen Zyklus ist die hohe Lerngeschwindigkeit. Das Lernziel ist immer ein noch besseres Verständnis der Welt des Kunden. Wir verzichten hier gezielt auf ausgefeilte Konzepte und geben der Praxis den Vorzug vor der Theorie. Das klingt verschwenderisch, ist es aber ganz und gar nicht. Das Verständnis für den Kunden wächst auf diese Weise sehr schnell und wir vermeiden Sackgassen. Um nicht in die Beliebigkeit abzurutschen, brauchen wir jedoch einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Diesen Rahmen zeigen wir im Kapitel „Vom Ende her denken“. Im Ergebnis bekommen wir einen zielgerichteten Trial and error-Prozess und wir werden noch sehen, dass das Vorgehen für Produkte, Dienstleistungen, E-Mails, Social-Media-Kampagnen und viele weitere Ergebnisse in gleicher Weise angewendet werden kann. Da dieses Modell ein rasches Experimentieren beinhaltet, sehen wir es im Kapitel „Einfach Machen“ wieder.
Wir haben bis hierher gesehen, warum es wichtig ist, die Welt des Kunden zu verstehen, und haben gerade ein fundamentales Handwerkszeug kennengelernt. Jetzt wollen wir uns im Detail anschauen, wie das funktioniert. Im Service gibt es viele Gelegenheiten, von den Kunden zu lernen, und wir sollten davon so viele wie möglich nutzen. Aus der Sicht eines Serviceverantwortlichen können fünf Arbeitsbereiche unterschieden werden, in denen der Dienstleister Gelegenheit hat, das Verständnis für seine Kunden zu verbessern. Jeder Arbeitsbereich hat einen anderen Zweck und die Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein. Daher sind die konkreten Methoden, die in den einzelnen Arbeitsbereichen Anwendung finden, sehr unterschiedlich. In den folgenden Abschnitten stellen wir die Arbeitsbereiche mit ihren Methoden vor.
Design
Zweck des Servicedesigns ist die Gestaltung eines neuen Service, als Antwort auf ein ungelöstes Kundenproblem. Das ist der Arbeitsbereich, in dem sich Dienstleister neu erfinden und neue Märkte erschließen. Wem es gelingt, das beste Verständnis von der gewählten Kundengruppe und ihrer Probleme zu entwickeln, wird mit seinem Service den Wettbewerbern enteilen. Der Dienstleister nimmt hier die Rolle des Forschenden ein, während der Kunde als Experte Einsichten in sein Wissen gewährt.
„Wenn man mir eine Stunde Zeit geben würde, ein Problem zu lösen, von dem mein Leben abhängt, würde ich 40 Minuten dazu verwenden, es zu studieren, 15 Minuten dazu, Lösungsmöglichkeiten zu prüfen, und 5 Minuten, um es zu lösen.“
Albert Einstein
Das Ziel in dieser Phase ist die Entwicklung neuer Services aus dem Verständnis unerfüllter und möglicherweise sogar unausgesprochener Bedürfnisse und Anforderungen, um diese in das Serviceportfolio aufzunehmen.
Die von der Firma IDEO entwickelte und besonders in Deutschland vom Hasso-Plattner-Institut of Design Thinking (HPI) in Potsdam propagierte Methodik setzt auf bewährte Bausteine und bietet einen Prozess für Innovation. Der Prozess stellt sicher, dass relevante Problemstellungen erkannt und verstanden werden, Lösungen schnell gefunden und in ersten Versionen implementiert werden und diese schließlich durch Tests und direktes Kundenfeedback verifiziert werden. In dieser Einfachheit gleicht der Prozess dem Modell des Lean Startup von Eric Reis.
Marketing
Service Marketing hat die Aufgabe, Aufmerksamkeit für die Dienstleistungen zu generieren und schließlich Kontakt zu kaufbereiten Kunden herzustellen. Das setzt die Wahl des richtigen Marketing-Mix voraus. Sich im täglichen Werbelärm zu behaupten, erfordert zudem ein gutes Gespür für den richtigen Zeitpunkt und die richtige Art der Kundenansprache. Marketer sprechen vom Lead Nurturing. Interessenten werden an den Touchpoints entlang der Customer Journey gehegt und gepflegt, bis sie bereit für einen Kaufabschluss sind.
Verkauf
Gerade im B2B-Geschäft kommt dem Verkauf eine große Bedeutung zu. Ziel ist es, einem interessierten Kunden ein Angebot zu machen, das er nicht ablehnen kann. Da wir es hier oft mit mehr als einer Person zu tun haben, welche Kaufentscheidungen beeinflussen kann, ist es essenziell, die Stakeholder und ihre persönlichen Bedürfnisse zu kennen. Die gezielte Ansprache und die Beeinflussung jedes Einzelnen führen schließlich zum Auftrag.
Leistung
Sowohl für den Kunden als auch für den Dienstleister führen alle Bemühungen und Kontakte der Kundenreise auf diesen Moment hin – den Moment, in dem der Kunde die Leistung tatsächlich in Anspruch nimmt. Es kommt darauf an, den Kunden mit seinen individuellen Bedürfnissen wahrzunehmen und so individuell wie möglich darauf zu reagieren. Voraussetzung für zufriedene Kunden ist die Erfüllung der selbst geweckten Erwartungen.
Community
Kunden suchen häufig nach anderen Kunden, um sich mit ihnen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Der Dienstleister kann diesen Austausch nutzen, um seinerseits wertvolle Tipps und andere nützliche Informationen an einen treuen Kundenkreis weiterzugeben. Communities sind darüber hinaus eine exzellente Quelle für konstruktive Anregungen zur Weiterentwicklung der Leistungen.
2.2Service Design2.2.1Informieren im Service DesignInformieren bedeutet immer, einen konkreten Sachverhalt zu durchdringen. Dazu sollte geklärt werden, welcher Sachverhalt verstanden werden muss oder eben welches Problem gelöst werden soll. Zunächst muss daher die richtige Frage gefunden werden, um nicht die Analyse schon durch die Fragestellung einzugrenzen. Die Automobilindustrie hat sich beispielsweise sehr lange mit der Frage nach der Reduzierung des Schadstoffausstoßes herkömmlicher Motoren befasst, statt zu fragen, wie eine praktikable und wirtschaftliche Antriebstechnik in Zukunft aussieht.
Ist die Fragestellung gefunden, folgt eine gründliche Analyse der Problemstellung. Iterationen sind hier gewünscht. Es ist möglich, dass während der Analyse die Fragestellung angepasst wird. Im Zentrum der Analyse stehen die Nutzer, also die Menschen, die zukünftig von der geplanten Innovation profitieren sollen. Lösungen und Lösungsansätze spielen in dieser Phase noch keine Rolle.
Eine zentrale Rolle spielt jedoch die Zielgruppe. Ziel ist es, die zukünftigen Benutzer sowie deren Wünsche und Bedürfnisse so gut wie möglich zu verstehen. Dazu soll deren tägliches Erleben und Verhalten so genau wie möglich beobachtet werden. Es geht nicht nur um Anforderungen, sondern auch um Widersprüche und Spannungen in der Zielgruppe, denn sie sind ein guter Hinweis auf Innovationspotenzial. Warum sind die bisher vorhandenen Lösungen nicht ausreichend und was stand bisher besseren Lösungen im Weg? Fragen Sie in dieser Phase vor allem „Warum?“ und nicht „Wie?“. Der Fokus muss bei allen Fragen stets auf dem Nutzen und den Möglichkeiten statt auf Produkten, Prozessen und Features liegen. Es ist wichtiger zu verstehen, warum der Kunde etwas benötigt, als wie er etwas getan haben will. Die Empathy Map ist ein Werkzeug, das neben faktischen Anforderungen und Eigenschaften, orientiert an den Sinnesorganen, hilft, die Menschen in der Zielgruppe besser zu verstehen [Curedale, 2019] (Bild 2.2).
Bild 2.2Empathy Map
Zielgruppen werden häufig nach einfachen Kriterien ermittelt. Diese geben Eigenschaften des idealen Kunden wieder: Alter, Geschlecht, Bildungsstand, soziales Umfeld, Gehalt, Beruf und weitere Eigenschaften, die sich beobachten lassen. Dabei gilt die Annahme, dass diese Parameter das Kaufverhalten beeinflussen.
Das so beschriebene Bild unseres idealen Kunden wird als Persona beschrieben. Die Persona bekommt einen Namen, ein Gesicht, einen Beruf und alle weiteren Eigenschaften, die wir uns für diesen Kunden überlegt haben (Bild 2.3).
Das entstehende Bild ist allerdings, so konkret wir es auch beschreiben, nur eine sehr grobe Darstellung des idealen Kunden. Kaufentscheidungen treffen Kunden auf Basis unterbewusster Prozesse, die zu Verhaltenspräferenzen führen. Verhaltenspräferenzen entstehen dabei durch unsere grundlegenden Motive und unser Wertemodell. Informationen zu Motiven und Werten unserer Kunden stehen uns natürlich nicht für jeden Einzelfall zur Verfügung. Wir können auch nicht die individuellen Befindlichkeiten jedes einzelnen Kunden analysieren, aber das ist glücklicherweise auch gar nicht notwendig. Entscheidend ist, dass Kunden Verhaltenspräferenzen haben. Wir müssen nur nach dem Verhalten suchen, das zu unseren Leistungen passt, und dabei ist es völlig ok, zu verallgemeinern. Diese Abstraktion ist der Schlüssel zur Vereinfachung, die es uns später ermöglicht, konkrete Lösungen zu finden.
Bild 2.3Persona
Zum Abschluss der Problemanalyse werden die gesammelten Informationen geordnet, gewichtet und verdichtet. Dabei zählen nicht nur die gesammelten Fakten, sondern auch die gefundenen Zwischentöne und Emotionen. Die gesammelten Nutzerbedürfnisse und Einblicke in deren Erfahrungswelt werden später als Erkenntnisse für neue Designmöglichkeiten genutzt. Ergebnis dieser Phase ist eine gemeinsame Sichtweise als Grundlage für die weitere Arbeit an der Innovation. Eine Reihe Werkzeuge haben sich für diese Aufgabe als erfolgversprechend erwiesen:
Sammeln von Informationen
Kundeninterviews
Der Kunde ist der Experte auf seinem Gebiet. Er kennt seine Aufgaben und seine Probleme. Kundeninterviews bergen jedoch das Risiko der Betriebsblindheit. Der Kunde ist voreingenommen. Dadurch können blinde Flecken bei der Problemanalyse entstehen.
Für einen konstruktiven, persönlichen Austausch mit dem Kunden gelten ein paar Grundregeln.
Do’s
Seien Sie neugierig und hören Sie zu. Der Kunde sollte mehr als 80 % der Zeit sprechen. Geben Sie ihm Zeit nachzudenken und fragen Sie zum besseren Verständnis nach. Dadurch geben Sie dem Kunden Raum und zeigen echtes Interesse.
Seien Sie emphatisch. Erkennen Sie die Bedürfnisse des Kunden und werten Sie nicht. Die Wahrnehmung des Kunden ist entscheidend. Das muss nicht objektiv sein. Mit Empathie holen Sie Ihren Kunden emotional ab und es entstehen persönliche Bindungen.
dentifizieren Sie Fakten und suchen Sie nach Belegen. Fragen Sie nach konkreten Situationen, Zahlen, Abläufen etc. so konkret wie möglich. Verallgemeinerungen sind wertlos. Werden Sie so spezifisch wie möglich.
Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Fakten und relevante Fälle. Halten Sie sich nicht mit Sonderfällen und unwichtigen Details auf. Die Häufigkeiten und Relevanz einzelner Sachverhalte spielen eine große Rolle. Das hilft bei der Identifizierung des drängendsten, schmerzlichsten Problems.
Don’ts
Belehren Sie Ihren Kunden nicht. Der Kunde ist der Experte in seinem Job. Geben Sie ihm Gelegenheit, seine Erfahrungen zu teilen.
Vermeiden Sie zu verkaufen, wenn Sie sich nicht gerade in der Akquise befinden. Wenn es Ihr Ziel ist, den Kunden zu verstehen, gilt es, voreilige Schlüsse unbedingt zu vermeiden.
Verstellen Sie sich nicht und bleiben Sie authentisch. Das Kundengespräch ist kein Theater, in dem Sie Ihre Rolle spielen und einen Text aufsagen. Es ist ein Gespräch unter Partnern, das Sie mit Interesse und Respekt führen sollten.
Expertengespräche: Solche Gespräche bilden in der Regel einen Spezialfall der Kundeninterviews, mit den gleichen Chancen und Risiken. Branchenexperten, die nicht direkt zum Kundenkreis gehören, können hier eine Alternative sein. Das Risiko der Betriebsblindheit ist hier deutlich geringer. Erfahrungen von Branchenexperten sind in der Regel verdichtete Erfahrungen aus unterschiedlichen Kundensituationen. Zudem sind diese natürlich auch subjektiv und von den Motiven und Werten des Experten geprägt.
Kundenpraktikum
Im Praktikum oder auch „Shadowing“ kann das eigene Erleben mit Expertengesprächen verbunden werden. Der Vorteil eines Kundenpraktikums ist die eigene Wahrnehmung. Dadurch können die Aussagen des Kunden besser eingeordnet werden. Außerdem kann durch ein Praktikum ein weiteres Problem von Interviews vermieden werden. Kunden sind subjektiv bei der Bewertung von Situationen und haben sich nicht selten an Probleme gewöhnt. Im Interview oder Expertengespräch werden solche Situationen nicht aktiv angesprochen. Da der Interviewer die Situation nicht kennt, kann er auch nicht danach fragen. Das Praktikum sollte mehrere Tage umfassen und die praktische Mitarbeit unbedingt einschließen. Es hat sich bewährt, ein Tagebuch anzufertigen, um die Erlebnisse während des Praktikums zu dokumentieren. Bei der Konzentration auf eine Rolle oder Aufgabe kann aus dem Tagebuch ein „Tag im Leben von …“ herausgearbeitet werden und eine Persona erstellt werden.
5W
Die „Fünf Warum?“ eignen sich gut, um von einer oberflächlichen Anforderung zum Kern des Problems vorzudringen.
Open innovation & crowd sourcing
In den meisten Fällen findet Innovation im Rahmen der eigenen Organisation statt. Das hat den Vorteil, dass Ergebnisse im Besitz der Organisation bleiben und gegebenenfalls urheberrechtlich geschützt werden können. Die innovativen Möglichkeiten sind dabei auf die Organisation und ihre Fähigkeiten beschränkt. Open innovation oder crowd sourcing bieten Möglichkeiten, die Ideen, Fähigkeiten und Erfahrungen anderer in die Entwicklung einzubeziehen.
Social listening
Die sozialen Medien haben in den letzten Jahren eine neue Informationsquelle geschaffen. Kunden und Nutzer tauschen ihre Meinung zu Services und Produkten auf vielfältige Weise miteinander aus. Social listening ist die gezielte Auswertung von zugänglichen Informationen aller Art. Die meisten Informationen, ob aus sozialen Medien, Nachrichten, Internetpräsenz der Unternehmen oder Blogs, stehen heute online zur Verfügung und sind für jedermann einsehbar. Viele Fragen zum Verhalten der Kunden können bereits mit einfachen Mitteln beantwortet werden. Zum Beispiel können mit Answer the public zu einem Schlüsselwort die häufigsten Suchanfragen ermittelt werden. Google Alerts listet zu einem Schlüsselwort aktuelle Nachrichten, Blogs, Webseiten, Videos, Bücher und Diskussionen. Mit Talkwalker können verschiedene Blogs, soziale Medien und andere Dienste ausgewertet werden, um Erkenntnisse zu aktuellen Themen zu gewinnen. Viele Unternehmen sind hier schon aktiv. Gerade im Mittelstand und bei kleineren Unternehmen liegen in diesem Bereich noch ungenutzte Potenziale für die Entwicklung neuer Services und Produkte.
Visualisieren, analysieren und Erkenntnisse formulieren
Persona
Die Identifikation mit der Rolle des Benutzers ist wichtig für das Verständnis seiner Herausforderungen und Wünsche. Die Identifikation gelingt am besten, wenn sich die Eigenschaften an einer konkreten Person festmachen lassen, einer Person mit Namen, Gesicht, Werten und spezifischen Verhaltensweisen. Dazu werden die bisher gesammelten Erkenntnisse bezüglich einer Nutzergruppe zusammengetragen und auf eine fiktive Person übertragen. Je konkreter die beschriebenen Eigenschaften, Wünsche und Bedürfnisse der Persona sind, desto mehr Erkenntnisse wird sie liefern. Folgende Informationen sollten für eine Persona mindestens zusammengetragen werden:
1. Name: Wir identifizieren uns mit Personen besser, sobald sie einen Namen haben.
2. Gesicht (Bild): Es fällt uns leichter, einem Menschen gegenüber empathisch zu sein, als einer Liste an Eigenschaften.
3. Aufgaben und Verantwortungen: Die Beschreibung der Aufgaben und Verantwortungen gibt uns den Kontext, in dem unsere Persona arbeitet. Wünsche und Herausforderungen haben ihre Bedeutung in diesem Kontext.
4. Wünsche und Herausforderungen: Diese Frage ist der Kern der Beschreibung der Persona, weil sie die zu lösende Aufgabe beschreibt.
Empathy Map
Während die Persona stärker auf die Aufgaben und Verhaltensweisen der Kunden fokussiert, bildet die Empathy Map die Wahrnehmungen des Kunden ab und fokussiert daher stark auf den Kunden als Mensch. Es werden verschiedene Perspektiven betrachtet: Was sagt und tut der Kunde? Was denkt und fühlt er? Was hört und was sieht er? Was tut ihm weh und wie könnten Verbesserungen erzeugt werden? Die Erkenntnisse sind entscheidend für das Customer Experience Design. Diese Alternative zur Persona werden wir uns noch ausführlich in Kapitel 3„Den Menschen in den Mittelpunkt stellen“ ansehen.
Nutzenanalyse (Value Proposition)
Die Value Proposition bringt den Zusammenhang zwischen dem Kunden mit seinen Problemen und Wünschen und den wichtigsten Eigenschaften der Lösungen auf den Punkt. Die Value Proposition basiert auf einem Werkzeug von Alexander Osterwalder [Osterwalder/Pigneur 2014]. Wir haben das Modell auf die konkreten Bedürfnisse im Service adaptiert.
Die Nutzenanalyse besteht aus zwei Teilen. Auf der Kundenseite (in Bild 2.4 auf der rechten Seite) werden folgende Informationen gesammelt:
1. Wunschkunde
Die Beschreibung der Persona des Wunschkunden ist essenziell, da dadurch der Rahmen für alle weiteren Aktivitäten im Service gesetzt wird. Wir haben bereits weiter oben in diesem Abschnitt beschrieben, wie eine Persona erstellt wird. Der Begriff Wunschkunde mag etwas verwirren, weil die meisten vermutlich eher etwas mit dem Begriff Zielkunden anfangen können. Wir nutzen den Begriff aus zwei Gründen: zum einen, weil die Aggressivität der Sprache zu oft zu Aggressivität im Verhalten führt und wir das gerade im Service für unangebracht halten. Zum anderen, weil wir dadurch den Blick darauf richten, dass wir uns im Service unsere Kunden tatsächlich aussuchen oder wünschen. Das tun wir ohnehin – bewusst oder unbewusst. Mit der Art, wie wir uns positionieren, wie wir uns darstellen und auf was wir Wert legen, ziehen wir ganz bestimmte Kunden an und stoßen andere ab. Hier zu formulieren, was wir uns wünschen, hilft uns also, unsere Wunschkunden gezielt anzuziehen.
2. Kernaufgabe
Auch hier haben wir schon viele Informationen gesammelt, als wir die Persona beschrieben haben. Jetzt geht es darum, die wichtigste Aufgabe zu identifizieren, bei der es Herausforderungen oder Probleme bei unseren Wunschkunden gibt. Weil wir uns nicht in aktuellen Tätigkeiten verlieren wollen, ist es entscheidend, die Aufgaben ergebnisorientiert zu formulieren. Es ist wichtiger, zu wissen, welches Ergebnis erstellt werden soll, als zu wissen, was heute dafür getan wird.
3. Herausforderung
Hier geht es um den größten Schmerz der Kunden, den sogenannten Kittelbrennfaktor. Wenn wir diesen Schmerz lindern oder im besten Fall vollständig abstellen können, haben unsere Kunden einen konkreten Nutzen. Jede rationale Argumentation beginnt hier, weil diese Herausforderung der rationale Treiber für die Kaufentscheidung des Kunden ist.
4. Wunsch
Die meisten Kunden entscheiden aber gar nicht rational, sondern emotional. Daher ist es wichtig, die emotionalen Treiber für Kaufentscheidungen zu kennen. Das sind versteckte Bedürfnisse der Kunden. Hierzu gehören grundlegende Motive wie Macht, Ansehen, Neugier, Sicherheit etc.
Auf der Seite des Dienstleisters (in Bild 2.4 auf der linken Seite) werden die Antworten auf die Kundensicht gesammelt:
1. Glaubwürdigkeit
Meine Wunschkunden werden nur dann zu mir finden, wenn wir Anknüpfungspunkte finden, die über die fachliche Leistung hinausgehen. Zudem müssen Dienstleister die Erwartungen und Wünsche des Wunschkunden auch glaubwürdig verkörpern. Wenn Wunschkunden abenteuerlustige Individualisten sind, ist ein biederer Auftritt eines Reiseveranstalters mit Schlips und Kragen eher unpassend.
Bild 2.4Value Proposition
2. Service
Hier verdichten wir die Lösung auf einige wenige fundamentale Aussagen zur Beschreibung der Leistung als Antwort auf die Kernaufgabe des Kunden und zur Beschreibung des Charakters der Lösung.
3. Rationaler Nutzen
Mit dem Service werden Ergebnisse erzielt, die die Schmerzen des Kunden lindern. Diese Ergebnisse werden durch konkrete Eigenschaften oder Leistungen des Service ermöglicht. Die Formulierung des Nutzens ist eine direkte Antwort auf die Herausforderungen des Kunden.
4. Emotionaler Nutzen
Die versteckten Bedürfnisse des Kunden, seine Motive und Werte adressieren wir über Garantien und das Kundenerlebnis. Es ist möglich, dass verschiedene Bedürfnisse adressiert werden. Da jedoch einige Bedürfnisse miteinander unvereinbar sind, müssen wir uns entscheiden, welchen Persönlichkeitstyp wir ansprechen und welchen nicht.
Zunächst geht es darum, eine möglichst große Zahl an Ideen zu sammeln. Hier ist Kreativität gefragt. Kreativität erfordert Provokation statt Konvention und Beweglichkeit statt Bequemlichkeit. Die entsteht allerdings nicht unter Laborbedingungen oder im Büroalltag. Daher hilft es sehr, wenn besondere Räume für diese Arbeit zur Verfügung stehen. Kreativität braucht Platz, eine offene Atmosphäre und Zeit.
Erst im zweiten Schritt werden die gesammelten Ideen zu Clustern sortiert und die am besten geeigneten Ideen ausgewählt. Während es beim Ideen sammeln um die Quantität geht, endet dieser Auswahlprozess mit einigen wenigen Ideen, die dann konsequent weiterverfolgt werden. Ideen können nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt werden. Entscheidend ist, dass in dieser Phase auch herausfordernde Ideen eine Chance brauchen. Wirkliche Innovation entsteht oft da, wo Zweifel an der Umsetzbarkeit herrschen.
Ausgewählte Ideen werden nun umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt zunächst als Prototyp. Prototypen dienen dazu, die ausgewählten Ideen greifbar und erlebbar zu machen. Sie müssen nicht perfekt sein, sondern schnell und gut verständlich. Es ist erwünscht, dass sie während des Prozesses mehrfach verworfen, geändert und optimiert werden. Je weniger Aufwand in einen Prototyp gesteckt wurde, desto leichter fällt es, ihn aufzugeben. Wer sich in seine Prototypen verliebt, vergibt Chancen zur weiteren Innovation. Ganz besonders in dieser Phase gilt es, möglichst früh möglichst viele Fehler zu machen, um Erkenntnisse für die Realisierbarkeit zu gewinnen.
Prototypen sind etwas Haptisches. Bauklötze, Lego, Schere, Kleber, Papier, Rollenspiele – alles ist erlaubt. Oft genügt es, sich bei der Erstellung eines Prototyps auf die wichtigste Eigenschaft zu konzentrieren. Gerade bei komplexen Lösungen führt das schneller zum Ziel. Es können auch mehrere Prototypen zur gleichen Zeit entwickelt werden. So können Eigenschaften verschiedener Prototypen im Test vom Kunden miteinander verglichen werden.
Auch für diese Aufgaben gibt es einen großen Fundus an Werkzeugen. Wir haben hier exemplarisch einige zusammengetragen:
Ideen sammeln
Brainstorming
Bei dieser wohl am weitesten verbreiteten Methode werden die Ideen in der Gruppe durch freies Assoziieren, Fantasieren und das Aufgreifen der Ideen anderer erzeugt, gesammelt und protokolliert. Jeder trägt das bei, was ihm oder ihr einfällt. Ziel ist eine große Anzahl an Ideen mit einem möglichst weiten Spektrum. Brainstorming wird meist mit bewussten Beschränkungen durchgeführt, sowohl zeitlich als auch thematisch. Folgende Prinzipien haben sich beim Brainstorming bewährt:
Vielfalt ist Trumpf – je unterschiedlicher die Teilnehmer, desto besser das Ergebnis
Zeit ist knapp – zeitlicher Druck ist eher förderlich als hinderlich
Klarheit und Fokus – eine gute Beschreibung des Problems ist schon die halbe Miete.
Viel hilft viel – für Qualität kann später gesorgt werden, jetzt kommt es auf die Menge an.
Nichts ist unmöglich – Neues entsteht jenseits der Erfahrungen.
Brainwriting
Das Brainwriting ist dem Brainstorming sehr ähnlich, allerdings haben die Teilnehmer Gelegenheit, in Ruhe nachzudenken und Ihre Ideen zu dokumentieren, bevor sie in der Gruppe ausgetauscht werden. Das hilft besonders den leiseren Menschen im Team.
Mindmapping
Beim Mindmapping werden Assoziationen in einer Baumstruktur notiert. Auf diese Weise können komplexe Zusammenhänge sichtbar gemacht werden. Mindmapping hilft dabei, den Gedanken und Ideen Struktur zu geben. Eine Mindmap kann auch zur Strukturierung der Ideen eines Brainstormings genutzt werden.
Morphologischer Kasten
Im Morphologischen Kasten werden die Ausprägungen eines vorher gewählten Satzes an Attributen auf verschiedene Weise kombiniert. Die Ergebnisse können zu neuen Sichtweisen inspirieren.
SCAMPER
Diese Methode ist ein sehr systematischer Ansatz, um bestehende Lösungen zu hinterfragen. Die einzelnen Ansätze können auch als Restriktionen beim Brainstorming genutzt werden. SCAMPER bedeutet im Einzelnen:
1. Substituieren (S)
Es werden Teile, Komponenten, Materialien, Personen, Leistungen, Prozesse oder Nutzer durch andere ersetzt.
2. Kombinieren (C)
Verschiedene Services, Ideen, Anforderungen oder Verwendungszwecke werden miteinander vermischt.
3. Adaptieren (A)
Es werden Parallelen, Nachahmungen oder Ähnlichkeiten gesucht.
4. Modifizieren (M)
Wie wäre eine andere Bedeutung, Farbe, Bewegung, Richtung, Ton, Geruch, Form, Situation, Größe oder ein anderer Zeitraum?
5. Projizieren (P)
Die Suche nach alternativer Verwendung so, wie sie ist, oder nach Anpassung
6. Eliminieren (E)
Durch Weglassen einzelner Bestandteile wird vereinfacht oder auf das Wesentliche reduziert.
7. Umkehren (R)