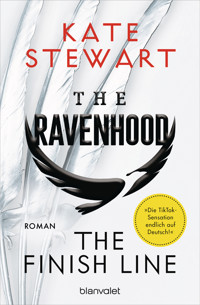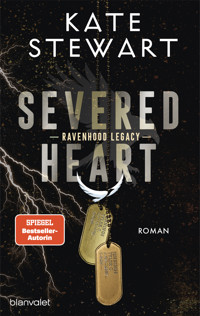
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ravenhood Legacy
- Sprache: Deutsch
Ein Krieger wird geboren. Tylers Geschichte und wie alles begann ...
Tyler ist düster, unnahbar und bereits in jungen Jahren mit einem eisernen Willen ausgestattet, doch niemand ahnt, welche dunklen Geheimnisse er vor der Außenwelt verbirgt – bis Delphine, eine vom Leben gezeichnete Straßenkämpferin, in sein Leben tritt. Als einzige sieht sie die Narben auf seiner Seele – Narben, die ihren eigenen Schmerz widerspiegeln. Zwischen den beiden entsteht eine unerklärliche Verbindung, die sich tief in Tylers Herz brennt und ihn für immer verändern wird …
Große Gefühle, knisternder Spice und Destined-to-be-together Romance – Band 2 des langersehnten »The Ravenhood« Spin-Offs!
Spice-Level: 3 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1216
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Tyler ist düster, unnahbar und bereits in jungen Jahren mit einem eisernen Willen ausgestattet, doch niemand ahnt, welche dunklen Geheimnisse er vor der Außenwelt verbirgt – bis Delphine, eine vom Leben gezeichnete Straßenkämpferin, in sein Leben tritt. Als Einzige sieht sie die Narben auf seiner Seele – Narben, die ihren eigenen Schmerz widerspiegeln. Zwischen den beiden entsteht eine unerklärliche Verbindung, die sich tief in Tylers Herz brennt und ihn für immer verändern wird …
Autorin
Kate Stewart ist mehrfache »USA Today«-Bestsellerautorin, und das nicht ohne Grund: Ihre Romane rauben ihren Fans den Atem! Insbesondere ihre »The Ravenhood«-Trilogie traf mitten in das Herz ihrer Leser*innen und wurde zu einer weltweiten TikTok-Sensation. Die gebürtige Texanerin lebt mit ihrem Mann inmitten der Blue Ridge Mountains in North Carolina. Wenn sie nicht gerade am Schreibtisch sitzt und knisternde Geschichten zu Papier bringt, vertreibt sie sich gern die Zeit mit Fotografie, mit der Musik der 1980er- und 1990er-Jahre oder mit einem Glas gutem Whiskey.
Von Kate Stewart bereits erschienen:
The Ravenhood – Flock · The Ravenhood – Exodus · The Ravenhood – The Finish Line · Ravenhood Legacy – One Last Rainy Day · Ravenhood Legacy – Severed Heart
Kate Stewart
Severed Heart
Roman
Deutsch von Michaela Link
Ravenhood Legacy Band 2
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »The Ravenhood Legacy – Severed Heart: The Birth of a Warrior(Ravenhood Legacy Book 2)«
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2025 by Kate Stewart
First published 2025 by Pan, an imprint of Pan Macmillan,
a division of Macmillan Publishers International Limited
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Daniela Bühl
Umschlaggestaltung: © http://www.buerosued.de
nach einer Originalvorlage von QDesign
Umschlagdesign und -motiv: © Amy Queau
KW Herstellung: DiMo
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-33285-3V001
www.blanvalet.de
US-Präsident – Preston J. Monroe – 2021 bis 2029
Gegenwart
Prolog
Tyler
Der Schweiß läuft mir über die Schläfen, bevor ich meine Baseballkappe anhebe, um ihn mir mit dem Handschuh abzuwischen. Den Blick fest auf die Tür gerichtet, lehne ich mich bei laufendem Motor in dem Schalensitz zurück, als eine willkommene Brise über mich hinwegstreift. Die leichte Kühle darin kündet vom Ende des Sommers und streichelt meine erhitzte Haut.
Als ich die Augen schließe, kann ich sie mir so lebhaft vorstellen, wie sie mich von der Veranda aus mit schmalen Augen anschaut. Barfuß, die Hand zum Salut erhoben, um ihre silbergrauen Augen vor der Sonne zu schützen, während die vom Wind gepeitschten Spitzen ihres langen onyxfarbenen Haars über ihren Rücken tanzen. Ein sanftes Lächeln umspielt ihre Mundwinkel, als ich näher komme – ihr Mienenspiel, dazu der Ausdruck in ihren Augen, machen mich sprachlos.
Ihr ganzes Wesen strahlt Liebe aus, aus jeder Pore, wie sie da nur wenige Meter von mir entfernt steht und mich zu sich ruft.
Eine so reine, so greifbare und bedingungslose Liebe verbindet uns. Die einzige sichere Zuflucht, die ich jemals wirklich gekannt habe, ist das Herz, das in ihrer Brust schlägt, und ich lief mit stampfenden Schritten über die Holzdielen, um ihrem Ruf zu folgen und mich an einer Liebe zu weiden, die mich wie eine Decke umhüllt. Eine Liebe, die mich beschützt und mir Frieden bringt, mich aber auch vervollständigt. Eine Liebe, die ganz meine, ganz unsere ist.
Eine Liebe und ein Heim, die wir uns gemeinsam erschaffen haben, allen Widrigkeiten zum Trotz. Unsere Dunkelheit hat sich vermischt und Gestalt angenommen, hat unser Fundament gegossen und das Grundgerüst errichtet, während wir die Wände mit den Erinnerungen geschmückt haben, die wir geschaffen hatten. Wir haben jedes Regal und jeden Schrank damit gefüllt und so unser immerwährendes Zuhause ineinander geschaffen.
Der Motor schnurrt unter mir, als wollte er mich ermahnen, einen Zahn zuzulegen, während meine Gedanken mich im Leerlauf halten und ich die Erinnerungen wecke. Von ihnen allen zehre ich bewusst, hole sie aus der Versenkung meines Geistes, wo ich sie sicher und ungetrübt aufbewahrt habe – keine Sekunde vergessen.
»Bitte, trauere nicht um mich.« Als hätte ich je eine Wahl gehabt. Als hätten wir beide in dieser Hinsicht je die Kontrolle über irgendetwas gehabt – ihre Bitte zu erfüllen, war unmöglich.
Mittlerweile weiß ich es besser, weil ich lange genug gelebt habe, um es besser zu wissen. Was mich auf den Gedanken bringt, dass sie dieses Geheimnis vielleicht gar nicht entdeckt hat, bevor sie starb. Oder vielleicht hatte sie es entdeckt und wollte nur ihren Willen und ihre Hoffnung für mich in ihre Bitte einfließen lassen.
Aber in diesem Punkt halte ich mich für den Weiseren von uns beiden. Dieses Versprechen konnte ich genauso wenig geben oder halten, wie sie ihr Schicksal im Kampf gegen den Krebs ändern konnte, der sie zugrunde richtete, bevor er ihr den letzten Atemzug raubte.
Und seit ich gesehen habe, wie sie den tat, konnte ich selbst nicht mehr richtig durchatmen – auch das keine Wahl. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass meine flachen Atemzüge seit ihrem Tod ein Teil des Preises dafür sind, dass ich etwas so Vollkommenes hatte. Dass ich für einen flüchtigen Moment im Leben wahren Frieden gefunden hatte.
Sie hat mir einmal gesagt, das Leben könne in einem Wimpernschlag stattfinden, aber es war eine Reihe von Wimpernschlägen, die uns zusammengebracht haben. Das Leben ist uns widerfahren und endete dennoch mit dem Schließen der Augen, sodass ich ohne sie auf der anderen Seite zurückblieb. Das verstehe ich jetzt besser denn je. Denn ich kenne den Unterschied zwischen einem gelebten Leben und einem Leben, das einem widerfährt, und die beiden unterscheiden sich deutlich.
Das Leben zu leben, bedeutet, Entscheidungen zu treffen – was man anzieht, wann man isst, ob man sich die Haare schneiden lässt oder nicht. Das sind die einfachen Entscheidungen, die wir treffen dürfen – bei denen wir ein Mitspracherecht haben oder selbst mitwirken dürfen.
Leben, das einem widerfährt, ist etwas ganz, ganz anderes. Es kommt in Form einer mächtigen, alles bestimmenden Kraft, die deinen Weg zum Guten oder Schlechten festlegt. Erst im Nachhinein wird dir klar, dass die einfachen Entscheidungen die einzigen sind, bei denen du wirklich mitbestimmen kannst.
Die schweren Sachen – die wirklich schweren Sachen, die sind das Leben, das dir widerfährt.
Und da ich ein Mann bin, der sich auf Eventualitäten einstellt, habe ich einen Weg gefunden, nicht zuzulassen, dass mir das Leben widerfährt.
Ich habe den Trick, das Schlupfloch, den Weg gefunden, um ihm die Macht, die es über mich ausüben kann, zu entziehen, und jetzt bin ich es, der meinem Leben und dem Leben anderer widerfährt. Nicht umgekehrt. An diesem Punkt liegt es nur noch bei mir, mich an die Wimpernschläge der Tage vor und nach dieser Errungenschaft zu erinnern.
Wimpernschläge, an die ich mich jetzt aus freien Stücken erinnere. Einige von ihnen langsam und dazu gedacht, sie auszukosten. Viele so schnell, dass es sich nicht anfühlt, als wären sie real, die aber von einer so mächtigen Kraft erzeugt werden, dass ihre Existenz unbestreitbar ist. Einer Kraft, zu der sie gebetet und die sie Gott genannt hat.
Etwas, dem ich ihr gegenüber nie widersprochen habe und das ich immer noch nicht wirklich für falsch halte. Während ihr Glaube unerschütterlich war, ruht mein Glaube weiter in ihr – in uns.
So oder so, während ich mich darauf vorbereite, dem Leben in den kommenden Jahren zu widerfahren, schließe ich die Augen und rufe alles an Nähe und Klarheit herbei, das mich hierhergeführt hat – das uns zusammengebracht hat – , bevor ich gezwungen bin, alles wieder wegzublinzeln.
Teil 1
»Ein Knabe wird zum Mann, wenn ein Mann von Nöten ist.«
John Steinbeck
US-Präsident – Ronald Reagan – 1981 bis 1989
Kapitel 1
Delphine
Ich drehe am Regler des Radios, um unseren neuen Lieblingssong von Johnny Hallyday zu finden, als eine sehr laute Frauenstimme aus den Lautsprechern schallt und ich zusammenzucke. »… le président Américain Reagan a été abattu devant un hôtel Hilton à Washington …«US-Präsident Reagan wurde vor einem Hilton in Washington angeschossen …
Um Papa nicht aus seinem Nickerchen zu wecken, drehe ich den Ton leiser und zucke erneut zusammen, als jemand gegen die Haustür hämmert. »Matiiiis!«
Der Mann wiederholt Papas Namen so, wie wir es immer tun, wenn wir Verstecken spielen. »Matiiisss!«
Als ich zur Tür gehe, springt der Riegel hoch, und ich bleibe stehen, als ich durch den Spalt den Mann mit dem verbrannten Gesicht sehe, der mich anstarrt. »Delphine, wo ist Matis?«
Da ich ihm nicht antworte, lächelt er mich mit schiefen Zähnen an. Ich hasse den verbrannten Mann. Er versucht immer, mich zu berühren, wenn Papa nicht hinschaut, und Papa schaut nie hin, wenn er Karten spielt.
»Mach die Tür auf, Delphine«, befiehlt er, bevor er heftig gegen das Holz drischt, um mich zu erschrecken. Ich drücke gegen die Tür, um ihm zu zeigen, dass er mir keine Angst macht, und um ihm die Tür vor seiner hässlichen Fratze zuzuschlagen. »Gehen Sie weg, mein Papa schläft, und Sie wecken ihn noch auf!«
Er lacht auf eine Art, die nicht witzig ist, und brüllt mich an, die Tür zu öffnen. Als ich das nicht tue, verschwindet er, und ich stoße die Tür schnell zu. Ich drehe mich um, weil ich Papa holen gehen will, doch in dem Moment tritt der verbrannte Mann die Tür ein, und sie kracht mir gegen den Rücken. Mit einem Schrei falle ich auf den Boden. Als der Mann die Hände nach mir ausstreckt, springe ich auf, während Papa hereingelaufen kommt und anfängt, mit ihm zu ringen. Gleichzeitig ruft er mir zu: »Delphine, in die Scheune! Geh!«
Ich weiß, als seine brave Soldatin sollte ich seinen Befehlen folgen, aber ich sehe die glänzende Schneide eines Messers in der Hand des verbrannten Mannes und warne Papa stattdessen.
»Die … Scheune, geh!«, brüllt Papa erneut und ringt mit dem verbrannten Mann um das Messer, während ich mich nach etwas umsehe, das ihm im Kampf helfen könnte. Papa sagt mir immer: »Jemand, der sich nicht auf eine Seite schlägt, steht nur im Weg«, und ich werde ihm im Weg stehen, wenn ich mich nicht auf seine Seite schlage und versuche, ihm zu helfen. Als der verbrannte Mann Papa angrinst und ihm das Messer immer dichter an die Kehle drückt, dreht sich mir der Magen um. »Keine Sorge, Matis. Bis Sonnenuntergang wird sie eine Frau sein.«
»Delphine, lauf!«, brüllt Papa noch einmal, so wie er es nur tut, wenn er wirklich sauer auf mich ist, während er die scharfe Seite der Klinge von seinem Hals wegdrückt. Als ich mich umdrehe, um seinen Befehl zu befolgen, krache ich gegen einen anderen Mann und höre ihn fluchen. Dann schaue ich hoch. Immer weiter nach oben. Mein Kopf beginnt zu brennen, als mir Wasser in den Nacken tröpfelt. Der Mann legt den Kopf schief und starrt auf mich herab, und Papa schreit ihm zu, er solle mich ja nicht anrühren. Als ich wieder zu Papa schaue, schiebt er das Messer auf die Kehle des verbrannten Mannes zu, bevor der Mann vor mir mich zu Boden stößt. Mir verschwimmt alles vor den Augen, und ich halte inne und wische mir das Wasser weg, damit ich besser sehen kann. Als Papa nach mir ruft, krieche ich auf seine Stimme zu, aber als ich eine Hand auf den Boden setze, sehe ich, dass das kein Wasser in meinen Augen ist – sondern Blut.
Mir wird schwindlig, ich liege auf dem Boden und versuche, nicht einzuschlafen, während Papa und der zweite Mann einander anbrüllen. Ich rolle mich über den Teppich auf Papas Stimme zu und halte inne, als ich die offenen Augen des verbrannten Mannes sehe, die mich anstarren.
Er ist tot.
Papa hat ihn getötet.
Darüber bin ich froh. Er ist kein guter Mensch. Das hat Papa gesagt. Er hat gesagt, er spiele Karten mit schlechten Menschen, um ihre Geheimnisse in Erfahrung zu bringen.
Als ich wieder zu Papa aufschaue, steht er gerade vom Boden auf und sieht sehr, sehr zornig aus, während der Mann, den er nun anbrüllt, mir einen Tritt in den Magen verpasst. »Es ist viel zu spät, Matis. Deine Zahlung ist fällig, und es ist Zeit, das Geld einzutreiben.«
»Das Einzige, was du heute eintreiben wirst, du verdammtes Schwein, ist dein Tod, und den liefere ich dir nur allzu gerne«, sagt Papa mit zusammengebissenen Zähnen, seine Stimme noch immer sehr zornig, aber auch sehr leise. Als Papa auf den Mann zugeht, um ihm seinen Tod zu liefern, frage ich mich, ob er mich dafür bestrafen wird, dass ich seinem Befehl nicht gehorcht habe, in die Scheune zu gehen. Vielleicht ist er ja stolz auf mich, weil ich gekämpft habe. Bevor ich ihn fragen kann, schlafe ich ein.
***
»Wach auf, kleine Blume. Bitte, brich mir nicht das Herz. Bitte«, flüstert er, eine Hand an meiner Wange.
»Papa«, rufe ich. »Ich kann die Augen nicht öffnen.«
Sein Atem kitzelt mich an der Nase, als er seinen müden Seufzer ausstößt, so wie wenn ich versehentlich Geschirr zerbreche oder den Teppich schmutzig mache, nachdem ich im Bach gespielt habe.
»Du kannst sehen, kleine Blume. Öffne die Augen.«
Mühsam schaffe ich es und stelle fest, dass Papas Augen rot und verquollen sind. Er hat geweint. Das weiß ich, weil er lange, lange geweint hat, nachdem Maman uns gesagt hat, wir sollten »in unserem dreckigen Leben verrotten«. Ich war nicht traurig, als Maman fortging, nicht so, wie Papa es war. Sie war gemein zu mir und hat die ganze Zeit geschlafen.
Papa war derjenige, der mit mir gespielt hat. Der mir das Haar gebürstet hat. Der mir Spielzeug gegeben hat. Es war immer Papa, der mir Geschichten vorgelesen hat und mich im Bett zugedeckt hat.
»Papa«, flüstere ich und wische über den kleinen Blutfleck auf seiner Wange. »Hast du dir auch den Kopf gestoßen?«
»Nein, kleine Blume.« Papa schließt die Augen und beginnt zu weinen. »Verzeih mir, Delphine.«
»Matis, wenn du sie vor deinem Schicksal bewahren willst, müssen wir jetzt aufbrechen.« Die Stimme kommt von einem Mann, der an meiner Schlafzimmertür steht. Ich versuche, ihn anzusehen, aber Papa dreht mein Gesicht mit einem Finger zu seinem. Das Licht des Kronleuchters, der über ihm hängt, tut mir in den Augen weh. Papa hat ihn mir zum Geburtstag geschenkt und mir gesagt, alle Prinzessinnen hätten Zimmer mit Kronleuchtern. Ich habe ihm gesagt, dass ich der Prinz sein wolle, weil Prinzen kämpfen dürften. Er hat gelacht und gelacht, bevor er mir versprach, mir nichts mehr für eine Prinzessin mitzubringen, und als er das nächste Mal vom Kartenspielen zurückkam, brachte er mir ein Schwert mit – mein Schwert! Ich hätte mein Schwert holen sollen, als der verbrannte Mann herkam.
»Delphine, erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe, du würdest eines Tages eine Soldatin sein?«
»Ja, ich bin bereit!«, antworte ich ihm und versuche, mich aufzurichten, aber er drückt mich wieder aufs Bett.
»Gut. Du musst jetzt Befehle befolgen und genau das tun, was ich dir sage, verstanden?«
»Ja, Papa.«
»Wir müssen jetzt gehen!«, ruft der Mann von meiner Tür aus. »Ich sterbe nicht für dein Kind, Matis!«
»Du musst mit diesem Mann gehen und tun, was er dir sagt«, flüstert Papa und hebt mich aus dem Bett. Er geht durchs Zimmer und drückt mich dem Mann in die Arme, dann reicht er ihm meinen Koffer mit den Wildblumen, die aussehen wie die Blumen, in denen wir immer tanzen. Der Mann starrt auf mich herab, und ich beschließe, dass ich heute Nacht keine Befehle befolgen will, aber Papa bedeutet mir zu schweigen.
»Ich flehe dich an … Bring sie zu meinem Neffen. Francis wird sie großziehen wie sein eigenes Kind. Bitte, bring sie in Sicherheit«, sagt er dem Mann. »Ich zahle jeden Preis, den du verlangst.«
»Als würdest du das hier überleben«, sagte der Mann Papa. »Versprechungen zu machen, die du nicht halten kannst, hat dir diesen Schlamassel überhaupt erst eingebrockt, Matis.«
»Vergiss, was du über mich denkst, nur dieses eine Mal, bitte.«
»Ich bin ja hier, nicht wahr?« Er redet ganz komisch, wenn er nicht Französisch spricht. Papa hat mir erzählt, dass diese Leute Die Briten genannt werden.
»Papa, ich will heute Abend keine Befehle befolgen. Mein Kopf tut weh«, sage ich ihm, aber er ruckt mit dem Kinn, damit ich still bin.
»Hier«, sagt Papa und drückt dem Mann eine Rolle Geldscheine in die Hand. »Das ist alles, was ich habe. Ich wollte eigentlich genug ansparen, um die Kleine von hier wegzubringen, aber ich verstehe nicht … Warum sind sie noch nicht hier?« Papa fängt wieder an zu weinen.
»Selbst jetzt hältst du noch an der Lüge fest?«, fragt der britische Mann.
»Ich habe keine Zeit, mit dir zu streiten.« Papa seufzt und wischt sich übers Gesicht.
»Du könntest versuchen zu fliehen«, sagt er zu Papa, bevor er mich ansieht, als wäre ich Abschaum, »und mir die Mühe ersparen.«
Papa schüttelt den Kopf. »Es ist zu spät. Jetzt werden sie keine Ruhe mehr geben. Vor allem anderen musst du dafür sorgen, dass man dir nicht folgt.«
»Um der alten Zeiten willen, Matis.« Er sieht Papa an, als wäre der ebenfalls Abschaum. »Ehrlich, diese Dreckskerle tun uns alle einen Gefallen, wenn sie die Welt von dir befreien, aber du hast mein Wort, dass ihr heute Nacht nichts geschieht, wenn es in meiner Macht liegt. Aber wenn das irgendwie klappen soll, müssen wir jetzt sofort gehen.«
»P-Papa?«, wispere ich, sehe den Mann und dann wieder Papa an. Ich mag diesen Mann gar nicht, und auch nicht die Art, wie er mit meinem Papa spricht, aber der nickt dem britischen Mann zu, ehe er mich ansieht und seine Augen sich noch mehr röten.
»Ich liebe dich, kleine Blume«, flüstert er, beugt sich vor und küsst mich neben der Stelle, die so wehtut, auf den Kopf. »Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Verzeih mir.« Papa zeichnet mit dem Finger das Kreuzzeichen auf meine Stirn, schließt die Augen und spricht Englisch mit dem britischen Mann. »Nimm sie mit. Geh.«
»N-Nein, nein, Papa!«, schreie ich, als der Mann sich in Bewegung setzt und geht und Papa in seine Hände weint. »Papa, nein, keine Befehle heute Abend. Bitte!«, rufe ich und fühle mich wieder schläfrig, als der Mann mich fester an sich drückt und seine Schritte beschleunigt.
»B-Bitte, Papa!« Ich winde mich in den Armen des Mannes. »Ich bin bereit, deine Soldatin zu sein, nicht seine!«, schreie ich über die Schulter des Mannes hinweg, als Papa uns aus meinem Zimmer folgt, meine Hand ergreift und dem Mann, der mich festhält, weiter durch den Flur folgt.
»Schließ die Augen, Delphine«, befiehlt Papa mir, damit ich die Männer nicht sehe, denen er im Wohnzimmer den Tod geliefert hat. Mit geschlossenen Augen halte ich Papas Hand ganz fest, damit er nicht loslassen kann. Als wir draußen sind, fällt mir Schnee auf die Nase und streift meine Wangen, und durch den Wind verschlimmern sich meine Kopfschmerzen noch. »Es tut mir leid, dass ich nicht in die Scheune gegangen bin. Es tut mir leid«, sage ich Papa. »Ich werde brav sein. Versprochen. Ich werde Befehle befolgen, deine Befehle!«
»Warte, bitte … nur noch eine Minute«, fleht Papa den Mann an.
»Schluss mit dem Drama, Matis! Es ist wahrscheinlich eh schon zu spät!«
Papa weint noch heftiger und folgt uns die knarrende Verandatreppe draußen hinunter, bevor er mir einen Kuss auf die Hand drückt. »Erinnerst du dich an das, was ich dir beigebracht habe?«
»Ja, Papa.«
»Erinnere dich, kleine Blume. Erinnere dich an alles, was ich dir erzählt habe. Vergiss es nie!«
»Ich werde mich erinnern, versprochen!«
Papa schließt die Augen und küsst noch einmal meine Hand, bevor er sie loslässt, und ich schreie nach ihm, als der britische Mann mit mir in den Armen losrennt. Papa ruft mir durch den Schnee etwas nach und sagt mir, dass es okay sei. Dass alles gut werden würde und dass ich mit dem Mann mitgehen solle – dass der mich beschützen würde. Dass Papa mich liebt. Dass ich seine brave Soldatin bin. Dass es ihm leidtut, aber dabei weint er die ganze Zeit! Wenn alles in Ordnung wäre, würde er doch nicht so heftig weinen!
»Nein! Papa!« Als ich dem britischen Mann ins Gesicht schlage, flucht er und lässt meinen Koffer fallen. Der springt auf, und der Mann setzt mich in sein Auto. Immer wieder trete ich nach ihm, während er meine Kleidung einsammelt und fluchend meine Beine und meinen Koffer ins Auto hineinquetscht. »Papa, bitte, erlaub ihm nicht, mich mitzunehmen! Es tut mir leid, dass ich nicht in die Scheune gegangen bin! Es tut mir leid!«
»Delphine, sei meine Soldatin, und tu, was man dir sagt!«, brüllt Papa über den Wind hinweg, aber ich kann ihn vor lauter Schnee nicht mehr sehen! Der Mann knallt die Tür zu, und im selben Moment blitzen Lichter durch die Autoscheiben auf.
»Sie sind da!«, ruft der Mann Papa zu und steigt eilig in den Wagen.
»Bring sie von hier weg!«, schreit Papa, und der Mann fährt los, bevor ich mich auf den Boden erbreche.
»Oh, verfluchte Scheiße«, schimpft der Mann und schaut durch die Scheibe auf die Lichter, bevor vom Haus hinter uns ein lauter Knall ertönt. Ich kenne dieses Geräusch. Papa schießt mit seiner großen, großen Waffe. Die Autos mit den Lichtern bringen noch mehr böse Männer her, und Papa schießt auf sie, damit sie wegbleiben. Er kämpft wieder.
»Ich muss zurück!«, brülle ich den Mann an. »Ich muss kämpfen!«
Ich reiße an dem Griff der Autotür, aber der Mann zerrt meinen Arm weg, um mich im Wagen festzuhalten, und fährt schneller.
»Komm schon, Matis.« Der Mann sagt Papas Namen, als würde er beten, und dann ertönt ein weiterer lauter Knall vom Haus und lässt unser Auto erzittern.
Papa schießt immer wieder auf die nahenden Lichter, und ein Auto geht in Flammen auf, bevor es in den Fluss stürzt. Weitere Lichter kommen, und der Mann fährt immer schneller und schneller und ändert immer wieder die Richtung.
»Bringen Sie mich zurück!«, befehle ich, wie Papa es tut.
»Sei still«, sagt mir der Mann und dreht das Lenkrad. »Mach weiter, Matis, nur noch ein bisschen länger«, flüstert er und schaut in den Rückspiegel über der Windschutzscheibe.
»Sind Sie blöd?«, frage ich den Mann. »Er kann Ihr Flüstern nicht hören!«
Der Mann lacht, als hätte ich ihm einen Witz erzählt, bevor ich drei Autos zähle, die in unsere Straße einbiegen. Der Mann fährt immer schneller, und ich schließe die Augen, um Gott darum zu bitten, Papa genug Kugeln für die großen Gewehre zu geben, um alle bösen Männer zu erschießen.
»Schau nicht zurück«, sagt der Mann mir, als er nun wirklich, wirklich, wirklich schnell fährt. Der Schnee macht es schwer, durch die Scheibe zu sehen, und mein Bauch tut weh, als ich unser Haus nicht mehr erkennen kann.
»Wir fahren weit weg jetzt!«, rufe ich auf Englisch. »Ich bin Matis’ Soldat! Nicht für Sie! Bringen Delphine zurück Haus und helfen kämpfen!«
Der Mann fährt weiter, obwohl ich weiß, dass ich die Worte richtig gesagt habe.
»Sie verstehen mein Englisch!«, brülle ich ihn an. »Ich befehle Sie umkehren!« Als er erneut nicht gehorcht, beschimpfe ich ihn. »Idiot!«
»Definitiv Matis’ Tochter«, sagt der Mann lachend, und ich weiß, dass er sich über Papa und mich lustig macht. Ich beschließe, dass ich britische Männer nicht mag.
»Ich bin Matis’ Soldat!«
»Klar bist du das, Kleine.« Er sagt das, als würde er mir nicht glauben. Aber ich bin eine Soldatin. Papa hat mir beigebracht, wie man marschiert und salutiert. Wie man Feuer macht. Wie man fischt. Wie man schießt – noch nicht mit der großen Waffe. Wie man ein Kaninchen häutet und ausweidet. Wie man kocht. Welche Pilze giftig und welche essbar und lecker sind. Er hat mir taktisches Denken und Spionage beigebracht, wie er es gelernt hat, als er ein Elitesoldat war. Er hat mir beigebracht, dass man Gott nahe bleibt, wenn man sich rein hält. Er liest mir die Geschichten anderer Soldaten vor. Geschichten über Kriege. Über die Nachrichten. Ich komme zu dem Schluss, dass der Mann am Steuer Papa nicht kennt. Ich starre ihn von der Seite an und spreche erneut Englisch. »Sie machen Delphine sehr böse.«
Er lächelt. »Gewöhn dich dran.«
Er ist kein netter Mann, aber ich weiß, dass er mir nichts tun will, wie der verbrannte Mann es wollte. Papa sagt, er würde mich beschützen, und ich glaube Papa.
»Sie Soldat, wie Matis?«, frage ich auf Englisch.
»Ja. Vor langer Zeit, als er noch ein ehrbarer Mann war.« Der Brite fährt schneller und schreit auf, als sein Auto mehrmals herumwirbelt, bevor es endlich stehen bleibt. Er flucht, als ich mich wieder auf den Boden, über meine Kleidung und meinen Koffer übergebe. Ich wische mir den Mund ab und sehe mich nach den Lichtern um, die durch das Heckfenster des Autos scheinen.
»Die bösen Männer jagen uns!«
»Dessen bin ich mir bewusst, Delphine, Himmel, sei einfach still! Und ich bringe dich ja weg von dem bösen Mann«, schreit er mich an und kurbelt sein Fenster herunter. Er schießt mit einer Pistole auf das Auto, das uns verfolgt, schießt immer wieder, bis wir die Lichter nicht mehr sehen können, dann stößt er einen langen Atemzug aus.
Wir fahren ganz lange weiter, bis der Brite anhält und mir sagt, ich solle auf meinem Sitz geduckt bleiben, während er die Straße beobachtet und Ausschau nach weiteren Lichtern hält. Nach einer langen Zeit bemühe ich mich, nicht einzuschlafen, als er schließlich spricht.
»Dein Vater mag das größte Pech gehabt haben, aber wie es scheint, wird es dir heute nicht so ergehen. Sieht so aus, als würdest du den Tag überleben.« Er drückt sich eine Hand aufs Gesicht. »Himmel, das war knapp.«
»Bringen Sie Delphine zurück Haus. Matis brauchen …« Ich versuche, mich auf das englische Wort zu besinnen. »Seinen medi … medisinen Löffel. Ich weiß, wo. Nur ich helfen ihm.«
»Das Leben ist grausam, und es würde dir guttun, das frühzeitig zu lernen.« Er dreht sich auf seinem Sitz zu mir um. »So intelligent du für dein Alter auch sein magst, so bist du doch völlig ahnungslos, was die Einschätzung deiner Loyalität angeht, denn dein Papa ist der böse Mann, kleine Blume. Ein schwacher, erbärmlicher Drogensüchtiger.« Der Mann flucht und schüttelt den Kopf, als er den Schlüssel in der Zündung dreht. »So schwach, dass er auf eine weitere dubiose Wette eingegangen ist, weil er nichts hatte, um seinen kostbaren Löffel zu füllen.«
»Papa nicht böser Mann«, flüstere ich und starre auf sein Profil. Ich hoffe, er merkt, dass er mich wütend macht und ich ihn für einen Idioten halte. »Sie erzählen Lügen.«
»Du scheinst kein Soldat zu sein, der Befehle befolgt«, antwortet er und schaut auf mich in meinem Sitz hinunter. »Vielleicht hat er deshalb dich als Wetteinsatz genommen.«
US-Präsident – William J. Clinton – 1993 bis 2001
Kapitel 2
Tyler
»Barrett, hier drüben!«, johle ich, bevor ich ein paar Stufen die Leiter hochklettere, die Mom mir spezial verboten hat. Sie sieht mich jetzt nicht, weil sie zu sehr damit beschäftigt ist, meine Zwillingscousins Jasper und Jessie anzuhimmeln.
Eins weiß ich: Bei Babys benehmen sich Erwachsene bescheuert. Das ist alles, was ich weiß. Barrett und ich konnten heute den Adleraugen unserer Eltern leicht entwischen, weil sie nicht aufhören können, davon zu schwärmen, wie süß die beiden sind. Ich sehe nicht, was an denen so toll sein soll. Die zwei können nichts anderes als weinen, kacken und alles vollkotzen. Jasper hat gekackt und auf mich gekotzt, als ich ihn gehalten habe.
»Barrett«, gröle ich noch lauter, und er lässt den Stock fallen, mit dem er an dem toten Eichhörnchen rumgestochert hat, dann kommt er zu mir gerannt, während ich überlege, welchen Apfel ich pflücken soll. Wir sind heute auf die Farm gekommen, weil Mom, Dad und meine Tanten und Onkel den ganzen Tag die Unterkünfte sauber gemacht und hergerichtet haben, damit sie für die Arbeiter bereit sind.
Während der Erntezeit kommt unsere ganze weitere Familie aus Georgia und Florida her. Daddy erlaubt Barrett und mir nicht, zur Farm zu gehen, wenn sie hier sind, weil er sagt, dass viele von ihnen »nicht den Verstand haben, den Gott ihnen gegeben hat« und dass sie zu viel trinken und zu viel fluchen.
Barrett blinzelt mich von unten an, wo er am Fuß der Leiter steht, während ich mich auf der Mitte der Leiter so hoch strecke, wie ich kann.
»Tyeeelerrr«, jault er, »Onkel Carter hat gesagt, wir sollen keine Äpfel pflücken.« Er schaut zu unseren Eltern hinüber, die neben einem großen Lagerfeuer Hühnchen grillen und Bier trinken. Im Moment steigt der Rauch in den Himmel und bietet uns etwas dringend benötigte Deckung.
»Die achten kein Stück auf uns. Onkel Grayson redet wieder über diesen Kurt-Cobana-Typen, der sich den Kopf weggepustet hat, aber Daddy regt sich über den Streik in der Major League auf. Plus, es ist bloß ein Apfel, und Pawpaw hat gesagt, das Land hier ist so gut wie unseres, und wenn wir richtige Farmer werden wollen, müssen wir früh anfangen, uns die Hände schmutzig zu machen und unser Land zu bestellen.«
»Tja, du kannst ja Farmer werden, aber ich werde kein Alfalfa-Desperado.«
»Du weißt ja nicht mal, was das bedeutet.« Ich verdrehe die Augen.
»Doch, tu ich wohl. Ich werde nicht irgendein Farmer sein, der nur Äpfel und Gemüse anbaut. Ich züchte auch Vieh. Damit ich ein richtiger Cowboy sein kann.«
»Tja, ich werde keine Zeit haben, Cowboy zu sein, denn ich werde Soldat bei den Marines wie Onkel Gray, Daddy und Pawpaw.«
»Dann wirst du bloß ein Farmer sein. Alfalfa-Desperado!«, stichelt er und zeigt auf mich.
»Halt die Klappe.« Müde vom Hochrecken, lasse ich die Schultern kreisen. »Ich schätze, ich könnte auch Cowboy werden. Vielleicht kann ich ein Pferd und ein paar Rinder auf deinem Land einstellen, und du passt auf sie auf, während ich ein Marine bin?«
»Vielleicht.«
»Bis dahin müssen wir Stoppelhopser sein«, erkläre ich ihm.
»Was ist das denn?«
»Keine Ahnung. Arbeiter, glaube ich. Stoppelhopser müssen mit Äpfeln anfangen.«
»Na schön.« Er schaut zurück zu dem Lagerfeuer. »Aber wenn dein Daddy uns erwischt, wird er uns den Hintern versohlen.«
»Na und?« Ich schlage nach einer Fliege auf meiner Nase. »Ich kann schon einstecken. Ich heule nicht rum wie du.«
»Ich heule auch nicht«, ruft er zu mir herauf.
»Doch, tust du wohl. Du heulst lauter als Jasper und Jessie, wenn du aufs Maul kriegst. Ich wette, die könnten besser Äpfel pflücken als du.«
»Klappe.« Barrett wischt sich mit dem T-Shirt über die Nase. »Die sind bloß Babys. Sie wissen noch nicht, dass sie Land besitzen oder Äpfel zum Pflücken haben, weil sie Babygehirne haben. Blödmann.«
»Was bedeutet, dass ich der älteste Cousin bin und der Boss. Jetzt halt meine Beine fest, Heulsuse, und beeil dich.«
»Ich heule nicht«, lügt er, als er sich reckt und meine Beine festhält. Ich drehe den Apfel vom Ast, und endlich löst er sich, sodass ich ihn Barrett hinhalten kann. »Siehst du, kein Ding. Die merken nie, dass einer fehlt.«
»Lass mich auch einen pflücken«, sagt er, als ich hinunterklettere.
»Du musst auf deinem eigenen Land arbeiten.«
Er rümpft die Nase, und ich steige die letzte Sprosse nach unten. »Wo soll mein Land noch mal sein?«
»Pah, du hörst nie zu.« Ich deute mit dem Kopf auf die andere Seite der Landstraße. »Da drüben. Von der Straße aus den Hügel hoch und dann noch ein Stück hinter Pawpaws Haus.«
»Da können wir nicht hin! Da müssen wir ja über die Landstraße rüber. Wenn wir über die Landstraße rübergehen, kriegen wir beide aufs Maul.«
»Das ist keine Landstraße«, erkläre ich ihm. »Es ist bloß ’ne Straße, und du hast immer Angst.«
»Gar nicht, und Mom sagt, ich werde eines Tages mal so groß wie mein Daddy.«
»Noch sind wir nicht so groß wie sie, weil wir unseren Wachstumsschub noch nicht bekommen haben.«
»Was ist das denn?«, fragt Barrett.
»Wenn du Haare unter den Achseln kriegst«, erkläre ich ihm, »und«, füge ich flüsternd hinzu, »ich habe Onkel Grayson sagen hören, dass unsere Eier noch fallen werden.«
»Fallen wohin?«
»Keine Ahnung.« Ich ziehe die Nase kraus und frage mich, wohin meine Eier wohl fallen werden.
»Bis meine Eier fallen, Tyler, lass mich einen deiner Äpfel auf deinem Land pflücken.«
»Nichts da«, antworte ich und wische den Apfel an meinem Hemd ab, bevor ich einen Bissen nehme. »Du musst dein eigenes Land bestellen. Das sind die Regeln.«
»Na schön. Aber du musst mir helfen, die Leiter über die Landstraße zu tragen.«
»Warum? Ich kann sie alleine tragen.«
»Lügner, ich habe gesehen, dass Onkel Carter sie hergetragen hat!«
»Jungs!«, ruft Mom. »Abendessen!«
»Scheiße«, murmle ich. »Du musst warten.«
»Komm schon, Cousin«, bettelt Barrett, »lass mich einen deiner Äpfel pflücken. Ich mache auch ganz schnell.«
Ich werfe meinen Apfel weg und verschränke die Arme vor der Brust. »Was gibst du mir dafür?«
»Ich hab kein Geld mehr im Sparschwein. Du hast mir schon alles weggenommen«, zischt er.
»Na gut.« Ich ziehe meine Baseballkappe tiefer herunter. »Wenn du das nächste Mal Geld hast, schuldest du mir zwei Dollar. Spuck drauf und schlag ein.«
»Ich werde nie Geld haben, wenn du es mir immer wieder wegnimmst.«
»Dein verfluchtes Pech«, sage ich, wie Daddy es immer tut. »Das ist der Preis dafür, dass du auf meinem Land Obst pflückst.«
Barrett geht um mich herum zur Leiter, aber ich versperre ihm den Weg und schüttle den Kopf. »Nichts da, spuck drauf und schlag ein. Zwei Dollar.«
»Na schön. Zwei Dollar.«
Wir spucken uns beide in die Hände und reichen sie uns dann, damit es ein echtes Geschäft unter Männern ist.
»In Ordnung. Kletter rauf, und ich halte deine Beine fest.«
»Für ganze zwei Dollar sollte ich dich den Apfel pflücken lassen.«
»Barrett, willst du ein echter Farmer sein, der sein Land bestellt, oder nicht?«
»Ja!«, ruft er, und ich ermahne ihn, leise zu sein, als Mom uns erneut zum Abendessen ruft.
»Kommen gleich, Mama«, brülle ich zurück und ziehe den Kopf ein, damit sie nicht sehen kann, wo genau wir im Obstgarten sind. »Sag ihr auch, dass du kommst, und beeil dich«, befehle ich Barrett. Er brüllt ihnen etwas zu und klettert die Leiter hoch. Als er so weit oben ist, dass ich ihn gerade noch halten kann, zeige ich auf einen Apfel, den er erreichen kann.
»Hab … ihn … fast«, sagt er und reckt sich, um sich den Apfel zu schnappen. Als er ihn endlich packt, verliere ich den Halt an seinen Beinen, und er schreit und fällt. Plötzlich ist Daddy da und fängt ihn auf, bevor er auf dem Boden aufschlagen kann. Ich drücke den Rücken durch, als Daddy sich zu mir umdreht, während Barrett in seinen Armen zappelt. Barretts Augen sind genauso groß wie meine.
»Daddy, das war so, so schnell«, sage ich. »Wie bist du so schnell hierhergekommen?«
»Netter Vortrag, mein Sohn«, sagt Dad in seinem autoritären Ton. »Dieser Junge war dreißig Zentimeter davon entfernt, sich zum ersten Mal die Knochen zu brechen«, fügt er auf eine Weise hinzu, die mir sagt, dass ich mir Haue verdient habe und dass es wehtun wird. Ich hebe die Hand zum Schutz vor der Sonne, um zu schauen, wie sauer er ist, und sehe ihn nur den Kopf schütteln. Das bedeutet, dass er enttäuscht ist. »Für einen Jungen, der gern Befehle erteilt, salutierst du aber wirklich schrecklich.«
»Tut mir leid, Daddy«, murmle ich und lasse die Hand sinken. »Ich habe nicht salutiert. Die Sonne hat mich geblendet. Ich habe nur … na ja, Barrett …«
»Überleg lieber noch ein bisschen, bevor du mich anlügst, Tyler«, warnt Daddy mich.
»Ich hab nur …«
»Oh, ich habe gehört, was du zu ihm gesagt hast«, erklärt er mir auf die gleiche Weise, wie er es tut, wenn er mich aufzieht. Ich blinzle ihn an, während er Barrett hochwirft, bis der Junge kichert.
»Jedes Wort, Junge, einschließlich deiner Flüche.« Er hört sich wieder so an, als würde er mich aufziehen, und ich schwöre, ich sehe ihn lächeln, aber die Sonne blendet mich. Er wirbelt Barrett noch einmal herum, und Barrett kreischt, bevor Daddy ihn auf den Boden stellt.
»Danke, dass du mich aufgefangen hast, Onkel Carter. Tut mir leid, dass wir nicht gehorcht haben. Ich hab versucht, Tyler zu sagen, dass wir Ärger kriegen. Wirst du mich auch verhauen?«
»Wir werden sehen. Du kannst während des Abendessens darüber nachdenken, was du getan hast.« Daddy legt Barrett eine Hand auf die Schulter. »Jetzt geh dich waschen und setz dich an den Tisch, damit wir beten können.«
»’kay«, sagt Barrett und sieht mich hinter Daddys Rücken mit großen Augen an.
»Verzeihung, wie war das?«, ruft Dad ihm nach.
»Ich meine, jawohl, Sir«, brüllt Barrett hinter ihm, als er zur Veranda rennt.
Daddy kniet sich neben mich und hebt den Apfel auf, in den ich hineingebissen und den ich dann auf den Boden geworfen habe. »Junge, wenn du die Verantwortung übernimmst und der Älteste und Anführer sein willst, solltest du besser wissen, was du tust, bevor du anfängst, Befehle zu erteilen und Vorträge zu halten.«
»Aber ich habe dir, Pawpaw, und Onkel Grayson zugesehen, also weiß ich, was zu tun ist.«
Er lächelt und schüttelt den Kopf. »Ach ja?«
»Ja, Sir.«
»Na schön. Dann sag mir mal, mein Sohn, wie viel kostet ein Apfel?«
»Wie bitte?«
»Zeit schinden und höflich sein wird dir nicht weiterhelfen. Also, ich frage dich noch einmal. Kennst du den Preis eines Apfels?«
Ich schlucke und verscheuche eine Fliege von meiner Nase. »Nein, Sir, den kenne ich nicht.«
»Und wieso kennst du ihn nicht?«
»Weil wir keine kaufen brauchen.« Ich lächle und strecke die Arme aus. »Wir haben eine Farm!«
»Stimmt, aber wir müssen die Äpfel verkaufen, um Geld zu verdienen, und du hast deinen Pawpaw gerade das Geld für diesen Apfel gekostet, das du zurückzahlen wirst.« Er hebt Barretts Apfel auf. »Denkst du, wir können einen Apfel mit Druckstellen verkaufen?«
»Nein, Sir, tut mir leid …«
»Deine Entschuldigung zählt nicht, Tyler. Du entschuldigst dich nicht, weil es dir leidtut – nur weil du erwischt worden bist. Wenn du ein richtiger Mann werden willst, entschuldige dich, wenn du es ehrlich meinst, sonst bedeuten deine Entschuldigungen niemandem etwas. Und glaub nicht, dass du die Leute täuschen kannst. Menschen wissen, wann du es ernst meinst und wann nicht.«
»Jawohl, Sir.«
Er nimmt mir meine Baseballkappe vom Kopf und verwuschelt mir das Haar. »Du wirst früh genug ein Mann sein, aber bis dahin hast du keinem anderen Jungen zu erklären, wie er etwas zu sein hat, was du selbst noch nicht bist. Verstanden?«
»Ja, Sir«, antworte ich, als er mir meine Kappe wieder in die Stirn schiebt.
»Jetzt komm, deine Mutter hat dich schon zweimal zum Abendessen gerufen, wenn du also noch etwas Haut an deinem Hintern behalten willst, schlage ich vor, dass du dich wäschst und zu Tisch kommst.«
Ich nicke, und wir gehen zur Terrasse, wo die Familie auf Picknickbänken sitzt. »He, Daddy?«
»Ja?«
»Wie viel wird mir gehören? Du weißt schon … Wenn ich ein Mann bin?«
Er bleibt stehen und hebt mich über seinen Kopf auf seine Schultern. Ich muss lachen, weil ich weiß, dass ich langsam zu groß dafür bin, aber er ist so stark, dass er mich trotzdem tragen kann. Alle sagen, ich sehe aus wie er, und ich weiß, dass ich eines Tages so stark sein werde wie er. Er zeigt auf einen der Hügel vor uns. »Geradeaus durch das Tal …«
»Auf zwölf Uhr«, antworte ich ihm, denn ich weiß, dass ihn das mit Stolz erfüllt.
»Genau. Siehst du die Baumlinie da draußen?«
»Ja, Sir.«
»Von zwölf Uhr bis vier Uhr und dann den ganzen Weg zur Rückseite von Onkel Graysons Haus und von dort bis zur Straße und zurück hierher, wo wir gerade stehen.«
»Das gehört alles mir?«
»Ja, Junge, das wird alles mal dir gehören.«
»Warum willst du nicht auf unserem Land arbeiten? Pawpaw sagt, du hättest deinen Anteil an Land nicht genommen, um es zu bearbeiten.«
»Ich schätze, ich wollte lieber Soldat werden.«
»Muss ich mich entscheiden?«
»Nein, du kannst beides sein, wenn du willst.«
»Pawpaw war beides«, antworte ich ihm.
»Ja, hm, Pawpaw ist ein besserer Mann als ich.«
»Auf keinen Fall, ist er nicht«, widerspreche ich und raufe ihm das Haar, wie er es sonst bei mir tut, und er lacht.
»So mache ich’s. Ich werde ein Marine und ein Cowboy, aber bloß nicht so ’n verdammter Alfalfa-Desperado.«
»Kindermund tut Wahrheit kund«, sagt er lachend, dann hebt er mich von seinen Schultern und stellt mich vor sich hin. »Das ist was, das ich nicht geschafft habe, aber ich glaube, wenn irgendjemand das hinkriegt, dann bist du das. Aber tust du mir einen Gefallen?«
»Welchen?«
»Bleib für deine Mom und mich noch ein Weilchen ein Junge. Meinst du, das kannst du schaffen?«
»Wenn ich noch ein Weilchen ein Junge bleibe, können wir dann nach dem Abendessen Fangen spielen?«
»Immer muss er feilschen.« Lachend zieht er mir meine Kappe über die Augen.
»Was ist das?«
»Deine Veranlagung.« Er kichert, während ich mir meine Kappe wieder richtig aufsetze. »Und abgemacht, aber versuch, deinem Cousin an diesem Wochenende keine Knochen zu brechen, und entschuldige dich heute Abend in deinen Gebeten für das Fluchen.«
»’kay … Also … wirst du mich verhauen? Denn Mom hat mir ganz spezial gesagt, ich soll nicht auf die Leiter.«
»Das heißt, ganz speziell, und keine Haue heute, aber jetzt weißt du es besser.« Er nimmt meine Hand, als wir auf die Veranda zugehen, und ich drücke sie fest. Beim Gehen schaut er zu mir herunter, und ich kann an seinen Augen erkennen, dass er stolz ist. »Hab dich lieb, Junge.«
»Ich dich auch, Daddy.«
Wir gehen noch ein paar Schritte weiter. »Daddy?«
»Ja?«
»Danke, dass du es für mich behalten hast … Das Land. Ich kann es gar nicht erwarten, ein Marine und ein Cowboy zu sein.«
»Gern geschehen.«
»He, Daddy?«
»Gütiger Gott, Junge, was noch?«
»Was kostet denn nun ein Apfel?«
US-Präsident – Ronald Reagan – 1981 bis 1989
Kapitel 3
Delphine
»Salope«, tönt es höhnisch, bevor ich Celines Autotür zuschlage und das Mädchen durch mein Fenster böse anstarre, während es triumphierend abzieht. Es ist das dritte Mal heute, und ich weiß, dass sie es geplant hat. Sie planen es immer.
»Ignorier sie«, sagt Celine mit einem Seufzen und fährt mir zärtlich mit ihren manikürten Nägeln durchs Haar, bevor sie vom Bordstein wegfährt. »Sie sind nur sauer, weil du hübscher bist als sie und Brüste hast.«
»Ich habe Brüste, seit ich neun war.«
»Wie könnte ich das vergessen? Du hast sie mir und dem Rest der Familie beim Abendessen gezeigt«, sagt sie lachend, und ich verdrehe die Augen.
»Sie sind sauer, weil sie denken, ich hätte ihre Freunde geküsst … und das habe ich auch. Ich habe ihren Freund geküsst.« Ich deute mit dem Kopf zur Schule. »Lyam, während der Mittagspause. Er macht zu viel mit der Zunge.«
Celine schnappt nach Luft, als ich mich mit meinem eigenen triumphierenden Lächeln zu ihr umdrehe und meinen Anschnallgurt einrasten lasse.
»So wirst du dir keine Freunde machen«, warnt sie mich.
»Mit denen will ich gar nicht befreundet sein«, antworte ich ihr. Und das stimmt. Ich will nicht ständig nur über Jungs reden – oder Kleider, Make-up, Shoppen oder irgendwelche Konzerte. Ich will im Fluss angeln, schießen und Lagerfeuer machen. Ich will wieder in Levallois-Perret sein und als Matis’ Tochter leben. Nicht so tun, als wäre ich Celines kleine Schwester – obwohl das außer Celine niemand aus der Familie glaubt.
»Du solltest nicht so viele Jungen küssen. Neun ist noch gar nicht so lange her«, spottet Celine und biegt in eine Straße ein, die zu uns nach Hause führt. Ein Zuhause, in dem die Vorhänge Rüschen haben, die Böden nicht knarren und die Fenster nicht mit einer dicken Schmutzschicht bedeckt sind, in der wir nach Mamans Worten verrotten sollten. Jeden Tag sehne ich mich nach unserem Haus etwas außerhalb von Levallois-Perret zurück, und jeden Tag lebe ich wie eine Prinzessin statt wie eine Soldatin. Es ist ein Zuhause, in dem wir Hausangestellte haben, die unsere Wäsche waschen und jede meiner Bewegungen überwachen und dann Papas Neffen Francis und seiner Frau Marine melden.
»Wo ist Ezekiel?«, frage ich und werfe einen Blick auf den leeren Rücksitz, während sie im Radio »Lucky Star« von Madonna aufdreht. Schon wieder Madonna. Immer Madonna. Ich mag Prince.
»Er ist diese Nacht bei Maman, du siehst ihn also, wenn ich dich zu Hause absetze.«
»Warum ist er bei ihr?«
»Warum?« Sie reißt die Augen auf, und ich lache, denn ich weiß sehr gut, was für ein Tyrann mein drei Jahre alter »Neffe« ist. »Damit ich etwas dringend benötigte Ruhe bekomme.« Sie seufzt und sieht mich an. »Und ich küsse genau einen Mann«, fügt sie tadelnd hinzu und weigert sich, mein Eingeständnis auf sich beruhen zu lassen. »Einen einzigen Mann, den ich heute Abend hoffentlich ohne aufdringliches Publikum küssen kann.«
»Und genau darum bist du so langweilig. Jetzt schon an einen einzigen Mann gebunden, für immer und ewig, du Idiotin«, stichle ich wie immer, und sie lächelt – wie immer – , weil sie meine Beleidigungen nie ernst nimmt, selbst wenn ich sie ernst meine.
Celine hat mich sofort ins Herz geschlossen, als ich damals vor ihrer Haustür abgesetzt wurde. Sie kam mit meinem Temperament gut zurecht, weil sie nie zornig zu werden schien. Ich tat alles, was ich konnte, um sie während meiner ersten Monate in ihrem Haus dazu zu bringen, mich zurückzuschlagen. Obwohl es viele Schlafzimmer gibt, teilten wir uns ein Zimmer, bevor sie auszog und mit Abijah durchbrannte. Mein Verdacht ist, dass wir uns nur ein Zimmer geteilt haben, weil Celine schon vor meiner Ankunft beschlossen hatte, dass ich die Schwester war, nach der sie sich immer gesehnt hatte. Damals tat ich mein Bestes, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ich stahl ihre Kleidung und behauptete sogar, ihre Lieblingskette gehöre mir. Immer wenn ich so etwas tat, zuckte sie nur mit den Achseln und sagte, sie hätte mir die Sachen sowieso gegeben, wenn ich sie nur gefragt hätte. Celine bedeuten Besitztümer nichts – wahrscheinlich, weil sie in solchem Überfluss aufgewachsen ist.
Zuerst habe ich es gehasst, dass sie nie sauer wurde, aber statt sich zur Wehr zu setzen, umarmte sie mich. Sie sagte, ich würde Umarmungen brauchen. Auch wenn ich ihre Umarmungen nicht mag, lasse ich sie zu, weil ich glaube, dass sie diejenige ist, die sie braucht.
Obwohl Celine und ich uns nähergekommen sind, ist die Sache mit ihren Eltern eine andere. Francis, ein viel älterer Cousin, den ich vor der Nacht, in der ich zu ihm kam, noch nie kennengelernt hatte, spielt jetzt für mich die Rolle eines Elternteils. Und während ich Francis zum Lachen bringe, toleriert seine Frau Marine mich nur. Kurz nachdem ich wie Müll vor ihrer Haustür abgesetzt worden war, belauschte ich Marine, als sie ihre Meinung über mich äußerte.
»Sie ist aus den Slums zu uns gekommen, und genauso benimmt sie sich auch. Er hat kein Mädchen großgezogen – er hat eine künftige Verbrecherin großgezogen, die frech ist und keinerlei Manieren hat.«
Marines Meinung über mich hat sich während der gemeinsamen Jahre nicht wesentlich geändert. Sie sieht mich immer noch so an wie früher und erklärt, dass all ihre Bemühungen umsonst waren, weil ich »immer noch frech« sei und »keinerlei Manieren« hätte.
Francis hat mich in jener Nacht verteidigt, so wie er es immer noch häufig tut, indem er ihr ins Gedächtnis rief, dass sie die einzige Familie seien, die ich noch hätte. Das war die Wahrheit, wie ich wusste, denn mein Onkel Aloús – Matis’ einziger Bruder und Francis’ Vater – war Soldat gewesen, aber in Vietnam gefallen. Nach dem, was Celine mir später beim nächtlichen Flüstern in unserem Zimmer erzählt hat, waren Francis und Marine Aktivisten, bis Celine ins Teenageralter kam. Anhand ihres Benehmens kann ich nur vermuten, dass Marine diejenige war, die dem Ganzen Einhalt geboten hat, obwohl ich den Verdacht habe, dass Francis ohne ihr Wissen weiterhin involviert ist.
Am Esstisch bringt Celines Mutter Francis immer zum Schweigen, wenn er Geschichten über ihre gemeinsame Zeit als Aktivisten erzählen will. Sie sorgt auch dafür, dass Francis den Mund hält, wenn er meinen Papa oder seinen eigenen toten Vater erwähnt, Aloús. Aber ich weigere mich, meinen Vater zu vergessen oder mein Versprechen ihm gegenüber, mich an das zu erinnern, was er mir beigebracht hat. An den meisten Abenden starre ich an die Decke, um meine Erinnerungen zu bewahren, und durchlebe noch einmal die Zeit mit ihm, nachdem Maman uns verlassen hat – meine glücklichsten Tage. Meistens tue ich so, als wäre er in jener Nacht nicht im Schnee gestorben. Als hätte der britische Mann gelogen, und mein Vater hätte mich nicht für einen Löffel voll Drogen verkauft. Ich mache mir vieles vor, weil ich immer noch bei ihm sein möchte – dort. Immer. Für immer zwischen den Wildblumen tanzend.
Dieses Leben ist für mich kein richtiges Leben. Es gibt keine Abenteuer im Freien, keine Blumenwiesen, auf denen man tanzen kann, oder Flüsse in der Nähe, in denen man angeln kann, und keine Tiere, auf die man zielen und schießen kann. Die ganze Stadt besteht aus Beton, und es gibt viel zu viele Augen. Zu viele Menschen. Ich mache Celine keine Vorwürfe, dass sie ausgezogen ist, obwohl sie dummerweise nicht aus der Stadt weggezogen ist.
»Der Mann, den ich küsse, verändert die Welt«, tiriliert Celine glücklich, als ich den Sender wechsle, nachdem Reagans Worte »Mister Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!« schon wieder aus den Lautsprechern schallen, zum millionsten Mal, seit der amerikanische Präsident sie vor einigen Monaten geäußert hat.
»Ja, ja, und du wirst ihm helfen«, murmle ich.
Obwohl sie seit Jahren zusammen sind, redet Celine ständig über Abijah. Als wir uns noch ein Zimmer geteilt haben, habe ich ihre Gespräche belauscht, wenn sie ihn nachts heimlich hereingeschleust hat. Manchmal küssten sie sich leidenschaftlich, wenn sie dachten, ich würde schlafen. Wenn sie sich nicht küssten, erzählte er ihr Geschichten über unsere Regierung und über die korrupten Menschen darin. Von einer Gruppe, der er angehörte – Pardi Radical – , und von den Veränderungen, die in der Führung vorgenommen wurden. Oft erzählte er ihr Geschichten über seinen Freund Alain, dessen Papa bei einem Bombenanschlag getötet worden war, und von ihren Plänen, gemeinsam etwas zu verändern.
Ich hörte zu, weil es mich an Papas Geschichten erinnerte und Abijah mich an den Soldaten erinnerte, der mein Papa gewesen war.
Celine hing an seinen Lippen und wurde mit ihm zusammen fast wöchentlich wegen irgendeiner Demonstration verhaftet, nachdem sie von zu Hause ausgezogen war. Bis sie mit Ezekiel schwanger wurde, führte Celine eher das Leben einer Soldatin als ich. Für meine Tante und meinen Onkel war ich plötzlich die brave Tochter.
Obwohl ich die meisten Jungs für Schwachköpfe halte, kann ich verstehen, warum Celine sich so unsterblich in Abijah verliebt hat. Er ist nicht nur ein wahrer Straßenkämpfer, sondern sieht auch sehr, sehr gut aus. Mit pechschwarzem Haar, Augen, die glühen wie Feuer, und einer weichen, seidigen Stimme. Er spricht immer so begeistert über seine Pläne, dass ich ihm manchmal genauso glaube, wie Celine es tut.
»Ich hab dir gesagt, dass ich ihm vorerst nicht mehr helfe, und zwar für einen viel besseren Zweck«, berichtet sie liebevoll und spricht von der anderen Liebe ihres Lebens, ihrem Sohn, während sie in eine Straße einbiegt, die ich nicht kenne.
»Celine, das ist nicht der Weg nach Hause«, bemerke ich und schaue sie an.
»Für mich schon.« Sie sieht mich an, ein schelmisches Glitzern in den Augen. »Du bittest mich ständig, dich zu meiner Wohnung mitzunehmen und unsere Freunde kennenzulernen.«
Endlich mal von etwas begeistert, drehe ich mich auf meinem Sitz ganz zu ihr um. »Heute? Wir fahren jetzt hin?«
»Ja, aber du musst mir versprechen, dich zu benehmen. Widersprich Abijah diesmal nicht mit deinen politischen Ansichten. Hör einfach zu.«
»Versprochen«, sage ich bereitwillig, und bei dem Gedanken, über mehr als nur Lippenstiftschattierungen zu sprechen, durchströmt mich Vorfreude.
»Sieh zu, dass ich diese Entscheidung nicht bereuen muss.« Sie verdreht die Augen, als Prince anfängt »When Doves Cry« zu singen.
»Ich verspreche es«, antworte ich ihr, bevor ich die Lautstärke hochdrehe.
***
Als ich in der winzigen Küche stehe und die Landkarte studiere, die Abijah markiert hat, dringt Celines Gelächter aus ihrem Schlafzimmer zu mir. Ich verdrehe die Augen und gehe an einem Tisch voller Waffen vorbei – die meisten davon wurden dort abgelegt, als ihre Freunde hereinkamen. Celine kichert leise, als jemand den Plattenspieler einschaltet und immer mehr Rauch in die kleine Wohnung dringt. Diese Nikotinwolke, die sich schnell im Raum verteilt, stammt von einem halben Dutzend ihrer Freunde, die sich auf dem Balkon im zweiten Stock zusammendrängen. Fröstelnd, weil eine frische Herbstbrise durch den Raum weht, untersuche ich das überwiegend unspektakuläre Waffenarsenal, bis ich bei einer Schusswaffe hängen bleibe, die einer von Papas Knarren ähnelt. Daneben liegt eine große Kiste mit Werkzeugen und Behältern, in denen Pulver enthalten ist. Als ich die Hand ausstrecke, um einen der Behälter zu öffnen, flüstert mir jemand ein »PENG!« ins Ohr.
Ich zucke zusammen, drehe mich um und sehe einen Mann oder … Jungen vor mir. Er ist im Alter irgendwo dazwischen, seine Augen hellbraun, sein Haar so dunkel wie das von Abijah. Als ich ihn genauer betrachte, komme ich zu dem Schluss, dass er fast so gut aussieht wie Abijah – auch wenn seine Zähne ein wenig schief sind, als er mich anlächelt. »Damit würde ich nicht herumspielen. Das ist kein Spielzeug.«
»Ich habe nicht gespielt. Ich bin kein kleines Mädchen mehr.«
»Du bist Celines Schwester? Non?«, fragt er überwiegend auf Englisch.
»Oui, aber …« Ich halte inne, um das richtige Wort zu finden. »Ich … neugierig.«
»Neugier ist der Katze Tod«, sagt er lachend und nimmt einen Schluck von seinem Bier. Er trägt Jeans und ein T-Shirt, aber seine Schuhe sehen neu und teuer aus.
»Sehe ich wie ein Katz aus? Du siehst wie ein Idiot aus«, füge ich hinzu, wie so oft gedemütigt von meinem Englisch. Seit Marine mich in der Schule angemeldet hat, habe ich jedes Jahr versucht, meine Klassenkameraden einzuholen, weil Matis mich nie in die Schule geschickt hatte, als ich nach Mamans Verschwinden alt genug war.
Der Junge lässt ein breites Grinsen aufblitzen, als wüsste er etwas, das ich nicht weiß. »Nein … Du, du bist ein temperamentvolles kleines Mädchen.«
»Ich bin ebenso wenig ein Mädchen, wie du ein Junge bist«, kontere ich auf Französisch.
»Hm. Verstehe. Nimm es mir bitte nicht übel, kleine Schwester.« Er lacht mich jetzt vielleicht nicht mehr offen aus, aber seine Augen tun es, und ich funkle ihn böse an, bevor ich ein Gewehr in die Hand nehme, mit dem ich vertraut bin.
»Das hier ist alt«, sage ich. »MAS 49 / 56, Zehn-Schuss-Magazin. Standardausgabe der französischen Armee in den Sechzigern. Das ist ein Relikt, das Gas zum Schießen braucht und begraben gehört.«
Verwirrt zieht er die Augenbrauen hoch. »Woher weißt du das?«
»Das ist meine Angelegenheit. Wer bist du?«
»Ich schätze, du wirst neugierig bleiben müssen, aber ich behalte dich im Auge, kleine Schwester.«
»Du kannst deine Augen für dich behalten«, zische ich, unsicher, warum mein Herz so schnell hämmert, als er mir über die Schulter schaut. Ich folge seinem Blick zu einem Mädchen, das ihn zu sich heranwinkt.
Er grüßt sie, indem er kurz das Kinn hebt, bevor er den Blick langsam wieder auf mich richtet. Mein Herz krampft sich ein wenig zusammen, als er mich ein paar Sekunden lang ansieht. »Es war schön, dich kennenzulernen, Delphine.«
»Ich werde nicht behaupten, dass es schön war, dich kennenzulernen«, antworte ich ihm. »Geh mal lieber zu ihr, jedenfalls wenn du es magst, dass man dir sagt, was du tun sollst.«
Er lacht, nippt noch einmal an seinem Bier und sieht mich weiterhin an, obwohl er auf das Mädchen zugeht. Celine kommt aus dem Schlafzimmer und versperrt mir die Sicht, kurz nachdem er in dem Rauch auf dem Balkon verschwunden ist. Sobald er außer Sichtweite ist, hasse ich es, dass ich ihn nicht mehr sehen kann.
»Abmarschbereit?«, fragt Celine mich.
Ich nicke und folge ihr zur Tür, werfe aber noch einen letzten Blick zurück, um zu sehen, ob der dunkelhaarige Junge mich beobachtet. Abijah kommt kurz darauf aus ihrem Schlafzimmer und bleibt an der Tür stehen, um uns nachzusehen – um Celine nachzusehen. Er ist genauso besessen von ihr, und als ich das erkenne, ertappe ich mich bei dem Wunsch, dass mich jemand so ansehen soll, wie Abijah seine Frau ansieht.
»Celine?«, frage ich und spähe erneut zum Balkon, in der Hoffnung, ihn dort zu entdecken.
»Ja«, antwortet sie geistesabwesend und scheint von den Flammen wie gebannt zu sein, die in den Augen ihres Mannes tanzen. Dabei lächelt sie ihn selbstbewusst an, und ich weiß, dass es an der Art liegt, wie er sie ansieht – er lässt sie keine Sekunde aus den Augen, nicht einmal, wenn jemand seinen Namen ruft. Jeder im Raum kann erkennen, dass sie einander lieben. Man braucht nur hinzuschauen, um es zu erkennen. Während ich sie beobachte, beschließe ich, dass ich dasselbe Selbstvertrauen spüren möchte, wenn ein Junge mich ansieht.
»Celine, wer war der Junge, der gerade auf den Balkon gegangen ist? Der mit dem blauen Shirt?«
»Mit dem blauen Shirt? Oh, das war Alain.«
»Das war Alain?« Ich reiße die Augen auf, schockiert darüber, dass er so jung ist, weil Abijah immer in den höchsten Tönen von ihm spricht – als wäre er eine Respektsperson.
»Mhm«, bestätigt sie, als wir die Wohnung verlassen und dann die Treppe zu ihrem Auto hinuntergehen. In Gedanken bin ich noch bei dem Jungen, den ich gerade kennengelernt habe. Alain muss mindestens sechzehn sein – höchstens siebzehn. Das bedeutet, dass ich ihn nicht küssen darf, was meinen Wunsch, genau das zu tun, nur noch verstärkt.
Als Celine von der Wohnung wegfährt, halte ich Ausschau nach ihm und entdecke ihn auf dem Balkon, wo er gerade mit dem Mädchen lacht, das ihn gerufen hat. Als wir davonfahren, beschließe ich, dass ich es satthabe, Jungen wie Lyam zu küssen.
US-Präsident – William J. Clinton – 1993 bis 2001
Kapitel 4
Tyler
Meine Arme brennen, als ich mit dem Rasenmäher um die Ecke fahre, so wie es mir mein Daddy beigebracht hat, bevor ich anhalte, um mir den Schweiß unter der Baseballkappe wegzuwischen. Als ich aufschaue, sehe ich wieder dieselben beiden Jungen mit ihren Fahrrädern an meinem Haus vorbeifahren. Einen von ihnen kenne ich aus der Schule. Sean. Und manchmal sehe ich ihn im The Pitt Stop. Der Laden gehört seinem Daddy, und mein Daddy kennt seinen Daddy und liebt deren Burger. Wir gehen da manchmal nach der Kirche einen Happen essen. Der andere Junge ist vor einiger Zeit in unsere Gegend gezogen. Daddy nennt ihren Garten einen »Saustall«, weil sie nie ihren Rasen mähen. Daddy sagt: »Ein Mann, der seinen Garten nicht pflegt, hat keinen Stolz.«
Sean winkt mir zu, als sie das nächste Mal vorbeiradeln, und ich winke zurück. Sie fahren noch zwei weitere Male an meinem Haus vorbei, bevor Sean in unsere Einfahrt abbiegt und mir etwas zuruft. Ich schüttle den Kopf, um ihm zu zeigen, dass ich ihn nicht hören kann, und schalte den Rasenmäher aus.
»Was?«, brülle ich von dort, wo ich im Garten stehe.
»Warum mäht bei euch nicht dein Daddy den Rasen?!«, brüllt Sean zurück.
Ich gehe hinüber, als der andere Junge vorfährt und neben Sean anhält. Er sagt nichts, sondern starrt mich nur an.
»Er ist zum Einsatz abkommandiert«, sage ich Sean und starre dabei immer noch den dunkelhaarigen Jungen an. Seine Augen sehen aus wie das Metall von einer von Daddys Waffen.
»Oh«, murmelt Sean, bevor er den Kopf schief hält. »Was heißt das?«
»Das heißt, dass er ein Soldat der Marines ist und dich und mich vor allen Feinden beschützt, ausländischen und einheimischen. Ich bin der Mann im Haus, während er weg ist, deshalb mähe ich den Rasen.«
Der dunkelhaarige Junge lacht, und ich werfe ihm einen strengen Blick zu. »Dein Garten ist ein Saustall. Warum mäht dein Daddy da nicht den Rasen?«
Der dunkelhaarige Junge starrt mich nur an.
»Sein Daddy ist tot. Seine Momma auch«, berichtet Sean mir.