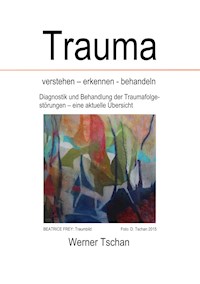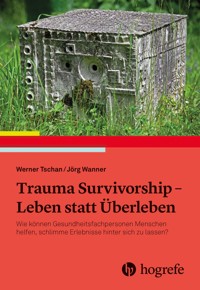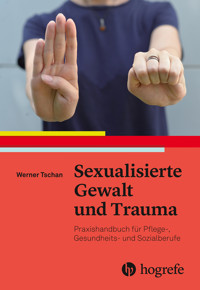
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Menschen reagieren auf Vorfälle sexualisierter Gewalt oft mit Rat- und Hilflosigkeit. In Fällen der Anklage stellen Opferaussagen häufig das einzige Beweismittel dar, wodurch eine gerechte Strafverfolgung erschwert und weitere Belastungen für die Betroffenen entstehen können. Noch immer prägen Schweigen, Bagatellisierung und mangelnde Verantwortungsübernahme den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Bei den oft als unvorhersehbare Einzelfälle wahrgenommenen Taten handelt es sich tatsächlich um systemische Delikte, die besonders in Institutionen und Organisationen begünstigte Bedingungen vorfinden, wie das Praxishandbuch schnörkellos und eindrücklich verdeutlicht. Anhand zahlreicher Beispiele schafft der erfahrene Psychiater und Psychotherapeut Werner Tschan einen facettenreichen Überblick der Problematik. Das Praxishandbuch richtet sich an Pflege-, Gesundheits-, Sozial-, Trainings-, und Erziehungsberufe. Es bietet ihnen umfangreiche Informationen, die sie im Umgang mit sexualisierter Gewalt in ihrer Tätigkeit unterstützen. Es betont, wie bedeutend fundiertes Wissen über sexualisierte Gewalt ist, um Betroffene zu stärken und zu schützen. Der Autor • beschreibt psychische und physische Folgen für Betroffene • zerstreut stereotype Vorstellungen über Täter und Opfer • erläutert Schutz- und Behandlungsmöglichkeiten • ermutigt zu gegenseitigem Austausch von Wissen und Erfahrung • ruft zu einer Kultur des Hinschauens auf. Aus dem Inhalt • Traumafolgestörungen nach Gewalterfahrungen • Behandlung und Stabilisierungstechniken • Bedeutung für das Gesundheitswesen, die Sozial- und Erziehungswissenschaften sowie den Sport- und Freizeitbereich • Kompetenzen der Fachkräfte • Berufsrisiko: sekundäre Traumatisierung .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Werner Tschan
Sexualisierte Gewalt und Trauma
Praxishandbuch für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe
Sexualisierte Gewalt und Trauma
Werner Tschan
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
André Fringer, Winterthur; Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Angelika Zegelin, Dortmund
Werner Tschan. Dr. med., Psychiater und Psychotherapeut, FMH, Allschwil/Basel
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z. Hd. Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Johanna Hartner
Redaktionelle Bearbeitung: Martina Kasper
Herstellung: Daniel Berger, René Tschirren
Umschlagabbildung: Jürgen Georg
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Kapiteltrenner: Hatto von Hatzfeld.
Illustration/Fotos (Innenteil): Getty Images – Kapitel 6: Peter Dazeley; Kapitel 7: XiFotos; Kapitel 9: merry; Kapitel 10: FG Trade; Kapitel 12: Stephanie Noritz; Kapitel 17: Chris Ryan
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
1. Auflage 2024
© 2024 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96324-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76324-8)
ISBN 978-3-456-86324-5
https://doi.org/10.1024/86324-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wieso dieses Buch?
Aktueller Überblick
Teil I: Sexualisierte Gewalt und Auswirkungen
1 Sexualisierte Gewalt und Trauma
2 Was sind die Folgen?
2.1 Intrusionen und Flashbacks
2.2 Vermeidungsverhalten
2.3 Erhöhte Grundspannung
2.4 Numbing
3 Barnahus
3.1 Posttraumatische Belastungsstörung – 6B40
4 Anzeigeverhalten
5 Diagnostik der Traumafolgestörungen
5.1 Anpassungsstörung – 6B43
5.2 Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung – 6B41
5.3 Die dissoziative Identitätsstörung – 6B64
5.4 Partielle dissoziative Identitätsstörung- 6B65
5.5 Depersonalisations-Derealisationsstörung – 6B66
Teil II: Aufarbeitung
6 Behandlung
6.1 Sicherheit und Stabilisieren
6.2 Durcharbeiten Traumaexposition
6.3 Integrieren
6.4 Stabilisierungstechniken
6.5 Epigenetische Veränderungen
6.6 Window of Tolerance
6.7 Erhöhte Grundspannung
6.7.1 Verbale Methoden
6.7.2 Aktivitäten
6.7.3 Körperliche Methoden
6.7.4 Impulskontrollübungen
6.7.5 Imaginationstechniken
6.7.6 Spiritualität
6.7.7 Notfallkoffer
6.7.8 Stabilisierungstechniken bei Kindern und Jugendlichen
Teil III: Die einzelnen Bereiche
7 Bereiche im Gesundheitswesen
7.1 Arztpraxen, ambulante Versorgung
7.2 Notfall- und Katastrophenmedizin
7.2.1 Gewalt in der Notfallmedizin
7.3 Kinder- und Jugendheime
7.4 Menschen mit Behinderungen
7.5 Langzeitpflege, Altenbetreuung
7.6 Forensik
7.7 Spital
8 Bereich der Sozial- und Erziehungswissenschaften
9 Sport- und Freizeitbereich
10 Sexualdelinquenz und Gewalt
10.1 Das Wissen um die Täterstrategien
10.2 Zustimmung versus Widerspruchslösung
10.3 Delinquenten als vorherige Opfer
10.4 Genderstereotypien
Teil IV: Maßnahmen
11 Prävention
11.1 Die sichere Einrichtung
11.2 Qualitätssicherung im Gesundheitswesen
12 Kompetenzen der Fachkräfte
12.1 Sexualität in ihren verschiedenen Funktionen
12.2 Eine umfassende Sexualpädagogik
12.3 Entwicklung der Sexualität
12.4 Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten
12.5 Nebenwirkungen von Behandlungen
12.6 Kenntnisse über sexualisierte Gewalt und Folgen
13 Schutzkonzepte in Einrichtungen
14 Aus-, Fort- und Weiterbildung
15 Hilfe für Fachkräfte, Betroffene und Angehörige
16 Berufsrisiko: sekundäre Traumatisierung
17 Kultur des Hinschauens
17.1 Fehlerkultur
17.2 Ausblick auf zukünftige präventive Maßnahmen
Anhang
Das Signal for Help – Hilfezeichen
Literatur
Über den Autor
Sachwortverzeichnis
|9|Einleitung
Schweigen ist die stärkste Waffe der Täter.
(Tschan, 2012, S. 11)
In den zurückliegenden Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass im Gesundheitswesen viel mehr Menschen von sexualisierten Gewalterfahrungen und anderen Traumata betroffen sind und behandelt werden müssen, als man lange Zeit annahm. Dieser Paradigmenwechsel beruht im Wesentlichen auf einer Enttabuisierung eines unliebsamen gesellschaftlich relevanten Sachverhaltes sowie den Konzepten über Traumafolgestörungen, wie sie seit der Einführung der neuen diagnostischen Begriffe seit 1980 entwickelt wurden. Verfügte man zu Beginn dieser Entwicklung über die Folgen von Gewalterfahrungen praktisch ausschließlich über Erfahrungen und Kenntnisse aus der Militärmedizin, änderte sich dies mit den weltweiten Forschungsergebnissen nach 1980 grundlegend (Tschan, 2019). Trotzdem mag überraschen, dass die Ausbildung der Fachleute zu diesen Aspekten insbesondere im Gesundheitswesen und in den Sozial- und Erziehungswissenschaften nur zögerlich aufgegriffen wurde – mit nachteiligen Auswirkungen auf die Aufdeckung von sexualisierten Gewaltdelikten sowie Betreuung und Behandlung von Betroffenen.
Es gibt zwei hauptsächliche Risikobereiche, in denen sexualisierte Gewaltdelikte verübt werden – der eine Bereich ist die Kernfamilie, der andere Bereich sind Einrichtungen und Institutionen. Diese Erkenntnis beruht auf wissenschaftlichen Untersuchungen, wie sie beispielsweise im Abschlussbericht der ersten Missbrauchsbeauftragten der deutschen Bundesregierung veröffentlicht wurden. Bei dieser Studie wurden 2484 Betroffene darüber befragt, wo sich die Übergriffe zugetragen haben (Bergmann, 2011):
52,1 % innerhalb der Familie
9,3 % im erweiterten sozialen Umfeld (Nachbarn, Arbeitsplatz etc.)
32,2 % in Einrichtungen und Institutionen
6,5 % fremde Täter.
Als Täter*innen kommen innerhalb der Familie grundsätzlich alle Familienmitglieder infrage, neben Vater und Mutter auch Geschwister, Onkel, Tanten, Großeltern und/oder Cousins und Cousinen. Betroffene können sich kaum wehren – wenn diejenigen Menschen, die für ihr Wohlergehen sorgen müssten, zu Tätern werden. Die Ohnmacht ist mit Händen zu greifen, auch der Fachleute, die sich in dieser Thematik |10|engagieren. Für die Einrichtungen und Institutionen gilt, dass neben den Mitarbeitenden auch Mitbewohner resp. Gleichaltrige als Täter*innen infrage kommen. Besonders zu beachten ist eine Aussage aus dem Abschlussbericht:
„Männer und Frauen haben das jahrzehntelange Schweigen gebrochen, erstmalig über ihr Leiden und die lebenslangen Folgen gesprochen. Sie haben auch darüber gesprochen, wie sie mit ihren Versuchen, Hilfe zu erhalten, gescheitert sind, und wie die Täter und Täterinnen geschützt wurden. Das Verschweigen, Vertuschen und Verleugnen der Taten hat das Unrecht vervielfacht“ (Bergmann, 2011, S. 13).
Betroffene schweigen nicht mehr beschämt, sondern sie werden gehört. Das ist neu. Und Betroffene reden über die Folgen, unter denen sie zu leiden haben. Wenn Fachleute nicht auf das vorbereitet sind, was sie zu hören bekommen, wird es problematisch: Entweder verfallen sie in blinden Aktionismus in der Meinung, so das Übel sofort aus der Welt schaffen zu können, oder sie reagieren unschlüssig und paralysiert, weil sie nicht wissen, was zu tun ist. Vielleicht zweifeln sie das Gehörte an und meinen, das kann doch nicht sein. Opfer haben feine Antennen und spüren instinktiv diese Infragestellung oder gar Schuldzuweisung im Sinne einer Täter-Opfer-Umkehr. Fazit: Das Thema ist für alle schwierig. Man möchte am liebsten Augen und Ohren verschließen und das Ganze wie einen bösen Traum vergessen. Fachleute benötigen Theorien und Konzepte, wie sie Traumafolgestörungen einordnen und Betroffene behandeln können – Anja Röhl hat am Beispiel der Verschickungskinder dokumentiert, welch menschenverachtende Haltungen bei Fachleuten vorhanden sein können (Röhl, 2021).
Es dauerte eine beachtliche Zeit, bis die Medizin eine adäquate Diagnostik über die Auswirkungen und Folgen von sexualisierten Übergriffen präsentieren konnte. Ein Psychotrauma ist ein Ereignis, das die momentanen seelischen Belastungsgrenzen übersteigt. Den Opfern wurde lange nicht geglaubt. Man bezeichnete die Betroffenen als Lügnerinnen, wenn nicht sogar als Hexen (Guggenbühl, 2002) und dergleichen mehr. Namhafte Wissenschafter waren in der Vergangenheit der Auffassung, dass sexualisierte Gewaltdelikte extrem seltene Ereignisse darstellen – kein Wunder, war doch das ganze Ausmaß völlig tabuisiert. Man durfte solche Dinge nicht aussprechen.
Seit 1980 verfügen wir nun über eine adäquate Traumadiagnostik – mit Erstaunen fragt man sich, wieso dies nicht früher der Fall war. Mögliche Gründe für diese späte Reaktion werden im Kapitel 1 über sexualisierte Gewalt und Trauma diskutiert. Betroffene suchten vergeblich Anerkennung ihres Leidens. Eine zentrale Rolle spielen neben menschenverachtenden Auffassungen namhafter Fachleute bei diesem Nichtwahrhabenwollen sicherlich auch ökonomische Aspekte – seit der Industrialisierung kam es bei Unfällen zu Haftungsfragen sowie sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen, deswegen die Infragestellung der psychischen Auswirkungen (Tschan, 2019). Seit dem Krimkrieg, noch deutlicher seit den beiden Weltkriegen, |11|waren zudem die Militärführungen mit dem Problem von traumatisierten Soldaten konfrontiert – dem man beispielsweise mittels der Kaufmann-Kur (elektrische Folter mit galvanischem Strom) und dem Pansen-Verfahren (extrem schmerzhafte Stromschläge) beizukommen versuchte. Es galt die Überzeugung, dass richtige Männer die Grausamkeiten von kriegerischen Auseinandersetzungen seelisch unbeschadet überstehen können und dass sich ausschließlich „minderwertige Psychopathen“ in die Krankheit flüchten.
Der deutsche Nervenarzt Adolf von Strümpell war vor über hundert Jahren der Auffassung, dass es sich bei Traumafolgestörungen um bewusst vorgetäuschte Störungsbilder ohne Krankheitscharakter handeln würde (Tschan, 2019). Der deutsche Mediziner His hat in einem Referat später dazu festgehalten, dass Stümpell mit dem glücklichen Wort der Begehrungsvorstellung des Rätsels Lösung gefunden habe. Schon 1906 sprachen sich deutsche Ärzte gegen eine Entschädigung von Menschen nach Psychotrauma im Rahmen der Rentenversicherung aus; und 1916 wurde schließlich ihre Auffassung, dass diese Störungsbilder einer „psychogenen Reaktion mit wunschbedingt-tendenziösem Charakter“ entsprechen, allgemein akzeptiert. Der deutsche Psychiater Karl Bonhoeffer doppelte nach, indem er festhielt, dass die „sogenannte traumatische Neurose als psychopathische Reaktion“ (sic!) aufzufassen sei (Bonhoeffer, 1926, S. 181). Damit war der Begriff der Rentenneurose geprägt, der fortan die Entschädigungspraxis bestimmte.
Der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud stellt 1896 in einem Referat fest, dass er die Ursache von neurotischen Störungen (Beeinträchtigung des psychischen Befindens) durch sexualisierte Gewalterlebnisse ab der frühesten Kindheit gefunden habe (Tschan, 2005). Aufgrund von Häufigkeitsüberlegungen widerruft Freud seine These bereits ein Jahr später – da Neurosen in der Gesellschaft häufig vorkamen, ließe dies nur die eine Schlussfolgerung zu, dass sexualisierte Delikte ebenso häufig vorkommen würden. Das konnte nicht sein (Fegert, 2022). Dabei blieb es dann für lange Zeit. Man konnte und wollte den Opfern keinen Glauben schenken, weil man sich das nicht vorstellen konnte, was die Betroffenen erzählten.
Weiter prägte das 1939 von Dansauer und Schellworth publizierte Büchlein Neurosefrage, Ursachenbegriff und Rechtsprechung für die folgenden 25 Jahre die Gutachtertätigkeit und Rechtsprechung in Deutschland in Zusammenhang mit Traumafolgestörungen, in erster Linie bei Holocaust-Betroffenen und KZ-Überlebenden. Die beiden Autoren waren der Auffassung, dass „es gar keine kausalen Beziehungen zwischen äußeren Ereignissen und psychischen Folgen geben [könne], da Ursache-Wirkungs-Verknüpfungen nur im räumlich-materiellen Bezugssystem denkbar seien“. Anders ausgedrückt hieße das, dass „eine psychische Traumatisierung gar nicht kausal für eine psychische Störung verantwortlich sein [könne] und niemand daher einem anderen einen psychischen Schaden zufügen [könne]“ (Vees, 2010, zitiert nach Tschan, 2019, S. 94). Ende der Diskussion. Es muss daher nicht weiter |12|überraschen, dass die Rezeption der 1980 geschaffenen Diagnostik bei Traumafolgestörungen innerhalb des Gesundheitswesens nur zögerlich erfolgte.
Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte 1991 die ICD-10 und übernahm damit die 1980 von der amerikanischen Psychiatrie geschaffene Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung und der multiplen Persönlichkeitsstörung, heute als Dissoziative Identitätsstörung bezeichnet. Das erste Lehrbuch in deutscher Sprache über die Psychotraumatologie erschien 1998 (Fischer & Riedesser, 1998). Die Widerstände innerhalb der europäischen Fachwelt waren zunächst erheblich – lange Zeit war die Rede von einer Modediagnose und ähnlichem Schmarren. Diese Widerstände mögen aus heutiger Sicht erstaunen, sie zeigen jedoch auch mit aller Deutlichkeit ein Versagen elementarster zwischenmenschlicher Anteilnahme – wohl nicht zuletzt mitbedingt durch ein Weiterbestehen von rassistischen und nazifreundlichen Ideologien in den Köpfen führender Mediziner, Wissenschaftler und Juristen im Nachkriegsdeutschland und in anderen Ländern Europas. In Analogie lässt sich über die gerichtliche Ahndung von Sexualdelikten heute feststellen, dass Richter*innen in zahlreichen Fällen den Opfern keinen Glauben schenkten – häufig unterstützt durch medizinische Expertisen, wo sich eine Haltung gegenüber den Opfern zeigte, die zynischer nicht sein könnte. Das Schweigen der Betroffenen wurde zum Beweis umgedeutet, dass sie die sexuellen Handlungen gesucht hätten – sonst hätten sie sich ja zur Wehr gesetzt. Täter*innen nutzen dies geschickt aus – nicht so selten sagten sie ihren Opfern ins Gesicht: „Erzähl dies ruhig der Polizei, es wird dir eh niemand glauben …“.
Weil die Aussage von Betroffenen häufig der einzige Beweis der Anklage darstellt, kommt der Glaubhaftigkeit der Opferaussage prozessrechtlich eine eminent wichtige Bedeutung zu – die Täteranwälte versuchen daher auf alle erdenkliche Art und Weise, diese Glaubhaftigkeit in Zweifel zu ziehen. Richter*innen müssen dann im „Zweifel für den Angeklagten“ entscheiden und Beschuldigte laufen lassen.
|13|Wieso dieses Buch?
Sexualisierte Gewalt ist ein weltweites Phänomen. Ohne Optimierung der Helferkette haben (potenzielle) Opfer keine Chance, dass sie geschützt werden oder dass die Täter*innen für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden – ohne Wissen um die Zusammenhänge sind die Fachleute ratlos und überfordert. In jeder Schulklasse befinden sich mehrere Opfer von sexualisierter Gewalt, in jeder Arztpraxis werden täglich mehrere Opfer mit erheblichen Traumafolgestörungen gesehen. Die Betroffenen selbst können vielfach keinen Zusammenhang zwischen den heutigen Beschwerden und den lange zurückliegenden Gewalterfahrungen herstellen. Viele Opfer schweigen jahrzehntelang und geben kaum etwas preis – die Aufdeckung von Gewalterfahrungen und deren Prävention stellt eine komplexe Aufgabe dar, die ohne das erforderliche Know-how zum Scheitern verurteilt ist. Sagen Opfer etwas, wird ihnen oft nicht geglaubt – man kann sich kaum in die Situation von Betroffenen versetzen und geht vielfach von falschen Mythen und Annahmen aus.
Eine Stationsleiterin eines Spitals nach einem Übergriff auf eine frisch operierte Patientin: „Die Frau war in ihren Aussagen so selbstbewusst und direkt. Sie hat auf mich nicht wie ein Opfer gewirkt, deshalb habe ich ihr kein Wort geglaubt“. Fachleute werden kaum über Folgen von sexualisierter Gewalt und den resultierenden Opferreaktionen geschult. Die Thematik wird gemieden – ein eklatantes Versagen der Verantwortlichen für die Gestaltung der Curricula und damit der mangelnden Kompetenzen in der späteren Berufstätigkeit.
Heute wird kein Patient mehr als unglaubwürdig oder Simulant dargestellt, der Schmerzen in den Zehen verspürt, obwohl ihm das betreffende Bein schon vor einiger Zeit amputiert werden musste. Das Phänomen ist als Phantomschmerz jeder Fachperson im Gesundheitswesen bekannt. Das lernt man in der Ausbildung. Nicht so mit Traumafolgestörungen, die es ja wohl schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte in großer Zahl auftraten. Wir hören von Unglücksfällen wie etwa die Katastrophe an der Flugshow in Ramstein Air Base vom 28. August 1988 oder dem Attentat in Nizza vom 14. Juli 2014. Offenbar weiß man wenig über die Langzeitfolgen von derartigen Ereignissen – dies zumindest der Eindruck nach der Lektüre eines Beitrages in der NZZ (Belz, 2022), wo die Studie „14-7“ vorgestellt und kommentiert wurde. Es handelt sich dabei um eine wissenschaftliche Untersuchung unter der Leitung von Florence Askenazy, die so lange fortgeführt werden soll, bis der jüngste Patient aus Nizza das 25. Lebensjahr erreicht hat (Gindt et al., 2019).
Ganz so unwissend sind wir nicht, wie uns hier die Zeitungsfrau weismachen will. Die bisher umfangreichste und zugleich aussagekräftigste Studie über Traumafolgestörungen und die Auswirkungen auf die Gesundheit wurde durch die ACE-|14|Studie (adverse childhood experience) vorgelegt – Details sind im Kapitel „Aktueller Überblick“ beschrieben. Die Forschungsergebnisse sind in Überlegungen zu Krankheitsursachen eingeflossen, die in einem epochalen Fachbeitrag diskutiert wurden (Yang et al., 2013). Damit wird klar, wieso sich alle Fachleute im Gesundheitswesen mit diesen Erkenntnissen auseinander zu setzen haben. Die Theorien und Konzepte aus der Medizin sollen anschließend für andere Bereiche nutzbar gemacht werden.
Man fragt sich natürlich, wie viele Menschen denn von sexualisierter Gewalt betroffen sind und wie man in diesem Bereich an verlässliche Zahlen kommt. Unter was leiden eigentlich Betroffene? Was soll man allgemein unter sexualisierter Gewalt verstehen? Was ist ein Trauma, und was ist keines? Wie viele Täter*innen gibt es? Aufgrund welcher Merkmale kann man diese erkennen? Wie zeigen sich Traumafolgestörungen? Was hilft gegen sexualisierte Gewalt? Das vorliegende Buch versucht, auf solche Fragen wissenschaftlich fundierte Antworten zu geben – und Mythen und Falschannahmen aufzuzeigen. Ziel ist dabei, die Kompetenz der Fachleute durch die Zurverfügungstellung des erforderlichen Wissens grundlegend zu verbessern und ein empathisches und einfühlsames Vorgehen gegenüber betroffenen Opfern sicher zu stellen. Das soll nicht überheblich klingen, sondern beruht auf meinen langjährigen Erfahrungen als Traumatherapeut und Dozent in unterschiedlichen Bereichen. Als ich einmal einen ca. 50-jährigen Mann, der sich zur Behandlung an mich gewandt hatte, gefragt habe, ob er eine Idee habe, wie viele betroffene Männer es von sexualisierter Gewalt gebe, war seine Antwort: „Viele können es nicht sein, sonst würde dies in den Medien stehen“. Der Mann war Manager in einem Großkonzern und wohl gut informiert: Nach dem Tod seines Vaters realisierte er, dass er wie auch seine vier Geschwister jahrelang sexualisierte Gewalt durch den Vater erlitten hatten. Er schämte sich und machte sich Vorwürfe – erst das im Laufe der Behandlung vermittelte Wissen um das Ausmaß von sexualisierter Gewalt und deren Auswirkungen auf viele Lebensbereiche half ihm entscheidend zur Überwindung der Folgen.
Noch schwieriger wird es, wenn Opfer von Organisierter Sexualisierter und Ritueller Gewalt Hilfe suchen – ihre oft bizarr und widersprüchlich anmutenden Schilderungen übersteigen unser Vorstellungsvermögen mit dem Resultat, dass man den Opfern beim besten Willen nicht glauben kann. Ohne das notwendige Wissen geht es nicht – aber das ist in anderen Bereichen des Gesundheitswesens nicht anders. Wenn die Kette der ärztlichen, pflegerischen und sozialarbeiterischen Tätigkeit nicht vernetzt und verzahnt wäre, würden Spitalbehandlungen in ein Desaster führen. Erst das sinnvolle Ineinandergreifen der einzelnen Schritte trägt zur Heilung bei – dass dies nicht ohne Schulung und gegenseitiges Bemühen geht, ist evident. Für die Genesung brauchen Betroffene Unterstützung, Rat und Hilfe. Um diese Aufgabe kompetent zu erfüllen, benötigen die Fachleute Konzepte und Theorien, in denen sie geschult werden müssen: „Die Aufgabe des Arztes besteht darin, die |15|somatischen, psychischen und sozialen Faktoren in ihren Zusammenhängen zu erfassen, zu gewichten und daraus Handlungsanweisungen für das ärztliche Tun abzuleiten“ (Adler, 2022, S. 9). Die Haltung und Einstellung der Fachperson ist dabei von zentraler Bedeutung: „Bedeutsam ist, dass die Auswahl der unendlichen vielen Gegebenheiten, die beobachtet werden können, vom inneren Zustand des Beobachters abhängt“ (Adler, 2022, S. 18). Weil der Zeitgeist sich wandelt und neuen Erkenntnissen folgt, ändern sich auch die medizinischen Diagnosen: „Diagnosen sind nicht ‚gegeben‘, existieren nicht einfach so, sondern sie entstammen Vorstellungen in uns, die auf einer Theorie der Medizin beruhen“ (Adler, 2022, S. 38). Es muss daher nicht weiter überraschen, dass sich die Diagnostik der Traumafolgestörungen wie kaum ein anderes Krankheitsbild über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich verändert hat. Als ehemaliges „Schmuddelthema“ ist heute das Wissen über sexualisierte Gewalt ein anderes als noch vor einer Generation.
Der Fokus dieses Buches liegt auf den Auswirkungen von sexualisierter Gewalt für das Gesundheitswesen, den sozial- und erziehungswissenschaftlichen Bereich sowie den Freizeit- und Sportbereich. Die familiären Entstehungsbedingungen von sexualisierter Gewalt werden nicht weiter ausgeführt und behandelt. Die Übergriffe im kirchlichen Bereich werden in diesem Buch ebenfalls nicht systematisch behandelt – da, wo kirchliche Institutionen als Träger von Einrichtungen im Gesundheitswesen fungieren, wird in den entsprechenden Textstellen auf mögliche Auswirkungen hingewiesen. Dies gilt ebenso für den erziehungswissenschaftlichen und den Freizeitbereich, in denen häufig kirchlich geprägte Organisationen involviert sind. Die Erkenntnisse über die letzten Jahre, angefangen beim Ryan Report in Irland, dem Canisius-Kolleg in Deutschland, dem Heimskandal in Österreich, der Arbeit der CIVIISE Kommission in Frankreich, dem Skandal über Verding- und Heimkinder in der Schweiz, den Verschickungskindern etc., begründen den gewählten Schwerpunkt des vorliegenden Buches.
|17|Aktueller Überblick
Die Häufigkeit von Gewalt- und Sexualdelikten ist unbekannt. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahrzehnte lassen das Ausmaß erahnen. Lara Stemple hat jedoch einen grundlegenden methodischen Fehler in der Datenerhebung festgestellt:
„We concluded that federal surveys detect a high prevalence of sexual victimization among men in many circumstances similar to the prevalence found among women. We identified factors that perpetuate misperceptions about men’s sexual victimization: reliance on traditional gender stereotypes, outdated and inconsistent definitions, and methodological sampling biases that excluded inmates“ (Stemple & Meyer, 2014, S. 19).
Zahlreiche Forschungsgruppen haben beim Thema Gewalterfahrungen jeweils nur Frauen befragt – so z. B. die Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte von 2014, basierend auf einer Befragung von 42 000 Frauen in der EU-28 (FRA, 2014). Demgemäß hat jede dritte Frau seit dem Alter von 15 Jahren sexualisierte und/oder körperliche Gewalt erlebt – hochgerechnet sind dies 62 000 000 Frauen. Männer hat man nicht nach ihren Erfahrungen befragt.
Präzise Daten über Gewalterfahrungen sind unabdingbar für Präventionskonzepte. Die in Europa erhobenen Daten bestätigen die Ergebnisse der ACE-Studie, der bisher umfangreichsten Untersuchung zu den Auswirkungen von Gewalterfahrungen auf die Gesundheit (Felitti et al., 1998). Lange Zeit wurden diese Erkenntnisse im Gesundheitswesen ignoriert und nicht zur Kenntnis genommen – da die Relevanz für die Diagnostik und Behandlung zunächst nicht erkannt wurde. Das hat sich inzwischen jedoch grundlegend geändert. Die ACE-Studie untersucht an über 17 000 Personen retrospektiv und prospektiv die Auswirkungen von negativen Erfahrungen in den ersten 18 Lebensjahren auf die Gesundheit und die Häufigkeit von Erkrankungen. Dies sind zunächst einmal bloß statistische Zusammenhänge, die noch nichts über die Kausalität und Pathophysiologie (Krankheitsentstehung) aussagen. Die Datenanalyse liefert der Fachwelt jedoch dermaßen überzeugende Daten, dass wohl von niemandem die Zusammenhänge ernsthaft in Zweifel gezogen werden können. Bei Menschen mit einem ACE-Score von sechs zeigt sich gegenüber denjenigen mit Null in der prospektiven Datenauswertung eine Verkürzung der Lebenserwartung um fast 20 Jahre.
Die Idee zur Durchführung dieser Studie geht auf die Erfahrungen mit Gewichtsreduktionsprogrammen zurück. Im Jahre 1985 war der Internist Vincent Felitti Direktor von Kaiser Permanente’s Departement of Preventive Medicine in San Diego, welches damals eines der umfangreichsten Screening-Programme durch|18|führte. Eine 28-jährige Krankenschwester meldete sich bei ihm für ein Gewichtsreduktionsprogramm an. Im Laufe der folgenden 51 Wochen konnte sie ihr Gewicht von 185 kg auf 60 kg reduzieren. Als Felitti sie einige Monate später wieder sah, hatte sie mehr Kilos als je zuvor. Was war geschehen? Ein Mitarbeiter an ihrem Arbeitsort hatte mit ihr zu flirten begonnen und wollte mit ihr eine intime Beziehung aufnehmen – sie ging nach Hause und begann zu essen. Im Laufe der weiteren Examination legte sie sexuelle Übergriffe durch ihren Großvater offen. Felitti realisierte rasch, dass sie nicht die einzige war, welche Probleme hatte. Fünf Jahre später präsentierte er erstmals seine Daten vor der North American Association for the Study of Obesity. Die medizinischen Experten wiesen seine Schlussfolgerung weit von sich: Wieso Felitti diesen Frauen Glauben schenken würde? Nichts sei bewiesen – diese Frauen würden solche Geschichten als Ausflüchte für ihre Misserfolge erfinden und dergleichen mehr. Einzig ein Epidemiologe vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) ermunterte ihn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und eine größere Studie durchzuführen und bot eine Kollaboration mit dem CDC an. Daraus entstand die ACE Studie in Kollaboration zwischen Kaiser und CDC mit Robert Anda und Vincent Felitti als den beiden führenden Köpfen.
Bei Kaiser werden jährlich über 50 000 Patienten für medizinische Screeninguntersuchungen gesehen. Die geplante Studie sollte 25 000 konsekutive Patienten umfassen – 17 421 waren schließlich bereit, mitzumachen. Rund 80 % waren weiße US-Bürger, 10 % dunkelhäutige Teilnehmer*innen und 10 % Asiaten. 74 % waren College Absolventen (hierzulande: Abiturabschluss), das Durchschnittsalter liegt bei 57 Jahren. Die Teilnehmenden entstammen der Mittelklasse der siebtgrößten US-Stadt San Diego in California. Es wurden zehn negative Kindheitserlebnisse definiert, welche sich empirisch aus der Übergewichtsstudie herauskristallisiert hatten. Ein Score wurde für jedes dieser Ereignisse vergeben, unabhängig von Dauer und Schweregrad. Der maximal erreichbare Wert beträgt somit zehn, der minimale null; d. h. es liegt im letzteren Fall kein negatives Ereignis in der eigenen Biografie bis zum Lebensalter von 18 Jahren vor.
Die einzelnen Ereignisse für den ACE-Score (Prävalenzen/Häufigkeiten in Klammern):
Emotionale Übergriffe, wiederholte Drohungen, Demütigungen (11 %)
Körperliche Gewalt (ohne elterliche Züchtigungen) (28 %)
Sexualisierte Gewalterlebnisse (Frauen 28 %, Männer 16 %, total 22 %)
Mutter häuslicher Gewalt ausgesetzt (13 %)
Alkohol- oder Drogenkonsum im Haushalt (27 %)
Familienmitglied mit Gefängnisstrafe (6 %)
Familienmitglied hatte ernsthafte psychiatrische Erkrankung, litt an Depressionen und/oder Suizidalität, oder musste psychiatrisch hospitalisiert werden (17 %)
|19|Nicht durch beide biologischen Eltern erzogen (23 %)
Körperliche Vernachlässigung (10 %)
Emotionale Vernachlässigung (15 %.).
Nur ein Drittel der Teilnehmenden wiesen einen ACE-Score von Null auf, d. h. sie hatten keines dieser negativen Erlebnisse in ihrer Biografie vorzuweisen. Die Verteilung der ACE zeigte ein clusterartiges Muster; lag ein ACE-Score vor, so fand sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 % ein zweites Ereignis. Rund 15 % der Teilnehmenden wiesen einen ACE-Score von vier oder höher auf.
Diese Daten bedeuten, dass jeder Arzt oder Ärztin in der Praxis täglich mehrere Patient*innen mit hohem ACE-Score sieht. Die Auswertung zeigt über alle untersuchten Zusammenhänge hinweg einen eindeutigen Zusammenhang zwischen ACE-Score und gesundheitlichen Folgen.
Die Daten der Teilnehmenden an der Studie wurden anschließend mit den umfangreichen medizinischen Daten von Kaiser abgeglichen. 28 % der Frauen und 16 % der Männer gaben an, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt hatten. Die Teilnehmenden waren mittelständische Personen, die sich eine Krankenversicherung leisten konnten. Felitti und sein Team fanden heraus, dass sich die Folgen erstmals in der Schule manifestieren: Über die Hälfte aller Teilnehmenden mit einem Score von vier und höher hatten Lernschwierigkeiten oder Verhaltensprobleme, verglichen mit 3 % aus derjenigen Gruppe mit Score 0.
In der Gruppe mit Score 4 und höher litten zwei Drittel aller Studienteilnehmenden an Depression, verglichen mit 12 % in der Gruppe mit Score 0; analog verhält es sich mit Psychopharmaka und Schmerzmedikamenten. Felitti hat darauf hingewiesen, dass wir heute Probleme behandeln, die ihren Ursprung vor 50 Jahren haben. Personen mit einem Score von vier und mehr haben ein siebenfach gesteigertes Risiko, an Alkoholabhängigkeit zu erkranken, verglichen mit denjenigen von Score 0. Die Wahrscheinlichkeit für Suizidversuche ist in der Gruppe mit Score 6 um einen Faktor 5000-mal höher als in der Gruppe mit Score 0. In der Gruppe mit Score 0 lag die Häufigkeit für eine Vergewaltigung im erwachsenen Alter bei 5 %; hingegen bei einem Score von vier und mehr waren 33 % betroffen.
Robert Anda hat die Auswirkungen von sexualisierter Gewalt (CSA, child sexual abuse