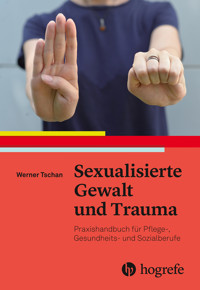Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Traumatische Erfahrungen hinterlassen Spuren - der Einzelne ist in der Bewältigung überfordert und reagiert mit einer Dissoziation auf die schlimme Erfahrung. Analog reagiert die Gesellschaft. Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation (Zusammenführen), indem einzelne Erfahrungen von der Auseinandersetzung "fern" gehalten werden. Damit ist ein überleben und Funktionieren im Alltag sichergestellt. Das Buch zeigt im Überblick den heutigen Stand des Wissens über Traumafolgestörungen, und wie sie behandelt werden können. Ein Trauma kann sichtbar oder unsichtbar sein, einzelne Ereignisse müssen von Mehrfach-Traumatisierungen unterschieden werden. Je jünger betroffene Personen sind, und je schwerer die Traumatisierung, desto gravierender die Folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warnung: Triggermechanismen
Die Ausführungen in diesem Werk können als Triggermechanismen wirken und bei Gewaltbetroffenen seelische Reaktionen auslösen. Betroffene sollen sich für entsprechende Hilfe an erfahrene Fachleute wenden.
Bei der Verfassung und Zusammenstellung der Texte in diesem Werk wurde mit grösster Sorgfalt vorgegangen; trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Haftungsausschluss
Sämtliche Äusserungen in diesem Werk erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung für möglicherweise unzutreffende Angaben tatsächlicher oder rechtlicher Art. Das vorliegende Werk kann nicht für rechtsverbindliche Auskünfte und Ratschläge verwendet werden; es kann auch keine persönliche Beratung ersetzen. Wenn Sie konkrete Anliegen in Zusammenhang mit der Thematik haben, wenden Sie sich bitte an erfahrene Fachleute.
Der Verfasser hat keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung von Links, welche in diesem Werk angeführt werden. Werner Tschan übernimmt deshalb keine Haftung für die Inhalte externer Links, für die ausschliesslich die jeweiligen Betreiber verantwortlich sind.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Empfohlene Literatur
Ein Beispiel zur Einleitung
Kompetenz im Beruf
Was ist ein Trauma?
Was ist eine Dissoziation?
Was lösen Opfer aus?
Wieso wird Opfern nicht geglaubt?
Opfer-Täter-Interaktion
Neurowissenschaftliche Zusammenhänge
Diagnostik
CTQ (Childhood Trauma Questionnaire)
Kontinuum der Diagnostik
Komorbiditäten
Traumafolgestörung: Neuformulierung der Diagnostik
Differentialdiagnostik
Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf die Gesundheit
ACE-Studie
Geschichte der Neurowissenschaften
Neurobiologie
Geschichte des Traumabegriffs in der Psychiatrie
Geschichtlicher Abriss zu Dissoziation
Kriegszitterer
Trauma und Dissoziation
Bindungstheorie
Abwehrhaltung von Fachleuten
Sekundäre Traumatisierungen von Fachleuten
Genetik und Epigenetik
Epigenetische Regulation
Geschlecht und Verhalten
Bindungsforschung
Entwicklungsstadien des Gehirns
Neurosequentielle Methode
Entwicklungspsychologie
Mind
Affektregulierung
Veränderungen im Gehirn unter Traumatisierung
Kleinkinder
Erwachsene
Alte Menschen
Trauma und Entwicklung der Persönlichkeit
Veränderungen im Gehirn unter Traumatisierung
Zustandsabhängige Erinnerungen
Gedächtnis
Grundlagen von Lernen und Gedächtnis
Neuroplastizität
Neurozeption
Mentalisierung
Verbalisierung
Dissoziative Phänomene
Triggerphänomene
Schutzfunktion
Recovered Memories (wiedergefundene Erinnerungen)
Unterschiedliche körperliche Zustände je nach Teil-Identität
Spektrum von dissoziativen Phänomenen
Missverständnisse
Körpererinnerungen versus kognitive Erinnerungen
Sensorimotorische Psychotherapie
Neuropsychoimmunologie
Trauma Model Therapy
Die Bindung an den Täter
Scham
Schuldgefühle
Therapieverlauf
Einmalige und kumulative/sequentielle Traumata
Medikation
Berücksichtigung der dissoziativen Zustände
Berücksichtigung der Komorbiditäten
Spiegelneurone
Mit der Hand sehen
Die Erfassung des uns umgebenden Raumes
Das Mitempfinden von Emotionen
Window of Tolerance
Erhöhte Grundspannung
Tiere in der Trauma-Behandlung
Transfer der Erkenntnisse für die Psychotherapie
Heilungsprozess
Berücksichtigung der neurobiologischen Forschung
Auftragsklärung
Informed Consent
Fachliches Fehlverhalten bei Traumafolgestörungen
DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie)
Hypnotherapeutische Interventionen
Behandlung von Traumafolgestörungen im Überblick
Nebenwirkungen von therapeutischen Interventionen
Behandlung von Flüchtlingen
Zukünftige Entwicklungen
Zum Schluss
Glossar
Literatur
Der Autor: Dr. med. Werner Tschan MAE
Danksagung
Ich danke meinen Patienten, welche sich vertrauensvoll mit ihren Anliegen an mich gewandt haben und die mir mitgeholfen haben, den vorliegenden Text über Traumafolgestörungen zu verfassen. Danken möchte ich auch den Fachkolleginnen und –kollegen, die mir ihren Forschungen und ihren Beiträgen mitgeholfen haben, Traumafolgen besser zu verstehen. Ein besonderer Dank gilt meiner Ehefrau Melanie Kast Tschan, die neben Medizin auch Philosophie studiert hatte – und die mich Dank ihren Kenntnissen und Erfahrungen stets unterstützt hat. Sie hat in der Entstehung dieses Werkes Wesentliches beigesteuert und hat durch ihre Sicht als Frau auch mitgeholfen, einen allfälligen Genderbias zu überwinden.
Ein besonderer Dank gilt unserer Hündin, welche die therapeutischen Prozesse in unserer Praxis grundlegend verändert hat. Immer wird sie durch Patientinnen und Patienten als erste begrüsst, und falls sie nicht anwesend ist, kommen besorgte Fragen. Ihre blosse Anwesenheit im Praxisraum vermittelt für viele Traumabetroffene „Sicherheit“.
Danken möchte ich auch denjenigen Patientinnen und Patienten für ihre Bereitschaft, Teile ihrer Geschichten als Beispiel hier verwenden zu dürfen. Ihre Biografien sind auf eine Art und Weise verändert, dass ein Rückschluss auf bestimmte Personen ausgeschlossen ist – der Kerngehalt der Aussagen in Bezug auf die Traumafolgen ist hingegen tatsachengemäss wiedergegeben.
Empfohlene Literatur
Jede Empfehlung ist subjektiv. Die nachfolgend aufgeführten Autoren und deren Bücher waren für mich eine grosse Hilfe für de Entwicklung des vorliegenden Werkes. Judith Herman hat als eine der ersten Fachfrauen nach der revolutionären Wende von 1980, die mit der Schaffung der PTSD und DID Diagnose eingeleitet wurde, die „Sutren, die Bibel, der Koran oder den Talmud der Psychotraumatologie“ geschrieben. Das wäre das erste Buch, welches ich lesen würde; das zweite wäre das neuste Buch von Daniel Siegel und das dritte das Monumentalwerk von Henry Ellenberger über die historische Entwicklung der wissenschaftlichen Konzeption der Traumafolgestörungen.
Siegel Daniel J.: The developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience. New York, Guilford, 1999.
Siegel Daniel J.: The developing Mind. How relationships and the brain interact to shape who we are. New York, Guilford, 2012.
Ellenberger Henry: Die Entdeckung des Unbewussten. Zürich, Diogenes, 1980.
Herman Judith: Trauma and Recovery. New York, Basic Books, 1998. Dt.: Die Narben der Gewalt. Paderborn, Junfermann, 2003.
Kluft Richard P.: Shelter from the Storm. Processing the Traumatic Memories of DID/ DDNOS Patients with The Fractionated Abreaction Technique. North Charlston, Create Space Independent Publishing Platform, 2013.
Panksepp Jaak: Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions. New York, Oxford University Press, 1998.
Damasio Antonio: The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of the Cultural Mind. New York, Pantheon, 2018.
Seung Sebastian: How the Brain’s Wiring Makes Us Who We Are. Wilmington MA, Mariner, 2013.
Cozolino Louis: Why Therapy Works: using our minds to change our brains. New York, W.W. Norton, 2016.
Cozolino Louis: Neuroscience of Psychotherapy. Building and Rebuilding the Human Brain. New York, W.W. Norton, 2017.
Van Derbur Marilyn: Tagkind – Nachtkind. Das Trauma sexueller Gewalt. Überlebenswege, Heiungsgeschichte, Hilfen zur Prävention. Kröning, Asanger, 2013.
Gallese Vittorio: The Birth of Intersubjectivity: Psychodynamics, Neurobiology and the Self. New York, W.W. Norton, 2014.
Porges Stephen: Die Polyvagaltheorie und die Suche nach Sicherheit: Traumabehandlung, soziales Engagement und Bindung. Lichtenau, G.P. Probst, 2018.
Onno Van der Hart, Ellert R.S. Nijenhuis und Kathy Steel: Das verfolgte Selbst: Strukturelle Dissoziation. Die Behandlung chronischer Traumatisierung. Paderborn, Junfermann, 2008.
Ein Beispiel zur Einleitung
Eine 26 jährige Frau sieht sich plötzlich von Feuerwehrleuten und Polizei umringt, auf dem Dach eines mehrgeschossigen Gebäudes. Die Frau weiss nicht, wie sie auf den 9. Stock der Klinik gekommen ist. Es fragt sie auch niemand danach. Die Rettungsleute wie auch das Klinikpersonal gehen davon aus, dass die junge Frau sich das Leben nehmen wollte.
Der Frau wurde durch das Klinikpersonal in der Folge vorgeworfen, sie sei nicht kooperativ und verhalte sich destruktiv. Sie bekam täglich 200mg Diazepan (Valium ®) und 30mg Alprazolam (Xanax ®). Wenn sie einen Anlauf nahm, etwas über ihre traumatischen Erfahrungen mitzuteilen, wurde sie jeweils von Ärztinnen oder Ärzten mit dem Hinweis unterbrochen, es gehe jetzt um die Suizidalität und nicht um die alten Sachen. Ziel sei, dass sie wieder stabilier sei, dann könne sie die Klinik wieder verlassen …
Weder Ärzte noch Pflegepersonal realisierte die dissoziativen Symptome. Die Patientin selbst fürchtete sich vor diesen für sie unerklärlichen Filmrissen – die sie so nicht zum ersten Mal erlebte. Sie wusste nicht, was mit ihr los war. Es war ihr einfach alles zuviel. Dass diese Phänome Ausdruck einer dissoziativen Störung sind, erfuhr sie erst viele Jahre später im Rahmen einer traumafokussierten Behandlung. Sie konnte dann auch beschreiben, dass diese Symptome in der Vergangenheit auftraten, wenn sie unter Spannung stand und nicht weiter wusste. Immer habe es geheissen, sie habe die ganze Familie zerstört. So der Vater, der sie jahrelang vergewaltigt hatte …
Dabei hatte sie immer auf eine “normale Familie” gehofft, wo man es gut miteinander hat – so wie sie dies bei anderen gesehen hatte, wo man zusammen lachen konnte, fröhlich war, und Spiele zusammen spielen konnte.
Die psychiatrischen Klinken waren zunächst ein Schutz für sie. Hier konnte ihr zumindest der Vater nichts anhaben. Als sie jedoch durch Ärzte und Pflegepersonal immer öfters zurecht gewiesen wurde (sie solle sich jetzt endlich zusammen nehmen, sie solle nicht immer mit den alten Sachen anfangen, damit würde sie sich nur selber schaden, etc.) reagierte sie zunehmend verunsichert. Und als sie schliesslich in der Klinik durch einen Mitpatienten vergewaltigt wurde, hielt es auch da nicht mehr aus – nun gab es keinen sicheren Ort mehr für sie, weder in ihrer Familie, noch in der psychiatrischen Klinik, noch sonst wo.
Diese Beispiel zeigt unmissverständlich die Notwendigkeit einer systemischen Sichtweise zum Verständnis der Traumafolgestörungen auf – ohne die sozialen Dimensionen werden die individuellen Auswirkungen nicht verstanden. Der Rechtsstaat soll Menschen vor Gewalt schützen – das Versagen ist mit Händen zu greifen und verdeutlicht den schmerzvollen Leidensweg dieser jungen Frau. Die Staatliche Rentenversicherung (in der Schweiz: Invalidenversicherung genannt) gewährte ihr schliesslich wegen anhaltender Erwerbsunfähigkeit eine volle Erwerbsausfallsrente – deren reale Höhe auf Grund der fehlenden Berufsausbildung (einer weiteren Folge der durchgemachten Gewalterfahrungen) auf das gesetzliche Minimum beschränkt wurde – womit sie systembedingt erneut “bestraft” wurde. Eine Intervention beim zuständigen Ministerium (in der Schweiz: Bundesrat) wurde abschlägig beantwortet: man könne bei der Rentenbemessung nicht auf die individuellen Gegebenheiten abstellen, der Gesetzgeber habe für alle geltende Massstäbe geschaffen. Ende der Diskussion.
Trauma: Diagnostik und Behandlung der Traumafolgestörungen – eine aktuelle Übersicht
Kompetenz im Beruf
„Wirksame therapeutische Arbeit ist nur möglich, wenn der Klient sich in der Therapiesituation sicher fühlt“ (Porges 2017, S. 190). Traumatherapeuten müssen über ein spezifisches Wissen, spezifische Fertigkeiten und eine bestimmte Haltung verfügen – alles vereint wird dies mit dem Begriff der Kompetenz charakterisiert.
Mit Kompetenz wird im Allgemeinen die Befähigung zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit auf einer bestimmten Stufe umschrieben. Die Bewältigung von Gewalterfahrungen setzt eine optimale Helferkette voraus – erst das Zusammenwirken aller involvierten Fachleute hilft Betroffenen, ihre durchgemachten Erfahrungen überwinden zu können. Vergessen können sie die traumatischen Ereignisse ohnehin nicht, und ungeschehen machen kann sie auch niemand. Die Hilfe wird über unerschiedliche Fachdisziplinen vermittelt – es ist deshalb erforderlich, die Kompetenzen der involvierten Fachleute in einer integrierenden Sichtweise darzustellen.
Zunehmend wird heute gefordert, dass die Abschlüsse der Berufsbildung international vergleichbar sein sollen. Die EU hat im Jahre 2000 mit der Lissabon-Strategie ein Vorgehen festgelegt, welches durch den Kopenhagen-Prozess (2002) weiter konkretisiert wurde. Im Hochschulbereich hat die Bologna-Reform eine Vereinheitlichung der Studiengänge zum Ziel gehabt – der Kopenhagen-Prozess unterstützt hingegen die Vielfältigkeit der Berufsbildungssysteme aller Länder.
Für die universitäre Bildung hat sich die ECTS (European Credit Transfer System) Bewertung etabliert. Ein Kreditpunkt entspricht einem zeitlichen Arbeitsaufwand des Studierenden von 25-30 Stunden. Ein im Vollzeitstudium absolviertes Studienjahr umfasst 1500-1800 Stunden (60 Kredit– Punkte). Der Workload umfasst den gesamten Zeitaufwand für die Erreichung der Lernergebnisse (Learning Outcomes), d.h. inkl. Vor-/Nachbereitung, Selbststudium und Leistungsnachweisen). Nach Möglichkeit werden Leistungsüberprüfungen auf Modulebene durchgeführt.
Als Beispiel einer derartigen Kompetenzumschreibung sei auf Art. 5 des Schweizer Bundesgesetzes über die Psychologieberufe vom 18. März 2011 (in Kraft seit 1. April 2013) verwiesen, wonach Fachkräfte die in der Hochschulausbildung erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen so erweitern und vertiefen, dass die Absolventinnen und Absolventen in den entsprechenden Fachgebieten der Psychologie eigenverantwortlich tätig werden können. Derartige und ähnliche Formulierungen finden sich inzwischen für die unterschiedlichen Berufsdiziplinen, welche in die Bewältigung von Traumafolgestörungen involviert sind (Retkowski 2018). Dabei müssen die Kompetenzen der Polizeieinsatzkräfte, der Pflegefachleute, der Juristen wie auch der therapeutischen tätigen Fachleute als Teil der Helferkette aus einer interdisziplinären Sichtweise formuliert werden.
„Die Essenz der Psychotherapie ist der Therapeut“ (Rufer 2012, p. 49). Die therapeutische Kompetenz wie auch die Auseinandersetzung mit eigenen Schwächen und Stärken wird damit zum entscheidenden Faktor von gelingender diagnostischer und therapeutischer Intervention. Darüber hinaus erfordert eine traumasensitive Arbeit neben der Bereitschaft zu einem systemischen Denken (Siegel 2010) umfassende Kenntnisse über Traumafolgen, den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und den Willen, Betroffenen in der Bewältigung ihrer Erfahrungen zu helfen. Menschen mit schweren Traumafolgestörungen haben unzählige Grenzverletzungen sowie Erfahrungen mit Fremdbestimmung und Kontrolle über sich erlebt. Es ist deshalb entscheidend, Überlebenden im therapeutischen Prozess ein hohes Mass an Selbstbestimmung zuzugestehen (Erpenbeck 2017). Menschen mit Traumafolgestörungen können bei Traumatherapeutinnen und – therapeuten zu grossen Belastungen führen – dies muss als Berufsrisiko anerkannt werden. Als Trauma-Therapeutin resp. -Therapeut muss man die Bereitschaft zu flexiblen Lösungsansätzen mitbringen, wie auch die Bereitschaft, auf die unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse einzugehen. Um die erforderliche Sicherheit innerhalb des therapeutischen Prozesses zu schaffen, hat Stephen Porges den Begriff der Präsenz vorgeschlagen. Diese zeigt sich in verschiedenen Dimensionen – das wesentliche ist dabei die Bereitschaft, Betroffene in ihrem Heilungsprozess zu begleiten und zu unterstützen. Dies ist ein entscheidender Unterschied in der gutachterlichen Diagnostik von Traumafolgestörungen – wo Gutachter einen Klienten vergleichsweise kurz sehen, erlaubt die Behandlung einen prozesshaften Einblick in die Entstehungsbedingungen der jeweiligen Traumafolgestörung, zusätzlich verstärkt durch die therapeutische Präsenz. „Um zu therapeutischer Präsenz fähig zu sein, muss der Therapeut zunächst geerdet, zentriert, stabil und aussderdem offen und empfänglich für das gesamte Erleben des Klienten sein“ (Porges 2017, S. 193).
Die Fachkompetenz umfasst:
Beziehungskompetenz (angemessene Nähe und Distanz, Klärung der eigenen Rolle, Eingehenkönnen auf stark beziehungstraumatisierte Menschen)
Präsenz
Verbindlichkeit
Berufserfahrung
Methodenkompetenz (Diagnostik, Einsatz therapeutischer Interventionsstrategien, Therapieplanung, Formulierung von Zielsetzungen, Umsetzung)
Fundierte Kenntnisse über die Epidemiologie von Traumafolgestörungen
Kenntnisse über Täterstrategien
Beratungskompetenz
Kenntnisse über Bedrohungsmanagement und Sicherheitsfragen
Faktenwissen über die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen inkl. den individuellen Anpassungsleistungen (welche die Symptomatik häufig verschleiern)
Handlungswissen über therapeutische Techniken zur Stabilisierung von Betroffenen
Bereitschaft zum Einsatz von grenzachtenden Berührungen in der Therapie
Motivationsfähigkeit
Fähigkeit als Rollenmodell für Patienten zu wirken
Taktgefühl
Konfliktfähigkeit
Scham- und Affekttoleranz
Bereitschaft, von der Patientin resp. dem Patienten zu lernen
Frustrationstoleranz
Fähigkeit, Infragestellung auszuhalten und sich testen zu lassen
Fähigkeit, Praxis und Theorie in Einklang zu bringen
Kollegiale Zusammenarbeit
Kontext- und Systemkompetenz
Weitere Kompetenzen:
Fähigkeit zur Selbstorganisation (Mentale Fähigkeiten, Zeitmanagement)
Speditive und zielorientierte Arbeitsweise
Belastbarkeit
Gelassenheit und psychische Stabilität
Rollenklärung und Abgrenzung (die fachliche Beziehung ist keine private Beziehung)
Authentizität (Konsitenz der eigenen Haltung)
Nähe und Distanzfähigkeit (klare Grenzen!)
Reflexionsfähigkeit (aus Erfahrungen lernen)
Fähigkeit, positiv zu denken und Positives zu vermitteln
Fähigkeit, zu ermutigen ohne zu schönen
Fähigkeit, für eigene Integrität zu sorgen
Selbstpflege, um leistungsfähig zu bleiben
Stephen Porges hat unter Berücksichtigung der Therapeiwirkungsforschung darauf hingewiesen, dass für die Behandlung von Traumafolgestörungen die therapeutische Beziehung im Hinblick auf gewünschte Veränderungen von zentraler Bedeutung ist, und dass konkrete Resultate therapeutischer
Arbeit nur in geringem Masse bestimmten Teckniken zuzuschreiben sind (Porges 2017, S. 190).
Teilnehmer sollen nach Besuch von Aus- und Fortbildungen über Diagnostik und Behandlung von Traumafolgestörungen über folgende Kompetenzen verfügen:
Kenntnisse
Theoretisches Verständnis über Traumatisierungen
Vertiefte Kenntnisse über Dissoziationen
Kenntisse über Diagnostik bei Traumafolgestörungen
Verständnis über die altersentsprechenden Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf die Entwicklung der Persönlichkeit und die damit verbunden Langzeitfolgen
Verständnis über die gesundheitlichen Auswirkungen traumatischer Erfahrungen und die neurowissenschaftlichen Erklärungsansätze
Kenntisse über die somatischen Folgen nach traumatischen Erfahrungen
Kenntnisse über Komorbiditäten
Kenntnisse über die pharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten
Kenntisse über die Entwicklungsgeschichte der Neurobiologie von Traumafolgestörungen
Den gesellschaftliche Kontext (Soziologie) von Traumafolgestörungen berücksichtigen können.
Transformation der wissenschaftlichen Erkenntisse für die traumasensitive Behandlung
Fertigkeiten
Umfassende Diagnostik und Differentialdiagnostik von Traumafolgestörungen
Schulenübergreifende Interventionskonzepte bei Traumafolgestörungen kennen und anwenden können
Anwendung der neurobiologischen Erkenntisse auf therapeutische Interventionen bei Traumafolgestörungen
Gestaltung und Durchführung von traumasensitiven Behandlungen Haltungen
Reflexion über die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf Therapeuten
Beachtung von Grenzen
Klare Reaktionsweisen bei Fehlverhalten von Fachleuten
Ein weiteres Beispiel zur Verdeutlichung von Kompetenzen in Zusammenhang mit der Diagnostik und Behandlung von Traumafolgestörungen findet sich im deutschen HRG - gemäss §7 des HRG (Hochschulrahmengesetz, 1976 mit Änderungen) wird als Ziel der Ausbildung gefordert: „Lehre und Studium sollen den Studenten auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihm die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang entsprechend so vermitteln, dass er zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigt wird“.
Kompetenz könnte man auch mit Problemlösefähigkeiten umschreiben. Erfahrung kann nicht durch Ausbildung vermittelt werden – das müssen sich Fachleute in ihrer praktischen Tätigkeit und Lebenswirklichkeit selber aneignen – im Mittel geht man davon aus, dass es 10 Jahre in einem Berufsfeld dauert, bis man über die notwendige Erfahrung verfügt. Kompetenz wird durch Heinz Bachmann (2011, p.19) wie folgt verstanden:
Kompetenz, H. Bachmann 2011
Für die Dozenten-Kompetenz bedeutet die Stoffvermittlung im Bereich von Traumafolgestörungen zunächst die Anforderung: „ ... als Lehrende(r) die Fähigkeit zu besitzen, die Fachinhalte ... nicht allein entlang der Logik des Erkenntnisgebäudes der Wissenschafts-disziplin auszuwählen, sondern aus der beruflichen Praxis abgeleitete Auswahlkriterien entwickeln zu können, um die für ein berufliches Tätigkeitsfeld erforderlichen fachlichen Kenntnisse zu vermitteln“ (Webler 2004, p. 12). Dies setzt fundierte und schulenüber-greifende Kenntnisse über Psychotherapie voraus, sowie Erwachsenenbildner-Kompetenz und Know-How über Traumafolgestörungen. „Um hier entscheidungssicher zu sein, muss dieses berufliche Tätigkeitsfeld den Dozenten ausreichend vertraut sein – ein verbreiteter struktureller Mangel, denn viele Dozenten an Universitäten verfügen nur über drei Erfahrungsräume – die Schüler-, Studierenden- und Lehrendenperspektive, sollen aber für akademische Berufe ausserhalb der Hochschulen ausbilden“ (Webler 2004, p. 12).
Die Traumatherapeutin resp. der Traumatherapeut ist für seine Patienten stets auch ein Rollenmodell für den Umgang mit den traumatischen Erfahrungen. Sie oder er muss daher ihre/seine Haltungen vor diesem Hintergrund reflektieren. Das heisst mit anderen Worten, dass ein Dozierender im Bereich Traumafolgestörungen sorgfältig auf die Menschenwürde, Autonomie und Gerechtigkeit zu achten hat und dass er nicht in einem autoritären Stil sein Wissen doziert, sondern in einem partizipativen, wo auch andere
Meinungen Geltung haben können. Die Lernenden haben ihre Kompetenzen, wie sie auch die Patientinnen und Patienten in der Psychotherapie haben. Dem ist in didaktischer und methodischer Hinsicht Rechnung zu tragen – der Dozent steht nicht wie ein General vor seiner Armee, die er zu befehligen hat, vielmehr sollen die Lernenden ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen können. Damit wird die Aus- und Fortbildung selbst zu einem Modell, wie eine traumasensitive Therapie zu praktizieren ist.
„Verantwortliches Handeln kann nur im Zusammenwirken von Theorie und Praxis, durch Aufklärung und Aufmerksamkeit dieser Verantwortungsdimension gegenüber in Lehrveranstaltungen und durch praktische Erprobung erlernt werden“ (Webler 2004, p. 14). Mit diesem anspruchsvollen Ziel vor Augen habe ich diesen aktuellen Überblick über die Diagnostik und Behandlung von Traumafolgestörungen verfasst. Die Dinge sind in stetem Fluss – Diagnostik und Behandlung von Traumafolgestörungen werden seit ihrer erstmaligen Formulierung seit 1980 laufend verändert. Die geplante Neuaufflage der ICD-11 wird wiedum Neuerungen bringen – es wird u.a. ein Begriff für komplexe Traumafolgestörungen geschaffen. Facheute müssen ihr Wissen stets up to date halten - das vorliegende Werk beruht auf dem derzeitigen Stand des Wissen.
Literatur:
Bachmann Heinz: Hochschullehre neu definiert – shift from teaching to learning. In: Heinz Bachmann (Hrsg.): Kompetenzorientierte Hochschullehre. Die Notwendigkeit von Kohärenz zwischen Lernzielen, Prüfungsformen und Lehr-Lern-Methoden. Bern, hep Verlag, 2011; 12-28.
Erpenbeck Mechtild: Wirksam werden im Kontakt. Die systemische Haltung im Coaching. Heidelberg, Carl-Auer, 2017.
Porges Stephen W.: Die Polyvagaltheorie und die Suche nach Sicherheit. Traumabehandlung, soziales Engagement und Bindung. Lichtenau, G.P. Probst, 2017.
Rufer Martin: Erfasse komplex, handle einfach. Systemische Psychotherapie als Praxis der Selbstorganisation – ein Lernbuch. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2012.
Webler Wolff-Dietrich: Lehrkompetenz – über eine komplexe Kombination aus Wissen, Ethik, Handlungsfähigkeit und Praxisentwicklung. Bielefeld, UVW, 2004.
1 Was ist ein Trauma?
„Dissociation is the essence of trauma“ (Bessel van der Kolk 2014, p. 66).
Analog wie sich die Gesellschaft vor der Auseinandersetzung mit Gewalt und ihren Folgen durch Dissoziation schützt, versuchen auch einzelne Individuen sich durch Dissoziation zu schützen. Dissoziation bedeutet Abspaltung, Nicht-Wahrhaben-Wollen, nicht zur Kenntnis nehmen müssen – Trauma heisst Wunde. Wunden schmerzen. Der Volksmund sprach bei traumatisierten Personen immer schon von gebrochenen Menschen – es handelt sich bei den Überlebenden um Betroffene von existentiell bedrohenden Erfahrungen. Traumatische Erfahrungen zeichnen Menschen und hinterlassen Spuren – sowohl im Körper als auch in der Psyche. Instinktiv versucht man sich zu schützen, versucht den Erinnerungen und der Auseinandersetzung auszuweichen. Die häufig anzutreffende Formulierung von Tabuisie-rung des Sachverhaltens greift zu kurz – Dissoziation beruht auf einem evolutions-biologisch abgestützen Schutzmechanismus des einzelnen Individuums, aber auch eine kollektive Reaktion der ganzen Gesellschaft.
Der Mensch ist unteilbar, wenn es um die Bewältigung schrecklicher Ereignisse geht – die traditionelle Aufteilung in Körper und Psyche ist irreführend, da schon ein einfaches Erschrecken bekanntlich stets Körper und Seele trifft. Menschen besitzen eine erstaunliche Fähigkeit in der Bewältigung schrecklicher und traumatischer Erlebnisse – sonst hätte die Menschheit als Spezies wohl kaum überlebt. Es macht deshalb Sinn, die Grundlagen von Traumafolgestörungen aus einer neuen Perspektive anzugehen, welche keine Unterscheidung zwischen Körper und Psyche mehr macht, sondern Körper und Psyche als eine Einheit versteht. Als Ausdruck ein und desselben lebendendigen Organismus, welcher auf die durchgemachten Erfahrungen reagiert. Hier helfen die Neurowissenschaften weiter, welche in den vergangenen 25-30 Jahren das Verständnis für Traumafolgen grundlegend verändert und die ehemaligen mechanistischen Hypothesen weit hinter sich gelassen haben. Ein Trauma führt zu einer Beeinträchtigung der integrativen Funktion dessen, was im englischen mit mind bezeichnet wird. Was mind ist, wird später ausgeführt.
Es gibt sichbare und es gibt unsichtbare traumatische Erfahrungen. Nebst der individuellen Beeinträchtigung führen traumatische Erfahrungen regelmässig zu Erschütterungen ganzer Gemeinschaften. Die Serientat eines 28-jährigen Mannes in Christchurch NZ am 15.03.2019 mit 50 Toten erschütterte ein ganzes Land – die Premierministerin Jacinda Ardern fand Worte, welche die Hinterbliebenen und Trauernden erreichten. Auch die Gemeinschaft leidet nach derartigen Ereignissen und kann nicht einfach zur Normalität zurück finden. Rituale können mithelfen, diesen Trauerprozess zu gestalten.
Trauma
Ein Trauma führt zu einer Beeinträchtigung der Integration und Verarbeitung des Erlebten.
Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Arten von Trauma – nach einmaligen Ereignissen sprachen wir von Monotrauma, bei wiederkehrenden, repetitiven Ereignissen hingegen von Polytrauma. Die Unterscheidung macht Sinn, weil die Folgen nach Monotrauma grundsätzlich anders als nach Mehrfachtrauma sind. Typische Beispiele für Monotrauma sind Naturkatastrophen wie etwa ein Tsunami, ein Erdbeben, eine Lawinen – oder Hochwasserkatastrophe, aber auch ein Unfall oder die Diagnose einer lebendsbedrohenden Erkrankung. Derartige Ereignisse werden oft als Schicksalsschläge hingestellt – gegen die der Mensch ohnhin nichts ausrichten kann, und die in ihren Auswirkungen eigentlich nicht vorhersehbar waren. Je mehr hingegen ein menschliches Zutun hinzukommt, etwa durch schlampige Baumethoden bei Erdbebenfolgen, oder irreführenden Warnungen der Wetterdienste bei Unwetterkatastrophen, desto schwerer tragen Betroffene die Folgen. Sexualisierte Gewaltdelikte, partnerschaftliche Gewalt, Flucht und Immigration stellen hingegen in der Regel Polytrauma dar, die meist nicht bloss mit repetitiven traumatischen Erfahrungen verbunden sind, sondern vielfach Kinder und Jugendliche in Entwicklung treffen, und deren Ereignisse vielfach unichtbar sind. Die Folgen sind um ein Vielfaches gravierender und komplexer, zudem werden regelmässig Bindungserfahrungen tangiert, wenn beispielsweise die sexualisierten Übergriffe innerhalb der Familie oder durch nahestehende Bezugspersonen verübt werden.
Noch gravierender sind die Auswirkungen frühkindlicher Traumatisierung, beispielsweise im Rahmen von kommerzieller sexualisierter Ausbeutung in der Pornoherstellung und Kinderprostitution. Es resultieren Störungsbilder, welche als Dissoziative Identitätsstörung bezeichnet werden, die schlimmsten Traumafolgestörungen. Man spricht heute von einem Kontinuum an Traumafolgestötungen oder englisch: trauma spectrum disorders.
Monotrauma einmaliges Ereignis, z. B. Naturkatastrophe
Polytrauma mehrmalige Ereignis, z.B. sexualisierte Gewalt
Der französische Forscher Pierre Janet war der erste, welcher ein narratives vom eigentlichen Traumagedächtnis unterschieden hat. Er realisierte, dass Triggermechanismen beim Traumagedächtnis zu Aktivierungen der Erinnerungen führen. Janet war auch der erste, welcher den Begriff der Dissoziation im klinischen Zusammenhang verwendet hat – als Gegenteil von Assoziation (Zusammenführen) oder Integration. Er erkannte zudem, dass die Integration im therapeutischen Prozess hilft, die Dissoziation zu überwinden.
Die Erfahrung zeigt, dass eine an sich traumatische Erfahrung per se nicht alleine dafür verantwortlich ist, ob sich in der Folge ein Störungsbild zeigt – sondern dass Fragen der Einordnung des Geschehens und mögliche Bewältigungsstrategien möglicherweise sogar einen grösseren Einfluss auf die Symptomentstehung haben. Weiter ist zu bedenken, dass Menschen, die mit dem selben Ereignis konfrontiert sind, unterscheidlich reagieren können: die eine Person reagiert mit einer Traumafolgestörung, die andere nicht. Für die zweite Person ist demzufolge dieses Ereignis nicht traumatisch – d.h. mit anderen Worten, dass die nachfolgende Reaktion letztlich bestimmt, ob ein Ereignis traumatisch war oder nicht. Das geht vielen Leuten nicht in den Kopf. Aber so ist es. Die soziale und kulturelle Realität spielt in der Traumaentstehung eine zentrale Rolle – das Verständnis über die Traumafolgen kann damit nicht auf einer individualpathologischen Basis abgehandelt werden, sondern bedarf einer systemischen Sichtweise (Herman 1992, 1998).
Dissoziation
(Phasenweise) Störung der integrativen Funktion des Bewusstseins mit Trennung von Wahrnehmungs- und Gedächtnisfunktion.
Die individuelle Anpassungsleistung ist bei Traumafolgestörungen zwingend mit zu berücksichtigen – insbesondere bei sexualisierten Gewaltdelikten. Ein Beispiel von David Clark, einem meiner Lehrer über Traumafolgestörungen, soll dies verdeutlichen. Eine ca. 35-jährige Frau wird vergewaltigt; sie zeigt in der Folge keine nennenswerten Beschwerden. Für sie gehört das zum Schicksal vom Frausein – sie ist nicht die erste und nicht die letzte, der so etwas zustösst. Neun Monate später erfährt sie aus den Medien, dass derselbe Täter erneut eine Frau in der näheren Umgebung vergewaltigt und getötet hat. Jetzt bricht bei der Frau das Vollbild einer PTSD aus – plötzlich wird ihr gewahr, in welcher Gefahr sie selber geschwebt hatte. Zudem macht sie sich Vorwürfe: hätte sie damals das Delikt angezeigt, dann hätte sie möglicherweise den Tod der anderen Frau verhindern können.
Weiter gehören dissoziative Phänomene zu jeder Traumafolgestörung (ohne dissoziative Symptomatik kann ein noch so schreckliches Ereignis keine Traumafolgestörung bewirken!) – Depersonalisationsphänomene wie „das bin nicht ich; es ist wie wenn es eine andere Person betrifft“ oder immer wieder auftauchende Flashbacks an die zurückliegenden Ereignisse sind untrügliche Zeichen. Das Vermeidungsverhalten als Teil der vier clusterartigen Symptomgruppen der posttraumatichen Belastungsstörung führt dazu, dass Betroffene häufig nicht über ihre durchgemachten Erfahrungen sprechen (können), da dies unweigerlich ihre traumatischen Erinnerungen wecken würde, welchen sie instinktiv ausweichen, da sie so unerträglich sind.
Traumafolgestörung
Wenn Menschen nach Erleben eines traumatischen Ereignisses charakteristische clusterartige Beschwerden entwickeln, sprechen wir von einer Traumafolgestörung. Das Beschwerdebild kann ab Ereignis bestehen, oder mit einer Latenz von Monaten bis Jahren auftreten. Je nach Schweregrad resultieren unterschiedliche Störungsbilder – wir sprechen deshalb von einem Kontiunuum der Traumafolgestörungen (trauma spectrum disorder).
Die traumatische Erfahrung übersteigt die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten und führt deshalb zu einer anderen Art und Weise der Verarbeitung sowie Lernvorgängen als sonstige Alltagserfahrungen. Verantwortlich ist ein evolutionsbiologisch vorgegebener Mechanismus, der sich in erster Linie im Thalmus abspielt – wo sich die Integration unterschiedlicher Lebenserfahrungen vollzieht. Die Dissoziation ist damit nicht ein Abwehrvorgang wie beispielswesie die Verdrängung als aktive Ich-Leistung, sondern stellt einen unwillkürlich ablaufenden Schutzmechanismus dar, der schon beim Kleinkind wirksam ist. Dazu folgen später weitere Ausführungen.
Viele Betroffene schämen sich abgrundtief über ihre Unfähigkeit, mit dem Geschehen fertig zu werden und die Dinge hinter sich zu lassen. Diese Scham verschliesst den Menschen den Mund. „[...] deep down many traumatized people are even more haunted by the shame they feel about what they themselves did or did not do under the circumstances“ (Van der Kolk 2014, p. 13). Die Entwicklung einer tragfähigen therapeutischen Arbeitsbeziehung ist als Folge der Traumatisierungen mit Beeinträchtigung der Beziehungsfähigkeit deutlich erschwert (Olbricht 2004, p. 172).
Der Konflikt zwischen dem Wunsch, schreckliche Ereignisse zu verleugnen, und dem Wunsch, sie laut auszusprechen, ist die zentrale Dialektik des psychischen Traumas (Judit Herman, 1992, p. 9).
Die Häufigkeit von sexualisierten Gewaltdelikten liess sich nicht mehr kleinreden, ebensowenig die Folgen für die Gesundheit. Die seit Herbst 2017 in der Öffentlichkeit wahrgenommene #MeToo Bewegung verdeutlichte das Ausmass des Problemes. Eine Studie der FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) vom Frühjahr 2014 besagt, dass innerhalb der EU-28 33% der Frauen im Alter von 15 bis 74 Jahren körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erleben; das sind 62'000'000 Frauen. Männer hat man einmal mehr nicht befragt – ein Bias vieler Wissenschafter, die immer noch dem Irrglauben aufsitzen, dass sexualisierte und häusliche Gewalt praktisch ausschliesslich Frauen trifft. Lara Stemple und Mitarbeiter haben gezeigt, dass bei korrekter Datenerhebung sich die Zahlen über sexualisierte Gewaltdelikte deutlich verändern (Stemple et al. 2014). Werden typische männliche Sozialisierungsbereiche wie Militär oder Knast in die Untersuchungen miteinbezogen, sind Männer wie Frauen etwa geich häufig von sexualisierten Gewalterfahrungen betroffen.
Die körperlichen Auswirkungen psychischer Traumaerfahrungen wurden bis in die jüngste Vergangenheit völlig vernachlässigt. Wie ein Zitat belegen mag, hat dies jedoch eine Vorgeschichte: „The body, for a host of reasons, has been left out of the talking cure“ (Ogden et al. 2006, p. XXVii). Bei der Formulierung des PTSD-Konzeptes durch die psychiatrischen Fachleute 1980 wurden die körperlichen Symptome schlicht vergessen – dabei ist es bis heute geblieben. Ein fataler Irrtum der psychiatrischen Diagnostik: viele Betroffene suchen wegen körperlichen Beschwerden ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt auf, wo sie eine psychosomatische oder eine funktionelle Diagnose erhalten – beides hilft nicht viel weiter, weil die Hausärzte mangels geeigneter Diagnostik die traumatische Ursache der Beschwerden kaum erfassen. Die Ergebnisse der ACE-Studie haben diesbezüglich einen Paradigmenwechsel eingeleitet, der zu einem neuen Krankheitsverständnis innerhalb der Medizin führt (Tschan 2013). In die gleiche Richtung weisen die Erkenntnisse über epigenetische Veränderung in Zusammenhang mit Stressregulationsvorgängen – es liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass traumatische Erfahrungen in der menschlichen Entwicklung zu grundlegenden Veränderungen der Gensteuerung führen.
Was ist eine Dissoziation?
Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation, also abspalten, nicht zusammenbringen oder im englischen als “compartmentalise”, d.h. aufteilen, aufspalten, bezeichnet. Bei den Traumafolgestörungen wird unter Dissoziation die Nicht-Integration nicht-bewältigbarer Anteile in die Persönlichkeit verstanden, mit dem Resultat der Abspaltung resp. Ausbildung von selbstständig agierenden Persönlichkeitsanteilen. Betroffene können mitunter diese Anteile nicht wahrnehmen. Dissoziative Reaktionen werden als Selbstschutzmechanismen verstanden, die in Momenten grosser Bedrohung aktiviert werden; und die demgemäss für das Überleben wesentlich sind. Im späteren Lebenszyklus können sie zu dysfunktionalen Mechanismen werden, die nicht mehr sinnvollen Adapationsvorgängen entsprechen. Als Folge der dissoziativen Phänomene entwickeln betroffene Menschen keine positiven Copingstrategien im Umgang mit belastenden Lebenssituationen: „Die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, auf grösseren Stress mit Dissoziation zu reagieren – dies bedeutet: keinen Schmerz, keine Panik, weder Affekte noch den eigenen Körper wahrzunehmen -, ist eine überlebenswichtige Funktion“ (Brisch in Wieland 2014, p. 8).
Für das Verständnis der Traumafolgestörungen ist wesentlich, dass nach dem bisherigen Stand des Wissens eine Dissoziative Identitätsstörung früh im Leben erworben wird (Dutra et al. 2009). Hingegen können andere dissoziative Symptome wie beispielsweise Depersonalisationsphänomene auch im späteren Lebenszyklus auftreten. Eine knapp 60-jährige Frau erlitt einen Unfall auf dem Amazonas. Bei starker Strömung fiel sie aus einem Schlauchboot und konnte erst nach mehreren Minuten gerettet werden. Sie war nicht mehr ansprechbar und wurde auf der Intensivstation einer Klinik in Manaus behandelt. Nach einem protrahierten Heilungsverlauf konnte sie die Heimreise antreten und wurde dann durch ihren behandelnden Arzt an mich überwiesen. Sie litt an einer Posttraumatischen Belastungsstörung und sagte wiederholt, dass sie wie neben sich stehe, wenn sie an dieses Ereignis zurück denke. Es komme ihr so vor, wie wenn diese Geschichte nicht sie betreffe, sondern eine andere Person.
Versetzen Sie sich in die Situation eines gewaltbetroffenen Kindes, welches am Frühstücktisch mit seinem Vater zusammen sitzen muss, der es am Abend zuvor vergewaltigt hat. Die Abspaltung traumatischer Erinnerungsbilder ist ein wirksames Mittel der Überlebensstrategie. Aus diesem Grund werden dissoziative Phänomene als Selbstschutzmechanismen verstanden. Aber leider hat alles auch seine Kehrseite, weil die Dissoziation die Triggerphänomene bedingt, welche zu Flashbacks und Intrusionen führen. Während ein traumatisches Ereignis irgendwann vorbei ist, sind solche immer wieder auftauchenden Traumaerinnerungen völlig unberechenbar: “Flashbacks and reliving are in some ways worse that the trauma itself” (Van der Kolk 2014, p. 66). Dieses Ausgeliefertsein macht die Betroffenen völlig verzweifelt – wie dies im Buch “Das verfolgte Selbst” von Van der Hart et (2008) beschrieben wird. Da die ursprünglichen traumatischen Erfahrungen oft lange Zeit zurückliegen, sehen Betroffene häufig keinen Zusammenhang zwischen ihren jetztigen Beschwerden und der damaligen Situation.
Eine Frau sieht sich im TV einen Film an. Bei einer Szene, wo ein Pferd mit Hufeisen beschlagen wird, gerät sie völlig in Panik, verbunden mit Herzrasen und eingeengtem Bewusstsein. Sie weiss nicht mehr was tun und reagiert völlig verzweifelt. Dank einer Tablette Temesta® Expidet (Lorazepam) gelingt es ihr sich wieder zu beruhigen.
Diese Frau überlebte die Schiffskatastrophe der Costa Concordia vor der Insel Giglio. Die Kreuzfahrt näherte sich ihrem Ende, es war der letzte Abend an Bord, ein Freitag. Um 21:45 erschütterte ein heftiger Schlag das Schiff. Als erfahrene Seglerin realisierte sie sofort, dass da etwas nicht stimmen konnte. Als sie kurz darauf mit Schwimmweste aus ihrer Kabine trat, wurde sie durch das Personal aufs heftigste beschimpft: Sie solle sofort die Schwimmweste wieder ablegen. Mit ihrem Verhalten würde sie Panik verbreiten und die übrigen Passagiere verunsichern. Sie stand an der Reling und sah die nahen Lichter der Insel Giglio – viel zu hoch, um runter zu springen. Das Schiff hatte seine Fahrt eingestellt und neigte sich langsam auf eine Seite, bis es plötzlich auf die andere Seite kippte. Irgendwann erloschen die Lichter. Nun erkannte die Mannschaft den Ernst der Lage und begann mit der Evakuierung. Die Frau befand sich schliesslich mit vielen andern zusammen in einem Rettungsboot, welches wegen der Schlagseite des Schiffes der Bootswand entlang schlitterte. Plötzlich blieb das Rettungsboot an einem Metallbolzen hängen und drohte zu kippen. Mit einer Axt gelang es schliesslich einem Besatzungsmitglied, den Bolzen abzuschlagen, worauf das Boot erneut zu kippen drohte. Schliesslich konnten alle aus diesem Boot gerettet werden und die Frau konnte äusserlich unversehrt die Nacht in einem Kindergarten auf der Insel Giglio verbringen.
Das Metallgeräusch durch das Beschlagen des Pferdes wirkte als Triggermechanimus. Das ursprüngliche Ereignis war das Abschlagen des Metallbolzen mittels einer Axt – plötzlich war die Lebensbedrohung wieder da. Obwohl die Frau diese Zusammenhänge (kognitiv) kannte, half ihr das nichts. Die Angst, vermittelt durch die körperlichen Reaktionen als Folge der Aktivierung der Amygdala, war stärker als alles andere. Ihre rationale Entscheidungsmöglichkeit (siehe MPFC im nächsten Abschnitt) wurde in solchen Momenten blockiert.
Die Frau war erschüttert, dass lange nach dem ursprünglichen Ereignis vom 13. Januar 2012 immer wieder solch belastende Ereignisse aufzutreten pflegten. Wie bedrohlich das Schiffsunglück war, zeigt sich auch an der Zahl der Toten: 32 Passagiere kamen damals ums Leben.
Die Gründe für schwere Traumafolgestörungen mit dissoziativen Störungsanteilen sind nachfolgend aufgeführt:
Vernachlässigung (Nichterfüllen der kindlichen Bedürfnissen und Missachtung)
Sexualisierte Gewalthandlungen
Körperliche und psychische Misshandlungen
Folterungen, Gehirnwäsche (organisierte Gewalt, Traffiking, Sekten, etc.)
Benutztwerden zum Herstellen von Kinderpornografie
Gezielte Isolierung, Abhalten von sozialen Kontakten mit Gleichaltrigen
Die Prävalenzzahlen für schwere Traumafolgestörungen bewegen sich in der Grössenordnung von 1% der Bevölkerung resp. bis zu 6% von psychiatrischen Patientenpopulationen (Gast 2000).
Bei Hinweisen auf schwere Traumafolgestörungen ist ein behutsames therapeutisches Vorgehen indiziert. Eine Akzeptanz der Diagnose durch möglichst viele Innenanteile ist erstrebenswert.
Fachleute müssen jeweils klarstellen, was sie mit “Dissoziation” beschreiben wollen. Nachfolgend in Anlehnung an Ross und Halpern (2009) die vier Bedeutungen des Begriffs Dissoziation:
Dissoziation hat vier Bedeutungen:
Ein mentaler Prozess, welcher das Gegenteil von Assoziation (Zusammenführen, Integrieren) bedeutet
Ein diagnostischer Begriff der Psychiatrie (eine psychiatrische Störung)
Ein technischer Ausdruck der Kognitionspsychologie (mit vier Dimensionen)
Ein Selbstschutzmechansimus (und damit ein intrapsychischer Copingmechanismus)
Der Begriff „Dissoziation“ wird in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet, was jedoch der Sache nicht dienlich ist. So gibt es Fachleute, die von „normaler Dissoziation“ sprechen, was aber tatsächlich eine Abweichung der Aufmerksamkeit darstellt („den Faden verlieren“, einem Gespräch nicht voll zuhören, „abgelenkt sein“, etc.). Ross und Halpern haben Dissoziation wie folgt definiert: „When two things are dissociated, they are disconnected from each other, out of relationship with each other, and not interacting“ (Ross et al. 2009, p. 2). Das Gegenteil ist Assoziation; d.h. zwei oder mehr Dinge stehen miteinander in Beziehung oder in Verbindung. Die Dissoziation kann in Bezug auf die konkrete Symptomatik unterschiedliche Ausmasse annehmen. In der Kognitionspsychologie werden vier Dimensionen unterschieden, welche unser Bewusssein charakterisieren: Zeit, Gedanken, Gefühle und Körper. Im Rahmen von dissoziativen Prozessen können alle vier Dimensionen beeinträchtigt sein: die Zeit wird nicht erfasst (Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft); der Gedankenfluss kann nicht mehr kontrolliert werden; die Gefühle können nicht mehr kontrolliert werden; und der Bezug zum eigenen Körper kann beeinträchtigt sein (Mosquera 2016, p. 27).
Was lösen Opfer aus?
„Je tabuisierter […] die Gewalt ist, um so grösser ist die ethisch-moralische Brisanz, die mit dem Aufdecken einer solchen Gewalt durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse einhergeht“ (Gast 2002, p. 129).
Opfer lösen mit ihren Geschichten Betroffenheit und Mitgefühl aus. Sie bewirken damit beim Gegenüber etwas: „Das Opfer verlangt Handeln, Engagement und Erinnerungsfähigkeit“ (Herman 2003, p. 18). Diese Anteilnahme kann nur erbringen, wer einem Opfer empathisch zuhören kann. Instinktiv wenden sich viele ab, weil sie die Belastung nicht ertragen – auch Fachleute. Sie wollen nicht Wahrhaben, was sie zu hören bekommen. Opfer bleiben damit einmal mehr alleine – sie entwickeln feine Antennen, wem sie etwas anvertrauen können, und wem nicht. Oft schweigen die Opfer aus Loyalität zu den Bindungspersonen – sie möchten sie nicht unnötig belasten, und fürchten von ihnen abgelehnt zu werden (weil sie ihnen Kummer und Sorgen bereiten ...).
Opfer werden oft beschuldigt, nicht die Wahrheit zu sagen – manchmal aus dem einfachen Grund, weil man sich das Gehörte nicht vorstellen kann (Miller 2014). In Zusammenhang mit der Aufdeckung der kriminellen Machenschaften von Jimmy Savile, einem britischen Entertainer, wies die Neue Zürcher Zeitung kürzlich darauf hin, dass dieser Fall die Schwelle dessen, was für möglich gehalten wurde, wesentlich verschoben hat. Allerdings hat in diesem Fall bis zu dessen Tod niemandem einem Opfer ein Wort geglaubt. Savile verübte seine Taten über einen Zeitraum von über 50 Jahren und es ist die Rede von gegen 1000 Opfern (siehe Bericht der Metropolitan Police: Giving Victims a Voice). Es wurde in diesem Fall nie eine Anklage erhoben, geschweige denn ein Verfahren eröffnet. Derartige Beispiele sind zumindest ein Hinweis auf täterloyales Verhalten vieler Beteiligter – ein grundlegendes Problem der menschlichen Gemeinschaften. Als der polnische Regisseur Tomasz Sekielski den Film Tylko Nie Mów Nikomu