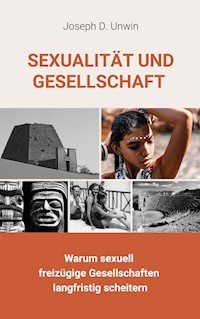
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner großen Studie Sex and culture aus dem Jahr 1934 untersuchte der britische Ethnologe Joseph D. Unwin den Zusammenhang zwischen den jeweils geltenden Sexualnormen und der gesellschaftlichen Entwicklung. Dazu wertete er eine immense Fülle an ethnologischen und historischen Daten aus - aus der Zeit der Babylonier bis ins 20. Jahrhundert. Seine Ergebnisse sind heute aktueller denn je. Unwin wies nach, dass der Aufstieg und Niedergang einer Kultur eng mit der Frage verknüpft ist, wie sehr es einer Gesellschaft gelingt, Monogamie und Familienwerte zu fördern. Gesellschaften, in denen sexuelle Freizügigkeit über drei Generationen hinweg die Kultur prägten, befanden sich in allen untersuchten Beispielen im Niedergang. Bei der vorliegenden Ausgabe handelt es sich um die erste deutschsprachige Teilübersetzung von Unwins Sex and culture, die alle für den Gedankengang zentralen Abschnitte sowie - in beispielhaften Auszügen - ethnologische und historische Belege enthält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Warum sexuell freizügige Gesellschaften langfristig scheitern
–
Vorbemerkungen des Übersetzers
Vorwort
Der Bezugsrahmen
1.1 Die Untersuchung
1.2 Das Material
1.3 Definition von „kultureller Zustand“
1.4 Die kulturellen Zustände zoistisch, manistisch und deistisch
1.5 Die Vermittlung zu den Mächten im Universum
1.6 Anmerkungen zum Quellenmaterial
Ethnologische Befunde
2.1 Loyalitätsinseln und Tanna
2.2 Die Schilluk
2.3 Die Wayao und Anyanja (matrilineare Ethnien)
2.4 Die Azteken
2.5 Paläosibirische Ethnien: Tschuktschen, Koryaken, Jukagiren
Rückentwicklungen bei unzivilisierten Ethnien
Psychologische Befunde
4.1 Die soziale Natur des Unbewussten
4.2 Der Effekt sexueller Einschränkungen
4.3 Die Ursache sozialer Energie
Zwischenbilanz
Gesetzmäßigkeiten des zwischenmenschlichen Verhaltens
6.1 Die Eigentümlichkeit des zwischenmenschlichen Verhaltens
6.2 Die Wissenschaft zwischenmenschlicher Beziehungen
Historische Befunde
7.1 Die Babylonier und Sumerer
7.2 Die Athener
7.3 Die Römer
7.4 Die Germanen
7.5 Der Einfluss des Christentums
7.6 Die Araber
7.7 Die Angelsachsen
7.8 Die Engländer
Menschliche Entropie
Ergebnisse
Nachweis zur Übersetzung
- - -
Tafeln und Abbildungen
Tafel Südpazifische Inseln und Neuguinea
Tafel Afrika
Tafel Amerika
Tafel Ozeanien
Tafel Assam (nordöstliches Indien
)
Tafel Sonstige Ethnien
Diagramme der kulturellen Zustände
Warum sexuell freizügige Gesellschaften langfristig scheitern – Vorbemerkungen des Übersetzers
Schlaglichter auf den Wandel der Sexualnormen
Am 5. Juni 1956 trat Elvis Presley, der „King of Rock ´n Roll“, in der US-amerikanischen Milton-Berle-Show auf und spielte den Song Hound dog. Gekleidet war er, wie damals als Musiker üblich, mit Hemd, Anzug und schwarzer Hose. Gegen Ende, während eines langsameren Blues-Teils, machte der Sänger vor dem Mikrofon für einige Sekunden laszive Hüft- und Beinbewegungen im Rhythmus des Songs. Das Publikum reagierte unterschiedlich, teils mit verzücktem Klatschen und Begeisterung, aber auch mit Erstaunen und Fassungslosigkeit. Die Brisanz von Presleys erotischen Bewegungen war für alle im Saal spürbar. In den Medien löste der Auftritt umgehend einen Skandal aus. Presley wurde vorgeworfen, dass er „körperlich enthemmt und fanatisiert“ auftrete und sein Tanz „voller sinnlicher, jugendgefährdender Impulse“ sei.1 Die Heftigkeit der Reaktionen lag darin begründet, dass der Sänger mit seinem aufreizenden öffentlichen Auftritt gegen die damaligen Sexualnormen verstieß. Mit vehementen Protesten versuchte das damalige Establishment die strengen Sitten und Werte zu verteidigen, mit denen es selbst noch aufgewachsen war: Sexuelle Anspielungen in der Öffentlichkeit galten als unsittlich; bestimmte Gesten und Bewegungen hatten außerhalb der Ehe nichts verloren. Bei folgenden TV-Auftritten wurde Elvis Presley aus Jugendschutzgründen nur vom Oberkörper aufwärts gezeigt.
Ein Zeitsprung: Am 7. August 2020 veröffentlichten die US-amerikanischen Rapperinnen Cardi B und Megan Thee Stallion den Song Wet-Ass Pussy (übersetzt etwa „verdammt feuchte Muschi“), in dem sie in aller Deutlichkeit und in vulgärer Sprache auf sexuelle Fantasien und Vorlieben eingingen. Im Musik-Clip zu diesem Lied stellten die Sängerinnen ihre weitgehend entblößten Brüste und Hintern in aufreizenden Posen zur Schau. Die Rapperinnen streiften dabei halbnackt durch eine luxuriöse Villa, in der Skulpturen mit goldenen Hintern und Wasserfontänen speienden Brüsten an den Wänden hingen. Nur 24 Stunden nach der Veröffentlichung des Videos war der Musik-Clip bereits 26 Millionen Mal angeklickt worden, bis zum April 2022 schon 454 Millionen Mal. Die Anzahl der Klicks übertraf damit die Einwohnerzahl der kompletten Europäischen Union von Portugal bis Finnland. Die Reaktionen auf den Song und das pornografische Video waren dieses Mal, anders als bei Presley 1956, fast durchweg positiv. Lobend hervorgehoben wurden „der neue Sexpositivismus“ (Tagesspiegel) und wie die Rapperinnen „Stolz und Fleischlichkeit behaupten“ und „das verbindende Element menschlicher Körperausflüsse feiern“ (Süddeutsche). Mehrere Medienanstalten und Fachzeitschriften listeten „Wet-Ass Pussy“ als besten Song des Jahres. Das Establishment des Jahres 2020 sah in diesem pornografischen Video ein Plädoyer für „female Empowerment“, ein Eintreten für eine gute Sache. Die wenigen kritischen Stimmen, die sich zu Wort meldeten, kamen vor allem von Tierschützern, die sich über die Zurschaustellung von Großkatzen im Musikvideo beklagten.
Die beiden Schlaglichter machen deutlich, wie grundlegend sich die Auffassungen über Sex und die Art, wie sie öffentlich thematisiert werden, gewandelt haben. Im frühen 21. Jahrhundert dominiert die Auffassung, dass die sexuelle Freizügigkeit erst dort eine Grenze findet, wo Straftaten begangen werden. Alles andere steht jedem frei. Psychische, kulturelle und gesellschaftliche Folgen der sexuellen Freizügigkeit werden heute nur wenig in den Blick genommen und weitgehend ausgeblendet.
Joseph D. Unwin hingegen interessierte sich für genau diese Fragen. Er wollte herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Sexualnormen und der gesellschaftlichen Entwicklung – und wenn ja, welchen. Um es gleich vorweg zu sagen: Unwin stellte fest, dass es tatsächlich eine solche Verbindung gibt. Seine Untersuchungen ergaben, dass strengere Sexualnormen die gesellschaftliche Entwicklung fördern und laxere Normen – allerdings erst verzögert nach etwa drei Generationen – zu einem gesellschaftlichen Abwärtstrend oder Niedergang führen.
Sollten Unwins Erkenntnisse zutreffend sein, stellt sich die Frage: Treten die gesellschaftlichen Auswirkungen, die Unwin an unzähligen historischen Beispielen nachwies, auch heute noch auf? Werden auch in unserer Gesellschaft jene negativen Folgen eintreten, die angesichts des Wandels der Sexualnormen seit den späten 1960er-Jahren hin zu deutlich laxeren Einstellungen zu erwarten wären?
In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer eklatanten Verschiebung hin zu unverbindlicheren Beziehungsformen. In dieser Zeit hat sich die Zahl der Eheschließungen deutlich vermindert2, die Schei-dungsrate erhöht3, Dating-Plattformen wenden sich nicht mehr nur an Singles, sondern auch an Verheiratete 4 , Prostitution 5 und Porno-Industrie6 boomen.
Träfe Unwins Prognose zu, befänden wir uns in einer Phase eines kulturellen und gesellschaftlichen Abwärtstrends. Tatsächlich gibt es Indizien, die in diese Richtung weisen: Was der Soziologe Andreas Reckwitz als „Gesellschaft der Singularitäten“ bezeichnet, den Trend zu Individualisierung und Partikularisierung, geht einher mit einem Nachlassen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. An den schon seit längerem abnehmenden Bindekräften von Familien, Parteien, Vereinen und Kirchen lässt sich das gut erkennen. Ablesen lässt sich das auch an der zunehmenden Anzahl von Personen, die ohne Angehörige oder Freunde beerdigt werden. Allein im Berliner Bezirk Reinickendorf waren das im Jahr 2018 bereits 226 Personen, in ganz Berlin etwa 5 % aller Beerdigungen, Tendenz steigend.7 Weitere Krisenphänomene sind die eklatante Zunahme psychischer Krankheiten8 und die Tatsache, dass sowohl öffentliche Debatten als auch Gespräche zunehmend durch Fake News, Verschwörungstheorien, „alternative Fakten“ und Lügen beeinträchtigt sind. Der Respekt vor der Wahrheit ist im Rückgang begriffen. Und mit dem Verschwinden der Tugend der Wahrhaftigkeit kommt es zur Auflösung von Gewissheiten.9
Neben dem schwindenden gesellschaftlichen Zusammenhalt würde Joseph Unwin für die kommenden Jahre auch eine Zunahme sozialer Krisen sowie ein Nachlassen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des politischen Gewichts jener Gesellschaften erwarten, die einen Wandel hin zu laxen Sexualnormen vollzogen haben. Auch von daher haben seine Untersuchungen heute eine erhebliche Brisanz.
Zur Bedeutung anspruchsvoller Sexualnormen
In den westlichen Gesellschaften besteht heute ein starkes Bedürfnis, sich nicht einschränken lassen zu wollen, nicht auf Handlungsoptionen verzichten zu wollen. Für die gegenwärtige Kultur ist der Autonomiegedanke, der Gedanke der Selbstbestimmung 10 zentral. Im Mittelpunkt steht das Ideal des freien, ungebundenen Lebens – und damit letztlich das Ich und dessen potenziell grenzenlose Ansprüche. Die gegenwärtige Konsumgesellschaft 11 erzieht ihre Mitglieder zu einer möglichst sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Die Bereitschaft zu verzichten wird dadurch geschwächt. Durch die Werbeindustrie und Vorbilder in sozialen Medien wird suggeriert, mehr zu benötigen und stets mehr und Neues erleben zu müssen. Die Folge ist eine Kultur der Maßlosigkeit, die in vielen Schattierungen und Ausprägungen auftritt – bis hin zum Suchtverhalten.
Diese Grundmentalität beeinflusst natürlich auch die Gestaltung von Beziehungen. Betrachtet man die langfristige Entwicklung von der Mitte des 20. Jahrhunderts – der Zeit des frühen Elvis Presley – bis in die Gegenwart, so sind die Veränderungen gravierend.
Viele Menschen sind heute geneigt, den jeweils vorherrschenden Gewohnheiten eine „normative Kraft des Faktischen“ zuzubilligen, also das für gut oder normal zu halten, was hinreichend oft der Fall ist. Unwin hingegen weist in seinem Werk immer wieder auf qualitative Unterschiede hin. Typischerweise geht, wie Unwin aufzeigt, die Hochachtung von Monogamie und ehelicher Treue mit anspruchsvollen Sexualnormen einher. Von Mann und Frau wird Verzicht auf außerehelichen Geschlechtsverkehr erwartet. Was das biblische Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“12 fordert, ist nach den Resultaten der vorliegenden Studie nichts anderes als eine Grundvoraussetzung für eine intakte und zukunftsfähige Gesellschaft. Die dafür erforderliche Verzichtsleistung ist für Unwin eine zentrale Quelle gesellschaftlicher Energie, Kern jedes kulturellen Fortschritts und – so ließe sich hinzufügen – könnte heute einen Beitrag leisten für ein harmonischeres Miteinander der Geschlechter.
Ein Wissenschaftler wie Unwin, der das menschliche Verhalten in verschiedenen kulturellen Kontexten präzise analysierte, der zu ermitteln versuchte, welche Sitten mit welchen gesellschaftlichen Effekten korrelieren, was die Voraussetzungen sind für das Entstehen, Fortdauern oder den Verfall einer Kultur, der in seinem gewaltigen Datenmaterial Gesetzmäßigkeiten erkannte und auf ihre objektive Gültigkeit hinwies, der widerspricht der subjektivistischen Intuition der Gegenwart. An konkreten Beispielen zeigt Unwin die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz sexueller Normen auf, und welche Auswirkungen diese auf die nächsten Generationen haben. Mit seiner datenbasierten Vorgehensweise ermittelte er Faktoren, die dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben zuträglich, und solche, die ihm abträglich sind. Vor allem machte Unwin auf langfristige Wirkungen aufmerksam. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte er, dass die Auswirkungen von Sexualnormen erst mit einer Verzögerung von drei Generationen in vollem Umfang zu Tage treten. Er weist damit auf die Verantwortung für das soziale und kulturelle Erbe hin, und lenkt den Blick auf das, was wir der nächsten Generation hinterlassen.
Unwin erkannte im Verlauf seiner Untersuchung, dass es so etwas wie eine menschliche Natur gibt, die über alle Kulturen und Epochen hinweg auf vergleichbare Weise wirkt. Seine Studie ist nicht so angelegt, dass sie eine vorgefertigte Meinung zu begründen versucht. Als Empiriker legte er seine Untersuchung ergebnisoffen an, ließ nur evidenzbasierte Erkenntnisse gelten – und war am Ende selbst von seinen Resultaten überrascht.
Manche seiner Ergebnisse lassen an Einsichten klassischer Philosophen wie Platon, Aristoteles oder Thomas von Aquin denken, die nicht müde wurden, die Relevanz objektiver Maßstäbe und die Bedeutung von Tugenden hervorzuheben. Sie stehen aber auch im Einklang mit jenen modernen Denkern, die – wie Hans Jonas oder Emmanuel Lévinas – die Verantwortung für den Anderen als essenziell erachten. „Von dem Moment an“, schreibt Lévinas zum Beispiel, „in dem der Andere mich anblickt, bin ich für ihn verantwortlich.“ 13 Unsere gegenwärtige Kultur der Unverbindlichkeit und der vielen virtuellen Kontakte hat diese Einsicht verdrängt. Wir müssen wieder neu lernen, dass wir im Angesicht des Anderen einander verantwortlich sind. Zusammenhalt kann nur dort entstehen, wo wir füreinander Verantwortung übernehmen. Er geht verloren, wenn wir versuchen, andere oder uns selbst zu manipulieren oder zu einem Werkzeug unserer Wünsche zu machen.
Unwins Forschungen legen jedenfalls nahe, die gegenwärtige Kultur der Austauschbarkeit und Gleichgültigkeit zu überwinden. Anspruchsvolle Sexualnormen können dabei helfen, dem eigenen Leben und unseren Familien ein festeres Fundament zu geben.
Zur Frage interkultureller Konflikte
Unwin beschäftigte sich auch mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Gesellschaften. In seinen Untersuchungen stellte er fest, dass eine Kultur, die strengere Sexualnormen aufweist, eine größere Energie und Dynamik entwickelt und eine demoralisierte Kultur auf Dauer verdrängt.
Heute kann man – anders als in der Zeit Unwins – kaum mehr von nationalen Kulturen sprechen. Im Lauf der letzten Jahrzehnte ist eine gemeinsame liberale westliche Kultur entstanden, die sich mindestens über Europa und Nordamerika erstreckt und die (natürlich mit Abweichungen, zeitlichen Verschiebungen und diversen Sonderwege einschlagenden Subkulturen) insgesamt vergleichbare Charakteristika aufweist. Wenn interkulturelle Konflikte entstehen, dann geschieht das in der Regel an den Kontaktlinien zwischen größeren Kulturkreisen oder innerhalb von Gesellschaften zwischen Mehrheitskultur und Subkultur. Unwins Erkenntnisse ermöglichen jedenfalls auch hier ein besseres Verständnis.
Gegenwärtig können die westlichen Gesellschaften ihre allem Anschein nach abnehmende soziale Energie noch kompensieren, da sie in einem historisch einmaligen Umfang auf fossile Energiequellen zurückgreifen können, die ihnen in nahezu allen Tätigkeiten des Alltags zur Verfügung stehen. In den archaischen und antiken Gesellschaften waren die Folgen laxer Sexualnormen umfassender und gravierender. Eine hedonistisch gewordene Kultur verminderte schneller ihre Ressourcen und wurde schneller von einer sozial disziplinierteren Kultur übertroffen oder verdrängt.
Unwin selbst beschreibt die von ihm beobachteten gesellschaftlichen Entwicklungen sachlich und nüchtern. Ihm ging es letztlich um die kulturelle Weiterentwicklung von Gesellschaften, nicht um Imperialismus. Aldous Huxley wies zurecht darauf hin, dass soziale Energie auch missbraucht werden kann. Sein Plädoyer lautete deshalb: „Energiereiche Gesellschaften werden nur dann große Tugenden hervorbringen, wenn besonders darauf geachtet wird, die durch sexuelle Beschränkung entstandene Energie in ethisch respektable Kanäle umzuleiten. Wie kann das erreicht werden? Offensichtlich nur durch Erziehung.“14
Zur Person Unwins
Über Joseph D. Unwin ist nicht viel bekannt. Geboren 1895 in England gehört er einer Generation an, die in den letzten Zügen des viktorianischen Zeitalters aufwuchs und den Zusammenbruch der „Welt von gestern“ (St. Zweig) durch die Jahrhundertkatastrophe des 1. Weltkriegs an vorderster Front miterlebte: Fünf Jahre war er Soldat. Diese Erfahrung, die er mit Zeitgenossen wie J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis und A. Huxley teilte, hat ihn zweifellos tief geprägt. Er hat am eigenen Leib erfahren, dass Zivilisationen auch wieder in die Barbarei herabsinken können, dass ein sozialer und kultureller Fortschritt nicht von alleine eintritt.
Nach dem Krieg kümmerte sich Unwin fünf Jahre um geschäftliche Angelegenheiten, ab 1924 studierte er an der Universität Cambridge Gesellschaftsanthropologie und Psychologie. Mit dem Thema seiner Promotionsschrift beschäftigte er sich sieben Jahre, und rechnet man die Überarbeitungen und Ergänzungen hinzu, kommt man auf zehn Jahre, die Unwin an seinem großen Werk „Sex and culture“ forschte und schrieb. 1934 erschien es auf 676 eng bedruckten Seiten. Unwin hatte keine breite Leserschaft im Auge. Er verfasste seine Schrift für die wissenschaftliche Gemeinschaft, für Professoren und Studenten, denen er zumutete, zwischen Hauptteil, Anmerkungsapparat und Tafeln hin und her zu blättern. In den letzten beiden Jahren vor seinem frühen Tod im Juni 1936 führte er seine Forschungen weiter. Vor allem interessierte ihn, was eine ideale Gesellschaft kennzeichnet – eine Frage, die damals durch die Auseinandersetzung zwischen liberaler Demokratie, Faschismus und Kommunismus heftig debattiert wurde. Seine Entwürfe wurden posthum unter dem Titel „Hopousia“ veröffentlicht. Aldous Huxley verfasste für diese nachgelassenen Aufzeichnungen eine ausführliche Einführung, in der er den Autor als einen „zugleich originellen wie systematischen, einen unkonventionellen wie vernünftigen Geist“15 beschrieb.
Anthropologen wie George Peter Murdock griffen Einsichten von Unwin auf und führten seine ethnologischen Forschungen fort. Eine breite Rezeption seiner Schriften blieb hingegen aus. Drei Aspekte machen jedoch eine Beschäftigung mit Unwins Forschungen lohnenswert: erstens sein Nachweis, dass das menschliche Leben Gesetzmäßigkeiten folgt, die nicht beliebig veränderbar sind; zweitens seine Erkenntnis, dass sich die Hochachtung von Ehe und Familie positiv auf Kultur und Gesellschaft auswirken; und drittens seine Thesen über das Energielevel von Gesellschaften.
Unwins wissenschaftliche Untersuchungen weisen einen engen Bezug zu zahlreichen kontroversen Gegenwartsdebatten auf, beispielsweise zum Geschlechterverhältnis, zur Rolle von Religion und Kultur (im engeren Sinn), zu interkulturellen Konflikten sowie zu gesellschaftlichen und ökologischen Krisen.
Zur Übersetzung
Die vorliegende Teilübersetzung von Unwins umfangreicher Untersuchung möchte dazu beitragen, langfristige gesellschaftliche Entwicklungen besser zu verstehen. Unwins fundierte Einsichten können helfen, die Bedeutung der Familie, von Kunst, Kultur und Religion neu zu erkennen. Die Schrift möchte zeigen, warum die gegenwärtig weit verbreitete „Tinder-Kultur“ überwunden werden sollte. Häufig wechselnde intime Beziehungen, unverbindliche Dates, offene Partnerschaftsformen, die Nutzung von Prostitution und ähnliche Phänomene schaden auf Dauer sowohl den beteiligten Akteuren selbst, als auch der Gesellschaft als Ganzer. Für eine positive kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung ist eine Wiederentdeckung und Stärkung von „Lebensstilen der Verlässlichkeit“ – mit Treue, Verantwortung, Liebe als Hingabe – dringend erforderlich.
Der folgende Text enthält alle für den Gedankengang Unwins zentralen Paragraphen aus dem Werk „Sex and culture“. Die ethnologischen Belege, die im Original noch deutlich umfangreicher angeführt werden, liegen in dieser Übersetzung nur in beispielhaften Auszügen vor. Die beigefügten Tafeln enthalten jedoch in komprimierter Form Unwins Ergebnisse. Die historischen Belege wurden fast vollständig übersetzt. Wo nötig, wurden in Fußnoten Erklärungen ergänzt, die als Hinzufügungen des Übersetzers gekennzeichnet sind.
Ein genauer Nachweis, welche Paragraphen aus Unwins Schrift der Übersetzung zugrunde liegen, findet sich am Ende. Für eine bessere Lesbarkeit wurden zentrale Stellen aus dem Anmerkungsapparat an entsprechender Stelle in den Fließtext integriert. Meist sind die Anmerkungen Präzisierungen der Darstellung; sie wurden in der Regel in eine etwas kleinere Schrift gesetzt. Wer die vertiefenden Erläuterungen in den klein gesetzten Passagen überspringt, kann dem Gedankengang immer noch gut folgen.
Taufkirchen, Ostern 2022 Stefan Baus
1https://criminologia.de/2013/07/elvis-presley-rockn-roll-und-gesellschaftspa-ranoia (abgerufen am 15.4.2022).
2 von 750.452 Eheschließungen (11,0 pro 1.000 Einwohner) im Jahr 1950 auf 407.466 (4,9 pro 1.000 Einwohner) im Jahr 2017– vgl. Statistisches Bundesamt, www-genesis.destatis.de/genesis/online/link/tabelleErgebnis/12611-0001 (abgerufen am 12.06.2019)
3 von 46.101 im Jahr 1956 zum Höchststand von 213.975 im Jahr 2003 auf 153.501 im Jahr 2017 – Statistisches Bundesamt, www-genesis.destatis.de/gene-sis/online/link/tabelleErgebnis/12631-0001 (abgerufen am 12.6.2019)
4 vgl. www.zu-zweit.de/online-dating-statistiken (abgerufen am 12.6.2019)
5 In einer Studie von 2012 geht der Soziologe Udo Gerheim davon aus, dass 18 % der Männer in Deutschland zeitweise oder regelmäßig Prostitution nachfragen. (Katharina Sass, Gewalttat Sexkauf – Was wir über die Nachfrager der Prostitution wissen, in: Sass, Katharina (Hrsg.), Mythos „Sexarbeit“, S. 45.)
6 „Basierend auf den veröffentlichten globalen Top-Listen der meistbesuchten Websites, scheint es so zu sein, dass User viel mehr Zeit damit verbringen, Pornos zu schauen als soziale Medien zu nutzen, Filme zu streamen oder online einzukaufen.“ (www.wallstreet-online.de/nachricht/10896525-porno-seiten-be-liebter-netflix-co – abgerufen am 12.6.2019)
7 vgl. https://www.deutschlandfunk.de/verstorbene-ohne-angehoerige-wenn-der-staat-dasletzte-100.html (abgerufen am 16.4.22). Zur Zunahme der anonymen Bestattungen vgl.: https://www.welt.de/politik/deutschland/article15910 4588/Was-passiert-wenn-man-in-Deutschland-einsam-stirbt.html (abgerufen am 16.4.22).
8https://www.hrpraxis.ch/2021/06/psychische-erkrankungen-am-arbeitsplatz.html (abgerufen am 17.4.2022). Belege für diesen Trend finden sich v. a. in Statistiken von Krankenkassen, von Versicherern und in Ärzteblättern.
9 vgl. Myriam Revault d´Allonnes, Brüchige Wahrheit – Zur Auflösung von Gewissheiten in demokratischen Gesellschaften, Hamburg 2019.
10 In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Begriff „Selbstverwirklichung“ noch gebräuchlicher, der auf dem gleichen Autonomiegedanken basiert, gleichzeitig aber noch einen Nachklang der älteren Annahme erkennen lässt, dass sich eine Person zielgerichtet auf einen Punkt größerer Vollkommenheit hin zubewegt. Im Begriff der „Selbstbestimmung“ hingegen sind sowohl die Annahme eines Ziels als auch der im Begriff der „Verwirklichung“ implizierte längere Zeithorizont eliminiert: Nur der gegenwärtige Wille steht im Fokus der Aufmerksamkeit.
11 vgl. hierzu z. B. Zygmunt Bauman, Leben als Konsum, 2009.
12 vgl. Exodus 20,14 und Matthäus 5,27-28.
13 vgl. Emmanuel Lévinas, Ethik und Unendliches, 42008, S. 72.
14 Introduction of Aldous Huxley, in: J. D. Unwin, Hopousia, New York 1940.
15 Introduction of Aldous Huxley, in: J. D. Unwin, Hopousia, New York 1940, S. 15.
Vorwort
Als ich diese Untersuchung begann, wollte ich nichts beweisen, und ich hatte keine Vorstellung davon, was das Ergebnis sein würde. Mit unbedarfter Aufgeschlossenheit beschloss ich, mithilfe von historischem Quellenmaterial eine irgendwie alarmierende Vermutung von Psychoanalytikern zu untersuchen. Deren Annahme war, dass sich emotionale Konflikte, die entstehen, wenn gesellschaftliche Vorschriften die direkte Erfüllung sexueller Triebe verhindern, anderweitig bemerkbar machen, und dass das, was wir „Zivilisation“ nennen, immer auf einem verpflichtenden Verzicht der Befriedigung angeborener Bedürfnisse basiert. Zu diesem Ergebnis kamen die Psychoanalytiker, nachdem sie die Natur und die Ursachen geistiger Krankheiten untersucht hatten. Sie haben keinen Versuch unternommen, dies unter Bezugnahme auf kulturgeschichtliche Quellen zu belegen. Also entschloss ich mich, den Sachverhalt zu untersuchen. Ich begann in völliger Unwissenheit. Hätte ich geahnt, wie sehr ich meine persönliche Philosophie als Ergebnis der Studie ändern musste, hätte ich wahrscheinlich gezögert, sie überhaupt zu beginnen. Ich war so weit von dem Wunsch entfernt, eine persönliche Überzeugung zu belegen, dass ich fortwährend gegen die Schlussfolgerungen ankämpfte, die die Beweislage mir aufzwangen. Und so setzte ich meine Arbeit fort und widerstand der Versuchung etwas zu sagen, bis ich überzeugt war, keine Ausnahme zu den offensichtlichen Gesetzmäßigkeiten finden zu können. Dann sammelte ich so viel Material, wie mir nötig und ratsam schien. Diese Untersuchung ist das Ergebnis.
Ich musste viele unzivilisierte Gesellschaften auslassen, die ich zunächst einbeziehen wollte, weil ich herausfand, dass unser Kenntnisstand über sie nicht den Standard erreichte, den ich beschlossen hatte heranzuziehen. Daher habe ich die australischen Aborigines ausgeschlossen und ebenso viele Ethnien der Bantu und der indigenen Völker Amerikas, über deren Kulturen ich eine Voruntersuchung machte. Ich diskutiere die Ethnie der südöstlichen Solomon-Inseln (Melanesien), aber unser Wissen der anderen Bewohner der Solomonen habe ich nicht für gut genug befunden, um eine Berücksichtigung rechtfertigen zu können. Das Gleiche trifft auf die meisten Ethnien der Neuen Hebriden und Neuguinea zu. Meine Liste der polynesischen und mikronesischen Gesellschaften ist ebenfalls kürzer, als ich es gern gehabt hätte. Sie umfasst die Maori, Samoaner, Tongaer, Tahitianer und die Bewohner der Gilbert-Inseln. Außerdem gehe ich auf die Hawaiianer ein. Keinen Bezug nehme ich jedoch auf die Bewohner von Tuvalu, Kiribati und Palau sowie der Karolinen und der Marshall- und Marquesas-Inseln. Nur wenige Ethnien sind faszinierender als diese; aber unsere Informationen über sie sind sehr lückenhaft, spärlich und von zweifelhafter Zuverlässigkeit. Die Qualität der afrikanischen Ethnographie ist genauso unterschiedlich, und auch wenn es enttäuschend war, Gesellschaften wie die Bari, Kavirondo, Konde, Bushongo, Mbala sowie die Igbo- und Edo-sprechenden Ethnien auszuschließen (um einige der afrikanischen Gesellschaften zu nennen, die ich zunächst berücksichtigen wollte und später aufgeben musste), war ich nicht zufrieden mit der Qualität der verfügbaren Quellen hinsichtlich des Verhaltens der jeweiligen Volksgruppen. Des Weiteren studierte ich die Veddas, Toda, Oraon und andere bekannte Ethnien Indiens und Sri Lankas; ich fühlte mich aber nicht im Stande, die erforderlichen Daten aus unserem Wissen über sie zu ermitteln. Ich habe 28 indigene Gesellschaften Nordamerikas berücksichtigt, und in diesem Fall ist meine Auswahl erkennbar willkürlich erfolgt.
Von meiner ursprünglichen Liste habe ich die Ohiaht, Kwakiutl, Kutenai, Cheyenne, Delaware, Seminolen, Mojave und einige Shoshonen gestrichen. Aber es besteht kein Zweifel, dass unser Wissen über einige dieser Ethnien dem über die Lilloet, Shuswap und Thompson entspricht, die ich alle berücksichtigt habe. Die Ursache ist, dass unter den indigenen Völkern Amerikas eine große Vielfalt innerhalb eines kulturellen Grundmusters herrschte (wie ich es ausdrücken würde), und ich war bestrebt, so viele Gesellschaften wie nur möglich zu überprüfen, um herauszufinden, ob es zu einem Wandel im kulturellen Grundmuster selbst gekommen ist. Eine langwierige Suche ergab, dass es keinen derartigen Wandel gab. Aber als ich das Material über die indigenen Völkern Nordamerikas sammelte, schüchterte mich dessen großer Umfang in gewisser Weise ein. Einige Gesellschaften, wie die der Haida, Ojibwa, Dakota und Crow konnten schlicht nicht ausgelassen werden, da sie von elementarer Bedeutung waren und unsere Informationen über sie vergleichsweise gut sind. Von den restlichen Ethnien wählte ich einige aus, die als repräsentativ angesehen werden können.
Im Ganzen beschäftige ich mich mit 80 unzivilisierten Gesellschaften. Aus ihrem kulturellen Verhalten werde ich meine ersten Schlüsse ziehen. Im kulturellen Verhalten der ausgelassenen Gesellschaften war, soweit mir bekannt, kein Sachverhalt, der gegen diese Schlussfolgerung sprechen würde. Ich weise auf diese Tatsache hin, auch um den kritischen Leser zu informieren, dass meine Nachforschungen in Wirklichkeit ein weiteres Feld abdeckten als die gedruckte Studie.
Unser vergleichsweise geringes Wissen über die Sozialgeschichte zivilisierter Gesellschaften führt dazu, dass eine induktive Vorgehensweise über weite Strecken nicht möglich ist. Dies kann nicht oft genug und nicht deutlich genug gesagt werden. Ich bin so weit gegangen, in meiner ersten Anmerkung unverblümt zu sagen, dass Forschungen, die allein auf historischen Zeugnissen basieren, nicht beanspruchen können, erschöpfend zu sein. Hier denke ich insbesondere an die sozialen Vorschriften und Konventionen. Ich gebe zu, dass ich die zur Zeit bedauernswerterweise weit verbreitete Gewohnheit von Historikern und Altertumswissenschaftlern mit Sorge betrachte, von der Annahme auszugehen, dass die Vorschriften und Konventionen, die in einem Jahrhundert vorherrschen, aus dem wir unmittelbare Kenntnisse haben, ebenfalls in einem vorangegangenen oder nachfolgenden Jahrhundert vorherrschen, aus dem wir keine unmittelbaren Kenntnisse haben. Immer wenn sich unser Wissen vervollständigt, erkennen wir, dass in jeder dynamischen Gesellschaft die Art, wie die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern reglementiert wird, einem stetigen Wandel unterworfen ist. Bis zum Nachweis des Gegenteils ist es falsch anzunehmen, dass in jeder dieser Gesellschaften die sozialen Gesetzmäßigkeiten statisch und unveränderlich sind, selbst für drei Generationen.
Meine einführende Untersuchung zivilisierter Gesellschaften beschränkt sich auf die Sumerer, Babylonier (bis zum 20. Jahrhundert v. Chr.), Griechen, Römer, Angelsachsen und Engländer. Einige Anmerkungen mache ich auch über die arabischen Mauren, und einige Vermutungen leite ich über die Perser, Makedonier, Hunnen und Mongolen ab. Die Kürze der Erörterung liegt, wie eben erwähnt, vor allem darin begründet, dass die Quellenlage im Vergleich zu anderen antiken Kulturen vergleichsweise dürftig ist. Aber ich merkte auch, dass die Tragweite der Aussagen, die ich zu vermitteln erhoffte, verdeckt werden könnte, wenn ich zu sehr ins Detail ging. Aus diesen Gründen habe ich es unterlassen, auf viele Gesellschaften, die ich gerne erörtert hätte, näher einzugehen. Die Kreter, Hethiter, Assyrer und Inder wurden deswegen völlig außen vor gelassen. Beiläufig nehme ich Bezug auf die anfängliche Vitalität der Germanen, aber die darauf folgende Lethargie zum Beispiel der Westgoten und Lombarden oder der Dynastie der Merowinger wird nicht einmal erwähnt.
Die Gesetzgebung der Germanen hingegen wird lediglich in ihrem Zusammenhang mit angelsächsischen Bräuchen beschrieben. Außerdem habe ich es für besser befunden, jegliche Bezugnahme auf den Aufstieg der Sassaniden bis zur Ära des Heraklius auszuklammern, genauso wie auch andere große Umbrüche, die in Westeuropa, Nordafrika und dem westlichen Asien nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reichs und vor der Eroberung durch Mohammed stattfanden. Ich habe versucht unnötige Kontroversen zu vermeiden, indem ich die Präsentation römischer Quellen abgebrochen habe, sobald ich die Veränderungen in der Gesetzgebung zusammengefasst hatte, die zwischen der Gründung der Stadt, der Römischen Republik und dem Kaiserreich des Augustus stattfanden. Von den Ereignissen der nächsten drei Jahrhunderte lege ich nur allgemeine Hinweise vor. Meine Gründe hierfür werden im Text genannt. Hinsichtlich der Venetianer, Portugiesen und Spanier habe ich nicht mehr getan als darauf hinzuweisen, dass sie offenkundig zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedliche soziale Energie zeigten. Ich habe es dem Leser überlassen, die Relevanz meiner Schlussfolgerungen für die historische Entwicklung der Preußen, Holländer, Franzosen und anderer moderner Gesellschaften selbst zu beurteilen. Der Verzicht auf Material hierzu fiel mir sehr schwer. Aber ich dachte, dass sonst der induktive, von Einzelbeobachtungen ausgehende Charakter meiner Arbeit verletzt oder jedenfalls gefährdet worden wäre.
Ich habe erwähnt, dass es im kulturellen Werdegang der Gesellschaften, soweit ich weiß, nichts gibt, was im Widerspruch zu den Schlussfolgerungen steht, die ich gezogen habe. Zu einem späteren Zeitpunkt möchte ich einige meiner Auslassungen nachreichen. In der Zwischenzeit hege ich die Hoffnung, dass ein Student der Geschichte, wenn er von den hier präsentierten Fakten beeindruckt ist, meine Urteile anhand der kulturellen Entwicklung einer Gesellschaft, die in seinem Fachgebiet liegt, überprüfen wird.
Da ich nun so kühn war, in meiner Studie auf unsere eigene Gesellschaft einzugehen, sollte ich eine frühzeitige Warnung aussprechen, die Schlussfolgerungen nicht zu wörtlich auf die Gegenwart anzuwenden, weder im Sinne einer Reform noch in einem fanatischen Geist. Meine eigene Auffassung zu diesem wichtigen Thema steht implizit in meinen Schlusssätzen.
Wenn ich nun Beweise vorlege, so habe ich jede Anstrengung unternommen, akkurat und prägnant vorzugehen, aber trotz aller Sorgfalt und einiger Überarbeitungen können sich Fehler eingeschlichen haben. Sollten welche gefunden werden, wäre ich froh, darauf aufmerksam gemacht zu werden. Die Studie ist nicht kurz; dennoch ist sie an manchen Stellen extrem verdichtet. Es wäre tatsächlich einfacher gewesen, sie in sieben Bänden zu schreiben statt in einem. Das mag, auch wenn ich nichts beschönigen möchte, einige der Ungeschicklichkeiten erklären, die ich selbst in der Arbeit finde. Mein einziges Ziel war, mich so auszudrücken, dass kein Zweifel darüber bleibt, was ich jeweils genau meine. Ich hoffe, dass das zweite und dritte Kapitel seinen Zweck, Belege zu liefern, erfüllt. Sicher muss keiner die beiden Kapitel von Anfang bis Ende durchlesen. Ich bezweifle, dass ein durchschnittlicher Leser aus diesen Kapiteln viel mitnimmt; aber wenn er die Anmerkungen durchblättert, wird er etwas Aufschlussreiches finden.
Das Buch besteht aus drei Teilen: Text, Anmerkungen und Tafeln. Im Text beziehe ich mich allein auf die Fakten und interpretiere sie ohne vom zentralen Argument abzuschweifen. In den Tafeln werden die Fakten überblicksartig bzw. auf statistische Weise angeführt. Die Anmerkungen16 sind zweifacher Art. Zum einen zitiere ich Autoritäten zu den im Text gemachten Aussagen, vergleiche und analysiere gegenteilige Auffassungen und erhelle schwer verständliche Textstellen. Ich betrachte diesen Teil des Buchs als wichtig. Die Zeiten sind vorbei, in denen wir eine Aussage akzeptieren konnten, weil sie ein einzelner Experten bestätigt hat, oder in denen wir darauf verzichten konnten, andere Experten zu konsultieren oder zu zitieren. Die Bücher und Artikel, auf die ich mich beziehe, habe ich gründlich gelesen und verglichen. Zum anderen habe ich die Anmerkungen verwendet, um meine Annahme zu stützen, dass unzivilisierte Gesellschaften nur gemäß ihrer Riten klassifiziert werden können, sowie um auf einige Missverständnisse hinzuweisen, die durch die gängige Methode entstehen, die ursprünglichen Begriffe zu übersetzen. Ich bin entsetzt über die Fehler, in die wir geführt wurden durch den ungenauen Gebrauch von Begriffen wie „Hoher Gott“, „Geist“, „Gott“, „Dämon“, „böser Geist“, „lokale Gottheit“ usw. Es besteht für mich kein Zweifel, dass jemand, der diese Wörter ohne Bezug zum ursprünglichen Begriff und dessen angenommener Bedeutung verwendet, Gefahr läuft, oberflächlich zu sein oder gar fehlgeleitet zu werden.
Am besten, ich beschreibe den allgemeinen Plan der Studie, indem ich erkläre, wie das Buch geschrieben wurde.
Im Jahr 1924, nach zehn Jahren intellektueller Untätigkeit – fünf davon brachte ich im Krieg zu, fünf in Geschäften, die einige Reisen erforderten – beschloss ich, mich dem Studium zwischenmenschlicher Angelegenheiten zu widmen. Während meiner folgenden Lektüren stieß ich auf die alten sumerischen Gesetze, den Kodex Hammurabi, die neu veröffentlichen Gesetze der Hethiter und der Manu. Ich war sehr beeindruckt von deren Eigenart. Zu dieser Zeit waren die Arbeiten der Psychoanalytiker bereits Gegenstand lebhafter Debatten. Aus meinem Studium antiker Werke, gelesen im Licht der griechischen und römischen Geschichte, tauchte der Verdacht auf, dass die Psychologen mit ihren Vermutungen über die „Zivilisation“ richtig liegen könnten. Und je mehr ich historische Gesellschaften studierte, desto mehr war ich davon überzeugt, dass die Fakten ihre Theorien stützen könnten. Aber ich erkannte, zu keiner klaren Entscheidung kommen zu können, bis ich nicht sowohl die zivilisierten als auch die unzivilisierten Gesellschaften in der Studie berücksichtigte, die durchzuführen ich mich entschlossen hatte. Nachdem ich dann einige historische Belege auf zwei kurzen Seiten zusammengestellt hatte, suchte ich die Universität von Cambridge auf, um die Beziehung zwischen sexuellen Möglichkeiten und dem kulturellen Zustand bei unzivilisierten Ethnien zu erforschen. Als ich zum ersten Mal einige Autoritäten im Bereich der Ideen und des Verhaltens unzivilisierter Völker konsultierte, begann ich zu verzweifeln. Es schien nämlich, dass aus den historischen Belegen kaum Einsichten gewonnen werden konnten. Die Sprache der Sozialanthropologen schien nicht immer exakt zu sein, und ich konnte viele Aussagen in Bezug auf das Denken der Unzivilisierten, die einige Sozialanthropologen unhinterfragt zu akzeptieren schienen, nicht glauben. Ich lebte eng mit den unzivilisierten Menschen zusammen und stellte die Glaubwürdigkeit so vieler Behauptungen in Frage, die meine Vorgänger zufriedengestellt zu haben schienen. Glücklicherweise hatte ich in meiner ersten Übersicht (die 37 Spalten enthielt) die Riten der Völker ebenso berücksichtigt wie ihre Glaubensüberzeugungen; und nach und nach erwuchs aus dieser Datensammlung jener Zusammenhang, der in meinen ersten Kapiteln beschrieben wird. Der Zusammenhang war tatsächlich eindrucksvoll. Aber ich sah ein, dass ich erst dann fähig sein würde, die verschiedenen Arten der kulturellen Entwicklung oder den Grund für den offenkundigen Zusammenhang zu verstehen, wenn ich Erkenntnisse über die Ideen gewinnen würde, die dieses Verhalten veranlassten. Auf diese Weise stieß ich auf das Phänomen, das gemeinhin, aber auch missverständlich „die Evolution der Religion“ genannt wird.
Im Zuge meiner Darstellung des Datenmaterials musste ich einige anthropologische Schriften stark kritisieren oder abträglich kommentieren; aber ich kann ehrlich sagen, dass ich meine Anmerkungen auf jene Schriften beschränkt habe, bei denen zu befürchten war, dass sie allgemein und unkritisch für bare Münze genommen werden könnten. Ich bin nicht so weit gegangen, unabhängig von meiner Problemstellung jede Auffassung zurückzuweisen. Ich hoffe, dass die Kritik, die ich geübt habe, richtig verstanden wird: Sie entsprang einzig dem Bestreben nach einer größeren Exaktheit und Klarheit. Üblicherweise fand ich heraus, dass die gründlichen Vorarbeiten notwendig waren, bevor irgendeine Beschreibung von Ideen und Verhalten unzivilisierter Gesellschaften als zuverlässiger Nachweis akzeptiert werden kann.
Nachdem ich die Analyse durchgeführt und aus den anthropologischen Befunden einige Schlussfolgerungen gezogen hatte, ging ich im vierten Kapitel dazu über, die Auffassungen kompetenter Psychologen hinsichtlich der Auswirkungen verpflichtender Keuschheit zu skizzieren. Geübte Psychologen werden erkennen, dass dieser Teil meiner Arbeit grundlegend ist. Sie werden vielleicht über die Unverfrorenheit eines Mannes verwundert sein, der seine Fragestellung aus einer durch und durch behavioristischen Perspektive angeht und dann bei der Psychoanalyse Hilfe sucht. Aber ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Ich glaube nicht, dass menschliche Gesellschaften irgendwie anders als durch ihr Verhalten klassifiziert werden können. Dennoch war ich gezwungen, einen behavioristischen Ansatz zu wählen. Der springende Punkt meines Arguments ist, dass die Psychoanalytiker aus völlig anderen Überlegungen heraus vermutet haben, dass die Fakten so sind, wie ich sie gefunden habe.
Es wird allgemein angenommen, dass unweigerlich eine Form von Neurose entsteht, wenn sexuelle Triebe durch verpflichtende Kontrollen unterdrückt werden. Wenn wir unter einer Neurose etwas Abnormales verstehen, wird diese Auffassung durch die Fakten nicht gestützt. In gewisser Weise leiden alle zivilisierten Menschen unter einer Neurose. Es ist also üblich, das Wort für den Nervenzustand verhaltensgestörter Personen vorzubehalten. In den letzten Jahren wurde diesen Personen in unserer Gesellschaft große Aufmerksamkeit zuteil, tatsächlich sogar in allen Teilen der westlichen Zivilisation. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Anzahl derjenigen, deren Verhalten erfolgreich angepasst werden konnte, weit größer ist. Einige dieser angepassten Personen sind im genauen Sinn des Begriffs nicht weniger neurotisch als diejenigen, die wir als verhaltensgestört bezeichnen. Ihre Abnormalität scheint aber erlaubt zu sein. Auf dem Instrument des menschlichen Verhaltens werden manche Noten als normal bezeichnet, andere als abnormal, manche als exzentrisch, andere als kriminell. In jedem dieser Fälle liegt der Unterschied nicht in einer anderen Art eines Verhaltens, sondern dem Grad der Ausprägung, und die jeweiligen Grenzen werden von jeder Gesellschaft willkürlich festgelegt. So wie die meisten von uns Kavaliersdelikte begehen und dennoch nicht als Verbrecher eingesperrt werden, so ist jeder von uns eines Verhaltens schuldig, das, wenn man es übertreibt, einen Nervenzustand hervorruft, den ein Arzt als Neurose diagnostizieren würde. Wenn die verpflichtende Keuschheit streng ist, scheinen manche Personen nicht fähig, sich an ihre kulturelle Umgebung anzupassen. Aber unabhängig von unserer Sympathie ihnen gegenüber dürfen wir nicht kaschieren, dass es auch die gibt, deren Anpassung gelungen ist. Und wir dürfen den relativen Charakter unserer Urteile nicht vergessen. Tatsache ist, dass in der Mehrzahl der Fälle verpflichtende Keuschheit soziale Energie hervorbringt; und nur selten führt eine dauerhafte Reglementierung zu dem, was fachlich eine Neurose genannt wird.
Im Schlusskapitel präsentiere ich meine Ergebnisse und verorte den kulturellen Prozess in einem, wie mir scheint, angemessenen Bezug zu biologischen und universellen Prozessen. Unsere Vorgänger hielten sich nicht immer an eine klare Unterscheidung zwischen diesen drei Prozessen, und ich habe versucht ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen, das in den Köpfen durch die Kontroversen entstand, die das Auftreten der darwinistischen Hypothesen begleiteten. Auch in diesem Kapitel nehme ich nicht das Ergebnis vorweg. Schritt für Schritt führe ich zur Schlussfolgerung hin und die letzte Stufe meiner Argumentation erreiche ich erst in den letzten beiden Abschnitten.
Die Studie ist also nicht mehr als sie vorgibt. Sie enthält schlicht und einfach die Resultate einer Untersuchung und eine Interpretation der Fakten, die die Untersuchung ans Licht gebracht hat. Ich habe keinen Versuch unternommen, ein großes theoretisches Gebäude zu errichten; vielmehr habe ich Fundamente freigelegt, auf denen später ein Bauwerk errichtet werden kann. Intellektuelle eines gewissen Temperaments werden geneigt sein, die Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe, zu akzeptieren. Um meine mühsamen Nachweise werden sie sich keinen Deut kümmern. Möglicherweise werden sie auch behaupten, dass ich ihnen nichts sagen kann, was sie nicht schon zuvor gewusst hätten. Sie dürfen bei ihrer Meinung bleiben. Menschen mit einem anderen Temperament werden meine Schlussfolgerungen vehement ablehnen. Sie werden die Belege sehr genau unter die Lupe nehmen. Für sie habe ich geschrieben. Für sie habe ich auch rigoros unterschieden zwischen Fakten und meiner Interpretation der Fakten.
Diejenigen, die den viel weitreichenderen Forderungen der Unschärferelation in der Physik ein offenes Ohr geliehen haben, mögen vor meinem unbeugsamen Determinismus zurückscheuen; aber zur Zeit habe ich nicht vor, dem etwas hinzuzufügen, was ich hier und an anderer Stelle dargelegt habe. Ich anerkenne und betone sogar den freien Willen individueller menschlicher Wesen. Wenn nötig bin ich bereit, die Spontanität eines einzelnen Elektrons zu akzeptieren. Diese Sachen berühren nicht das Grundprinzip des Determinismus, wie ich ihn verstehe und definiere. Weiter möchte ich mich nicht verteidigen, bis durch neue Forschungsergebnisse über das Verhalten der Elektronen kompetente Forscher die Position, die ich eingenommen habe, als unhaltbar nachweisen.
Für jemanden, der nicht vertraut ist mit den Methoden wissenschaftlicher Forschung, könnten die präsentierten Fakten übermäßig vereinfacht erscheinen. Der Grund dafür ist, dass ich so lange mit der Veröffentlichung gewartet habe, bis ich das Gefühl hatte, sie wirklich verstanden zu haben. Wenn einer zögern sollte, die Nachweistafel zu akzeptieren, weil deren Inhalte zu gut aufgehen, dann lautet meine Erwiderung, dass die Wahrheit meistens eine einfache Sache ist. Wenn eine vermeintliche Wahrheit kompliziert daherkommt, dann ist es wahrscheinlich, dass wir etwas noch nicht richtig verstehen. Ich glaube, dass viel unscharfes, offensichtlich abstruses Wissen, das gegenwärtig im Umlauf ist, aufgrund von Forschungen entsteht, die auf schnelle Ergebnisse aus sind und deren Daten verfrüht veröffentlicht werden. Sie tauchen auf, um dieser Auffassung der Wahrheit zu widersprechen. Die Verbindung vorehelicher Keuschheit mit dem von mir so genannten deistischen Kulturzustand ist mir seit 1929 bekannt, und ich gestehe einen kurzen Artikel über dieses Thema geschrieben zu haben. Aber ich zog das Manuskript vor der Veröffentlichung zurück.
Im Frühling 1930 stieß ich auf die Existenz einer ungeregeltverpflichtenden bzw. gelegentlichen vorehelichen Keuschheit. Einige Monate später hatte ich die Nachweistafel vervollständigt, wie sie nun vorliegt. Dann spielte ich erneut mit dem Gedanken einer Veröffentlichung, entschloss mich jedoch die Tafel vor dem öffentlichen Auge zurückzuhalten, bis ich mir gewiss war, ihre Bedeutung wirklich zu verstehen. Ich bin mir bewusst, dass es üblich ist, die Resultate einer ausgiebigen Forschung in einer Serie kurzer Artikel zu präsentieren, und dass es gefährlich ist, mit einer Konvention zu brechen. Jedoch war ich nicht überzeugt, dass die Tafel begrüßt oder gar überprüft werden würde, wenn nicht zur selben Zeit eine Interpretation der Erkenntnisse beigefügt wird.
Kurz gesagt, meine Schlussfolgerung ist, dass der kulturelle Werdegang einer jeden menschlichen Gesellschaft erstens auf der dem Menschen inhärenten Natur basiert, und zweitens auf dem Energielevel, auf dem sich eine Gesellschaft aufgrund ihrer sexuellen Vorschriften befindet. Je nach dem Grad an Keuschheit, der eingefordert wird, lassen sich die sexuellen Vorschriften, die menschliche Gesellschaften in der Vergangenheit ausgeprägt haben, in sechs Klassen einteilen. Diese haben sechs unterschiedliche Energielevel, drei geringere und drei höhere. Alle unzivilisierten Gesellschaften wiesen einen der drei niedrigen Energielevel auf. Zivilisierte Gesellschaften befanden sich immer in einem der drei höheren Energiezustände. Jeder der drei Zustände niedrigerer Energie produziert einen bestimmten kulturellen Zustand. Diese kulturellen Zustände nenne ich zoistisch, manistisch und deistisch. Von den Zuständen höherer Energie erzeugt nur einer einen bestimmten kulturellen Zustand, nämlich den rationalistischen. Die beiden anderen Zustände sind solche expansiver und produktiver Energie.
Eine deistische Gesellschaft kann expansive Energie entfalten, aber, solange sie nicht rationalistisch geworden ist, keine produktive. Wenn eine rationalistische kulturelle Schicht ihre Energie für eine Generation zurückhält (die Werke rechtfertigen keine genauere Zeitangabe), scheint ihre kulturelle Tradition verstärkt zu werden durch ein Element, das ich menschliche Entropie genannt habe. Genau wie das zweite Gesetz der Thermodynamik bzw. das Gesetz der Entropie die Richtung des universalen Prozesses zu zeigen scheint, so scheint der oben genannte Vorgang die Richtung des kulturellen Prozesses anzuzeigen – daher sein Name. Solange die Gesellschaftsschicht fortfährt eine hohe Energie zu zeigen, verändert sich ihr kultureller Werdegang in Richtung des kulturellen Prozesses. Wenn, warum auch immer, ihre Energie sinkt, entfernt sich deren Verhalten von dieser Richtung. Soweit meine Kenntnis geht, gab es keine Gesellschaftsschicht, die sich länger als eine halbe Generation nach dem Auftreten menschlicher Entropie in Richtung des kulturellen Prozesses bewegt hat. Warum das so ist, muss der spekulativen Philosophie überlassen bleiben.
Bezüglich der dem Menschen inhärenten Natur sollte meine Verwendung des Begriffs „Konzept“ erklärt werden. Ich verwende ihn nicht als Psychologe. Ich weise auf die unveränderliche Reaktion des Menschen gegenüber dem „Außergewöhnlichen“ hin, mache aber keinen Versuch, sie zu erklären oder zu analysieren. Wenn ich sage, dass die menschliche Kultur (wie definiert) offensichtlich auf dem Konzept einer wunderbaren Qualität (oder Macht) gegründet ist, die sich in etwas Außergewöhnlichem oder Transzendentem manifestiert, dann meine ich damit vor allem, dass dies der kleinste gemeinsame Nenner unserer vier kulturellen Zustände zu sein scheint. Ich bin weit davon entfernt nahezulegen, dass in den Köpfen aller Menschen eine klar formulierte Vorstellung dieser Qualität oder Macht vorhanden ist oder war. Dennoch will die Verwendung des Begriffs „Konzept“ implizieren, dass dies meiner Meinung nach so ist oder war. Es war mir jedenfalls nicht möglich, mich auf eine andere einfache Weise auszudrücken. Also hoffe ich, dass der Begriff, wenn auch nicht ganz befriedigend, als ein nützliches Werkzeug zur Beschreibung eines Geisteszustands verwendet werden kann, den es ersichtlich gibt und gab.
Ich allein bin verantwortlich für die Methoden, die ich verwendet, und die Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe. Dennoch bin ich vielen Gelehrten für ihre Hilfe und Unterstützung zu Dank verpflichtet.
Im Jahr 1931 präsentierte ich dem Prüfungsausschuss für Forschungsstudien der Universität Cambridge eine Dissertation zum Thema dieses Buchs. Dr. R. R. Marett, Dozent für Gesellschaftsanthropologie der Universität Oxford, und Mr. F. C. Bartlett, Professor für Experimentalpsychologie an der Universität Cambridge, agierten als Doktorväter. Durch ihre Kritik lernte ich viel, und ich bin ihnen dankbar für ihren fortwährenden Einsatz.
Das Manuskript wurde von Januar bis März 1933 überarbeitet. Im März 1934 wurde das letzte Kapitel erweitert und um einige Anmerkungen ergänzt.
London, den 26. Mai 1934 Joseph D. Unwin
16 In der Übersetzung sind sie mit kleinerer Schrift in den Text integriert.
1. Die Anlage der Studie
1.1 Die Untersuchung
Sowohl unter zivilisierten wie auch unzivilisierten Völkern herrscht ein enger Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten, Sex zu praktizieren, und dem Zustand der Kultur, und ich hielt es für lohnenswert, eine detaillierte Untersuchung dieses Sachverhalts durchzuführen. Die Resultate meiner Untersuchung und die Schlussfolgerungen, die ich aus den Fakten gezogen habe, werden auf den folgenden Seiten präsentiert.





























