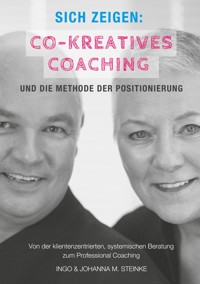
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Johanna M. und Ingo Steinke, Gründer der Coaching Company COATRAIN(R), eröffnen eine Perspektive auf Coaching, die weit über klassische Konzepte hinausgeht. Statt sich auf non-direktive Gesprächsführung zu beschränken, laden sie Coaches ein, Haltung zu zeigen, Position zu beziehen und den Dialog aktiv mitzugestalten. Dieses Buch macht deutlich: Coaching kann mehr sein als Prozessbegleitung - nämlich ein ehrlicher, lebendiger Austausch, der Menschen in ihrer beruflichen Rolle stärkt und echte Entwicklung ermöglicht. "Wir lieben den Dialog. Den Dialog miteinander. Den Dialog mit unseren Coachees. Wir lieben es, zu diskutieren, zu reflektieren, zu streiten. Und wir lieben es, den Dingen auf den Grund zu gehen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Wie wir das Thema Positionierung entdeckt haben
Wer wir sind und wie wir arbeiten
Warum reine Prozessbegleitung ein Holzweg ist
Was wir meinen, wenn wir Coaching sagen
Was ist Positionierung?
Positionierung in der Praxis
Techniken der Positionierung
Die erklärende Positionierung
Optionen schaukeln
Co-kreative Suchprozesse
Die Lagebeschreibung
Sparring
Proaktives Zuhören
Sich zeigen
Paradoxe Hinterlegungen
Arbeit mit Metaphern
Sich wundern und professionelles Nicht-Wissen
Wahrnehmungspositionen doppeln
Co-kreatives Sprechdenken
Co-kreativer Input
Vom Deuten zum Begreifen
Zu guter Letzt
Bücher, die uns inspiriert haben
Vorwort
Wir lieben den Dialog. Den Dialog miteinander. Den Dialog mit unseren Coachees. Wir lieben es, miteinander zu diskutieren, zu reflektieren, zu streiten. Wir lieben es, Dingen auf den Grund zu gehen.
Darum haben wir dieses Buch geschrieben.
Anfangs haben auch wir geglaubt, dass ein guter Coach ein Wegbegleiter ist, der einem Menschen oder einem Team hilft, sich besser zu verstehen, sich zu entwickeln, damit sie ein Problem selbst erkennen und selbst lösen. Wobei es der Coach vermeidet, inhaltlich etwas dazuzutun, Rat zu geben, Lösungsvorschläge zu machen. Das Dogma: Der Coachee findet die Lösung, der Coach kümmert sich um die Methode. Non-direktive Gesprächsführung hat man sie früher genannt oder auch klientenzentrierte Beratung. Heute heißt sie: Prozessbegleitung.
Doch Coaching, wie wir es verstehen, ist mehr – viel mehr. Es befähigt und konfrontiert. Es stärkt Menschen in ihren Rollen, es stärkt sie in ihrem Wirken, hier und jetzt in ihrem Arbeits-Leben.
Wir sagen: Ein Coach zeigt sich. Er formuliert eigene Positionen und Ansichten, an denen sich der Coachee reiben kann. Ein Coach bereichert mit Sichtweisen, auf die der Coachee noch nicht einmal im Traum käme. Ein Coach bringt sich gleichwertig und auf Augenhöhe ein – mit kreativen Analysen und überraschenden Perspektiven. Wohlwollend in der Beziehung, kritisch in den Fragen, prägnant in den Positionen.
Kurz: Ein Coach positioniert sich.
Er übernimmt Verantwortung. Nicht nur für einen guten Coaching-Prozess, sondern auch für die Ergebnisse. Er ist mitverantwortlich dafür, was ausgehend vom Coaching im Leben und Arbeiten des Coachees passiert.
Co-kreativ nennen wir unsere Methode. Unsere Vision: ein Coaching, das miteinander schöpferisch ist, auf Augenhöhe einfallsreich, Seite an Seite erfinderisch, kooperativ-produktiv.
Ein Coaching, das die Zahnlosigkeit und Ineffizienz der Prozessbegleitung aufhebt.
Der Weg, den wir vorschlagen, ist unbequem. Unsere Methode erfordert Mut und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Gemütlicher ist es, einen Klärungsprozess zu begleiten und ordentlich methodisch zu fragen. Da kann man sich zurücklehnen. Das ist angenehm, aber so was von unzeitgemäß. In der digitalen, agilen Arbeitswelt sind wir viel stärker als noch vor 10 oder 20 Jahren gefordert, rasch zu klaren Entscheidungen zu kommen. Eine gute Coachende ist effizient.
Sie kann sich nicht raushalten. Sie kann sich nicht auf eine neutrale Position zurückziehen, selbst wenn sie es wollte. Vielleicht ist sie sich ihres Einflusses und ihrer Verantwortung nicht bewusst, wiegt sich in der Illusion, dass sie die Veränderungen beim Coachee nur von außen begleitet. Doch das stimmt nicht: Coaching hat Konsequenzen.
Es kann einen Lebensweg prägen, dazu führen, dass Menschen ihren Job behalten oder nicht, dass eine Firma den Turnaround schafft oder nicht, dass sich Menschen in ihren Jobs verwirklichen oder weiter ausbrennen, dass sie ihre Berufung finden oder weiter nur ihrem Beruf nachgehen.
Wie gesagt: Die meisten Coaches arbeiten heute prozessbegleitend. Sie orientieren sich an der klientenzentrierten, nicht-direktiven Gesprächsführung oder dem in dieser Tradition stehenden systemischen Arbeiten. Begründet wurde dieser Ansatz von C. G. Jung, ausformuliert von Carl Rogers, Kurt Lewin hat ihn auf Organisationen übertragen. Der Ansatz geht davon aus, dass der Coachee die notwendigen Ressourcen oder Fähigkeiten besitzt, die nur entwickelt werden müssen; dass er die Lösung in sich trägt und sie sich lediglich bewusst machen muss.
Der Mensch steht bei diesem Ansatz im Mittelpunkt, nicht das Problem. Die Problemlösungsfähigkeit soll entwickelt werden, nicht nur das akute Problem gelöst werden.
Einerseits ist dieser Ansatz richtig: Psychische Systeme tragen Lösungen und Ressourcen in sich. Doch das Dogma der Prozessbegleitung ist zur Ideologie geronnen. Der Nichteinmischungspakt zwischen Coach und Coachee begrenzt das Coaching.
Immer wieder gibt es Situationen, in denen der Coachee eben nicht die Lösung kennt, eben nicht weiß, wie es weitergehen kann, eben nicht weiß, wie er mit einer Herausforderung umgehen soll. Er begreift vielleicht noch nicht einmal den Ernst der Lage. Ihm fehlt es an allem, an Wissen, Ressourcen, Erfahrungen, ihm fehlt es an Zeit. Er braucht Lösungen, rasch, er braucht Handlungsstrategien, sehr bald.
Angestellte und Führungskräfte, Freiberufler und Gründer, in Firmen und Agenturen, in Politik, Medien, Wirtschaft brechen regelmäßig auf in Gegenden, für die es keine Landkarten gibt. Sie wollen an ihr Ziel kommen, aber kennen den Weg nicht, wissen nicht, wo die Sümpfe liegen, welche Bergketten zu überqueren sind, wie undurchdringlich der Dschungel ist. Es reicht nicht, innere Klärungs- und Lösungsprozesse zu begleiten. Die Coachees brauchen neue Landkarten.
Diese Arbeitsweise müssen wir zurück ins professionelle Coaching holen. Coaching, wie wir es verstehen, ist viel stärker angesiedelt auf der Schwelle zwischen Person und Funktion – und viel weniger stark angesiedelt in den Tiefen der Persönlichkeit.
Ein solches Coaching, um ein Bild zu bemühen, ist wie ein Kochevent: Coach und Coachee stehen gemeinsam am Herd und geben ihre Zutaten gleichwertig in den Topf, sie kreieren zusammen ein Menü, das es vorher noch nicht gegeben hat. Um im Bild zu bleiben: Eine (Unternehmens-)Beraterin würde Topf und Rezept liefern und von außen vorgeben, wie das Gericht gelingt. Eine Therapeutin würde darüber reflektieren, wie es für einen war, als Mutti oder Vati gekocht haben, wie man alte Rezepte verlernen könnte oder ob der Vorgang des Kochens überhaupt der richtige ist, während man am Herd steht und in leere Töpfe guckt.
Die Angst, Menschen etwas überzustülpen, können wir im Coaching getrost ablegen. Denn die Coachees sind ja Ich-starke Persönlichkeiten und keine Therapiefälle. Sie brauchen einen Sparringspartner an ihrer Seite, der sich mit ihnen den Realitäten stellt und gemeinsam mit ihnen Lösungen und Strategien entwickelt.
Schon lange denken wir über dieses Buch nach. Und zugleich zögern wir. Denn überall wo Ideologien herrschen, ist die Gefahr groß, dass abweichende Meinungen als Angriff verstanden werden.
Aber darum geht es uns nicht. Wir wollen nicht abwerten oder umkrempeln, nicht kränken oder attackieren. Wir wollen ergänzen und anreichern, schärfen und entwickeln. Wir wollen Coaching besser machen – indem wir uns auf seine Wurzeln besinnen.
Wir lieben das Gespräch. Auch mit euch, auch mit Ihnen. Wie schön wäre es, wenn dieses Buch der Beginn einer neuen Unterhaltung wäre. Wie bereichernd.
Johanna M. & Ingo Steinke Hamburg, Januar 2023
Wie wir das Thema Positionierung entdeckt haben
Ariel: Liebe Johanna, lieber Ingo, wir sitzen hier in der Graustraße in Hamburg-Bergedorf, es ist Dezember 2022 und echtes norddeutsches Nieselwetter. Ich bin Journalist, wir kennen uns seit zehn Jahren, ihr habt mich eingeladen, zusammen mit euch mehrere Tage, vielleicht werden es auch Wochen, über das Thema Positionierung zu reden. Ihr werdet euch gleich ausführlicher vorstellen, ich werde mich auch vorstellen, aber lasst uns gern erst mal mitten hineinspringen ins Thema: Wie begann es? Woher kommt euer Ansatz, dass ein Coach sich positionieren soll, sich zeigen soll, auch mal Reibung erzeugen soll?
Ingo: Es muss um das Jahr 2004 gewesen sein. Wir saßen im Auto, es war dunkel, wir fuhren von Berlin zurück nach Hamburg, auf dem Rückweg von einer Supervision. Wir waren beschwingt, wir sagten uns: Das hat unheimlich gutgetan. Wir hatten mit unserer Supervisorin zig Stunden über alle möglichen Themen geredet, über unsere berufliche Entwicklung, unsere privaten Rollen, unsere Paarbeziehung. Und nun überlegten wir im Auto, woher unsere Hochstimmung rührte.
Johanna: Das Gespräch hat gutgetan. Nicht in einem therapeutischen Sinne, es war wohltuend an der Schnittstelle zwischen Person und Rolle: Wir fühlten uns plötzlich richtig und sicher, justiert in unseren Rollen als Coachende, Führungskraft, Partnerin, Frau und Mann. Das haben die meisten von uns schon mal erlebt: wie bereichernd es ist, wenn einem eine Andere auf Augenhöhe begegnet, eine, die anders denkt und andere Erfahrungen gemacht hat und einem diese zur Verfügung stellt. Und während wir darüber diskutierten, wurde uns klar: Weniger die gut gestellten Fragen unserer Supervisorin waren es, die uns so erfüllten, sondern dass sie sich als Mensch gezeigt hatte, dass sie Stellung bezogen hatte. Sie hatte uns in der Tiefe berührt.
Ingo: Da sind wir wohl zum ersten Mal auf dieses große Thema aufmerksam geworden. Und haben uns gefragt: Weiß unsere Supervisorin eigentlich, wie wichtig das für gutes Coaching ist, was sie da macht? Ist sie sich bewusst, dass ihre Positionierung der Kern ihrer Arbeit ist, der eigentliche Grund dafür, wie sehr das Gespräch mit ihr wirkt? Ich gestehe: Ich habe sie bis heute nie darauf angesprochen. Aber die Frage hat mich seither beschäftigt.
Johanna: Ich erinnere mich an eine andere Situation einige Jahre später, wir saßen an unserem Lieblingsstrand an der Ostsee, blickten aufs Meer und unterhielten uns über einen Coaching-Prozess, der mir nicht aus dem Sinn ging:
Ein Coachee von mir war zugleich in therapeutischer Behandlung, um zu lernen, selbstsicherer zu werden, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Erst kürzlich hatte er eine Funktion in der Nähe des Vorstandsvorsitzenden übernommen – und war jetzt von ihm zu einem Abendessen eingeladen worden. Mit seiner Therapeutin hatte der Coachee erarbeitet, getreu dem Auftrag, die Einladung abzulehnen. Er sollte sich abgrenzen, Nein sagen und die Absage selbstsicher formulieren. Mein Coachee erzählte mir davon. Ich wusste gleich: Ich konnte jetzt nicht einfach weiter kluge Fragen stellen. Stattdessen habe ich ihm meine Position zur Verfügung gestellt, sinngemäß: „Sie können alles absagen und überall Nein sagen, ganz souverän, aber ein Nein zu einer Abendessen-Einladung des Vorstandsvorsitzenden könnte der Beziehung zu ihm und Ihrer Zugehörigkeit zu dieser Unternehmensebene erheblich schaden. Und nun sagen Sie mir mal: Wo liegt eigentlich der Hase im Pfeffer bei dieser Einladung?“ Es stellte sich heraus, dass der Coachee nicht wusste, wie er sich an dem Abend verhalten, was er anziehen, worüber er sich unterhalten, wen er als Begleitung mitnehmen und wie er als schüchterner, introvertierter Ingenieur den Small Talk gestalten sollte. Das alles haben wir erarbeitet.
Ich fragte also Ingo im Strandkorb: Sag mal, wenn man so einen Fall hat – ist es dann okay, wenn ich mich da hinstelle und sage, wie ich die Sache sehe? Wir sahen uns an und lachten, weil die Frage im ersten Moment so absurd klang.
Aber auf den zweiten Blick klang sie gar nicht so absurd. Sondern es war einer der Momente, in denen wir die Methode der Positionierung durchdacht haben, erkannten, wie wichtig es sein kann, sich mit Einschätzungen und Ansichten einzumischen – und Haltungen, Prinzipien, Erfahrungswerte und Know-how in das Coaching einzuspeisen. Uns wurde klar, wie regelmäßig wir das bereits praktizierten in unseren Coachings. Wie hilfreich es für unsere Coachees war, wie wirksam.
Ariel: Was wurde aus dem Coachee?
Johanna: Er hat nicht nur den Abend wunderbar gemeistert, sondern auch seinen Job lange behalten.
Ariel: Während die Therapeutin, die einfach nur ihren Stiefel weitergemacht und das Ausgangsthema bearbeitet hätte, der Karriere des Coachees womöglich geschadet hätte.
Ingo: Der nächste Schritt war ein Vortrag vor Wirtschaftspsychologen über Coaching in Unternehmen. Das muss 2007 gewesen sein. Ich hatte steile Thesen vorbereitet, unter anderem: „Coaching ist methodenplural und beendet das Schulendenken – Bezeichnungen wie Systemisches Coaching sind ein Zeichen mangelnder Professionalität.“ Und: „Die fröhliche Idylle der Prozessbegleitung ist vorbei – wer professionell coacht, macht sich die Hände schmutzig.“ Damit meinte ich, dass man sich als Coach eben nicht einfach aus der Affäre ziehen kann, sondern mit eigenen Positionen sehr wohl das Handeln der Coachees beeinflusst. Implizit, explizit oder indem man eigene Positionen zurückhält.
Ariel: Yes! Ich liebe ja solche klaren Sätze. Wobei ich die Formulierung nicht so glücklich finde, wenn ich das anmerken darf.
Ingo: Darfst du, und sehe ich genauso. Heute würde ich sagen: Das Coaching ist nicht die Vorbereitung auf die Realität, das Coaching ist die Realität.
Johanna: Den letzten Anstoß gab vielleicht Helmut Schmidt – so um das Jahr 2013 herum muss das gewesen sein. Wir haben gemeinsam sein Buch „Ein letzter Besuch“ gelesen. An einer Stelle äußert sich Schmidt anerkennend über den chinesischen Premierminister Zhao Ziyang: Er bewundere dessen unbeirrbare, glasklare Urteilskraft. An dieser Stelle dachten wir: Das ist es! Auch im Führungshandeln, auch im Coaching geht es um Urteilskraft, um den Willen und Mut zu einer eigenen Beurteilung. So hatte Schmidt 1982 begonnen, gegen den Willen seiner Partei und weiter Teile der Gesellschaft, US-amerikanische Atomraketen in Deutschland stationieren zu lassen …
Ingo: … übrigens waren auch wir damals strikt dagegen …
Johanna: … jedenfalls war Helmut Schmidt aus seiner Urteilskraft heraus zu der Einschätzung gelangt: Dieser Weg mag noch so unpopulär sein, er ist trotzdem richtig. Den Prozess der politischen Urteilsbildung skizzierte Schmidt in einigen Sätzen am Beispiel eines chinesischen Politikers. Wir merkten auf – und begannen, uns mit politischer Urteilsbildung zu befassen. Denn auch wir müssen uns in unseren Coachings fortwährend ein Urteil bilden. Wobei ich das Wort nicht mag: Urteile werden vor Gericht gefällt, ein Coach ist keine übergeordnete, richtende Instanz. Treffender wäre: Verortung. Es geht darum, eine eigene Position einzunehmen.
Ingo: Vielleicht waren wir umso aufgeschlossener für dieses Thema, als wir die Folgenlosigkeit traditionellen, neutralen, sich nicht positionierenden Coachings schmerzhaft am eigenen Leib erlebt hatten. 1998, als unsere Karriere so richtig Fahrt aufgenommen hatte, haben wir als Coaches in einer Unternehmensberatung gearbeitet und wurden mit Coaching-Anfragen geradezu überhäuft. Unsere Aufgabe: die Motive der Menschen zu erfragen, die psychodynamischen Hintergründe ihres Handelns aufzudecken. Es war ein endloses, zähes Fragenstellen, das wir da über Stunden und Stunden veranstalteten. Allenfalls kam heraus, dass jemand gern Macht ausübte, keine Verantwortung übernehmen wollte oder einen respektlosen Kommunikationsstil hatte. Es war eine Art intellektuelle Selbstbefriedigung, eine Lust daran, dass die Leute ihre Projektionen durchschauten, ihre Gefühle spürten und Selbsterkenntnisse hatten.
Johanna: Mal abgesehen davon, dass das relativ wenig mit ihrem Job, ihrer Rolle im Betrieb zu tun hatte und eher so etwas wie „Psychotherapie light“ war, haben wir gemerkt, dass dieses rein prozessbegleitende Arbeiten auf dem Papier wunderbar klang, wir aber immer wieder an den Notwendigkeiten des Geschäftslebens vorbeicoachten.
Ingo: In diesen bis zu 100 Coaching-Prozessen, die wir da pro Jahr durchführten, haben wir früh begriffen, wie schnell der Einsatz von psychotherapeutischen Methoden im Coaching Menschen psychisch destabilisieren kann. Wie wichtig es demgegenüber ist, die Menschen im Coaching zu stabilisieren und im Erfolg zu halten, anstatt in ihrer Psyche herumzustochern. Ein Coach, der nichts anderes kann, löst Sachen aus, die jemanden vielleicht erfolglos werden lassen, weil dieser Mensch plötzlich im Job nicht mehr handlungsfähig ist.
Johanna: Ja, im Angesicht einer ernsten Realsituation, in der Coachees ja oft stecken, darf man bisweilen nicht rein methodisch handeln. So empfinde ich es manchmal bis heute, wenn Coaches einseitig mit ihrer Lieblingsmethode daherkommen. Da frage ich mich manchmal, ob sie damit nicht auch „über Leichen“ gehen. Eben weil sie, auf ihrer Methode beharrend, bestimmte Dinge unterlassen oder gar nicht thematisieren oder Wunden aufreißen, die man zu diesem Zeitpunkt besser nicht angerührt hätte. Die am Thema vorbeiarbeiten und sich und ihre Methode ins Zentrum stellen, anstatt zu bearbeiten, was der Coachee in seiner Rolle braucht.
So ist im Lauf der Jahre unser Credo erwachsen: Im Coaching geht es nicht darum, einfach nur seine Lieblingsmethoden anzuwenden. Sondern passgenau jene Methoden und Techniken zu nutzen, die ein Coachee oder ein Klientensystem in dieser Situation brauchen. Ein Coach benötigt Methodenpluralität, ein Spektrum an Handlungsmöglichkeiten, um klienten- und situationsangemessen professionell agieren zu können.
Ariel: Er muss also nicht nur sein Coaching-Handwerk sehr gut beherrschen, sondern braucht auch jede Menge Lebens- und Berufserfahrung. Wie ging es weiter?
Ingo: 2015 habe ich mich intensiv mit Coaching-Kompetenzen befasst und den Artikel „Prozessbegleitung? Nein Danke!“ geschrieben. Ich hatte damals echt die Nase voll von dieser ewigen Leier von Coaching als Prozessbegleitung – und habe richtig einen rausgehauen. Den Artikel wollte erst keiner haben, am Ende ist er in einem Fachportal für HR-Professionals erschienen. Sinngemäß habe ich damals geschrieben, dass ein Coach ein ausgeprägtes Urteilsvermögen haben muss, damit er die Vorgänge in Unternehmen verstehen und einordnen kann. Erkennen, wann man es tatsächlich mit Mobbing oder Burn-out zu tun hat und wann es eher vorschnelle Modediagnosen sind.
Oder, ganz praktisch: erkennen, dass jemand keine vernünftigen Präsentationen macht, und ihm dies nicht nur zurückmelden, sondern ihm auch zeigen oder gar vormachen, wie man anders präsentiert. Hier kommt das Lehrende, das Entwickelnde des Coachings der ersten Stunde wieder zum Vorschein, des „Managers as Coach“. Das erste Coaching-Lehrbuch, 1971 in den USA erschienen, beschreibt Coaching als pädagogische Disziplin: Die Manager sollten einen innerbetrieblichen Learning-Parcours für ihre Nachwuchskräfte kreieren, in dem sie all das lernen, um eines Tages als Manager Verantwortung übernehmen zu können.
Ariel: Der Coach als Lehrer. Interessanter Gedanke – und ziemlich weit weg von dem, wie es heute ist.
Johanna: 2016 kam für mich eine gesundheitliche Krise – und auch dort habe ich erfahren, wie sehr Positionierung das eigene Mindset erweitert, ja verändert. Meine gesundheitlichen Begleiter waren sehr unterschiedlich. Die einen hielten sich raus und ließen mich mit meinen Sorgen und Ängsten allein; andere sprachen offen mit mir, bezogen Position, sagten, was sie dachten und an meiner Stelle tun würden. Dank ihnen wusste ich viel besser, wo ich stand. Das hat meine Genesung beschleunigt.
Ingo: Noch eine Quelle wollen wir nicht unerwähnt lassen. 2017 gesellte sich unser Kollege Uwe Wunder zu unserem Geschäftsführungsteam dazu. Uwe ist Betriebswirt durch und durch und hat uns mit dem Ansatz des „Co-creation Paradigm“ vertraut gemacht. Die Philosophie dahinter in einem Satz: Kunden beteiligen sich in Workshops an der Produktentwicklung und helfen so dem Unternehmen, in Highspeed zeitgemäße und nützliche Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Dieser Ansatz, gemeinsam und auf Augenhöhe mit seinen Kunden Neues zu entwickeln, hat uns inspiriert und uns einen Schlüsselbegriff für unsere Arbeit beschert: co-kreatives Coaching.
Ariel: Übersetzen könnte man das mit miteinander-schöpferisches Coaching. Wir werden sicher darauf zurückkommen. What a journey! Rund 20 Jahre Nachdenken, erprobt in Hunderten Coachings, weiterentwickelt in zig Diskussionen, im Strandkorb, auf Spaziergängen, bei Autofahrten. Ein Nachdenken und Nachfühlen, das nun in dieses Buch mündet. Das bringt mich zu der Frage: Wie arbeitet ihr zusammen? Und warum habt ihr mich eingeladen, mit euch dieses Gespräch zu führen?
Wer wir sind und wie wir arbeiten
Ariel: Und, wenn ich gleich noch eine Frage stellen darf: Warum dieses Buch?
Ingo: Ab den 1990er-Jahren fand etwas statt, was ich gern das „Einbrechen des reflexiven Methodenrepertoires aus Counseling & Psychotherapy ins Coaching“ nenne. Meint: Wir Coaches verstanden es immer besser, dank all dieser wundervollen quasitherapeutischen Fragetechniken, Reflexionsprozesse auszulösen und kognitiv-emotionale Themen klug und versiert zu begleiten – hinderliche Glaubenssätze und emotionale Blockaden zu lösen, problemorientiertes Denken und Handeln zu transformieren, das Festhängen in Defiziten zu bearbeiten.
All das können wir mit diesen Tools und Techniken, und das schätzen wir sehr. Allein: Es ist eine sehr einseitige Ausrichtung des Coachings auf innere Vorgänge, auf rational-emotionale Entwicklungsprozesse.
Doch Coaching ist mehr. Menschen kommen mit ganz konkreten Schwierigkeiten zu uns. Sie wissen nicht weiter. Wer Probleme hat, braucht Lösungen. Wer Herausforderungen hat, steht vor dem Nichts und braucht Strategien. Die Menschen wissen aber nicht, wie sie mit einer Situation umgehen sollen. Sie begreifen vielleicht noch nicht einmal den Ernst der Lage. Wir vergleichen die Arbeit mit Herausforderungen im Coaching gern mit einer Reise in unbekannte Gegenden. Wobei auch diese Metapher hinkt. Denn da weißt du schon, dass du dich auf einer Reise befinden wirst und es in unbekannte Gegenden geht. Noch nicht einmal das wissen Menschen, die vor Herausforderungen stehen.
Ariel: Schönes Bild. Man hat vielleicht schon den Koffer gepackt, weiß, dass es bald losgeht, aber tatsächlich sitzt man bereits im Bus und ist unterwegs.
Johanna: Ein gutes Beispiel dafür ist die Coronakrise: Plötzlich bricht etwas über unsere Gesellschaft herein, für das es keine Blaupause gibt. Und alle fragen sich: Was ist hier los? Wo befinden wir uns hier? Die Fallzahlen steigen oder sinken, wir müssen handeln, die Alten schützen, die Krankenhäuser offen halten, die Schulen vielleicht schließen, zugleich tauchen große Fragen auf: Welche Rolle hat die Wissenschaft? Was passiert da gerade mit unserer Gesellschaft, mit unserer Freiheit, mit unserem Miteinander? Was bedeutet das für den Umgang mit Mitarbeitenden, die einfach sagen: Lecko mio, wir laufen weiter ohne Maske durch die Gegend? Eine solche Situation, wie wir sie in der Pandemie erlebt haben, kommt in Unternehmen regelmäßig vor: Die Mitarbeitenden oder Führungskräfte brechen auf in Gegenden, für die es keine Landkarten gibt.
Ingo





























