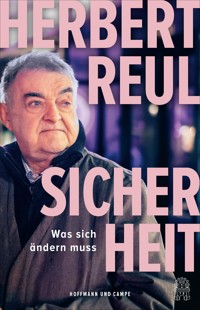
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Herbert Reul war schon immer ein Politiker, der sich nicht vor schweren Aufgaben scheut. Im Gegenteil, im Laufe seiner Amtszeit als Innenminister von NRW bringt er zahlreiche Maßnahmen in Gang zur Bekämpfung von Terrorismus, Cyberkriminalität und Clanverbrechen. Dabei zeichnet ihn aus, dass er sich weder von Panikmache noch von Aktionismus leiten lässt. Besonnen geht er vor, und dennoch konsequent. Nicht selten legt er den Finger in die Wunde und benennt klar, was sich ändern muss. Sein dringendstes Anliegen: Das Leben in Deutschland wieder sicherer machen. Sein Buch ist ein alarmierender Weckruf – und eine Anleitung, wie die Politik Schritt für Schritt das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herbert Reul
Sicherheit
Was sich ändern muss
Für die Polizistinnen und Polizisten und alle anderen Menschen, die jeden Tag ihren Dienst für die Gemeinschaft leisten
Eine kleine Träumerei
9
1
Eine Art Spezialfall: Clankriminalität
13
2
Das Schlimmste, was es gibt: Kindesmissbrauch
45
3
Eine neue Kategorie: Cybercrime
79
4
Bedrohliche Entwicklung: Gewalttaten
91
5
Das Erstarken der Ränder: Extremismus auf dem Vormarsch
115
6
Was sich ändern muss
157
Kurze Fragen – schnelle Antworten
171
Anmerkungen
177
Eine kleine Träumerei
Ein Buch schreiben? Mach’ ich nie! Das war meine felsenfeste Überzeugung, und ich habe mich auch wirklich sehr lange Zeit daran gehalten. Ich war immer der Meinung, dass ein Prestigeobjekt dieser Art nicht zu mir passt und ich nur Zeit und Energie verschwende, um etwas zustande zu bringen, was lediglich die politische Konkurrenz und ein paar meiner besten Freunde interessiert. Aber: Ich habe meine Ansicht geändert. Nicht, weil ich plötzlich eitel geworden wäre, sondern weil ich meine, dass ein Buch meinem Herzensanliegen ein Stück weiterhelfen kann.
Ich beobachte die Entwicklung in Deutschland schon seit langem mit großer Sorge. Nicht nur, was einzelne Aspekte angeht, etwa die beunruhigenden Zahlen von Gewaltdelikten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.[1] Sondern vor allem, dass uns die Bürger von der Fahne gehen, um es salopp zu sagen. Der normale, staatstragende Bürger1, das Rückgrat unserer Gesellschaft, glaubt uns Politikern nicht mehr. Er traut uns nicht mehr zu, dass wir die anstehenden Aufgaben lösen und mit den sich häufenden Schwierigkeiten klarkommen. Viele sind sogar der Ansicht, dass wir die Probleme nicht nur nicht lösen, sondern ständig neue verursachen. Immer mehr Menschen glauben, dass wir es nicht schaffen, ihnen ein sicheres Umfeld für sich und ihre Familie zu bieten. Sie haben das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und in das politische Leben verloren. Wir haben es bei der Bundestagswahl 2025 gesehen: Die sogenannten etablierten Parteien verlieren insgesamt, die extremen Ränder – die im Grunde schon ziemlich breite Randstreifen sind – gewinnen. Woran liegt das? Ein Grund besteht darin, dass die Menschen den Eindruck haben, wir seien nicht ehrlich. Wir würden die Probleme, sofern wir sie überhaupt sehen, nicht benennen, geschweige denn etwas unternehmen, um sie zu lösen. Sie haben das Gefühl, nicht gehört und nicht ernst genommen zu werden. Deshalb wenden sie sich denen zu, die sagen: Ihr habt recht, wir verstehen euch. Selbst wenn zu vermuten ist, dass deren Vorschläge für die Lösung der komplexen Fragen nicht ausreichen.
Ich will mich aber mit dieser Entwicklung nicht abfinden. »Geht halt alles den Bach runter« – das ist nicht meine Art zu denken. Ich will werben für diesen Staat, der – bei allen Mängeln, die ich nur zu gut kenne – im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Wir haben viele Jahrzehnte ausgezeichnet gelebt, und Frieden mit unseren Nachbarn hatten wir außerdem. Das verdanken wir den Regeln, die wir uns gegeben haben und an die wir uns halten, überwiegend jedenfalls. Das klingt vielleicht ein bisschen wie in der Schule, wenn das politische System der Bundesrepublik durchgenommen wird. Und ich war ja tatsächlich auch etliche Jahre Lehrer, aber jetzt schreibe ich als Politiker, weil ich dieses verloren gegangene Vertrauen der Bürger zurückgewinnen will. Ich stemme mich als Minister dagegen, dass dieses Vertrauen weiter zerbröselt. Und das tue ich durch ganz praktische Arbeit.
Neuling in der Innenpolitik
Als Armin Laschet 2017 sein Kabinett in Nordrhein-Westfalen bildete, fragte er mich, ob ich als Minister zu ihm kommen würde. Ich war überrascht, als er mir eröffnete, dass er mich für das Innenministerium vorgesehen hatte. Ich wandte ein, dass ich doch kein Jurist sei. »Eben deshalb«, lautete seine Antwort. Er wollte einen »Praktiker« an dieser Stelle. Ich war damals Abgeordneter im Europäischen Parlament und mit einer Menge sehr interessanter Themen beschäftigt. Ich habe einige Tage überlegt und dann Laschets Angebot angenommen. Obwohl ich 65 Jahre alt war und auch alles beim Alten hätte lassen können. Aber es war die großartige Chance, Wirkung zu zeigen, etwas zu unternehmen, um den Leuten zu beweisen: Wir tun was, ihr müsst nicht radikal wählen, um etwas zu verändern.
Ich habe mich ordentlich in die Arbeit reingehängt, oft begleitet von den Angriffen der Opposition oder mancher Medien. Manchmal war das ärgerlich, hin und wieder kränkend, aber im Wesentlichen hat auch das genützt. Denn ich erlebe die positiven Seiten einer gewissen Bekanntheit auf vielen abendlichen Veranstaltungen. Mittlerweile sitzen da nicht nur Zuhörer aus meiner eigenen Partei, sondern auch zunehmend aus anderen politischen Lagern oder parteilich ganz Ungebundene. Sie haben von mir erfahren, sind neugierig und wollen wissen, was ich als Innenminister unternehme, welche Ziele ich habe und wie ich vorgehe. Dieses Interesse ist gut, es ist der Ansatzpunkt für eine funktionierende Beziehung zwischen Bürger und Staat beziehungsweise Politik. Mein großes Ziel ist, den Bürgern das Vertrauen zurückzugeben, dass dieser Staat funktioniert und sie sich auf ihn, auf mich und viele Tausend Beamte und Angestellte verlassen können. Dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Regeln durchzusetzen, die unser Zusammenleben organisieren – ohne dass sich der Staat in jeden Kleinkram einmischt. Mein Vorgehen ist relativ einfach: Ich bin ehrlich und benenne die Probleme, die ich sehe und die den Bürgern auf den Nägeln brennen, ohne Politikergeschwurbel. Und ich versuche, diese Probleme zu lösen, aber keine Wunder zu versprechen. Das ist Gift fürs Vertrauen. Denn jeder weiß, dass Wunder nur in anderen Sphären stattfinden und die hiesige Wirklichkeit auf konkrete Maßnahmen angewiesen ist. Auf viele kleine Schritte.
Höchstes Gut: unser Rechtsstaat
Ich merke, dass meine Haltung ganz gut ankommt. Dass sich immer mehr Leute für mein Vorgehen interessieren und ich im direkten Kontakt an so einem Abend eine Menge erklären kann. Ich vertiefe das Verständnis und kann das Zutrauen stärken. Solche persönlichen Begegnungen sind das Beste. Nun schlage ich mir allerdings schon eine Menge Abende um die Ohren, trotzdem erreiche ich auf diese Weise nicht so viele Menschen, wie ich gern möchte. Deshalb habe ich mich entschlossen, auch die zweitbeste Möglichkeit zu nutzen: Ich schreibe doch ein Buch! Damit ich auch denen, die nicht zu den Veranstaltungen kommen, erklären kann, warum mir der Rechtsstaat so wichtig ist und ich mich für ihn einsetze. Bei aller Bodenständigkeit bin ich nämlich doch ein Träumer: Ich träume davon, dass mein Erklären und mein praktisches Tun etwas verändern können. Und ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass das Vertrauen in den Staat wieder wächst. Denn das brauchen wir, dringend.
1Eine Art Spezialfall: Clankriminalität
Ein ziemlich heißes Eisen habe ich kurz nach meinem Amtsantritt angefasst, die Bekämpfung der Clankriminalität. Zum Glück wusste ich vorher nicht ganz genau, was ich mir damit auflud, insbesondere was den Vorwurf angeht, dass ich ganze Gruppen von Menschen stigmatisieren würde. Sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht oder mir zumindest Zeit damit gelassen. Das wäre bedauerlich gewesen. Denn zum einen ist das eine große, wichtige Baustelle, die keinen Aufschub duldet. Zum anderen habe ich ausgerechnet an diesem Thema extrem viel gelernt. Es hat mir für alle anderen Aufgaben klargemacht, worum es geht: Probleme, die vorhanden sind, musst du benennen. Es hat nicht nur keinen Zweck, die Augen davor zu verschließen, es ist sogar schädlich. Denn die Menschen wissen, dass die Probleme da sind. Und wenn du so tust, als ob nichts wäre oder abwiegelst: »Das wird aufgebauscht, ist gar nicht so, stellt euch nicht so an«, dann fühlen sie sich verkackeiert. Man liefert ihnen frei Haus einen Grund dafür, einem das Vertrauen zu entziehen. Sie sehen die jungen Männer, die in teuren Autos herumgurken, die sie unmöglich mit einem normalen Gehalt finanzieren könnten. Sie haben den Eindruck, dass ganze Straßenzüge von Familien bewohnt werden, die offenbar in anderer als rein zufälliger nachbarschaftlicher Verbindung stehen. Sie erleben, dass sich die Polizei kaum noch oder nur in größerer Besetzung in solchen Ecken bewegt. Dass da ein Milieu existiert, das nach seinen eigenen Regeln lebt und sich nicht um die allgemeingültigen schert. Und wenn ich dann käme und sagte: »Ne, so kann man das aber nicht sehen« – dann können die Bürger ja nur zu dem Schluss kommen, dass der Staat nicht mehr funktioniert.
Was ist eigentlich Clankriminalität?
Bei der Bekämpfung von Clankriminalität gibt es eine Menge Hürden. Die erste ist ganz grundsätzlicher Art, nämlich die Frage: Gibt es so was wie Clans überhaupt? Ich meine, ja. Die offizielle Definition, die die Polizeien aus Bund und Ländern gemeinsam entwickelt haben, besteht aus zwei Teilen. Zum einen beschreibt sie einen Clan als »informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist«.[2] Der Verband ist hierarchisch organisiert, das Zugehörigkeitsgefühl ausgeprägt. Zum anderen fördert diese Zugehörigkeit das Begehen der Tat sowie die Behinderung der Aufklärung bei kriminellen Delikten von Clanmitgliedern. Die eigenen Normen und Werte werden über die Rechtsordnung gestellt. Das klingt vielleicht ein bisschen soziologisch, ist aber eine gute Arbeitsdefinition.
Nur mal ein Beispiel für diese »eigene« Regelung und den Zusammenhalt selbst verfeindeter Familien. Im Oktober 2023 gab es in Essen eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei türkisch-arabischstämmigen Familien. Beteiligt waren rund 40 bis 50 Personen. Zeugen berichteten, dass Baseballschläger und Äxte zum Einsatz kamen, Autoscheiben zu Bruch gingen. Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei schon beendet. Aber die Kollegen konnten vier Verletzte in den umliegenden Krankenhäusern ausfindig machen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Fünf Durchsuchungsbeschlüsse führten dazu, dass zwei Fahrzeuge und sechs Mobiltelefone sichergestellt wurden. Also eigentlich eine gute Ausgangslage für ein ordentliches Gerichtsverfahren. Aber dazu kam es nicht. Warum? Weil die – immerhin krankenhausreif geschlagenen – Verletzten nicht bereit waren, eine Aussage zu machen. Es mag mehrere Gründe dafür geben, doch zusammengefasst ist es einfach so: Die regeln das unter sich und nur unter sich. Das ist eine durch nichts legitimierte Paralleljustiz.
Clanbegriff als Diskriminierung?
Es gibt viel Kritik an der Tatsache, dass wir überhaupt von Clans reden und ihnen bestimmte Merkmale zuordnen. Allein das führe schon dazu, dass man eine Menge Menschen in einen Topf wirft und ihnen unterstellt, kriminell zu sein, sie damit also stigmatisiert. Da haben die Kritiker recht, das darf nicht sein. Ich nehme diesen Einwand auch sehr ernst und wische ihn keineswegs leichtfertig vom Tisch. Nur weil jemand in eine bestimmte Familie hineingeboren wird, ist er noch kein Straftäter, wird es vielleicht auch nie. Wir dürfen also nicht jeden verdächtigen, der den Namen einer Clanfamilie trägt. Das tun wir aber auch nicht. Aus ethischen Gründen nicht, aber auch ganz praxisbezogen. Wenn wir pauschal alle Mitglieder für verdächtig hielten, kämen wir auf ein paar Zigtausend. Das entspricht aber nicht dem, was wir rein mengenmäßig an Delikten sehen. Wir wissen, und ich bestätige es hier noch mal ausdrücklich, dass nur ein Bruchteil der Clanmitglieder kriminell ist.
Wenn wir in unserem Lagebild von Clans und Clankriminalität sprechen, dann meinen wir damit, dass wir ein Raster anlegen, um bestimmte Strukturen zu erfassen beziehungsweise im Detail zu betrachten. Es ist eine Arbeitshypothese, mit der wir Muster erkennen können. Klingt trocken, ist es aber nicht. Clankriminalität und organisierte Kriminalität treten oft gemeinsam auf, sind aber nicht dasselbe. Richtig ist: Clans betätigen sich in kriminellen Geschäftsfeldern organisiert und planvoll. Doch außerdem fallen viele ihrer Mitglieder auch durch Alltagskriminalität auf. Das ist beispielsweise ein Unterschied zur Mafia. Ein weiterer besteht darin, dass Clans eben familiär verbunden sind, was sie auch von anderen kriminellen Vereinigungen unterscheidet, etwa Rockern. Noch mal: Längst nicht jeder Clanangehörige mit einem bestimmten Familiennamen ist kriminell. Und nicht alle sind bis in die kleinsten Verästelungen direkt miteinander verwandt. Die weit verzweigten kriminellen Kontakte und Verflechtungen stützen sich bei der Clankriminalität allerdings häufig auf verwandtschaftliche Beziehungen oder auf solche, die so verstanden werden. Das Vertrauensverhältnis untereinander und die vollständige Abschottung nach außen spielen dabei eine große Rolle. Die soziale Organisation eines Clans zeichnet sich häufig durch eine hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis aus.
Typisch für kriminelle Clans ist, dass sie in Großstädten aktiv sind. Besonders betroffen sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Berlin. Ein Grund dafür ist der Niedergang der Industrie in einigen dieser Regionen in den 1980er-Jahren. Insbesondere im Ruhrgebiet standen als Folge viele Wohnungen und Häuser leer oder waren sehr billig zu haben. Deshalb haben sich dort viele Flüchtlinge niedergelassen und natürlich andere nachgezogen. Das ist ja logisch: Als Migrant geht man möglichst dorthin, wo man jemanden kennt. Weil einem das Netzwerk hilft, in der Fremde Fuß zu fassen. Viele Bundesländer haben so gut wie kein Problem mit Clans. In der Innenministerkonferenz hören mir die Kollegen der anderen Länder immer sehr interessiert zu, haben aber den Eindruck, dass es sie nicht betrifft. Wir stellen unsere Erkenntnisse zur Verfügung, und wer meint, es könnte sich lohnen, mal genauer draufzuschauen, ist herzlich willkommen.
Die Hauptgeschäftsfelder der Clans sind Drogenhandel, Zwangsprostitution und Menschenhandel, Geldwäsche und illegales Glücksspiel – mit internationalen Verbindungen. Der Kampf gegen diese Kriminalität wurde als sicherheitspolitisches Ziel im Koalitionsvertrag damals, als ich Minister wurde, festgelegt, und auch bereits vor dieser Regierung gab es Debatten über dieses Problem. Ich fand, dass man es nun anpacken müsse.
Als ich begann, mich damit zu beschäftigen und mir zu überlegen, was man unternehmen könnte, erhielt ich eine Menge wohlmeinende Ratschläge. Die überwiegende Mehrheit lautete zusammengefasst: »Lass das lieber, es ist ein heißes Eisen, und du kannst nicht viel gewinnen dabei. Kriegst nur Ärger.« Ja, das kann man so sehen, und der Ärger ist tatsächlich auch nicht ganz gering. Als mir die Fachleute vom Landeskriminalamt (LKA) die Dringlichkeit des Themas erklärten, wiesen sie mich auch auf die Risiken hin. »Man wird Ihnen vorwerfen, dass Sie ganze Familien stigmatisieren, und am Ende gelten Sie außerdem als ausländerfeindlich.«
Mir war aber klar, dass man gar nicht erst anzufangen brauchte, wenn man das Problem der Clankriminalität nicht beim Namen nannte. Denn die Existenz dieser Strukturen und Delikte ist exakt das, was das Vertrauen in den Staat unterminiert. Das ist etwas anderes als ein »normaler« Krimineller, der sich persönlich bereichert und den wir erwischen oder blöderweise eben nicht. Das kommt halt vor, dafür hat jeder Verständnis. Doch die Waffen strecken vor systematischen Vergehen, vor der totalen Missachtung der staatlichen Autorität – damit würden wir den Rechtsstaat aufgeben. Wir würden akzeptieren, dass sich hier jemand den Prinzipien und Werten unserer Gesellschaft überlegen fühlt und seine eigenen Regeln befolgt. Das wäre das Ende des Rechtsstaats. Deshalb ist es mir so wichtig zu zeigen: Wir gucken nicht weg, wir lassen uns das nicht gefallen, wir unternehmen was dagegen.
Auf der Suche nach einem Muster
Wir – das heißt die Beamten und Spezialisten im Landeskriminalamt und ich – haben also geschaut, wo man anpacken kann. Wir haben festgestellt, dass uns eine Auswertung auf Grundlage von Staatsangehörigkeit oder Geburtsort nicht weiterbringt, weil häufig Dokumente fehlen, Identitäten unklar bleiben und Staatsangehörigkeiten aufgrund der Migrationsgeschichte stark variieren. Um den zu analysierenden Personenkreis einzugrenzen, haben wir deshalb zur Identifizierung solche Familiennamen gewählt, die den Erkenntnissen aus der Polizeiarbeit zufolge typisch sind. Die Namensliste wird fortlaufend aktualisiert, im Lagebild 2023 sind 118 Familiennamen identifiziert. Es sind die Namen von türkisch-arabischen Familien, manchmal mit unterschiedlichen Schreibweisen, aber alles in allem etwas über hundert Familien. Zehn von diesen Namen beziehen sich auf ungefähr die Hälfte der Tatverdächtigen (46,3 Prozent).[3]
Ich muss es noch mal betonen: Nicht jeder, der einer dieser Familien angehört oder einen entsprechenden Nachnamen trägt, ist ein Krimineller. Aber eine relevante Anzahl von Vergehen kann man einigen wenigen Namen zuordnen.
Ich habe anfangs gezögert, das so deutlich auszusprechen, denn natürlich kann es passieren, dass jemand zu Unrecht verdächtigt oder ganz allgemein stigmatisiert wird, weil er halt den Namen einer Clanfamilie trägt. Kinder werden in der Schule gemobbt, die Arbeitssuche wird erschwert oder was auch immer. Das ist schlecht. Von einer genetisch begründeten Kriminalität eines Menschen gehe ich wirklich nicht aus. Ich musste jedoch abwägen und habe mich dafür entschieden, ein Lagebild Clan-kriminalität zu erstellen, das tatverdächtige Personen mit von den Ermittlungsbehörden als clanrelevant definierten Familiennamen in Beziehung bringt. Es geht nur um Großfamilien, die Bezüge zur Bevölkerungsgruppe der Mhallamiye oder zum Libanon aufweisen. Es ist eine Methode, die nicht optimal ist, aber die Alternative wäre, dass ich gar nichts tue. Wir hängen diese Namen auch nicht an ein öffentliches Schwarzes Brett, nicht mal im Lagebericht. Dort führen wir nur Nennungen auf wie »Clan Y«, »Clan O« usw.
Namen als weitgehend eindeutige Kriterien zu benutzen, ist keine vorauseilende Schuldzuweisung, sondern wie gesagt in erster Linie eine Arbeitshypothese, die wir seit 2017 anwenden, eben aufgrund unserer Erfahrungen. Mit Nationalitätsangaben allein kommt man nämlich nicht weit. Rund die Hälfte der registrierten Tatverdächtigen besitzt (auch) die deutsche Staatsangehörigkeit, ein großer Teil die syrische oder libanesische. Etliche sind staatenlos, oder es gibt gar keine Informationen über die Nationalität. Mit den Familiennamen aber konnten wir ein Raster anlegen und überhaupt mal richtig anfangen zu arbeiten, Muster feststellen, aufgrund derer wir dann weiter untersuchen konnten. Der erste Bericht, in dem wir Straftaten zu Familien zuordneten, erschien 2019. Seitdem erstellt das LKA jedes Jahr einen, vorgestellt immer mit Fokus auf die Familien mit Bezügen zur Bevölkerungsgruppe der Mhallamiye oder zum Libanon.
»Mhallamiye« ist nicht jedem geläufig. Grob gesagt handelt es sich dabei um kurdische Großfamilien, deren Ursprünge im Südosten der Türkei liegen. Sie stellten dort eine ethnische Minderheit dar und wurden auf vielfältige Weise diskriminiert und unterdrückt. Ein großer Teil von ihnen floh daher ab den 1920er-Jahren in den Libanon und nach Syrien, wo sie aber auch nicht anerkannt, geschweige denn integriert wurden. Der Bürgerkrieg im Libanon 1975 bis 1990 trieb viele dieser Familien nach Deutschland und in andere europäische Staaten.[4] Hier bei uns landeten sie im Grunde in einer Sackgasse. Sie wurden in der Regel nicht als Asylberechtigte anerkannt, sondern lediglich geduldet. Diese Duldungen wurden immer wieder verlängert, mündeten aber meist nicht in einen sicheren Status. Die Menschen lebten also über Jahre oder gar Jahrzehnte in der Schwebe, in einer existenziell nicht sicheren Situation. Das ist extrem belastend für die Psyche, aber auch ganz praktisch ein Problem: Es findet keine Integration statt, unter anderem weil die Duldung nicht für eine Arbeitserlaubnis ausreicht. Diese Menschen hatten keine Aussicht auf Zukunft, die mussten sich selbst etwas organisieren.
Die Entwicklung hin zu dem, was wir heute vor uns haben, war vielleicht nicht gerade zwangsläufig, aber wurde von den skizzierten Umständen sicherlich begünstigt. Ich muss ganz selbstkritisch sagen: Es war ein Fehler, dass wir, dass die Politik in Deutschland sich nicht frühzeitig und wirkungsvoll gekümmert hat. Wir haben dreißig Jahre lang nichts getan, und jetzt stehen wir vor einem Problem. Die Bürger haben uns schon früher darauf aufmerksam gemacht, aber wir Politiker wollten nicht zugeben, dass da was gehörig in die falsche Richtung gelaufen war. Deshalb hat sich das auch alles derart verfestigt, dass wir mittlerweile nur unter enormen Schwierigkeiten etwas ändern können. Aber nützt nichts, darüber zu jammern, wir müssen nach vorn gucken und mit den nun mal entstandenen Strukturen umgehen.
1000 Nadelstiche
Die entscheidende Frage lautet: Wie kriegen wir es hin, diesen Menschen zu vermitteln, dass man sich an staatliche Regeln halten muss? Dass es einen Rechtsstaat gibt und nicht jeder seine eigenen Regeln setzen kann? Dass bei uns nicht das Recht der Familie gilt, sondern das des Staates? Theorie nützt bestimmt nichts. Bei Vortragsveranstaltungen zum Thema »Rechtsstaat« säße ich sicher allein im Saal, und ein paar erläuternde Prospekte helfen auch nicht weiter. Deshalb habe ich mich für eine ganzheitliche Strategie der Bekämpfung entschieden. Ein wesentlicher Teil davon ist das Konzept »Learning by Erleben«. Anders gesagt: 1000 Nadelstiche oder Erfahrungen.
Beispiel Shisha-Bars. Oft haben wir einige für ein paar Tage schließen können, nicht weil wir irgendjemanden bei großen kriminellen Aktivitäten erwischt hätten, sondern etwa weil es keine Rauchmelder gab. Das ist letztlich in Bezug auf Kriminalität nicht so bedeutsam. Aber Shisha-Bars und andere Lokalitäten sind Orte, an denen sich alle treffen, wo Kommunikation stattfindet, wo Erlebtes weiter- und nach außen getragen wird. Dort kann man mit solchen Aktionen relativ leicht klarmachen: Regelverstöße dulden wir nicht. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt Ärger. Natürlich sind das keine einschneidenden Maßnahmen. Meistens dauerte es gerade mal zwei, drei Tage, dann sind die Rauchmelder beschafft, und der Laden wird wieder geöffnet. Das brachte mir unter anderem den Vorwurf ein, dass ich mich mit oberflächlichem Kleinkram aufhalte, statt mich auf die dicken Dinger zu konzentrieren. Rauchmelder sind halt läppisch, insbesondere im Zusammenhang mit Clankriminalität. Unter anderem im Parlament gab es Spott und Hohn für mich, »Reuls heroischer Kampf für die Rauchmelder« oder »ganz bestimmt ein harter Schlag für die Clans, die Rauchmelder«, in diese Richtung ging das. Aber was soll’s, das muss ich eben aushalten. Ich tröste mich damit, dass Al Capone, einer der erfolgreichsten Mafiabosse in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts, auch nicht wegen seiner Kapitalverbrechen verurteilt wurde, sondern wegen Steuerhinterziehung. Also, wenn kein Rauchmelder da ist, bleibt die Bude erst mal zu. Meistens nur für ein paar Tage, dann geht es weiter mit den Geschäften.
Kleine und große Regelverstöße ahnden
Doch das war schließlich nur der Anfang. Wir kontrollierten nach einer Weile nicht mehr nur, ob der Brandschutz ordnungsgemäß ausgestattet, sondern auch, ob der Tabak verzollt war, ob für den Alkoholausschank eine Konzession vorlag und die beschäftigten Mitarbeiter tatsächlich bei der Sozialversicherung gemeldet waren. Natürlich braucht man Anhaltspunkte, bevor man in einer Shisha-Bar auftaucht und die Papiere sehen will. Aber das ist nicht so schwierig, oft fallen solche Informationen im Zuge von Ermittlungen zu anderen, größeren Straftatbeständen ab. Oder jemand gibt uns einen Hinweis, das kommt auch vor. Oder einer unserer Ermittler stolpert im Internet über interessante Querverweise. Kommissar Zufall spielt eine große Rolle, zumindest am Anfang. Wenn man mal einen Anknüpfungspunkt gefunden hat, kann man systematisch weiterarbeiten. Wer jetzt einwendet: Das ist doch gar nicht Sache der Polizei, nach Konzessionen zu fragen oder die ordnungsgemäße Sozialversicherungsmeldung zu überprüfen – der hat recht! Für solche Dinge sind Ordnungsamt, Ausländeramt, Finanzamt, Gesundheitsamt und andere Behörden zuständig. Wir, die Polizei, sind nur eine Art Begleitschutz. Aber, und das ist der Clou: Wir profitieren alle von dieser Zusammenarbeit. Wir können Verstöße ahnden, die leicht aufzudecken sind und mit denen wir schnell eine Wirkung erzielen können.
Die naheliegende nächste Frage war: Womit verdienen Clans denn sonst noch so ihr Geld? Meine Erfahrung: mit allem, was geht! Illegales Glücksspiel zum Beispiel, genauer gesagt Spielautomaten, ist eine lukrative Geldquelle. Da werden Summen verdient, von denen einem schwindelig werden kann. Interessant ist, dass es gar nicht in erster Linie darum geht, die Leute punktuell stärker abzuzocken. Nein, der Verdienst steigt, wenn man sie am Spielen hält. Ich nahm mal an einer Razzia teil, bei der die Kollegen von der Polizei in einer Spielhalle einen Schrank wegschoben, hinter dem sich ein großer Raum öffnete. Ich traute meinen Augen nicht, es war wie im Film: Jede Menge Menschen saßen da und zockten.
Manipulierte Glücksspielautomaten sind eine Goldgrube, zumal es da nicht um einarmige Banditen geht, an denen man mal einen Euro oder zwei verspielt. Es handelt sich um große Summen, innerhalb weniger Stunden kann man mehrere Tausend Euro an einem solchen Automaten verlieren – beziehungsweise gewinnen, wenn man der Aufsteller ist. In sogenannten Umfangsverfahren zur organisierten Kriminalität gab es Tätergruppierungen, die kriminelle Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe erzielten.
Ich kann keinem Menschen verbieten, sein Geld in einen Automaten zu stecken, und hoffen, dass er es stattdessen in seine Altersvorsorge investiert. Aber wir müssen wenigstens dafür sorgen, dass er spielen kann, ohne betrogen zu werden. Abgesehen von individuellen Schäden entstehen auch dem Staat Nachteile von diesen kriminellen Machenschaften, schließlich entgehen ihm jede Menge Steuern. Denn natürlich laufen diese Gelder am Finanzamt vorbei. In einem Jahr können pro illegalem Automaten bis zu einer Million Euro an Schaden[5] entstehen.
Es sind, das muss ich der Vollständigkeit halber erwähnen, nicht nur Mitglieder von türkisch-arabischstämmigen Clans auf dem Sektor aktiv, sondern auch andere Gruppen, unter anderem Rocker. Diese verschiedenen Akteure teilen den Markt quasi unter sich auf, die Betreiber vor Ort sind in der Regel Strohleute. Die großen Bosse treten nicht in Erscheinung.





























