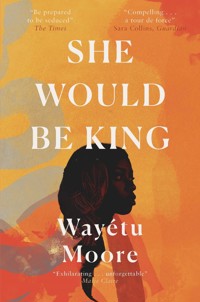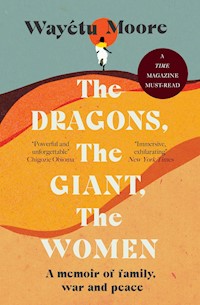Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: akono Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1831: Die rothaarige Gbessa wird im westafrikanischen Lai von ihrer Dorfgemeinschaft verstoßen, weil sie eine Hexe sein soll. Auf einer Plantage in Virginia muss der junge Sklave June Dey die Flucht antreten, da in ihm eine Kraft steckt, die die Aufseher in Angst und Schrecken versetzt. Und in den Blue Mountains von Jamaika kann Norman Aragon auf magische Weise den Fängen seines gewalttätigen Vaters entkommen, der ihn für Forschungsexperimente nach Europa schicken will. Als sich die Wege der drei an der Küste Westafrikas kreuzen, erkennen sie schnell, dass sie verflucht sind – oder einzigartig begabt. Gemeinsam beschützen sie die Schwachen und Verletzlichen inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen amerikanischen Siedlern, französischen Sklavenfängern und einheimischen Gruppen in der künftigen Republik Liberia. Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Brückner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel der Originalausgabe:
She would be King © 2018 by Wayétu Moore
Published by Arrangement with Wayétu Moore
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Aus dem Englischen von Thomas Brückner
Gestaltung und Satz: Ricarda Löser, Weimar | www.ricarda-loeser.de
Druck und Bindung: Euro PB, Příbram
Sie wäre König
© Akono Verlag Leipzig 2021
ISBN: 978-3-949554-01-8
ISBN (E-Book): 978-3-949554-02-5
www.akono.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, Hannover.
WAYÉTU MOORE
SIE WÄRE KÖNIG
ROMAN
Aus dem Englischen von Thomas Brückner
Für Gus & Mam
INHALT
Buch 1
Die Drei
GBESSA
JUNE DEY
NORMAN ARAGON
MONROVIA
Buch 2
Sie wäre König
DAS SCHIFF
DER GOTT DER VERFLUCHTEN
NACHT
DER BALL
VERSCHWUNDEN
SAFUA
KILIMANJARO
Glossar
Könige kommen mit Gaben,aus Ägypten bringt man Geräte von Erz,Kusch erhebt zu Gott seine Hände.
Psalm 68:31
Vorbemerkung der Autorin
In meiner Kindheit schärfte meine Mutter mir ein, immer freundlich zu Katzen zu sein. Sie erzählte mir eine Geschichte, die sich in dem westafrikanischen Dorf zutrug, in dem meine Familie und ich uns im Jahr 1990 während des Bürgerkrieges in Liberia versteckten. Sie sagte: »Es war einmal eine alte Frau in Lai, die ihre Katze zu Tode geprügelt hat. Die Katze erlebte ihre Wiederauferstehung und ihr Geist setzte sich auf das Dach der Frau, bis das Haus einfiel und sie tötete.« Vor mehreren Jahren versuchte ich, eine Erzählung über diese Frau und ihren berüchtigten Tod zu schreiben. Durch diesen Tod trat, ziemlich überraschend, und ich bin dankbar dafür, Gbessa in die Welt.
(Gbessa wird »Bessah« ausgesprochen)
BUCH1
DIE DREI
GBESSA
WENN GBESSA WEITERGEHEN WOLLTE, musste sie zunächst den Weg von einer langsam ringelnden Schlange befreien. Grünlichbraun mit goldenen Augen, in die zu sehen so schwer war wie in die Sonne, glich der Schlangenleib farblich genau dem Wald, aus dem sie gekrochen kam, und Gbessa kam es so vor, als ob der Busch um sie herum auf ihren Fortgang eifersüchtig war und deshalb die Zehen ausstreckte, um sich ihr in den Weg zu stellen. Auf dem Unterleib der Schlange, der sich krümmte und wand, als sie jetzt zischte, blitzte orangefarbener Staub, und Gbessa richtete einen fünf Fuß langen Stock gegen sie. Die Schlange fürchtete sich nicht vor ihr oder dem Stock. Sie reckte den Kopf und griff an.
Diese Fehde trug sich mehrere Monate nach jenem sengend heißen Tag zu, an dem sie für alle Zeiten aus Lai verbannt worden war. Seit Wochen schon hatte sie sich für diesen Pfad entschieden, war über eiserne Steinchen gestolpert und über Edelholzzweige, die sich von ihren Wurzeln verabschiedet hatten, hatte sich zwischen Zuckerrohrstängel gezwängt und sich dennoch verwehrt zurückzuschauen. Haarsträhnen verließen sie und gehörten fortan den Schleiern aus Lehmkörnern an, die gleich ihr auf dieser langen und gnadenlosen Straße wanderten. Gbessa konnte nicht zurückkehren. Safua lebte in entgegengesetzter Richtung, Hand in Hand mit der Abfuhr, die sie erfahren hatte, und auch mit jenen Toden. Gbessa stupste den Unterleib des reizbaren Wesens, und das schlug plötzlich zu. Sie sprang einen Schritt zurück und entging nur knapp einem Biss in ihr Schienbein.
Ich war an diesem Tag dabei, angezogen von ihr, wie ich mich auch zu jenen anderen mit den besonderen Gaben hingezogen fühlte, die an dem Tag dabei waren, als die Schiffe kamen.
»Sei vorsichtig, meine Liebe«, flüsterte ich Gbessa ins Ohr. »Sei vorsichtig, meine Freundin.«
Sie warf einen Blick über die Schulter, als hätte sie mich gehört oder als hoffte sie, dass Safua diese Bewegung ausgelöst hatte, und die Schlange griff erneut an, biss ihr diesmal in den Knöchel, bevor sie zwischen die Stängel auf der anderen Seite der Straße floh. Mit einem Aufschrei stürzte Gbessa zu Boden. Sie weinte, und es war klar, dass ihr das Bein wehtat, genauso wie das Herz, denn sie hielt ihre Tränen gefangen, schluchzte nur mit zusammengebissenen Zähnen. Sie rieb sich den Knöchel, als wollte sie bis auf den Knochen gelangen, dann drückte sie auf die gerötete Haut an der Stelle, an der die Schlange zugebissen hatte, drückte fest, um sich von dem Gift zu befreien. Möglich, dass außer diesem Stechen nichts geschah. Möglich, dass sie von diesem Schmerz ohnmächtig wurde. Zu guter Letzt aber würde sie wieder erwachen. Gbessa rieb sich die Wunde, wusste aber bereits, wie sie es schon immer gewusst hatte, dass dieses Gift für immer eins mit ihr bleiben würde. Sie wusste bereits, wie sie es schon immer gewusst hatte, dass sie, genau wie ihre Liebe zu Safua, nicht sterben würde, nicht sterben konnte.
Nicht ein einziges Mädchen gab es bei den Vai, das so war wie Gbessa. Auch hatte das Küstendorf Lai nur eine Frau je erlebt, die ebenso verflucht war – Ol’ Ma Famatta – von der man sich erzählt, dass sie auf dem Mond in einem Winkel hockt, nachdem sie an ihrem 193. Geburtstag von ihrer Hängematte hinaufgeschleudert worden war. Doch war selbst Ol’ Ma Famattas Unglück nichts verglichen mit dem Gbessas, deren Fluch nicht nur in der Unfähigkeit zu sterben bestand, sondern auch darin, wie der Tod sie verhöhnte.
Verborgen lag Lai inmitten der Wälder, als die Vai es für sich entdeckten. Funde bezeugen, dass dort einmal eine Stadt gewesen sein musste, da man Steingutscherben und zersplitterte Diamanten fand, verstreut auf den Hügelkuppen und in der ungewöhnlichen Gesellschaft von Hauskatzen. Als jedoch, im frühen achtzehnten Jahrhundert, die Vai aus dem kriegsgeplagten Arabien über das Binnenland der Mandingo Lai erreichten, trafen sie keine Bewohner mehr an und beschlossen, dieses Gebiet mit ihren eigenen Geistern zu besetzen.
Auf einem Landstrich, der eine Meile lang und eine halbe Meile breit war, errichteten sie aus geschmolzenem Eisen ihr Dorf – einen weit ausladenden Häuserkreis aus dem Holz der nahen Palmen, mit Zinkdächern und Lehmziegeln, die ihnen in der Trockenzeit Kühle spenden sollten.
Tagsüber hockten die Ol’ Pas beisammen und zeichneten Linien in den Staub und Symbole, die darstellten, wie viele Monde seit dem letzten Regen oder der letzten Sonnenfinsternis oder anderen Wundern des Himmels vergangen waren. Sie hofften darauf, dass die Geister sich ihnen in winzigen Zeichen zu erkennen gaben und ihnen die Geheimnisse des Landes und seiner Tiere offenbarten.
Die Geister verkündeten den Ol’ Pas auch, neben vielen anderen Dingen – welcher Poro-Krieger am erfolgreichsten die Verteidigungszüge gegen die andrängenden einheimischen Stämme anführte, damit die Vai-Armee mit Rindern, Korn und Gefangenen heimkehrte, die dabei halfen, die Reisfelder des Dorfes zu bestellen – sich um die empfindlichen Tiere dieses Gebietes zu kümmern – vor allem um die Katzen. Anschließend machten die Ol’ Pas die Dorfbewohner mit den Neuigkeiten bekannt, die sie von den Geistern erfahren hatten.
Ol’ Ma Nyanpo hörte nie zu.
Ol’ Ma Nyanpo – eine alte, verbitterte Witwe – wohnte, bevor Gbessa auf die Welt kam, nur zwei Häuser von Khati entfernt, Gbessas schwangerer Mutter. Sie besaß einen pummeligen, orangefarbenen Kater und prügelte ihn regelmäßig, um ihre Einsamkeit zu betäuben. Die Dorfältesten ermahnten Ol’ Ma Nyanpo, dass sie einhalte, welch Verbot die Geister ihnen über das Prügeln von Katzen offenbart hatten, doch sie scherte sich nicht darum – dem eigenen Stolz gegenüber war sie machtlos. Und sie hoffte, die Geister so zu erzürnen, dass sie sie wieder mit ihrem verstorbenen Liebsten vereinten.
Als Kano, der Sklave von Cholly, dem Fischer, an Ol’ Ma Nyanpos Tür klopfte, um ihr die Fische zu bringen, die sich in ihren Netzen gefangen hatten, starrte der pummelige Kater gierig auf den Blechkübel. Nachdem Ol’ Ma Nyanpo Kano die Tür vor der Nase zugeschlagen und den Kübel auf Anzeichen von Diebstahl geprüft hatte, versteckte der Kater sich hinter der Feuerstelle. Als sich nun der Katzenkopf hinter der Feuerstelle zeigte, langte sie einen Fisch aus dem Kübel und winkte ihm damit.
»Wage ja nicht, dich daran zu vergehen!«, keifte sie und schüttelte den Fisch. Schuppen, Salzwasser und Blut spritzten durch die Gegend und der Kater duckte sich unter Ol’ Ma Nyanpos Warnung. An jenem Abend nun blies Kano, nachdem er seine Pflicht erledigt hatte, Fisch für Chollys Frau zu putzen, die letzte Laterne aus. Der Pfiff, der durch seine zusammengepressten Lippen kam, vermählte sich mit dem stechenden Fischgeruch und reiste durch den Dorfkreis zu Ol’ Ma Nyanpos Haus, wo er den Kater weckte. Der Kater kam aus dem Winkel hervor, in dem er gelegen hatte und strich durch den Raum. Im Dunkel steuerte seine kalte Nase eine verzweifelte Suche nach Ol’ Ma Nyanpos Fischkübel.
Ol’ Ma Nyanpos Bein zuckte, und sie schnarchte Flüche in die Nacht. Erschreckt suchte der Kater nach einem Punkt zur Flucht, von dem aus er entweichen konnte, sollte sie aus dem Schlaf hochfahren, um ihn mit dem Rotholzstiel des Verandabesens zu prügeln. Doch Ol’ Ma Nyanpo verhielt in diesem finsteren Raum in bodenlosem Schlummer. Näher schlich sich der Kater an Ol’ Ma Nyanpos Fische heran, der am folgenden Tag drohenden Strafe nicht achtend, sobald sie entdeckte, dass ihre Fische nicht mehr waren. Als der Kater den Kübel erreichte, sprang er auf den Rand und achtete darauf, dass er den Rand nicht mit den Krallen kratzte. Groß waren seine Augen, sein Maul war bereit, als ein schwerer Schlag ihn durch den Raum schleuderte.
»Hab ich’s dir nich gesagt nich?«, fragte Ol’ Ma Nyanpo und zündete die Laterne an. Der Kater versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, doch da traf ihn erneut ein harter Hieb an den Kopf. Er fuhr die Krallen aus und zischte die alte Frau an. Ein weiteres Mal traf sie ihn am Kopf, und gellend jaulte der Kater auf, weckte einen Nachbarn, dessen neugierige Stimme und forschende Laterne langsam durch den Dorfkreis zogen.
Der Kater, entschlossen, ihrer Raserei zu entkommen, huschte über die Feuerstelle.
»Oh, nein!«, rief Ol’ Ma Nyanpo. »Du gehst nirgendwohin.« Am Schwanz zog sie ihn hinter der Feuerstelle hervor. Die Nachbarn aus dem Dorfkreis versammelten sich vor Ol’ Ma Nyanpos Tür und rätselten darüber, was die alte Frau so wütend gemacht hatte, dass sie den armen Kater mitten in der Nacht verprügeln musste.
»Dir werd ich’s zeigen! Das wirstu spüren!«, schrie sie. Der Kater kreischte, unfähig, der verbitterten Frau zu entkommen. Die Nachbarn wetzten die Zungen und spitzten die Ohren, entrüstet darüber, dass Ol’ Ma die Unverfrorenheit besaß, die Geister zu beleidigen. Cholly klopfte an Ol’ Ma Nyanpos Tür, doch sie achtete nicht auf ihn und prügelte weiter auf den Kater ein.
»Sie wird das Vieh umbringen«, meinte Chollys Sohn Safua, ein bereits hübsch anzusehender Fünfjähriger mit einer Haut von der Farbe einer Kokosnuss und Augen, die stets ernste Fragen stellten.
Im Hausinnern lag der Kater, in einer Ecke. Ol’ Ma Nyanpos beleibte Gestalt und der Besen verschwammen ihm vor den Augen. Ihres Anblicks überdrüssig, gab er auf, seine Augen schlossen sich, sein Herz blieb stehen und sein Maul offen.
Eine fassungslose Ol’ Ma Nyanpo starrte auf seinen Leib hinunter. Sie hatte das letzte Lebewesen getötet, das sie ihr Eigen nennen konnte und war jetzt vollkommen allein. Atemlos ging sie zur Tür. Als sie sie öffnete, standen ihre Nachbarn im Dorfkreis und hielten Laternen hoch, die ihre überreizten Gesichter beleuchteten. Cholly linste ins Haus und bemerkte den an der Wand liegenden toten Kater.
»Ay-yah!« rief er, erstaunt über Ol’ Ma Nyanpos Unverfrorenheit. Die Kinder rannten auseinander, als sie das tote Tier sahen, und kehrten in die Häuser zurück. »Dich holen die Geister«, sagte Safua, das einzige Kind im Dorfkreis, das noch geblieben war.
»Begrab ihn für mich«, sagte Ol’ Ma Nyanpo, als Cholly in das Haus trat und nach dem Kater sah. Er erwiderte nichts und mied es, in ihr Gesicht zu sehen. Er rief nach Kano, der den Kater herausholen sollte, und Kano stapfte aus dem Dorf und in den Wald, um das verblichene Tier zu begraben. Ihm folgte ein neugieriger Safua.
Ol’ Ma Nyanpos Haus stürzte am nächsten Morgen über ihr zusammen. Sie war sofort tot. Als man ihre sterblichen Überreste unter einem Haufen Palmholz, Stroh und Schutt ausgrub, waren Ol’ Ma Nyanpos Fische nirgends zu finden. Ol’ Pa Bondo, der die ganze Nacht durchgeschlafen hatte und jeden Morgen zum Gebet erwachte, bevor noch der Hahn krähte, wusste nichts von Ol’ Ma Nyanpos Missetat, berichtete aber, dass er den orangefarbenen Kater auf dem Dach gesehen hatte, unmittelbar bevor das Haus einstürzte.
»Aber die Katz’ is tot«, focht Cholly Bondos Behauptung an.
Als die Ältesten davon erfuhren, erklärten sie, überzeugt davon, dass die Geister in den toten Kater gefahren waren, auf dass er wiederkehre und sich räche und den Kübel mit dem Fisch stehle, um sein Verlangen zu stillen, den Tag zu einem verfluchten Tag.
Aufgrund dieser Verlautbarung wurden an jenem Tag vor Khatis Fenster dröhnend die Trommeln geschlagen. Ihr Mann war bereits zum Fischen am See, und sie lag, vor Schmerzen stöhnend, auf einer rechteckigen Pritsche aus verschränkten Palmwedeln, die mit Stroh ausgestopft war. Schon bald sollte sie ihr Baby bekommen, und deshalb war ihr Mann bereits in den vergangenen Wochen immer vor dem Lied des Hahns aufgestanden und hatte seine Zeit am Lake Piso in der Hoffnung zugebracht, genügend Fisch zu fangen, dass es für eine Mahlzeit reichte und sich noch etwas auf dem Dorfmarkt verkaufen ließ. Weder Khatis Vater noch der Vater ihres Vaters noch ihr Mann oder der Vater ihres Manns waren so gute Fischer, dass sie sich Haussklaven halten konnten, sodass Khati rein gar nichts geerbt hatte.
Im selben Augenblick noch, in dem sie die Augen aufschlug und den Trommelschlag vernahm, zwang Khati ihren schmerzenden Leib von der Pritsche hoch, auf der sie lag. Sie war eine dunkelbraune Frau mit schmaler Nase und dünnen Armen, deren Brüste und Hüften sich erst in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft voll ausgebildet hatten. Der Rhythmus der Trommeln sagte ihr, dass entweder jemand gestorben oder aber verflucht worden war, was in beiden Fällen ein düsteres Licht auf die bevorstehende Geburt ihres Kindes warf. Khatis Leib krümmte sich vor Schmerz. Vom offenen Fenster kroch das Grau des Morgens auf ihren sitzenden Leib zu und legte dünne Schweißbäche bloß, die ihr über das braune Gesicht und die Arme liefen. Khati rieb und tätschelte ihren Bauch. Sie flehte ihr ungeborenes Kind an, noch ein wenig in ihrem Schoß auszuhalten. Sie streckte die Hand von der Pritsche zum Boden, um sich zum Fenster zu schleppen, aber das ungleichmäßig verteilte Gewicht ihres Körpers führte dazu, dass sich Finger und Zehen des Babys in ihr krümmten.
»Nein, nein«, flüsterte Khati ihrem gedehnten Leib zu. »Warte, noch ein kleines bisschen.«
Sie presste die Hand auf den Erdboden neben dem Bett und versuchte es erneut, und diesmal gelang es ihr, den schmerzenden Körper von der Pritsche und durch das Zimmer zum Fenster zu schleppen, wo sie ausruhte, den Rücken gegen die Wand gelehnt. Khati umfasste den Fensterrahmen und zog sich hoch, bis ihr Blick die seltsamen Trommler draußen freigab.
Salz und Staub fleckten die Hände der Trommler. Die Ol’ Pas marschierten, die Hälse in die edel gekleideten Schultern gezogen, um die Trommler herum. Khati wusste, was es bedeutete, bekäme sie ihr Baby in diesem Augenblick, und sie presste die Beine zusammen. Aus Angst, dass man sie sah, ließ sie sich auf dem Boden zusammensinken. Ihr Körper fühlte sich gleichzeitig heiß und kalt an, ihr dünnes lappa war schweißgetränkt. In äußerster Panik rieb sie ihren Bauch, und ihr Blick durchsuchte den Raum nach einer Lösung für ihre Kümmernis. Ihre Suche endete bei der Tür zum Buschlandgarten, hinter dem der Wald begann.
Bevor Khati sich noch bewegen konnte, schwappte ein flüssiges Rinnsal aus Blut und Wasser ihre Schenkel herab, unmittelbar gefolgt von einem üppigeren Erguss, der ihr Lappa und den Fußboden um sie herum tränkte. Khati biss sich auf die Unterlippe, um nicht aufzuschreien, bis sie ihr eigenes Blut schmeckte. Sie konnte nicht riskieren, dass man sie hörte, konnte die Geburt eines Kindes an diesem Tag nicht riskieren, weil es ihr dann auf immer untersagt bliebe, ihrem Dorf ein weiteres zu schenken. Zu guter Letzt beschloss Khati, so weit in den Wald hinter ihrem Haus zu kriechen, wie sie nur konnte. Das Baby trat sie, war bereit, sich dem dämmerigen Licht in der Öffnung ihres Leibes zu nähern.
»Nein, nein«, sagte Khati ein weiteres Mal, als sich der Boden unter ihr immer mehr feuchtete. Ihr zitterten die Beine. Sie umklammerte ihr Lappa und presste den Schoß zusammen. Es nützte nichts. Das Kind wollte auf die Welt.
Khati schleppte sich zu der Tür, die in den Wald hinaus führte. Sie nahm beide Hände zu Hilfe und zog ihren zitternden Leib seitlich vorwärts. Das Kind drängte. Sie presste die Beine zusammen, bis sie ihr vor Gegenwehr schmerzten.
»Bitte, mein Kind«, wiederholte Khati. »Warte, nur noch ein klein wenig.«
Draußen donnerten die Trommler, und Khati stieß die hölzerne Hintertür auf und kroch auf ein Gebüsch zu. Sie stöhnte erschöpft und versuchte, das Baby aufzuhalten, zuerst mit einem unregelmäßigen Klopfen auf den Bauch. Dann langte sie mit einer Hand unter ihr Lappa, um die Flüssigkeit zu stoppen, mit der ihr Kind in die Welt drängte. Nur wenige Meter vom Haus entfernt, am Ende einer Blutspur und ohne alle Kraft, noch länger den Schmerz zu ignorieren, der unter ihren nassen und klebrigen Fingern drohte, sank Khati gegen die wartenden Blätter auf den Rücken. Unfähig, die glitschigen Schenkel noch länger zusammenzupressen, unfähig, den eigensinnigen Kopf ihres Babys einzuzwängen, heulte Khati gegen Wind und Sonne an.
Das Trommeln verklang.
Das war der Tag, an dem Gbessa auf die Welt kam.
Die Ältesten erklärten sie für verflucht.
In der Trockenzeit des Jahres 1831 gab es keine Kriege, und die Reisernte wie der Fischfang fielen üppig aus. In der Regenzeit saßen die Dorfkinder um die Griots herum, damit sie die Geschichte ihres Volkes ebenso lernten wie Schreiben und Zählen. In der Trockenzeit aber mussten alle arbeiten, die älter als fünf Jahre waren. Die Vai-Jungen zogen mit ihren Vätern zum Fischen an den Lake Piso und die Vai-Mädchen gingen auf die Reisfelder.
Die Ol’ Mas saßen beieinander und verspannen Baumwolle und Ziegenleder zu Lappas für die Vai-Frauen, mit denen sie sich bedecken konnten, damit die Kornfliegen sich nicht auf ihren Beinen festsetzten, wenn sie auf den Feldern Reis ernteten. Für ihre Lieblinge unter den Vai-Mädchen, jene, die den alten Frauen kleine Teile ihrer Ernte zum Geschenk machten oder ihre Sklaven vorbeischickten, damit sie sich um die Paprikagärten kümmerten, die sie neben ihren Häusern angelegt hatten, weichten die Ol’ Mas das Ziegenleder in zerlassenen Erden ein und verwandelten die Farbe zu Burgunderrot und Salbeigrün. Früher war Khati, wenngleich sie eine Gemeine war, der Liebling der Ol’ Mas gewesen, weil sie so bescheiden und sanftmütig war und diese waagerechten Grübchen am Hals hatte, die bei den Vai als Zeichen großer Schönheit gelten. Für Gbessa aber stellten die Ol’ Mas nie eine Lappa her, mit der sie sich bedecken konnte, und nachdem Gbessa auf die Welt gekommen war, bekam auch Khati nie wieder burgunderrotes Tuch. Stattdessen hüllte Khati ihre fünfjährige Tochter in eine verwaschene Lappa aus grobem pamkana-Tuch, wenn sie sie mit auf das Reisfeld nahm.
Auf dem Weg zum Reisfeld durchquerten Khati und Gbessa den Dorfkreis, in dem kleine Kinder beim Steinchenspiel ausgelassen lachten.
»Gbessa, die Hex! Gbessa, die Hex des fetten Katers!«, sangen die Kinder, wenn Gbessa, mehrere Meter hinter ihrer Mutter, an ihnen vorüberging. Wusste Gbessa, dass sie und ihre Mutter gerade am Lake Piso vorbeigingen, lugte sie durch die lichten Stellen im Gebüsch und hoffte, ihren Vater zu sehen. Gbessas Vater, ein Fischer, dessen Stellung im Dorf durch ihre Geburt vernichtet worden war, hatte sie noch nicht ein einziges Mal angesehen noch mit ihr gesprochen. Seiner Überzeugung nach konnte er, was vom guten Namen seiner Familie übrig war, nur durch seine harte Arbeit retten, weil ihm dieses Kind niemals zur Ehre gereichen würde. Deshalb verbrachte er den ganzen Tag und die ganze Nacht am See und fischte, fluchte leise auf das Leben, nickte darüber ein und wachte aus dem Schlaf wieder auf.
»Komm!«, rief Khati, die vorwegging, Gbessa zu, wenn sie spürte, dass ihre Tochter trödelte. Sobald sie bei den Feldern ankamen, schloss Khati sich den anderen Frauen an und befahl ihrer Tochter, sich an den Feldrand zu setzen. Die Vai-Frauen, sowohl die wohlhabenden wie die gemeinen, brachten die Vormittage auf den Feldern zu, die dem Dorf am nächsten lagen. Dort ernteten sie kaum einen Sack Korn von dem Getreide, das auf dem trockenen Land gedieh. Hauptsächlich tratschten sie miteinander, während ihre zwei Dutzend Sklavinnen und deren Töchter auf den weiter draußen liegenden Feldern und in den Sümpfen arbeiteten.
Nie wurde Gbessa von den Frauen gebeten, sich auf dem Feld zu ihnen zu gesellen und zu plaudern, wie sie es mit anderen Vai-Mädchen taten, die sie einluden, bei den Arbeiten auf dem Feld zu helfen und kleine Handreichungen zu übernehmen und dabei den Klatsch zu belauschen, wessen Wollohmit-Reis-Gericht bitter schmeckte. Und weil Gbessa von ihnen nicht beachtet wurde, freute sich die Sonne, sie ganz für sich allein zu haben, grub ihre Strahlen tief in ihre Haut und tönte sie in der Farbe des Zwielichts. Und weil die Sonne Gbessa mit nichts und niemandem teilen musste, war auch das Haar Ziel ihrer Schwärmerei, das in einem langen und feuerroten Gewirr schwer über ihren Rücken hing und damit zusätzlich die Überzeugung der Vai bestätigte, dass sie verflucht war.
In Gbessas achtem Jahr verspätete sich die Regenzeit um drei Monate. Zwar hatten die Vai-Frauen ausreichend Nahrung für die vor ihnen liegenden Monate gesammelt, doch sorgten sie sich, ob in den kommenden Monaten genug Regen für die nächste Ernte fallen würde. Ma Eilsu, eine gescheite Frau, die stets einen Strohhalm im Mundwinkel verkeilt hatte, bestand darauf, dass die Frauen die Angelegenheit den Ältesten vortrugen. Gemeinsam marschierten sie von den Reisfeldern zum Gehöft der Ältesten. Als sie bemerkte, dass die Dorfbewohner ihre täglichen Spiele und Verrichtungen aufgegeben, den Schatten der windschiefen Kokospalmen und Mangobäume verlassen, ihre Webnadeln und Tierhäute niedergelegt hatten, griff Khati hinter den Frauen nach Gbessas Hand.
Im Gehöft – einem kreisrunden Einschluss von aufeinander getürmten Kaffeestrauchstämmen – hoben zehn Ol’ Pas die Köpfe aus gewichtigem Schweigen, als die Frauen und ihre Töchter auf sie zukamen. Sobald das Oberhaupt der Ältesten die Hand in die Luft streckte, erlag das Geschnatter der Dorfbewohner mit einem Schlag.
»Elder«, hob Ma Groie an, die Anführerin von einer der Schlangen, die sich vor den Ältesten aufgebaut hatten, nachdem ihr sein Nicken Erlaubnis zu sprechen signalisiert hatte. »Alle wollen wissen, was mit dem Regen ist. Wir fürchten für die Reisfelder«, sagte sie. Die Frauen in der Schlange hinter ihr raunten und murmelten zustimmend.
»Das Mädchen kommt jeden Tag zusammen mit Khati«, sagte Ma Eilsu, die Anführerin der anderen Schlange, und zeigte auf eine bescheiden im Hintergrund des Anwesens mit Gbessa verharrende Khati. Khati drückte, verängstigt ob des plötzlichen Stimmungswandels, die Schultern ihrer Tochter. Die Frauen drehten sich zu Khati um und stimmten mit »ja« und »die Ol’ Ma hat Recht« in den Chorus gegen die kleine Hexe ein.
»Warum lasst ihr sie nicht in der Nähe der Sümpfe anbauen?«, fragte Elder. »Wächst doch dort der meiste Reis, nich?«
»Es geht nich drum, ob sie ackert bei uns oder im Sumpfland bei den Sklaven. Man kann sich vor Geistern nich verstecken nich. Die sehen sie«, hielt Ma Eilsu dagegen.
Endlose Zustimmung vibrierte durch das Gehöft, bis Elder schließlich in die zerfurchten Hände klatschte, damit der Lärm aufhörte. Er senkte den Kopf und alles verstummte, während er nachdachte.
»Die Kleine wird zu groß«, sagte er schließlich und nickte, während seine Stimme die Worte in heiseren und schwerfälligen Stanzen herausbrachte. »Kommt näher an ihr Dong-sakpa und die gebärfähigen Jahre. Arbeit auf dem Feld ist nich gut für sie.«»Ja-oh. Ja.« Die Ältesten nickten zustimmend.
»Schaff das Mädchen nach Hause. Nimm sie nicht mehr auf das Reisfeld mit. Vor ihrem Dong-sakpa soll sie nicht mehr aus dem Haus. Verstanden?«, sprach Elder zu Khati.
Khati wandte sich von den verdammenden Gesichtern im Gehöft ab. Schuldbeladen schlurfte sie durch den Dorfkreis zurück zu ihrem Haus. Gbessa stolperte beinahe über ihre Füße.
»Was -«
»Sch…, Mädchen«, unterbrach Khati ihre Tochter und schaute unverwandt nach vorn. Die Menge der neugierigen Dorfbewohner teilte sich, als Khati und Gbessa vorübergingen.
»Ma…«, sagte Gbessa, und ihr Kopf hüpfte neben ihrer Mutter auf und ab.
»Sch…«, sagte Khati, eilte ins Haus und warf die Tür hinter sich zu. Benommen stolperte Khati zu einem hohen Holzkrug mit Napf, der neben der Pritsche stand, auf der sie schliefen. Zitternd kippte Khati den Krug an und füllte den Napf mit Wasser.
»Sch…«, sagte Khati, obwohl Gbessa weder Körper noch Lippen bewegte. Khati starrte Gbessa an, bis ihr zu guter Letzt ihr Bild verschwamm und sie im Zimmer nichts mehr klar ausmachen konnte. Sie hielt ihrer Tochter den Napf hin, die langsam über den Fußboden auf sie zukam, das Haar in flammenderem Rot, als es Khati je aufgefallen war.
Gbessa schluckte und schielte auf den Boden des Napfes. Sie trank ihn leer, und als sie ihn von den Lippen nahm, hatte Khati ihr Gesicht in den Händen geborgen und weinte, bis ihre Finger und Arme triefnass waren.
Es war eine Griotte, die den Dorfkindern von Mamy Wateh erzählte, der Frau im See, deren Unterleib der eines Fisches war und die nach Menschen Ausschau hielt, die sie ertränken konnte, damit sie nicht einsam sein musste. Sie erzählte ihnen vom Volk der Gio und seinen Teufeln, und wie es tanzte Tag und Nacht, ein ganzes Jahr hindurch, um den Regen in sein Dorf zu locken, anstatt in das Nachbardorf zu ziehen und dort um Wasser zu bitten.
»Ol’ Ma Famatta war die erste«, hob die Griotte eines Abends an, die Stimme so fein und schneidend wie Stacheldraht.
»Die erste wovon«, fragte Chollys Sohn Safua nach. Er war fast dreizehn und dong-sakpa, aber er setzte sich immer noch hinter die kleineren Vai-Kinder und lauschte in noch jeder Nacht der Trockenzeit den Märchen der Geschichtenerzählerin.
»Sch…, Kind«, sagte die Griotte und legte den Finger auf die Lippen.
»Ol’ Ma Famatta war die erste Hexe der Vai«, fuhr sie fort.
Lai war damals ein noch junges Land, nicht älter als Ol’ Ma Famatta, die mit den ersten Siedlern aus dem alten Lai durch die Wüste gezogen war. Ihr Hund und die vier Katzen starben vor ihr, wie auch ihr Mann und alle Ol’ Mas und Ol’ Pas des alten Lai. Sie erlebte 193 Trockenzeiten. In Ol’ Mas späteren Jahren wurde Lai von Kriegen und ausgedehnten Dürrezeiten heimgesucht. Die Ältesten, die nicht sagen konnten, warum sich ihr Glück so schnell gewendet hatte, waren überzeugt, dass Ol’ Ma Famattas Alter den Geistern eine Beleidigung war. Als Ol’ Ma Famatta zugeflüstert bekam, dass man ihr die Schuld an Lais Schicksal gab, verriegelte sie die Türen ihres Hauses und weigerte sich, fortan noch einen Dorfbewohner zu empfangen. Allen kam es so vor, als hätte sie beschlossen, den Rest ihrer Tage allein zu verbringen, ein Pendel, das in einer alten Hängematte hinter ihrem Haus hin und her schaukelte. Wochenlang klopften die Dorfbewohner bei ihr an, bekamen aber nur Ol’ Ma Famattas Knurren zu hören.
Eines Tages brach ein Fischer auf Geheiß der Ol’ Pas die Eingangstür auf. Die Männer trampelten auf der Suche nach ihr durch das bescheidene Haus, doch Ol’ Ma Famatta war nicht darin. Als sie auf die hintere Veranda gelangten, war ihre alte Hängematte leer und schaukelte wild zwischen den Pfosten hin und her.
»Die Hängematte hat sie in den Himmel geschleudert, nich?«, mischte sich ein kleines Kind ein.
»Ist zu lang geblieben. Daher sagen die Ol’ Pas, dass alle mit einem Fluch ihr Dong-sakpa außerhalb von Lai im Wald zubringen müssen«, erklärte die Geschichtenerzählerin.
»Ich bin fast so weit«, meinte Safua, dem sein Alter einfiel.
»Bist aber nich verflucht nich«, erwiderte die Griotte.
»Ol’ Ma, wer muss in den Wald?«, wollte ein anderes Kind wissen.
»Coco, der Fischersohn mit Händen wie ein Frosch«, antwortete die Griotte mit ausgespreizten Fingern. Die Kinder kuschelten sich aneinander.
»Und Zolu, das klein-kleine Mädchen, das an dem Tag auf die Welt kam, als die Sonne schwarz wurde«, fuhr sie fort und zeigte auf den Mond am Himmel. Die Augen der Kinder wanderten hoch in den besternten Himmel, in dem Ol’ Ma Famatta saß und aus dem weißen Loch in der Mitte auf sie herabsah.
»Und Gbessa!«, rief ein Kind.
Die Geschichtenerzählerin nickte und schaute zu Gbessas Haus hinüber.
Gbessa lugte, wie sie das jedes Mal tat, wenn Geschichtenerzähler mit neuen Märchen auftauchten, durch ein Guckloch, das aus einem Riss in der Wand hinter der Feuerstelle entstanden war, und ein Frösteln befiel die unsichtbaren Haare auf ihrer Haut.
»Gbessa, die Hex«, meinte Safua bedächtig. Die Kinder kreischten.
»Gbessa, die Hex! Gbessa, die Hex!«, sangen einige, als sie davonrannten.
In spielerischem Geplänkel machten sie Jagd aufeinander, bevor sie zu guter Letzt in ihren Häusern verschwanden. Gbessa kroch zu dem Strohbündel neben Khatis Pritsche. Zunächst lag sie still da, doch dann tippte sie ihrer Mutter sacht an die Schulter. Khati schreckte hoch und ihre Lider schnellten auf.
»Gbessa?!«
»Ja, Ma«, antwortete Gbessa.
»Was ist?«
»Schaffen sie mich in den Wald, Ma?«, fragte Gbessa.
Ein Seufzen brach in Khatis Zögern und türmte sich zu noch größerer Stille.
»Schlaf, Kind«, sagte Khati. »Schlaf.«
Nachdem ihre Mutter am folgenden Morgen auf das Reisfeld gegangen war, schlängelte Gbessa sich zum Guckloch hinüber, um durch die schmale Öffnung in den Dorfkreis zu sehen, in dem sie Reste der Behauptungen der Geschichtenerzählerin zu ihrem Schicksal zu entdecken hoffte. Doch als sie ihre Augen an das Loch drückte, konnte sie nichts sehen.
Sie hörte, wie sich auf der anderen Seite jemand bewegte. »Wer da?«, fragte Gbessa, verblüfft über die Möglichkeit, umworben zu werden. Sie zog sich etwas zurück, um sich auf das Loch konzentrieren zu können. »Wer da?«, fragte sie erneut, lauter diesmal, und erstickte fast vor Begeisterung.
»Safua«, antwortete der Junge auf der anderen Seite.
Blind standen ihrer beider Augen einander gegenüber. Draußen riefen andere Jungsstimmen Safua zu, sich schnell von dem Haus zu entfernen, bevor er entdeckt und bestraft wurde.
»Geh weg. Geh weg von hier«, sagte Gbessa. Sie war überrascht, dass sie trotz der plötzlichen Hitze, die ihr in Haut und Wangen fuhr, Worte gefunden hatte.
»Sonst was?«, fragte ein ebenso erregter Safua, den die freche Hexe belustigte. Die Muskeln, die sich an seinen Armen herauszubilden begannen, spielten und er verbot sich zu lachen, obwohl seine Freunde nahebei nervös kicherten. »Hab nich Angst vor dir. Hab vor nichts Angst nich«, sagte Safua.
»Verschwinde von hier«, sagte Gbessa, nachdem ihr durch das Gelächter draußen klar geworden war, dass er sie nicht so begehrte wie sie ihn. Sie zischte ihn an. »Ich hab Fluch. Hastu nich gehört, heh?« Gbessa kroch weg von dem Loch. Safua erhaschte einen Blick auf das rote Haar um das unvergesslich schwarze Gesicht und rang nach Luft. Wieder drückte er sein Auge an das Guckloch.
»Ich komm wieder«, sagte er. Er wartete auf Gbessas Antwort, aber sie blieb stumm.
Safuas Freunde drängten weg von Gbessas Haus; sie stießen bülbül-Schreie aus, und der Staub, der von ihren Füßen aufsprang, ließ sich fleckend auf ihren Hintern nieder. Safua befolgte ihre Warnung und rannte davon.
Er drehte sich um und rief: »Gbessa, die Hex, Gbessa, die Hex!«, bevor er sich seinen verängstigten Freunden anschloss.
In den folgenden Tagen blieben Gbessas Augen auf das Guckloch fixiert. Sobald die Vögel draußen ein neues Lied anstimmten, grummelte es in ihrem Bauch. Lachte ein Kind aus dem Dorfkreis zu laut, stockte ihr der Atem. Alles schreckte sie auf: der Flügelschlag des Hahns, Schritte von Nachbarn zu nahe am Haus, die sich Geheimnisse zuflüsterten, ein wimmernder Wind und der Aufschrei der Kokospalme, wenn sich eine Machete in ihren Wipfel grub.
Jeden Morgen verließ Khati Gbessa ohne ein Wort und eilte durch eine sternenerhellte Dämmerung zu den Reisfeldern. Weil Gbessa das Haus ihrer Mutter nicht verlassen durfte, trug Khati ihr alltäglich Aufgaben auf, die sie während ihrer Abwesenheit erledigen sollte. Gbessa musste zuerst die Reiskörner, eins nach dem anderen, von der braunen, schuppigen Streu und den grün aufgeschossenen Stängeln trennen, an denen sie wuchsen. An manchen Tagen stellte sie zwei Stängel aufrecht so vor sich hin, dass sie einander gegenüber standen und sich beide wegen des Gewichts ihrer Spreu einander zuneigten, und dann tat sie so, als redete ein Vater zärtlich mit seiner Tochter, als unterhielten sich zwei Freunde über die Lieder der Zwergtaucher, oder sie verlor sich in anderen Träumereien, die ihr den Schlaf linderten. »Papa, ich möchte durch den Regen rennen«, flüsterte Gbessa und bewegte einen Stängel im Rhythmus ihrer Worte. »Es regnet aber sehr stark, liebes geh«, antwortete sie mit deutlich gebieterischer Stimme und bewegte den anderen Stängel. »Warte, bis der Regen nachlässt. Ich sage dir, wenn es soweit ist. Dann darfst du raus.« Die Tochter tobte und lief davon, warf sich auf die Pritsche und weinte, bis der Vater zu ihr kam und sie tröstete. Und er sagte ihr, dass sie hübsch sei und wie sehr er ihr Gesicht vermisse, und er hielt ihre Hand und ging mit ihr hinaus, beschützte ihren winzigen Kopf vor dem stürmischen und gnadenlosen Regen.
Hatte Gbessa das Korn gedroschen, teilte sie den Reis in Portionen auf – einiges zum Essen, anderes für den Handel und wieder anderes, um für die Regenzeit vorzusorgen. Den größten Teil verstaute sie in einem Pamkana-Beutel, der stets halbleer blieb. Eine Portion tauschte Khati gegen den winzigsten Fisch und wenige Betelnüsse, die Gbessa jeden Tag zusammen mit der restlichen Winzigkeit Reis kochte, eine Mahlzeit, von der nur ein kleines Kind satt wurde. Tag für Tag wartete sie mit dem Essen auf Khatis Rückkehr, auch wenn sie stets so großen Hunger hatte, dass sie manchmal sogar auf den Reisstängeln herumkaute, auf ihrem Fantasievater und ihren einzigen Freunden.
War sie mit dem Kochen fertig, kroch Gbessa zum Guckloch und spähte hinaus. Dort sah sie, dass einige Familien in Lai, wie zum Beispiel die Familie Safuas, den ganzen Tag lang aßen. Diese Familien verfügten über viele Leute, die sie an den See oder auf die Felder schicken konnten, Kinder wie Sklaven gleichermaßen. Kehrten die Krieger mit Werkzeug und Gefangenen aus jüngst eroberten Nachbardörfern zurück, die jetzt dem Königreich der Vai einverleibt waren, dann konnten auf dem Dorfmarkt nur Familien wie die Safuas ausreichend Fisch, Reis oder Lappas vorweisen, um handeln zu können. Nach den Schlachten wurden diejenigen getötet, die, war ein Dorf besiegt, nicht mit den Kriegern nach Lai zurückkehren wollten. Wer sich unterwarf, kam als Gefangener nach Lai und wurde als Sklave an Familien wie die Safuas verkauft. Gbessa bestaunte diese Familien und ihren Reichtum, die vielen Kinder und das viele Essen. Ihre Häuser besaßen mehr als zwei Öffnungen, nicht nur eine Tür, die auf den Dorfkreis hinaus wies und eine zweite, die in den Wald führte. Einige ihrer Häuser hatten sogar zwei Stockwerke. Und sie verfügten über Vorräte an Mangos und Orangen, Fisch und Kochbananen, Kassavablättern und Wolloh. Sie hatten oft Besuch – viele Dorfbewohner gingen singend durch die Türen aus und ein und waren trunken vom Palmwein. Gemeine Familien wie die Gbessas aber, deren Haushalt nur aus wenigen Angehörigen bestand, die auf den Feldern arbeiten oder fischen konnten, kannten nur eine Mahlzeit am Tag. Lediglich bei Hochzeitsfeiern und nach den Gefechten geschah es – und auch das konnte sie nur aus dem Haus heraus beobachten, weil sie und Khati nie eingeladen wurden –, dass Gemeine und wohlgeborene Familien gemeinsam aßen und Palmwein tranken, bis es Ol’ Ma Famatta leid wurde und sie von ihnen ging, um in anderen Dörfern, die zu weit entfernt waren, als dass man sie sich vorstellen konnte, den Sonnenschein zu verschlingen.
Eines Nachmittags beobachtete Gbessa das Guckloch so gebannt, weil sie auf ein Zeichen von Safuas Rückkehr hoffte, dass sie sowohl den Reis als auch das Kartoffelkraut anbrennen ließ. Es geschah zum ersten Mal, seit Khati sie das Kochen gelehrt hatte, dass ihr das Essen verbrannte, und sie wartete bang darauf, dass ihre Mutter vom Reisfeld zurückkam. Sie fragte sich, ob sie mit einer Gerte geschlagen werden würde, wie sie das bei anderen Müttern im Dorf gesehen hatte, die ihre Kinder prügelten, wenn sie Unrecht getan hatten. Doch als Khati an jenem Abend nach Hause kam und die verbrannten Blätter roch, die sich an den Topfboden klammerten, warf sie nur einen kurzen Blick auf die Feuerstelle und ihrer Tochter einen klagenden Blick voller Schwäche und Mitleid zu, legte sich mit dem Rücken zu Gbessa auf die Pritsche und schlief.
Als Khati am nächsten Abend vom Feld kam, erwartete Gbessa sie an der Tür mit einer Schüssel voll frisch gekochtem Reis mit Gemüse. In der Schüssel lag nur ein Holzlöffel, anstelle der sonst üblichen zwei, den Gbessa ihrer Mutter anbot. Khati tauschte das Bündel in ihrer Hand gegen die Schüssel in Gbessas, setzte sich an die Feuerstelle und aß. Gbessa sah zu, wie Khati ihr Essen kaum kaute, bevor sie es verzweifelt hinunterschluckte und ihren Rhythmus nur für ein leises Wimmern unterbrach, mit dem sie ihre Tränen begleitete.
Sieben Tage waren seit Safuas Besuch vergangen, als Gbessa, während sie einen Topf Gemüse vorbereitete, ein leises Kratzen außen an der Hüttenwand hörte. Sie eilte zum Guckloch und schlug sich fast den Kopf dabei.
»Wer da?«, fragte sie. Und die Worte eilten, auf die andere Seite zu gelangen.
»Wer da? Was meinstu mit ‚werda’?«, lachte Safua in sich hinein.
Gbessa wetzte die Zunge zu einer Antwort, es kam aber nichts aus ihrem Mund; nur ihr Herz pochte immer lauter in den Ohren.
»So werd ich dich heute nennen, Gbessa, die Hex: ›Werda‹«, sagte er und blinzelte durch das Guckloch, um einen Blick auf sie zu erhaschen.
»Wenn ich ne Hex bin, warum bistu wieder hier?«, fragte sie und spürte dieselbe Wut in sich aufsteigen wie bei seinem ersten Besuch.
»Meine Freunde haben mich herausgefordert, Werda«, antwortete er.
»Deine Freunde haben die Hosen voll«, erwiderte sie und nahm einen Augenblick lang wahr, dass er lächelte, weil er sich von der Wand zurückzog, um seinen Blick neu auszurichten und sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.
»Hastu nich unrecht«, stimmte er zu.
Von fern hörte sie das Lachen und die Sticheleien der Jungen, deren Stimmen sich zu ebensolchem gemeinschaftlichen Lärm vermischten wie bei zankenden Hühnern.
»Wie heißtu?«, fragte Gbessa.
»Safua«, antwortete er.
»Safua«, wiederholte sie. »Freut mich, dich kennenzulernen.«
»Gleichfalls, Werda«, gab Safua zurück. Auf der anderen Seite der Mauer bewegte sich sein Kopf lebhaft hin und her, weil er angestrengt versuchte, noch einmal ihr Gesicht zu sehen. »Sag mal, wie fühlt man sich als Hex?«, fragte er.
»Wie fühlt man sich als dummer Junge?«, konterte Gbessa ohne zu zögern. Safua brach sofort in Lachen aus, und Gbessa fasste sich an die Lippen, weil sie vor Freude zitterten.
»Bist ne unhöfliche Hex, Werda«, sagte er. »Werd dich aber am Leben lassen, wenn ich mal König bin.«
»Du? König?« Gbessa errötete.
»Ja. Wenn wir von der Initiation zurückkehren, werd ich der beste Poro-Krieger, und dann nehm ich eine Sande und werd König«, fuhr er fort.
»Was ist Initiation?«, fragte sie. »Und wann ist sie?«
»Bald«, antwortete Safua. »Initiation macht dich zum Krieger oder zur Königin. Du weißt gar nichts, Werda.«
Gbessa setzte sich auf den Boden, weil ihr die Knie wehtaten. Angestrengt dachte sie über seine Antwort nach, und fühlte sich wie stets vom pulsierenden Leben außerhalb ihrer Mauern ausgeschlossen. Safua legte beide Hände gegen das Haus, um sein Blickfeld zu schärfen und begierig darauf, ihr unbändiges Haar, ihre feingliedrigen Schultern und die schwarze Haut zu sehen.
»Hungrig«, sagte Gbessa zu guter Letzt.
»Was?«
»Du hast mich gefragt, wie man sich als Hexe fühlt. Mir knurrt immer der Magen«, erklärte sie.
»Kein Essen für die Hex nich, was?«, sagte Safua. »Deine Ma hat keine Hilfe nich. Dein Vater is verrückt, und du hast keine Brüder und Schwestern nich, keine Sklaven.«
Beschämt ließ Gbessa den Kopf sinken.
»Ich seh deine Ma auf dem Feld. Manchmal geht sie auch in die Sümpfe, weißtu«, fuhr Safua fort. Gbessas Gedanken an ihre Mutter, die auf der Suche nach reifen Reisstängeln durch das Sumpfwasser watete, wurden von Rufen unterbrochen. Safuas Freunde riefen aus der Ferne nach ihm.
»Bis bald!«, brüllte er und rannte davon, um sich ihnen, fünf Jungen im gleichen Alter und von ähnlicher Statur, anzuschließen.
Gbessa presste ihr Gesicht an das Guckloch und sah in der Ferne, wie sie Safua auf die Schultern klopften und lachten, bevor sie zum See stürmten. Je weiter er sich von ihrem Haus entfernte, desto mehr Fragen stauten sich am Dach ihres Mundes.
Drei Tage danach besuchte er sie erneut, und das war eine Zeitspanne, die noch dadurch verlängert worden war, dass Gbessa ihn, wenn sie während der Pausen zwischen ihren täglichen Pflichten durch das Guckloch lugte, einmal gesehen hatte, als er mit einem Netz voller Fische vom See zurückkam. Bei einer zweiten Gelegenheit spielte er mit seinen Freunden im Dorfkreis, und beide Male schaute er zu der Ecke ihres Hauses hinüber, an der sie einander begegnet waren. Und er hielt den Blick in ihrer Richtung, bis jemand seinen Trancezustand aufstörte.
»Werda. Werda«, hörte sie es eines Nachmittags.
Gbessa kniete sich vor das Guckloch und drückte ihr Gesicht in das hereinströmende Licht.
»Werda?«, fragte Safua.
»Ja«, antwortete Gbessa. »Und werden sie mich in den Wald bringen?«, fragte sie unvermittelt, weil sie es wissen wollte, bevor er wieder verschwand.
»Ja. Geht allen Hexen so«, antwortete Safua.
»Und was dann?«
»Dann stirbstu«, sagte Safua. »Hastu Angst vorm Tod?«, fragte er einen Augenblick später nach.
»Sollte ich?«, wollte Gbessa entmutigt wissen. Auf einmal war ihr kalt.
»Weißnich. Kenn keinen nich, der gestorben is und mir sagen konnte, ob ich Angst haben soll.«
Safua rutschte auf der anderen Seite des Hauses hin und her und wartete darauf, dass weitere Worte zu ihm drangen.
»Musst aber keine Angst vorm Wald nich haben«, sagte er. »Geh selber auch in den Wald, wegen meiner Aufnahme in Poro.« Er gab sich alle Mühe, ihr Gesicht zu sehen und verdrehte die Augen auf verschiedenste Weise. Gbessa blieb stumm, sprachlos ob der Grausamkeit von Safuas Worten.
»Da werd ich also sterben«, sprach sie zuletzt weinend. »Und was wirstu tun? Wenn du Poro wirst?«, wollte Gbessa wissen und fragte sich, ob Safua sie besuchen würde, wenn der Tod ihr Zuhause wurde. Bestürzt drehte sie sich um und lehnte sich an die Wand, starrte in das winzige Ein-Zimmer-Haus. Sie hörte, wie Safua draußen hin- und herrutschte und Erregung sich in seinem Atem breitmachte.
»Ich werd der beste Krieger in ganz Lai«, sagte er. »Ich werd das ganze Dorf verteidigen, jeden, sogar ne Hexe wie dich, und ich werd für die Vai weiter Dörfer erobern.«
Bevor Safua fortsetzen konnte, hörte Gbessa auf der anderen Seite der Wand ein Handgemenge.
»Saffy! Weg dort!«, sagte eine tiefe Stimme. Gbessa konnte das klatschende Geräusch einer Ohrfeige hören und sah durch das Guckloch. Kano zerrte Safua vom Haus weg und durch den Dorfkreis. Und er schlug dem Jungen sicherheitshalber noch einmal auf den Hintern, als sie Safuas Haus betraten.
Als Khati an jenem Abend vom Feld nach Hause kam, hielt sie einen frischen Fisch in der Hand. Sie ließ das Reisbündel zu Boden fallen, nachdem sie eingetreten war und starrte den mittelgroßen Fisch an, dessen beißender Geruch sich in dem winzigen Zimmer breitmachte.
»Er lag auf der Veranda«, murmelte Khati vor sich hin. Gbessa konnte nicht sagen, ob die Tränen in Khatis Augen jene waren, die dort vor langer Zeit ein Zuhause begründet hatten und zu Khatis Gesicht gehörten wie die winzigen Muttermale über ihren Wangenknochen, oder ob es sich um neuere Tränen handelte, die der Anblick des Fisches heraufbeschworen hatte, weil sie seit zwei Trockenzeiten keinen Fisch mehr gegessen hatten. Khati drückte den Fisch und legte ihn in eine Holzschüssel neben dem Kochtopf. Gbessa wartete ab, dass Khati ihr das Gesicht zuwandte und lächelte, bevor sie zum Guckloch hinübersah.
Khati ging wieder zur Tür und schaute über das Dorf mit seinem riesigen Häuserkreis. Es war niemand zu sehen, dem sie danken konnte, und einen Augenblick lang sah es so aus, als blickte Khati in Richtung des Lake Piso und ihres Mannes, der nie wieder nach Hause kommen sollte.
Als Kanos Pfiff in dieser Nacht das Licht der letzten Laterne ausblies, der Pfeifton den Dorfkreis umreiste und durch den Spalt im Holz in Khatis Hütte eindrang, erwachte Gbessa. Sie kroch zur Hintertür des Hauses. Sie dachte kurz daran, was geschehen könnte, wenn man sie draußen erwischte, aber es kümmerte sie nicht mehr. In ihr lebte nur noch der Wunsch zu fliehen. Bei jeder Bewegung achtete sie darauf, ob Khati noch schlief, befürchtete ein abruptes Erwachen und damit das endgültige Ende ihrer Flucht. Als Gbessa die Hintertür erreichte, streckte ihre Mutter sich zwischen zwei Träumen. Gbessa erstarrte und wartete ab, bis Khati sich wieder entspannte und zu einem Knäuel zusammenrollte. Gbessa öffnete die Tür und kniete draußen nieder, und der fegende Wind bemerkte es und eilte, sie zu begrüßen. Sie nahm die Nachtluft und das Mondlicht in sich auf. Nur wenige Meter von ihr entfernt befand sich hinter der Rückseite ihres Hauses der Zugang zum Wald. Doch als die Zweige der Bäume und Büsche sich übereinanderlegten und zu ihr neigten und sich zu labyrinthischen Netzen verspannen, die ihr mit Sicherheit die Sicht versperren würden, schaute Gbessa zum Mond hinauf, in dem die alte Frau saß, heitere Zuschauerin ihrer Flucht.
»Fa-ma-tta«, murmelte Gbessa zu dem schräggrauen Umriss hinauf, der in einem Winkel des Mondes hockte und kroch in den Wald. Unter ihren Knien und Händen brachen die Blätter und Gbessa bewegte sich in diesem bewegungslosen Geflecht. Sie wandte den Kopf dem furchteinflößenden nächtigen Flüstern zu und begann zu zittern. Sie hatte Angst, sich weiter vorzuwagen und versteckte sich unter einem Strauch. Dort setzte sie sich auf und zog die Knie vor die Brust. Heisere Geräusche umschlossen sie. Überfordert und erschöpft ließ sie den Kopf auf die Knie sinken, endgültig übermannt vom Unglück, das ihr Leben war. Und sie fing an zu weinen.
Eine Stimme schnitt in ihren Kummer. »Werda? Bist du’s?«
»Werda?«, hörte sie noch einmal. Zwar wusste sie, dass es Safua war, hatte aber trotzdem zu große Angst zu antworten, weil es ihr verboten war, die unmittelbare Umgebung ihres Hauses zu verlassen.
»Was machstu nachts im Wald? Isnich gut nich«, schimpfte er mit ihr.
»Weißnich«, flüsterte Gbessa. »Bin noch nich hier gewesen. Will hier weg«, sagte sie.
Safua lachte.
»Warum bist du hier?«, fragte sie.
»Üb das Schlafen im Wald. Für die Initiation.«
»Hast wohl heute nochnich genug Ärger gekriegt? Sie finden dich und verprügeln dich wieder«, sagte Gbessa.
»Nein, das war Kano, unser Haussklave. Er sagt, es isnich gut nich, wenn ich an dein Haus geh, aber er sagt es Pa nich. Er is gut«, erklärte Safua. »Und keiner hat mich gesehn, als ich raus bin. Werden nich kommen und mich finden. Werden hinter deinem Haus nich nachsehen.«
»Weil ich verflucht bin, was?«, flüsterte Gbessa. Sie brauchte ihn nicht zu sehen um zu wissen, dass er ihr zustimmte. »Ich werd sterben.«
»Ah, bist du also kurz vor dem Dong-sakpa, ja? In fünf Regenzeiten?«, fragte er und der Gedanke daran bekümmerte ihn. »Und da willst du fortlaufen?«
In der Dunkelheit drängte Gbessa die Tränen zurück. »Ja«, antwortete sie.
»Haustu ab, bringstu die Geister gegen Lai auf«, wand Safua nach kurzem Schweigen ein. »Geh nich.«
»Wenn du verflucht bist, willstu auch nur noch weg«, beharrte Gbessa.
»Finden dich nach dem ersten Hahnenschrei und bestrafen deine Ma«, erwiderte Safua.
Gbessa dachte an Khati, der sie nicht noch mehr Kummer bereiten wollte. »Gut«, willigte sie schließlich ein. »Ich geh zurück. Aber ich weißnich, wo ich bin.«
»Lass dich nich erwischen von ihnen. Machs gut«, sagte Safua scherzhaft.
»Nich«, flehte Gbessa und langte nach ihm, bevor er verschwand, griff aber nur in die Nacht.
Safua lachte erneut. »War nur Spaß. Verlass dich nich. Ich beschütz dich. Du verirrst dich, ich bring dich heim.«
Gbessa fuhr auf, als sie eine Jungenhand auf ihrem zarten Arm spürte.
»Warum hilfstu mir? Ich bin verflucht. Hastu keine Angst nich?«, fragte Gbessa ihn und suchte bang nach seinem Gesicht.
»Du bist nich anders«, meinte er schließlich. »Bist ne Hexe, hörst dich aber an wie jedes andere Vai-Mädchen auch.«
Ihr Herz raste.
»Und ich hab vor nichts Angst nich«, fügte Safua hinzu. »Ich komm oft in den Wald. Ich hab vor nichts im Wald Angst nich. Ich werd mal König, und der König hat nie Angst nich.«
»König Safua?«, fragte Gbessa sanft und befriedigt.
»Ja. Ich geh bald weg. Komm«, sagte er und kroch vor ihr durch das Gemurmel von Wald und Nacht. Mit hängenden Schultern folgte Gbessa seinem Atem, und bei jedem Schritt voran drückte sie eine Handvoll Gras nieder, erlaubte der Erde, sich in ihre Hand zu schmiegen. Diesmal war der Boden unter ihr von Zweigen und Blättern befreit. Nichts kratzte ihre weiche und unversehrte Haut, nur Staub und Schlamm waren da, in die ihre Glieder einsanken. Am Waldrand, an dem wartend Khatis Haus stand, traf sie das Mondlicht.
»Dort drüben. Geh heim«, sagte Safua und verließ sie so schnell, wie er aufgetaucht war. Stumm dankte Gbessa dem mutigen Jungen, die hoffnungsvollen Augen hoch zu Ol’ Ma Famatta gerichtet, bis ihr Gesicht verschwand, unkenntlich hinter den vorüberziehenden nächtlichen Wolken.
Am frühen Morgen ihres dreizehnten Geburtstags rief Khati Gbessa an die Tür. Dort hatte sich eine Gruppe Männer eingefunden und wartete. Safua, der die Gruppe anführte, war erst kürzlich in den Poro initiiert worden, jenen Geheimbund der Vai, der nur die stärksten und vielversprechendsten Jungen des Dorfes aufnahm. Fünf Trockenzeiten waren vergangen, seit Gbessa Safua zuletzt gesehen hatte. Er reckte sich, als er Gbessa sah, das fiel ihr auf. Hieß das etwa, dass sie hübsch war? Hatten sich ihr rotes Haar und die schwarze Haut, die so gar nicht zueinander passen wollte, endlich versöhnt?
»Safua«, sagte Gbessa zaghaft.
»Du musst mitkommen«, erwiderte Safua.
»Weshalb«, fragte Khati nach, obwohl sie wusste warum.
»Is Dong-sakpa. Oder nich?« Safua sprach weiter zu Gbessa. Sie nickte. Heute war ihr dreizehnter Geburtstag.
»Musst mitkommen«, wiederholte er. Gbessa sah Safua an, aber seine Augen und Schultern blieben kalt, seine Stimme fremd. Nachbarn steckten die Köpfe aus den Fenstern und Türen. Sie war herausgekommen. Heute war der Tag.
»Dong-sakpa«, sagte ein Alter beifällig.
»Gbessa, die Hex!«, riefen die Kinder.
Gbessa taten die Beine weh, als sie mit ihren Häschern den Weg aus Lai hinausging.
»Wohin bringt ihr mich?«, kreischte sie.
Safua hielt an, und die Männer blieben mit ihm stehen. Er drehte sich um und sah Gbessa an, die auf eine Antwort wartete.
»Wenn du willst, kannstu gleich auf der Stelle sterben«, sagte er. Er war so anders als der knabenhafte und wissbegierige Junge, den sie aus ihren kurzen und heimlichen Treffen in Erinnerung hatte. Gram überkam sie, und sie starrte zu Boden, bis schließlich der Weg vor ihr in einen riesigen Wald mündete. Baum um Baum einem gräulichen Himmel aufgezwungen. Zwischen den Blättern steuerten Insekten in Gelb und Pflaumenfarben inmitten der Schreie von Walduntieren und Geistern durch die Hitze.
»Komm«, wiederholte Safua, und diesmal ging er voran in den Wald und ließ die Männergruppe zurück. Gbessa beeilte sich, ihm zu folgen, weil sie fürchtete, allein mit den wartenden steingesichtigen Kriegern zurückzubleiben. Safua brach unnachgiebige Waldzweige, die sich ihm in den Weg stellten, bis seine Arme Kratzer trugen und bleibende Male ihres Weges.
»Du hast damals durch das Loch gesehen«, sagte Gbessa. Sie blieb stehen und löste ihr Haar von einem Zweig, in dem es sich verfangen hatte. »Bist jetzt ganz anders«, fuhr sie fort.
»Komm!«, brüllte Safua, dem das plötzliche Zögern in ihrem Schritt auffiel.
»Ich war am Guckloch an einem anderen Tag und hab auf dich gewartet, aber bist nich gekommen«, sprach Gbessa nach erneutem, langem Schweigen weiter. »Und seit der Nacht, in der du mir geholfen hast, hab ich nich mehr versucht zu fliehen.«
»Geh weiter«, sagte Safua und vergewisserte sich, dass die Poro-Krieger außer Sicht waren und ihn nicht hören konnten. Noch vermochte er einige im Gestrüpp zu sehen.
»Was machen wir hier?«
Safua drehte sich um und packte Gbessas Arm.
»Du tust mir weh …«
»Dann halt den Mund und geh weiter!«, erwiderte er und ließ ihren Arm los.
Gbessa rieb sich die Stelle, an der er sie festgehalten hatte, um den Bluterguss zu lindern, und folgte ihm still.
»Hier«, sagte Safua und zeigte auf den verborgenen Eingang zu einer Höhle mitten im Wald. Gbessa betrachtete den Eingang, auf den er zeigte. Sie schüttelte den Kopf.
»Geh rein«, befahl Safua und zeigte weiter auf den Eingang.
Als Gbessa die Höhle betrat, sah sie als erstes zwei menschliche Schädel in einem Schimmer aus Sonnenlicht. Sie setzte sich, lehnte sich an die Höhlenwand und wartete auf Safua, störte die Stille der Höhle mit ihren Tränen. Sie war unsicher, ob er unter ihrem Schluchzen in die Höhle geschlüpft war und irgendwo saß und abwartete, und wütender noch darüber, dass er es wagte, ihr grausames Dasein zu unterbrechen, und so rief sie nach ihm.
»Safua«, sagte Gbessa. Das Echo brachte ihr den Namen zurück. »Safua«, rief sie erneut.
Als er immer noch nicht antwortete, verließ Gbessa die Höhle und suchte im dichten Web der Waldbäume nach ihm. Safua war verschwunden.
Sie ging wieder in die Höhle und setzte sich um zu überlegen, was sie tun sollte. Nichts wollte ihr in den Sinn. Nur weitere Tränen kamen, und so lag sie dort, bis die Sonne unterging, der Suche nach ihr müde. »Fengbe, keh kamba be. Fengbe, kemu beh.« Wir haben nichts, aber wir haben Gott. Wir haben nichts, aber wir haben einander. Sie sang, bis ihre Stimme das Mondlicht verschlang und das Kreischen des Waldes, und als sie am Morgen die Augen aufschlug, hatten Tränenflecken ihre Wangen gebeizt.
»Gbessa«, hörte sie von draußen. Sie glaubte, dass die Einbildung ein übles Spiel mit ihr spielte und schloss wieder die Augen. In ihrem Magen rumorte ein Schmerz, und Gbessa schlang die Arme um den Leib und hoffte, dass der Hunger sie floh.
»Gbessa!«, hörte sie erneut ihren Namen. Diesmal erkannte sie die Stimme ihrer Mutter und eilte hinaus.
»Ma!«, rief Gbessa. Sie trat aus der Höhle.
»Nein, Gbessa«, wies Khati an. Sie schaute zu Boden und streckte die Hand aus. »Geh wieder rein.«
Gbessa gehorchte. Sie setzte sich am Eingang nieder und wartete darauf, dass Khati sich zu ihr gesellte, doch Khati stellte stattdessen nur einen Kübel vor sie hin. So viel Essen auf einmal, hatte Gbessa noch nie in ihrem Leben gesehen.
»Was?«, fragte Gbessa.
»Du musst hierbleiben«, antwortete Khati.
»Weshalb?«, flehte Gbessa, die der Gedanke beunruhigte, eine weitere Nacht in der Höhle verbringen zu müssen. »Er hat mich nich getötet, ich kann fliehen. Komm mit mir mit, Ma.«
»Du hast es kommen sehen, ja?« Khati sagte es mit einem winzigen Anflug Mitgefühl. Aber eigentlich hörte sie sich nicht so an, wie eine Mutter es sagen würde, sondern wie ein Dorfbewohner, der Gbessa überhaupt nicht kannte, wie ein Dorfbewohner, der, wie alle anderen, an ihrem Tod mitschuldig war.
»Ich hab dir Essen gebracht«, sagte Khati und warf einen Blick über die Schulter. »Es is nich erlaubt, aber Safua hat mir heimlich Essen gebracht und gesagt, dass er mich zu dir bringt. Er sollte dich töten, aber er hat dich verschont. Er wartet an der Straße.«
Sie verstummte, und Gbessa nickte, erfreut über das Opfer, das ihre Mutter brachte, die Tradition, der sie trotzte, um sie zu versorgen, und gleichzeitig betrübt darüber, dass ihr Opfer Grenzen hatte.
»Danke, Ma«, antwortete Gbessa. Sie wünschte sich, dass Khati sie umarmte. Ohne Abschiedsgruß, ohne Umarmung ließ Khati ihre Tochter im Wald zurück. Gbessa schaute auf die reifen Mangos, den Kochfisch und den Reis im Kübel und wünschte sich stattdessen ihre Mutter herbei.
»Ma!«, rief Gbessa ihr hinterher, doch Khati blieb nicht stehen. »Ma!«, rief Gbessa erneut, und ihr zweiter Ruf brachte ein Echo hervor, das die Vögel des Waldes aufschreckte und sie in plötzlichem Flug mit ihren Flügeln die Blätter der Bäume um sie schlagen ließ.
»Ma!« Doch ihre Mutter war bereits außer Sicht und wie sie in einem tiefen Wald verloren.
Und so fristete Gbessa ihr Dasein in der Höhle im Wald. Schon bald war das Essen im Kübel alle. Mit den Fingernägeln schabte sie die restliche Fischhaut ab, um ihren Hunger zu besänftigen. Sie hatte ihr Essen mit den Tieren des Waldes geteilt, die sich zunächst bedrohlich verhielten, doch schließlich durch ihre Sanftheit befriedet wurden. Später entdeckte Gbessa Pflanzen, zuckrige Blätter, die sie, bevor sie davon aß, mit einem Stein in einer Schale zerstampfte, die sie aus einem zerbrochenen Schädel hergestellt hatte. Die Waldwesen kreischten auf, berührte sie eine giftige Pflanze, und später legten sie ihr Überreste ihrer rohen Mahlzeiten vor den Höhleneingang, und so lernte sie, ihnen zu vertrauen und gewann sie lieb. Doch geschah es mehrere Wochen hintereinander, dass Gbessa nichts zu essen oder zu trinken finden konnte. Und diese Wochen wurden zu Monaten und sie fragte sich, wann sie des Hungers sterben würde, wann ihr Körper zerschmelzen und ihre Knochen sich zu den vielen Schädeln in dieser Höhle gesellen würden. Doch Gbessa zerging nicht. Und wenn sie auch den quälenden, unversöhnlichen Schmerz des Hungers spürte, so starb Gbessa nicht.
Die Tiere des Waldes schien ihre Unsterblichkeit nicht zu bekümmern. Täglich besuchten sie sie, manche ruhten auf ihrer Schulter aus, andere krochen, wenn sie lag, um und über ihre wachsenden Rundungen. Sie wurde Kind des Waldes; ihre Neugier, ihre Andersartigkeit, ihre Verborgenheit passten selbst zu den von ihr verschiedensten lebhaften Wesen des Waldes. Sie sorgten sich ebenso um sie wie die Sonne. Und wenn die Einsamkeit ihre Seele auslaugte, wenn ihre Echos es leid wurden, ihr Gesellschaft zu leisten und sie weinte, dann weinten auch die Bäume um sie, wiegten sich an Nachmittagen ohne jeden Hauch vor und zurück. Die Tiere ernährten sie so, wie in ihrer Vorstellung Mütter ihre Kinder ernähren sollten, boten ihr Zuflucht wie Väter ihre Töchter beschützen sollten. Und wenn die Sonne auf der Suche nach ihr durch die Zweige und Äste lugte, dann so, wie in ihrer Hoffnung Verliebte ihre Liebsten grüßen sollten. Regnete es, und die Höhle war voller Tiere mit ihren Jungen, die der Zuflucht mehr bedurften als sie, dann saß sie unter dem entfesselten Himmel, bis ihr ganzer Körper sich vom Angriff der Nässe faltete und schrumpelte.
Wollte sie in jenen Jahren den Schmerz betäuben, dann sang Gbessa: »Fengbe, keh kamba beh. Fengbe, kemu beh.« Auf stiegen die Worte, wurden eins mit dem reisenden Wind, und manchmal war es, als ob jemand mit ihr sang. »Fengbe, keh kamba beh. Fengbe, kemu be.«
Es geschah nach dem Aufwachen an einem Morgen in der Trockenzeit, dass ein Stechen ihr das Rückgrat hoch und runter prickelte. Gbessa blickte an ihrem Körper hinab und entdeckte sattrunde Brüste, die von ihrem Oberkörper abstanden. Als Gbessas Hände über diese Wölbungen fuhren, stieg ihr in Bauch und Herz eine so neue Wärme auf, eine derart aufrüttelnde Wärme, dass sie sich wünschte, in das Dorf ihrer Verbannung zurückzukehren. Sie wusste, dass sie nun seit langer Zeit im Wald hauste, denn ihr zottiges Haar fiel ihr inzwischen bis zu den Knien. Wenn es ihre Absicht gewesen war, sie in den Tod zu schicken, als sie sie hierher gebracht hatten, dann waren sie gescheitert, der Tod hatte versagt, und sie wollte jetzt nach Hause. Diesmal machte sie sich, anstatt den Wunsch nach Heimkehr zu unterdrücken oder sich mit der Routine des Waldlebens abzulenken, auf den Weg in die Richtung, aus der sie vor so vielen Jahren gekommen war.
»Ich komme wieder«, sagte Gbessa laut, als sie spürte, wie traurig der Wald war, wenn sie sich an den Bäumen vorüberschob.
»Ich komme zurück«, wiederholte sie.
Der Tag schritt voran, und Gbessa ging in einer Wolke aus Staub und Hitze auf dem Weg zurück nach Lai, auf dem die Poro sie an ihrem Dong-sakpa fortgeführt hatten.
In der Ferne spielte Safua im Dorfkreis mit seinem Sohn und klapste den Kopf des kleinen Jungen, bis der voller Energie und Begeisterung lachend auf seinen Vater losging. Ein Aufschrei vom Dorfrand schreckte Safua aus seinem Spiel.
»Geh zu deiner Ma«, wies er den Jungen an. Safua machte sich auf den Weg zum Ursprung des Schreis, der sich zu einem ohrenbetäubenden Chor gesteigert hatte.
»Da kommt ein Geist! Da kommt der Geist von Gbessa, der Hexe!« Eine Frau zeigte auf die Gestalt, die sich ihnen durch den Staub näherte.