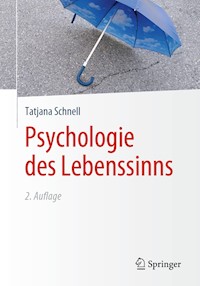20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wege zum Sinn im Leben - eine besondere Entdeckungsreise mit der Pionierin der empirischen Sinnforschung Tatjana Schnell und dem ZEIT-Journalisten Kilian Trotier Was gibt Hoffnung? Was macht mein Leben reicher? Was gibt ihm Sinn? Was verschafft ihm Erfüllung und Zuversicht? Basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt das Buch von Tatjana Schnell und Kilian Trotier, wie wir in einer Welt, die mehr denn je geprägt ist von Ungewissheit und fundamentaler Veränderung, unser eigenes Leben selbstbewusst gestalten. Es ist eine radikale Entscheidung, mit der viele vielleicht heimlich liebäugeln: aufstehen, alles liegen lassen und einfach weg, neu anfangen. Gerade in den Momenten, in denen sich das Leben besonders fragwürdig oder gar schmerzhaft anfühlt, taucht die Frage nach dem Sinn auf. Was macht ihn aus? Wie finden wir ihn? Kilian Trotier und Tatjana Schnell beschäftigen sich schon lange mit diesen Fragen. Sie wissen: Wer Sinn im Leben finden will, muss manchmal einen weiten Weg zurücklegen. In ihrem Buch machen sie deutlich, wie wichtig es ist, sich selbst zu kennen, um gut für andere da sein zu können. Sie zeigen sie, aus welchen Quellen wir Inspiration und Lebensfreude ziehen und warum Sinnkrisen uns auf positive Weise verändern können. Denn wer nach Sinn strebt, hat gute Chancen, auch glücklich zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sinn finden
Tatjana Schnell ist Professorin für Existenzielle Psychologie an der MF Specialized University in Oslo, Norwegen. Seit über zwanzig Jahren erforscht sie die Frage nach dem Sinn: im Leben, in der Arbeit, in Krisenzeiten. Nach ihrem Studium in Göttingen, London, Heidelberg und Cambridge promovierte sie an der Universität Trier und habilitierte sich an der Universität Innsbruck. Sie leitet seit vielen Jahren das Existential Psychology Lab und gründete die Plattform www.Sinnmacher.eu.
Kilian Trotier arbeitet bei der Wochenzeitung Die ZEIT. 2021 gründete er das Projekt »ZEIT Sinn – Wofür leben wir?« mit, in dem es um die großen Fragen des Lebens geht. Im Frühjahr 2023 hat er gemeinsam mit Tatjana Schnell die Serie »Sinn finden« entwickelt. Seit dem Frühjahr 2024 leitet er das ZEITmagazin ONLINE.
»Eine Vielzahl von Studien belegt: Menschen, die Sinn in ihrem Leben sehen, leben gesünder – körperlich und seelisch. Sie können besser mit Krisen umgehen, sie sind motivierter und glücklicher, und sie leben sogar länger.«Es ist eine radikale Entscheidung, mit der viele vielleicht heimlich liebäugeln: aufstehen, alles liegen lassen und einfach weg, um neu anzufangen. Gerade in den Momenten, in denen sich das Leben besonders fragwürdig oder gar schmerzhaft anfühlt, taucht die Frage nach dem Sinn auf. Was macht ihn aus? Wie finden wir ihn? Kilian Trotier und Tatjana Schnell beschäftigen sich schon lange mit diesen Fragen. Sie wissen: Wer Sinn im Leben finden will, muss manchmal einen weiten Weg zurücklegen. In ihrem Buch machen sie deutlich, wie wichtig es ist, sich selbst zu kennen, um gut für andere da sein zu können. Sie zeigen, aus welchen Quellen wir Inspiration und Lebensfreude ziehen und warum Sinnkrisen uns auf positive Weise verändern können. Denn wer nach Sinn strebt, hat gute Chancen, tatsächlich glücklich zu werden.
Tatjana Schnell und Kilian Trotier
Sinn finden
Warum es gut ist, das Leben zu hinterfragen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlagmotiv: © Holly StapletonUmschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, HamburgPorträtfotos: © Florian Lechner und © Phil DeraE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-3265-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1 Wer will ich sein?
Auf der Suche nach dem Ich
2 Warum Sinn?
Sinn braucht Zeit
Schwindelerregende Freiheit
3 Wonach suche ich eigentlich?
Glücksstreben als Risikofaktor
Vom Sinn zum Glück
Sinn ohne Glück
4 Wie fühlt sich Sinn an?
Ein kurzer geschichtlicher Abriss
Wie Sinn im Leben entsteht
Sinnerfahrungen
Sinn ist kein Gefühl
5 Bin ich ehrlich zu mir?
Positive Illusionen
6Wie kann ich wissen, was richtig für mich ist?
Über gute Entscheidungen
7 Worin kann ich Sinn finden?
Sinnquellen erforschen
Die größten Sinnstifter
Die Breite an Sinnquellen
Die Balance der Sinnquellen
Andere Persönlichkeit, andere Sinnquellen?
Wie verändern sich Sinnquellen?
Sinn und Geschlecht
8 Soll jemand mit mir gehen?
Familie und Freundschaft
Die Bedeutung des Wir
Die Bedeutung des großen Ganzen
9 Was soll dieser Sinn?
Existenzielle Indifferenz
Von der Indifferenz ins Mittendrin
Existenzielle Mobilisierung?
10 Warum tut es so weh?
Existenzielles Leid
Mit einer Sinnkrise umgehen
Aus der Sinnkrise herauskommen
11 Tut das gut?
Sinn macht gesund
Sinn als Motivator
Sinn als Moderator
12 Ist Sinn immer gut?
Ein kritischer Blick
Sinn Plus: Eine ethische Perspektive
13 Wie komme ich ins Handeln?
Rahmenbedingungen
Konkrete Schritte
Offen für das Unverfügbare
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
An dem Tag, der sein Leben verändern wird, kommt seine Freundin mit zur Arbeit. Er hat sie darum gebeten, weil er ihre Unterstützung braucht, das spürt er. Während er sein Büro in einer Universität betritt, setzt sie sich in eine ruhige Ecke auf derselben Etage. Kurz vor Mittag geht er zu ihr und sagt: »Ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr.« Sie verlassen das Gebäude, das er danach nie wieder betreten wird. Raus aus dem Job, in den er nicht mehr zurückkehren wird.
Es ist eine radikale Entscheidung. Eine, mit der viele heimlich liebäugeln: aufstehen, alles liegen lassen und einfach weg. Der Mann mit dem Job an der Universität, der anonym bleiben möchte und hier Rufus Weibel heißen soll, konnte nicht mehr. Er hielt den psychischen Druck nicht mehr aus, den seine Chefin in seinen Augen ausübte, ihre Forderung, ständig erreichbar sein zu sollen. Der Mann wollte aber auch nicht mehr.
Weibel hatte sich diesen Beruf ausgesucht, hatte sich auf die Stelle gefreut: Doktorand an einer renommierten Universität, er konnte etwas ganz Neues aufbauen, Teil eines Teams sein, motiviert, klug, hoffentlich bahnbrechend in den Forschungen. Sein Studium hatte er mit 1,0 abgeschlossen, ihm war alles leichtgefallen. Bis jetzt. Jetzt hat er einen Tinnitus und fühlt tief in sich drin: Das ist es nicht wert. Das muss ich nicht machen. Das hat keinen Sinn.
Das hat keinen Sinn – dieser Satz kann sich schnell und achtlos daher sagen. Bei Rufus Weibel ist es nicht so. Er meint ihn ernst: Was ihn vor gar nicht langer Zeit mit Vorfreude und Erwartungen erfüllt hatte, ist leer und belastend geworden. Und je intensiver sich die Zweifel in seine Gefühle gefressen haben, desto poröser wurde dieses zu Beginn noch unerschütterliche, weil selbstverständliche Wissen um den Sinn. Deshalb dieser krasse Bruch. Deshalb dieses Gefühl, verloren zu sein, orientierungslos.
Die Forschung zeigt: Menschen, die Sinn in ihrem Leben sehen, leben gesünder – körperlich und seelisch. Sie können besser mit Krisen umgehen. Sie können sich besser motivieren. Studien zeigen sogar, dass Menschen, die Sinn in ihrem Leben sehen, länger leben. Wie aber findet man diesen Sinn?
Die Antwort ist nicht leicht. Weder für Rufus Weibel noch für viele andere Menschen auf der Welt. Denn mit dem Sinn ist das so eine Sache. So sehr man ihn sich wünscht, er lässt sich nicht bestellen, nicht erzwingen und schon gar nicht kaufen. Sinn ist keine Emotion wie das Glück, die man in einem Moment spürt und bei der man sich sicher ist: Ja, so fühlt es sich an. Wer Sinn erkennen will, muss über ihn nachdenken. Wer Sinn finden will, muss manchmal einen weiten Weg zurücklegen, um ans Ziel zu gelangen. Wobei: Auch mit dem Ziel ist das so eine Sache.
Der Ursprung des Wortes Sinn liegt im indogermanischen Begriff »sent«, der so viel bedeutet wie »eine Richtung einschlagen, eine Fährte suchen«. Der Sinn ist also selbst der Weg, oder anders gesagt: Der Sinn findet sich auf dem Weg. Er ist nicht statisch, er kann sich verändern, er lässt sich nicht leicht greifen.
Gut vergleichbar ist die Suche mit einer Wanderung in der Natur: Mal ist der Pfad klar erkennbar, der Untergrund läuft sich leicht und die Richtung ist eindeutig. Mal hat der Regen den Boden so aufgeweicht, dass es schwer ist, voranzukommen. Mal hängt Gestrüpp von links und rechts, und die Gräser vor einem sind so hoch und dicht, dass man sich unsicher fragt: Geht es hier überhaupt weiter?
Die Wanderung ist für jeden Menschen anders. Niemand kann den Weg eines oder einer anderen gehen. Und niemand kann den Weg für eine oder einen anderen gehen. Es gibt aber bestimmte Gelände, bestimmte Herausforderungen und Wegmarken, die sich ähneln. Es gibt Menschen, die – wie der Mann, der vom Bürostuhl aufstand und nie zurückkehrte – im Beruf straucheln und nach einem neuen Sinn in ihrem Arbeitsleben suchen. Es gibt Menschen, deren Beziehung scheitert, die verlassen werden, die selbst spüren: So, wie es bislang war, geht es nicht weiter. Gerade in den Momenten, in denen sich das Leben besonders fragwürdig, manchmal auch besonders schmerzhaft anfühlt, taucht die Frage nach dem Sinn auf. Es gibt aber auch Menschen, bei denen kein großes Ereignis, kein Bruch zum Ausgangspunkt für die Suche wird. Der Prozess beginnt leiser, impliziter. Aber die Frage, sie geht nicht mehr weg.
Mit all diesen Menschen machen wir uns in diesem Buch gemeinsam auf den Weg. Während wir unterwegs sind, wollen wir den Sinn besser verstehen – indem wir uns ihm Schritt für Schritt annähern und ihn vermessen: mithilfe wissenschaftlicher Studien, die Tatjana Schnell und andere Forschende in den vergangenen 25 Jahren durchgeführt haben und die sie in ihrem Fachbuch Psychologie des Lebenssinns aufgearbeitet hat. Und mithilfe persönlicher Gespräche, die Kilian Trotier als Journalist der ZEIT mit Menschen wie Rufus Weibel über Erfüllung, Glück, Wendepunkte und Lebenskrisen geführt oder die er als Redakteur betreut hat.
Wir Autoren sind überzeugt, dass es Sinn ergibt, sich über den Sinn Gedanken zu machen. Damit sind wir nicht alleine. Das zeigen Daten aus Tatjana Schnells Studien. Siebzig Prozent der Deutschen finden es wichtig, ein sinnvolles Leben zu führen. Bei siebzig Millionen Erwachsenen sind das 49 Millionen Menschen. Nur acht Prozent meinen, sie brauchen keinen Sinn im Leben. Ungefähr ein Fünftel macht sich keine Gedanken über das Thema. Vor zwanzig Jahren war es noch ein Drittel. Es gibt also immer mehr Sinnbewusste und Sinnsuchende in diesem Land.
Für diese Menschen möchten wir vorab einige Dinge klären. Wer sich mit uns gemeinsam auf den Weg macht, soll nicht enttäuscht werden und erst recht nicht verletzt. Denn Sinn ist etwas sehr Persönliches. Damit gehen wir nicht leichtfertig um. Daher eine Reisevorbereitung in zehn Punkten.
Erstens: Wir schreiben über den Sinn, den Menschen in ihrem Leben sehen. Also den Sinn
im
Leben. Nicht den Sinn
des
Lebens. Ob es den Sinn des Lebens gibt, wissen wir nicht. Für manche ist er Teil ihres Lebenssinns, andere kommen ohne ihn aus. Beide Zugänge sind spannend, wir spekulieren hier nicht darüber, was richtig ist.
Zweitens: Wir machen uns auf die Suche nach Sinn im
Leben
, nicht nach Sinn in einzelnen
Ereignissen
. Wer in einer Krankheit, dem Tod eines Angehörigen, einer Scheidung oder dem Verlust eines Jobs einen Sinn finden will, kann daran verzweifeln. Wir weiten den Blick und versuchen herauszufinden, wie man selbst mit schwierigen Erlebnissen umzugehen lernen kann.
Drittens: Es ist kein Zufall, dass zurzeit so viele Menschen auf der Suche nach dem Sinn sind. Die Kirchen, die in unserem Teil der Welt jahrhundertelang das Monopol auf Sinnproduktion innehatten, sind in Deutschland zu einem Sinn-Anbieter unter vielen geschrumpft. Das hat umwälzende Auswirkungen. War der Sinn
im
Leben in einer kirchlich dominierten Gesellschaft unauflöslich verbunden mit dem Sinn
des
Lebens – einem allmächtigen Gott zu dienen –, kann jede und jeder nun selbst den Sinn im Leben suchen. Das hat etwas Befreiendes. Es ist nicht mehr vorgegeben, was man zu denken hat. Es ist aber auch eine Herausforderung: Jeder Mensch muss selbst für sich überlegen, worin er den Sinn seines Lebens sieht. Je mehr Optionen es gibt, desto schwieriger ist die Entscheidung.
Viertens: Sinn ist subjektiv. Was man als sinnvoll erachtet, entwickelt sich aus und mit persönlichen Erfahrungen, Einstellungen und Perspektiven auf die Welt. Diese Grunderkenntnis prägt die Art von Tatjana Schnell, Forschung zu betreiben und für dieses Buch auszuwerten. Wir wollen bei allen Fragen rund um den Sinn immer wissen, was die Empirie sagt – von welchen Erfahrungen also die Menschen berichten. Daraus ziehen wir unsere Schlüsse. Wenn wir so etwas wie zentrale Merkmale des Sinns entwickeln, dann auf Basis dessen, was Menschen mitteilen.
Fünftens: Wir werden am Ende nicht den einen Sinn präsentieren. Das wäre höchst unseriös. Wie sollten wir uns anmaßen, das für jede Einzelne und jeden Einzelnen zu entscheiden? Was wir tun: Wir geben Einsichten aus der Forschung und Gedanken an die Hand, die dabei helfen können, Sinn im Leben zu finden. Wir machen Angebote, manchmal auch auf Studien basierende Empfehlungen, aber keine Vorgaben.
Sechstens: Sinn ist ein schillernder Begriff. Deshalb wird er gern mit anderen schillernden Begriffen in Beziehung gebracht. Achtsamkeit zum Beispiel. Sinn ist aber etwas anderes als Achtsamkeit. Während die Achtsamkeit fordert, im Moment zu sein und sich für diesen innerlich zu leeren, fordert der Sinn ein Nachdenken, ein Füllen, ein über den Moment Hinausgehen. Sinn ist auch nicht gleich Glück. Das Verhältnis der beiden Begriffe lässt sich so zusammenfassen: Wer sich auf das Glück fokussiert, wird in vielen Fällen unglücklich. Wer nach Sinn strebt, hat gute Chancen, auch glücklich zu werden. Warum das so ist, erklären wir in diesem Buch.
Siebtens: Sinn ist kein Luxus. Er ist nicht nur etwas für die obere Mittelschicht, die im Berliner Prenzlauer Berg bei einem Hafermilchcappuccino über das Leben reflektiert. Sinn ist der Grund unseres Lebens – in dem Sinne, dass er wie ein Boden unter unseren Füßen ist und der Grund dafür, morgens aufzustehen. Deshalb denkt die Menschheit seit Jahrtausenden über den Sinn nach. Sinn ist keine Modeerscheinung. Er ist existenziell.
Achtens: Sinn ist keine Ego-Show. Natürlich muss man erst einmal über sich selbst nachdenken und Klarheit gewinnen, um an den Sinn im eigenen Leben ranzukommen. Das kann einem niemand abnehmen. Dieser Prozess, der ein innerer ist, führt aber nicht dazu, dass man nur im Inneren bleibt und nach dem Ende der Lektüre dieses Buches ständig »Ich, ich, ich« sagt. Vielmehr ist es so: Nur wer sich selbst gut kennt, mit seinen Stärken und Schwächen, Wünschen, Werten und Sehnsüchten, kann gut für andere da sein.
Neuntens: Sinn ist nicht
per se
gut. Um es drastisch zu sagen: Adolf Hitler fand wie viele andere Diktatoren dieser Welt das, was er tat, sinnvoll. Deshalb geht es uns in diesem Buch auch darum, nicht blind dem Sinn nachzulaufen, sondern die Bedingungen zu ergründen, die ihn moralisch integer machen.
Zehntens: Sich die Frage nach dem Sinn zu stellen, ist nicht ohne Risiko. Man setzt sich mit sich selbst auseinander. Das geht nah. Das ist schutzlos. Das kann erschüttern. Es kann passieren, dass man geglaubt hat, sich zu kennen – und dann spürt, dass vieles ganz anders ist als bislang angenommen. Dann kommen Fragen auf, die existenziell sind: Was heißt das für das eigene Leben? Muss man sich ändern? Man könnte denken: Dann lass ich es lieber ganz sein und lebe einfach so weiter wie bisher. Klingt attraktiv – ist es aber nicht unbedingt. Die Forschungen von Tatjana Schnell zeigen, dass der Prozess, den die Fragen auslösen, schmerzhaft sein kann. Noch schmerzhafter aber ist es, wenn man zu spät merkt, dass man ein Mensch geworden ist, mit dem man sich gar nicht identifizieren kann oder will. Wenn man realisiert, dass man sich vor allem daran orientiert hat, was andere von einem wollen. Dass einen deren Erwartungen geprägt haben. Ja, dass man vielleicht sogar die Vorstellungen anderer gelebt hat.
Wir als Autorin und Autor dieses Buches versprechen nicht, dass der Weg mit und zum Sinn leicht wird. Wir sind uns aber sicher, dass die Reise verändert – jede und jeden auf ganz eigene Weise.
Diejenigen, die sich auf diese Reise einlassen, werden im Laufe des Weges vielleicht fragiler, aber auch bewusster werden. Sie werden sich klarmachen, wie brüchig das Leben ist. Sie werden sich von lieb gewonnenen Illusionen verabschieden – beispielsweise von der, dass man selbst besser ist als der Durchschnitt oder dass man sein Leben unter Kontrolle hat. Sie werden spüren, wie verletzlich sie sind. Und gleichzeitig werden sie erfahren, welche Kraft sich gerade aus der Verletzbarkeit entfalten lässt. Sie werden Sinnquellen kennenlernen, aus denen wir Menschen Inspiration und Lebensfreude schöpfen. Sie werden erfahren, warum es für ein Leben, das auf Sinn fokussiert, nicht ausreicht, nur auf sein enges Umfeld, die Familie und die Freunde, zu schauen. Sie werden verstehen, warum Sinnkrisen ganz natürlich sind und dass sie, auch wenn man unter ihnen leidet, das Leben auf eine gute Weise verändern können. Und sie werden ergründen, wie ein Neuanfang gelingen kann, der ein sinnerfülltes Leben ermöglicht.
Was bedeutet das konkret? Woran hat jemand wie Rufus Weibel, der seinen Job aufgab, gemerkt, dass dieser Schritt richtig und notwendig ist? Wie kann er nach dem Bruch neu anfangen? Wie findet er wieder Spaß, Leichtigkeit und Erfüllung? Darauf gibt es nicht die eine allein gültige Antwort. Aber es gibt Strategien, die aufzeigen, wie man in solch einer Situation agieren kann – ja: agieren, nicht reagieren. Schon auf diesen Unterschied kommt es an.
1 Wer will ich sein?
Über die Notwendigkeit der Selbstkenntnis
Sibel Kekilli hat sich viel Zeit genommen an diesem warmen Herbstnachmittag. Die Schauspielerin holt sich noch einen Kaffee beim Hamburger Jungfernstieg, dann ist sie bereit für das Gespräch, das nah und existenziell wird. Sinn, Brüche im Leben, Tod, Leben nach dem Tod. Sie will darüber reden, auch wenn es ihr nicht leichtfällt, weil da Schmerz hochkommt und Trauer.
Kekilli ist mittlerweile mehr als vierzig Jahre alt. Deutschlandweit bekannt wurde sie mit Anfang zwanzig, als sie sich erst gegen 350 Mitbewerberinnen beim Casting für die Hauptrolle in Fatih Akins Film Gegen die Wand durchsetzte und dann die Rolle der Sibel Güner so atemberaubend rotzig und wild entfesselt spielte, dass sie dafür 2004 als beste Hauptdarstellerin den Deutschen Filmpreis erhielt.
Sie verkörperte eine junge Frau, die aus ihrer konservativen deutsch-türkischen Familie ausbricht. Und auch wenn Sibel Kekilli später im Gespräch sagen wird, dass sie damit nicht ihre eigene Geschichte verarbeitet habe, ist sie doch so nah an ihr dran, dass sie sich in diese Figur hineinbegeben konnte, ihr Innerstes ausleuchtete und zum Schwingen brachte. Oder wie Kekilli es selbst sagt: »Das ist ja das Schönste am Schauspiel: dass man sich austoben kann, wenn man einmal drin ist in der Figur.«
Mit allen Fasern lebt sie ein anderes Ich aus. Das ist ihr Beruf. Sie kann reinschlüpfen und wieder rausgehen. Das geht bei Figuren, nicht aber im eigenen Leben. Und deshalb ist dieses Interview auf einer Wiese mitten in der Hamburger Innenstadt ein ernstes.1 Denn bis sie dahin kommen konnte, dass sie andere Menschen spielt, war ihr Leben ein Kampf.
Kekilli wuchs in Heilbronn auf, ihre Eltern waren dorthin aus der Türkei gezogen. Über ihre Kindheit sagt sie: »Ich habe mich wie in eine Box eingepfercht gefühlt, in der ich mich nicht drehen und wenden konnte.« Als Mädchen durfte sie immer weniger als die Jungs. Sie sollte nie lange wegbleiben, auch nicht bei Freundinnen, nach zwanzig Minuten klingelte ihr Bruder und holte sie ab. Später, als Jugendliche, durfte sie keinen Liebeskummer zeigen, weil das bedeutet hätte, dass sie verliebt ist, was in ihrer Familie für sie als junge Frau tabu war. So erzählt sie es.
Als sie konnte, brach sie aus. Es war ein Ausbruch, ein Aufbruch, der bis heute einen Bruch nach sich zieht – mit ihrer Familie, mit ihrem Umfeld. Sie hat mit ihren engsten Menschen nie wieder etwas zu tun gehabt. Wie tief der Schmerz in ihrer Seele eingegraben ist, kann man erahnen, wenn sie vor einem sitzt und davon erzählt, den Blick auf den Boden fixiert. Und man kann ihn hören, in ihren Worten. Sich zu lösen, koste enorm viel Kraft, sagt Kekilli. »Man muss aus der Familie raus, aus dem Kulturkreis, wird nicht mehr zu Familienfesten eingeladen, nicht mehr angeschaut.« Und dann: »Du bist für den Rest deines Lebens auf dich allein gestellt.«
Sibel Kekilli spürte früh, dass sie völlig anders ist als die Menschen, mit denen sie aufwuchs. Sie schaute auf sich und glich sich ab. Sie glich sich ab und grenzte sich ab. Sie fühlte sich ausgegrenzt und rebellierte. Ihre Persönlichkeit formte sie in dieser Rebellion. Seit sie ein junges Mädchen war, sah sie sich gezwungen, über sich nachzudenken. Sie musste es tun, weil sie nach etwas derart Anderem strebte, als für sie vorgesehen war.
So wurde sie zu einer reflektierten Frau. Und tat etwas, das auf dem Weg zu einem sinnvollen Leben unerlässlich ist: über die eigene Identität nachdenken. Das lohnt sich – auch wenn man nicht auf derart harte Art dazu gedrängt wird wie Sibel Kekilli. Denn nur so kann ich mein Ich ausleuchten und mich wirklich kennenlernen. Nur wenn ich mich selbst gut kenne, mag und annehme, kann ich aus einer stabilen Position heraus nach außen schauen, handeln, gut für andere da sein. Über sich selbst nachzudenken, ist also nicht egoistisch. Es ist die Grundlage, um gut in Gemeinschaft leben zu können.
Auf der Suche nach dem Ich
Wer bin ich? Die Frage könnte man sofort abwürgen: Das weiß doch niemand so gut wie ich! Seit Beginn meines Lebens kenne ich mich. Das stimmt, aber es stimmt auch nicht. Ich bin mir vieler Dinge, die ich tue, bewusst. Vieles andere aber ist mir nur zugänglich, wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte – oder es wird mir erst bewusst, wenn ich versuche, es zu formulieren. Deshalb ist die Auseinandersetzung damit, wer ich bin, was mich ausmacht, was meine Ziele sind und welcher Mensch ich sein möchte, immer wieder von Neuem ein Gewinn.
Es geht bei diesem Nachdenken nicht darum, sich auf die Suche nach einem wahren Kern in mir zu machen. Dass es einen unveränderlichen Wesenskern in uns Menschen gibt, ist ein weit verbreiteter Glaube in vielen Kulturen der Welt. Das hat ein Team von Forschenden aus den USA, China, Indien, Singapur und Südkorea belegt.2 Wissenschaftlich lässt sich die Existenz eines wahren, stabilen, vom Außen unabhängigen Selbst nur schwer erforschen. In der Psychologie geht man allerdings meist davon aus, dass ein solcher Wesenskern nicht existiert. Auf die Suche machen kann ich mich trotzdem, nach Antworten auf Fragen wie: Was macht mich zu der Person, die ich bin, und wie ist Veränderung möglich? Welche Bedeutung haben meine Herkunft und meine Vergangenheit für mich, und wie binde ich sie in mein weiteres Leben ein?
Diese Fragen sind nicht ohne. Sie können Spuren von Lebensveränderung enthalten. Wenn ich sie mir stelle und sie ernsthaft versuche zu beantworten, kann einiges, das vorher sicher schien, ins Wackeln kommen. Diese Erfahrung verunsichert. Ich kann sie aber auch positiv für mich deuten: An meinen eigenen Fundamenten zu rütteln, kann dazu führen, dass ich mir möglicher Schwachstellen bewusst werde und sie ausbessere. Oder – im Extremfall – ein ganz neues Fundament aufbaue. So stabilisiere ich den Boden meines Lebens, der vielleicht poröser war, als ich es geahnt hatte.
Wer also bin ich? Ich bin in die Welt geworfen – ungefragt, ohne die Möglichkeit, mitzubestimmen beim Ob, Wann und Wo. Für den Philosophen Martin Heidegger ist das ein wichtiges Merkmal des menschlichen Daseins, der conditio humana. Der Inder Raphael Samuel wurde dafür bekannt, genau das nicht hinnehmen zu wollen: 2019 kündigte er an, seine Eltern dafür verklagen zu wollen, ihn in die Welt gesetzt zu haben – ohne seine Zustimmung! Tatsächlich hat er sie nicht verklagt, Eltern und Sohn haben ein gutes Verhältnis. Aber seine Absicht ist aufgegangen: mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Gefahren der Überbevölkerung für die Umwelt zu richten.
Raphael Samuel und viele Vertreterinnen und Vertreter der Existenzphilosophie sind sich darin einig, dass wir Menschen nicht mit einem vorbestimmten Plan auf die Welt kommen. Und viele andere haben ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass sie den Sinn des Lebens nicht greifen oder erkennen können. Und doch muss daraus kein sinnloses Leben folgen. Der Geworfenheit lässt sich der Entwurf entgegensetzen. Die Philosophin Hannah Arendt nannte dies »Gebürtlichkeit«: Unsere Geburt ist ein Neubeginn, und ein Anfang des Anfangens. Ich bin geboren – deshalb kann ich handeln. Im Handeln bekräftige ich mein Geborensein und übernehme Verantwortung für mein Leben.3
Agieren und reagieren
Inwieweit muss ich mit dem leben, was mir zufiel, in der Geworfenheit? Was kann ich überhaupt gestalten, entwerfen? Die Spannung zwischen diesen beiden Polen beschäftigt die Psychologie. Sie geht heute davon aus, dass wir Menschen teils durch Gene und Lebensbedingungen bestimmt werden, teils durch unsere Entscheidungen und Erfahrungen. Dabei ist die Umwelt natürlich nicht beliebig formbar.
Ob bewusst oder nicht stehe ich in ständigem Austausch mit der Umwelt. Ich werde durch äußere Bedingungen herausgefordert, angeregt, durch das Verhalten anderer aufgefordert und mit Problemen konfrontiert – auf all das will oder muss ich reagieren. Gleichzeitig habe ich Bedürfnisse, Pläne und Ziele, die ich umsetzen möchte. Um dies tun zu können, agiere ich.
In der Persönlichkeitspsychologie werden vier Arten von Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt unterschieden: reaktiv, evokativ, proaktiv und manipulativ. Diese Unterscheidung ist hilfreich, um das menschliche Erleben und Verhalten besser zu verstehen. Sie macht deutlich, dass es weder allein auf mich als Person noch allein auf die Situation ankommt, sondern dass sich beide auf verschiedene Arten beeinflussen.
Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf dieselbe Situation. Ein Freund erzählt von einer Freundin, die einen Fahrradunfall hatte. Der eine denkt: Die Arme!, und vergisst sie bald wieder. Die andere schickt ihr eine Textnachricht, in der sie gute Besserung wünscht, und fährt am nächsten Tag zu ihr ins Krankenhaus. Oder: Der Klimawandel führt zu Artensterben, Extremwetter, Verknappung von Ressourcen wie Trinkwasser und Lebensmittel. Die einen ignorieren oder leugnen die Zusammenhänge, andere fühlen sich gelähmt, während wiederum andere aktiv werden, ihren Lebensstil ändern, ihr Unternehmen umorganisieren oder Aktivisten werden. Es gibt kaum eine Situation, die bei allen die gleiche Reaktion auslöst. Die individuellen Eigenschaften, Erwartungen und Werte bestimmen die Reaktion immer mit.
Evokative Interaktion
Durch die Art, wie ich bin und wie ich handle, rufe ich in meiner Umwelt etwas hervor. Das erschafft wiederum eine Situation, die mich beeinflusst. Wenn Babys viel schreien, ruft das ein Verhalten der Eltern zutage, das besonders kontrollierend oder verärgert sein kann – das wirkt sich wiederum auf das Baby aus. Auch bei Erwachsenen ist das so: Wenn ich gern und viel lache, versetzt das manch andere in fröhliche Stimmung. Die gemeinsame Zeit wird dadurch lustig und bereitet mir Freude. Das heißt, wie sich andere mir gegenüber verhalten, hat längst nicht nur damit zu tun, was für Menschen sie sind, sondern auch damit, was ich in ihnen auslöse.
Proaktive Interaktion
Meiner Persönlichkeit und meinen Vorlieben entsprechend suche ich bestimmte Situationen auf und vermeide andere. Auch das geschieht meist nicht bewusst. So tendieren Menschen dazu, sich Freunde zu suchen, die ihnen ähnlich sind – was dazu führt, dass die geteilten Eigenschaften weiter verstärkt werden.
Manipulative Interaktion
Der Begriff klingt negativ, meint aber tatsächlich nur, dass ich meine Umwelt bewusst gestalte und umgestalte, damit ich mich, meine Bedürfnisse und meine Anliegen darin wiederfinde. So gründe ich einen Sportverein, wenn ich die Möglichkeit vermisse, mein Talent für Organisation und meinen Bewegungsdrang auszuleben. Oder ich bringe ab und zu einen selbst gebackenen Kuchen mit zur Arbeit, wenn ich ein geselliger Mensch bin und mir an einer guten Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen gelegen ist. Wie bei der proaktiven Interaktion suche oder schaffe ich selbst die Situationen, die mich dann wiederum beeinflussen.
Mein Leben wird durch alle vier Arten der Wechselwirkung bestimmt, permanent, häufig übergangslos und in den meisten Fällen, ohne dass ich darüber nachdenke. Sich dessen bewusst zu werden, kann dabei helfen, Erfahrungen besser zu verstehen und vielleicht auch die eigene Persönlichkeit zu verändern. Indem ich mir beispielsweise Freunde suche, die einen anderen Hintergrund als ich haben, oder indem ich ein neues Hobby ausprobiere und mich dabei in ein Umfeld begebe, das es mir nicht von Anfang an leicht macht.
Diese Erkenntnisse machen deutlich, dass es viele Möglichkeiten gibt, mit dem umzugehen, was mir im Leben begegnet. Nie geschieht nur etwas mit mir. Ich löse auch etwas aus, wenn ich handle. Ich kann gezielt nach Menschen und Situationen suchen, die mich bewegen, die mir guttun, die mich aus meiner Komfortzone holen oder infrage stellen. Und ich kann bewusst entscheiden, wobei ich nicht mitmachen möchte.
So geschieht Veränderung. Ich merke, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn Freunde mit mir durch Bars ziehen wollen, ich aber keine Lust habe und mich nicht dazu überreden lasse, sondern Nein sage. Oder ich gehe etwas an, das mich schon länger bewegt. Das kann ein Ehrenamt sein oder die Entscheidung, mehr Zeit mit meiner Partnerin zu verbringen. Manchmal sind es auch große Schritte, die ich gehe, wenn ich realisiere: Ich bin diesem Leben nicht ausgesetzt. Ich kann meinen eigenen Weg finden – meine Lebensgeschichte selbst schreiben.
Die Geschichte meines Lebens
Menschen sind fasziniert von Geschichten. Sie wecken Emotionen, bieten eine Dramaturgie, haben einen Spannungsbogen und folgen einer inneren Logik. Solch eine Geschichte erzählen wir auch von unserem eigenen Leben. Um zu verstehen, welchen Mustern diese Narration folgt, lohnt sich ein Blick in die Arbeiten des nordamerikanischen Psychologen Dan McAdams. McAdams hat Hunderte von Menschen interviewt, sie nach Schlüsselerlebnissen gefragt, nach ihrer Zukunftsvorstellung. Während er zuhörte, erkannte er Erzählmuster, die wiederkehrten. Als er sich eingehender mit ihnen beschäftigte, entdeckte er, dass sie in ihren Strukturen dem ähneln, was man Mythos nennt.
Mythen sind Erzählungen von Göttern und Menschen, die über den Einzelnen hinausweisen. Sie handeln von Gut und Böse, von Reise und Rückkehr, von Heldinnen und Heiligen. Sie gelten nicht nur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, sondern haben den Anspruch, etwas Allgemeingültiges in sich zu tragen.
Seit der Moderne kann der Westen mit den großen Mythen und Geschichten nicht mehr viel anfangen. Der französische Philosoph Jean-François Lyotard beschrieb diese Entwicklung 1979 als das »Ende der großen Erzählungen«4: Religiöse, philosophische und politische Narrative werden nicht länger als allgemeingültig und absolut wahrgenommen. Die Anziehungskraft des Christentums ist verblasst, die Ideen des Kommunismus und der Aufklärung sowie die Legitimation der Demokratie werden zunehmend infrage gestellt. Es gibt zahlreiche kleine Diskurse, in denen Vergangenheit und Gegenwart unterschiedlich interpretiert werden, in denen unterschiedliche Zukunftsvisionen entworfen und in denen unterschiedliche Menschenbilder vertreten werden. Für das Individuum erscheint der Blick auf das große Ganze fragmentiert. Das macht es nicht einfach, sich darin zu verorten. In einem solchen Umfeld ist es wichtig, zumindest das eigene Leben als schlüssig und zusammenhängend wahrzunehmen: einzelne Lebensereignisse in Verbindung setzen zu können, Veränderung zu verstehen, Entwicklung zu erleben. Lebensgeschichten ermöglichen das. Sie erschaffen ein Bild des Selbst als Kontinuität, als in sich kohärent.