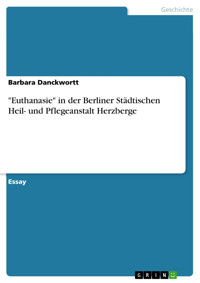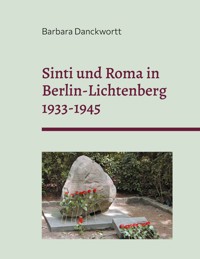
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die vielfältigen, detaillierten Recherchen zur Geschichte der Sinti und Roma im Bezirk Berlin-Lichtenberg im Nationalsozialismus ergaben bemerkenswerte Biographien und Dokumente aus zahlreichen Berliner und Brandenburgischen Archiven. Mit den Verfolgungseinrichtungen auf dem ehemaligen Lichtenberger Bezirksgebiet, wie dem Arbeitshaus Rummelsburg und dem Zwangslager Marzahn, verbunden sind die vorgestellten Biographien von Sinti und Roma, die Opfer rassistisch begründeter Verfolgung wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Sinti und Roma - Eine Geschichte der Verfolgung
2.1 Von der Einwanderung bis zur Weimarer Republik
2.2 Antiziganistische Vorurteile
Die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus
3.1 Die »Zigeunerverfolgung« der Kriminalpolizei im Nationalsozialismus
3.2 Die »Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle« am Reichsgesundheitsamt
3.2.1 Der Leiter der Forschungsstelle Dr. Dr. Robert Ritter
3.2.2 Die Arbeitsmethoden der Forschungsstelle
3.2.2.1 Erfassung
3.2.2.2 »Rassenanthropologische« Vermessung
3.2.2.3 Moulagen und Handleistenmuster
3.2.2.4 Fotografische und filmische Dokumentation
3.2.2.5 »Rassegutachten«
3.2.2.6 Die »Sippentafeln« der RHF
Das Zwangslager für Sinti und Roma in Berlin-Marzahn
4.1 Die Einrichtung des Lagers Marzahn 1936
4.2 »Rassenforschung« und Verhaftungsaktion im Zuge der Aktion »Arbeitsscheu Reich«
4.3 Zwangsarbeit in der Landwirtschaft und Industrie
4.4 Komparsen für Leni Riefenstahls Film »Tiefland«
4.5 Deportationen ins KZ Auschwitz-Birkenau
4.6 Zurückgeblieben im Lager Marzahn
Inhaftiert in Konzentrationslagern
5.1 Einweisungen ins KZ Sachsenhausen
5.2 Einweisungen ins KZ Ravensbrück
5.3 Im »Zigeunerlager« des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau
Sinti in den Laubenkolonien in Karlshorst
6.1 Wolgadeutsche
6.2 Musiker nur mit Genehmigung der Kriminalpolizei
6.3 Drohende Deportation ins KZ Auschwitz
6.4 Karlshorster Nachbarn zeigen Zivilcourage
Biographien
7.1 »Rukeli« Johann Wilhelm Trollmann (1907-1944)
7.2 Elli Rose (geb. 1920)
7.3 »Unku« Erna Lauenburger (1920-1943)
7.4 »Kaula« Helene Ansin (1920-1974)
7.5 Margarete Herzstein (1923-1943)
7.6 Otto Rosenberg (1927-2001)
7.7 Ewald Hanstein (1924-2009)
7.8 Oskar Böhmer (1920-2005)
7.9 Reinhold Laubinger (1920-1986)
7.10 Heinrich Steinbach (1872-1952)
7.11 Agnes Steinbach (1929-1999)
7.12 Alfred Lora Freiwald (geb. 1931)
Strafverfolgung, Problematik der »Wiedergutmachungsverfahren«, Gedenken
8.1 Strafverfolgung
8.2 Problematik der »Wiedergutmachungsverfahren«
8.3 Gedenken
Chronologie des Völkermords (»Porajmos«)
Archivverzeichnis
Literaturverzeichnis
11.1 Gedruckte Quellen
11.2 Literatur vor 1945
11.3 Literatur nach 1945
11.4 Internetquellen
Anmerkungen
1. Vorwort
Für das Bezirksamt Lichtenberg recherchierte ich 2016-2018 die Geschichte der Sinti und Roma im Bezirk Lichtenberg im Nationalsozialismus. Die vielfältigen, detaillierten Recherchen ergaben bemerkenswerte Biographien und Dokumente aus zahlreichen Archiven. Als Kuratorin konzipierte ich zwei Ausstellungen »Kann nur das beste Zeugnis geben – Karlshorster Sinti-Familien im Nationalsozialismus«1 und »ausgegrenzt-verfolgt-ermordet. Sinti und Roma in Lichtenberg 1933-1945«2, die 2018 im Museum Lichtenberg gezeigt wurden. Zu letzterer erschien eine bebilderte Broschüre. Die Ausstellung wurde 2019 nochmals im Museum Marzahn–Hellersdorf präsentiert.3 Zudem übernahm ich die wissenschaftliche Beratung für das Theaterstück »Rastplatz Marzahn« der Spreeagenten 2017.4
Ich danke dem damaligen Direktor des Museums, Thomas Thiele, für die Betreuung des Projektes und die Redaktion der Ausstellungstexte, Jan Lengert für die hervorragende grafische Gestaltung, dem damaligen Bürgermeister von Lichtenberg, Michael Grunst, für die engagierte Unterstützung sowie Petra Rosenberg vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Berlin-Brandenburg.
Die vorliegende Publikation wurde um Texte und Biographien erweitert. Mit den Verfolgungseinrichtungen auf dem ehemaligen Lichtenberger Bezirksgebiet, wie dem Arbeitshaus Rummelsburg und dem Zwangslager Marzahn, verbunden sind die vorgestellten Biographien von Sinti und Roma, die Opfer rassistisch begründeter Verfolgung wurden. Sie waren von Zwangsarbeit, Eingriffen in die persönliche und körperliche Unversehrtheit durch rassenbiologische Untersuchungen und Sterilisation sowie von der Deportation in Konzentrationslager- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten betroffen. Die Verantwortlichen der Lichtenberger Verwaltung waren Erfüllungsgehilfen von zentralen Institutionen, wie der Berliner Polizei und der »Rassenhygienischen Forschungsstelle« am Reichsgesundheitsamt, von denen die systematische Ausgrenzung und Verfolgung ausgingen.
Einige der Verfolgten entkamen dem an ihrem Volk verübten Genozid. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten gerade im Bezirk Lichtenberg die Majorität der Sinti und Roma in der DDR. Das Ende der NS-Herrschaft bedeutete allerdings kein Ende der Ausgrenzung. Überlebenden blieb in der Regel eine Entschädigung versagt, und auch heute noch müssen Angehörige dieser Minderheit um ihre Bürgerrechte kämpfen.
Ich danke vielmals für die hilfreiche Unterstützung dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, dem Landesverband der Deutschen Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V., dem Landesarchiv Berlin, dem Bundesarchiv, dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Entschädigungsbehörde, dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv, den Arolsen Archives, der Gedenkstätte Auschwitz, der Gedenkstätte Sachsenhausen, der Gedenkstätte Neuengamme, der Gedenkstätte Ravensbrück, der Gedenkstätte Moringen, der Kunststiftung Ruth Baumgarte und Manuel Trollmann.
Barbara Danckwortt, im Juli 2023
2. Sinti und Roma -Eine Geschichte der Verfolgung
2.1 Von der Einwanderung bis zur Weimarer Republik
Die sich in Europa aufhaltenden Gruppen Sinti, Roma und Kalé stammen ursprünglich aus Nordwestindien/Pakistan. Von dort waren sie im 9. und 10. Jahrhundert im Zuge der Islamisierung vertrieben worden. Mit Hilfe der Linguistik lässt sich der Weg von Indien nach Europa anhand der Lehnwörter verfolgen, die die einzelnen Gruppen aus den Sprachen der Gastländer in ihre Romanes-Dialekte aufnahmen. Der Sprachwissenschaftler August Friedrich Pott wies in seiner Veröffentlichung »Zigeuner in Europa und Asien« von 1844 die Abstammung von Romanes aus dem Sanskrit nach und widerlegte damit die Legende, die »Zigeuner« kämen aus Ägypten.5
Während die Sinti vor 600 Jahren in Deutschland einwanderten, die Kalé über Frankreich nach Spanien weiterzogen, gerieten die Roma im Spätmittelalter in der Walachei und der Moldau in die Sklaverei.6 Im französischen Sprachraum führen Sinti die Eigenbezeichnung »Manusch«/»Manouches«, eine kleinere Teilgruppe der Sinti aus Tschechien nennt sich Lalleri.
Die erste Urkunde über das Auftreten von Sinti und Roma in Deutschland stammt 1407 aus Hildesheim. Stießen sie aufgrund ihres vorgegebenen Status als Pilger und mitgeführter Geleitbriefe zunächst auf Hilfsbereitschaft, so untersagte ihnen 1482 der Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg (1414-1486) den Aufenthalt im Kurfürstentum Brandenburg. Der Reichstag zu Freiburg von 1498 erklärte den Geleitbrief des Königs Sigismund (1368-1437) für ungültig und die »Zigeuner« für »vogelfrei«. Die »Vogelfreiheit« bedeutete einen Freibrief für jedermann zu ihrer Verfolgung, Folter und Ermordung. Aufgegriffene wurden ausgepeitscht, gebrandmarkt und über die Grenze vertrieben. Sogenannte »Zigeunerpfähle« mit Darstellungen drakonischer Strafen sollten »Zigeuner« vom Betreten der Territorien abhalten. König Friedrich Wilhelm I. in Preußen (1688-1740) befahl im Edikt von 1725, alle »männlichen und weiblichen Zigeuner« über 18 Jahre ohne Gerichtsverfahren zu hängen. Die Kinder sollten in Waisenhäuser gebracht werden.
Mit der Aufklärung trat an Stelle der Verfolgungspolitik der Erziehungsgedanke. Ihre Umerziehung zu »nützlichen« Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft sollte durch das Verbot ihrer Sprache und das Entziehen ihrer Kinder erreicht werden. Ziel war eine Assimilation unter Zwang. Das Scheitern dieser Projekte wurde den »Zigeunern« angelastet und als Beleg für ihre »Unverbesserlichkeit« rezipiert.7
Prägend war der Gelehrte Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann (1756-1804) mit seiner Dissertation »Die Zigeuner« von 1783, in der er sämtliche Vorurteile zusammenfasste und sie als wissenschaftlich fundiertes Wissen ausgab.8 Mit dem Aufkommen von Rassentheorien verschärfte sich der Druck auch auf Sinti und Roma. Sie wurden, wie Juden oder »Neger« der weißen und »höherwertigen« Kulturrassen gegenübergestellt. Wegbereiter war der französische Schriftsteller Arthur de Gobinau (1816-1882) mit seiner mehrbändigen Schrift »Essay über die Ungleichheit der Menschenrassen«.9
Als im Kaiserreich verstärkt Roma-Familien einwanderten, propagierte die Regierung unterstützt von der Presse das Schreckgespenst der »Zigeunerplage«. Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) erklärte 1886 die Sesshaftmachung für inländische »Zigeuner« zum politischen Ziel, ausländischen »Zigeunern« drohte die Ausweisung. 1906 schlug sich dies in Preußen in der »Anweisung zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« nieder.10 Zur Abschiebung wurden Übernahmeabkommen mit Nachbarstaaten geschlossen. In der Weimarer Republik bestimmten im Gegensatz zur Verfassungstehende Sonderverordnungen die »Zigeunerpolitik«, so etwa 1926 in Bayern, wo das Reisen mit schulpflichtigen Kindern und in Gruppen verboten wurden und zudem die Inhaftierung drohte.
2.2 Antiziganistische Vorurteile
Schon bei Chronisten der Frühen Neuzeit findet sich ein ganzes Spektrum von Vorurteilen. Die Bezeichnung als »Tataren« setzte Sinti und Roma mit den Hunnen gleich, von deren Eroberungszügen man noch mit Schrecken sprach. Die Farbe Schwarz symbolisierte in der Tradition des abendländischen Christentums das Böse und Minderwertige schlechthin, so dass »Zigeuner« allein durch ihre dunkle Haut- und Haarfarbe geradezu zur Zielscheibe von Verleumdungen wurden. Auf Misstrauen stieß ihre Sprache, die mit einer Gaunersprache gleichgesetzt wurde. Der Vorwurf der Hexerei diente dazu, »Zigeunerinnen« und »Zigeuner« vor die Inquisition zu bringen. Begründet wurde die Verfolgung im 16. Jahrhundert mit der Unterstellung, sie seien »Spione« der Türken. Ein absurdes Vorurteil, das von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen wurde.
Während die Zuschreibung abwertender Charakterzüge wie »unsauber«, »kriminell«, »arbeitsscheu« die antiziganistische Stereotype bestimmten, zeigten im Gegensatz dazu Darstellungen in der populären Literatur und auf der Bühne ein romantisch erklärtes Klischee. Das Frauenbild war durch sexuelle Wunschprojektionen geprägt, obwohl die Imagination der freizügigen, lockenden »Carmen«, den kulturellen Normen der Sinti und Roma diametral entgegensteht. Ebenso entspringt die Vorstellung der wahrsagenden, unheimlichen »Zigeunerin« romantischer Dichterphantasie. Das Verhältnis zu »Zigeunern« war gespalten zwischen Faszination und Abscheu. Kinderbücher, wie die »Zigeunerfrieda« von 1910 trugen dazu bei, schon Heranwachsenden antiziganistische Stereotypen zu vermitteln. Unter dem Einfluss biologistisch-rassistischer Ideologien wurden Sinti und Roma zu »Rassisch Fremden«, »Volksschädlingen« und »Untermenschen« erklärt. Die antiziganistischen Vorurteile dienten den Verfolgern, aber auch der Mehrheitsbevölkerung zur Legitimation, die Verbrechen, die den »Zigeunern« zuvor zugeschrieben wurden – Diebstahl, Kindesraub, Mord – an dieser Minderheit zu begehen.11
3. Die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus
3.1 Die »Zigeunerverfolgung« der Kriminalpolizei im Nationalsozialismus
Das Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) war die reichsweite Behörde der nationalsozialistischen »Zigeunerverfolgung«. Für die kriminalanthropologischen und rassenbiologischen Theorien diente den Nationalsozialisten u.a. die Lehre vom »delinquente nato«, dem geborenen Verbrecher12, des italienischen Arztes und Professors der gerichtlichen Medizin und Psychiatrie Cesare Lombroso (1835-1909).13 Beeinflusst vom Sozialdarwinismus und der von Franz Joseph Gall (1758-1828)14 begründeten Phrenologie, typisierte Lombroso Verbrecher anhand äußerer Körpermerkmale wie eine bestimmte Schädelform. Dies galt ihm als Verweise auf eine atavistische Entwicklungsstufe.
In der NS-Ideologie transformierte das doppelte Feindbild - der »rassische Fremde« und der »primitive Arbeitsscheue« - zur »erbbiologisch minderwertigen Rasse« und zu aus der »Volksgemeinschaft« auszuschließenden »Asozialen«.15 Schon frühzeitig waren die »Zigeuner« daher von rassenhygienischen Maßnahmen wie Zwangssterilisationen16 nach dem am 14. Juli 1933 verabschiedeten »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses«, sowie von rassischen Maßnahmen wie dem »Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Blutschutzgesetz)« von 1935 bzw. den Ausführungsverordnungen betroffen, die ,,Zigeunern«" Eheschließungen mit »Deutschblütigen« verboten.17
Zwischen 1934 und 1938 durchgeführte Fahndungstage und Razzien zielten auf die Erfassung und Überprüfung der Personendaten. Auf Grundlage des »Gesetzes über Reichsverweisungen« vom 23. März 1934 konnten ausländische »Zigeuner« und Personen, bei denen die Staatsangehörigkeit angezweifelt wurde, ausgewiesen werden.
Der Berliner Polizeipräsident Wolf-Heinrich Graf von Helldorf (1896-1944) nahm den Runderlass zur »Bekämpfung der Zigeunerplage« vom 5. Juni 1936 des Reichsinnenministers Wilhelm Frick (1877-1946)18 als Auftrag, am 16. Juli etwa 600 Sinti und Roma zu verhaften und ins Zwangslager Marzahn zu verschleppen. Auch in anderen Städten, wie u.a. in Magdeburg und Köln, wurden ab 1935 Zwangslager für Sinti und Roma eingerichtet. Am 16. Mai 1938 zog die »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« nach Berlin um mit Hauptsitz am Werderschen Markt 5-6. Zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt 17.000 Akten zu 30.903 Personen registriert.19
In der Woche vom 13. bis zum 18. Juni 1938 verhaftete die Kriminalpolizei auf Anweisung von Reinhard Heydrich (1904-1942)20, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, in der Polizeiaktion »Arbeitsscheu Reich« bzw. »Arbeitszwang Reich«” sogenannte »Asoziale« und »Arbeitsscheue«. Grundlage war der Erlass des Reichs- und preußischen Ministers des Innern Frick vom 14. Dezember 1937 zur »Vorbeugenden Verbrechensbekämpfung«. Die Kriminalpolizei nahm 10.000 Männer, darunter auch Sinti und Roma, fest und wies sie in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald und Dachau ein. Mit der Einrichtung des KZ Ravensbrück im Mai 1939 erfolgten Einzelüberstellungen von Frauen ins KZ Ravensbrück.
Heinrich Himmler (1900-1945)21 , ab 1936 Chef der Deutschen Polizei und Reichsführer-SS, erließ am 8. Dezember 1938 den grundlegenden Erlass zur »Bekämpfung der Zigeunerplage«. Es sei »die Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus in Angriff zu nehmen.« Mit dem Ziel der »endgültigen Lösung der Zigeunerfrage« ordnete er an, jeden »Zigeuner« erkennungsdienstlich zu behandeln. Um die »Rassenzugehörigkeit« festzustellen, wurden die Polizeistellen angewiesen, alle »Zigeuner« und »Zigeunermischlinge« zu erfassen und ab dem sechsten Lebensjahr erkennungsdienstlich zu behandeln.22 »Zigeunerpolizeileitstellen« mit angegliederten »Dienststellen für Zigeunerfragen« wurden u.a. in Königsberg, Berlin, Köln, Hamburg eingerichtet. Neue, farblich gekennzeichnete Ausweise wurden ausgestellt: braune für »rassereine Zigeuner«, braune mit hellblauem Querstreifen für »Zigeunermischlinge« und graue für die »nach Zigeunerart Umherziehenden«. Jeder Ausweis war nummeriert und wurde im RKPA in einer entsprechenden Kontroll-Liste geführt. Mit der »Ausführungsanweisung« des RKPA vom 1. März 1939 wurde die »Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle« (RHF) am Reichsgesundheitsamt mit der Erstellung von »Gutachtlichen Äußerungen«, sogenannten »Rassegutachten«, beauftragt, für die sie vom Reichskriminalpolizeiamt mit 5 RM pro Gutachten entlohnt wurde.
Durch den Erlass zur »Bekämpfung der Zigeunerplage« war die Ausstellung von Gewerbescheinen untersagt worden. Diejenigen, die auf den Verdienst im Handel zum Lebensunterhalt angewiesen waren, traf diese Bestimmung hart. Ebenso gravierend war für viele Familien der Entzug der Familien- und Kinderbeihilfen, der Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit etc., auf die sie aufgrund der niedrigen Einkommen dringend angewiesen waren. Die Bestimmungen über Kinderarbeit, Jugend- und Arbeitsschutz entfielen. Jede vom Arbeitsamt zugewiesene Arbeit musste übernommen werden. Einkaufen durften sie nur noch zu bestimmten festgelegten Zeiten, der Besuch vonGaststätten und Kinos wurde verboten. Obwohl für sie Sondergesetze galten, mussten sie erhöhte Steuern entrichten, denn seit der »Verordnung über die Erhebung der Sozialausgleichsabgabe« vom 26. März 1942 galt für »Zigeuner« die sogenannte Judensteuer.23
Mit dem Erlass Himmlers vom 27. September 1939 wurde das RKPA unter Leitung Arthur Nebes (1894-1945)24 zum Amt V des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA). Sein Stellvertreter und Leiter der Amtsgruppe V A (vorbeugende Verbrechensbekämpfung) war der SS-Führer und Ministerialrat Paul Werner (1900-1970).25 Leiter des Referats »Vorbeugungshaft« (V A 2) war Kriminaldirektor Kurt Andexer, nach dessen Tod Kriminalrat Heinrich Böhlhoff (1896-1962). Kriminalrat Johannes Otto (1905-1961) war Referent im Amt V A 2 des RSHA.26 Hans Maly (1907-1971), Sachbearbeiter der Kölner Kriminalpolizei, war während des Zweiten Weltkriegs als leitender Beamter im RSHA. Von Januar bis April 1943 übernahm er die Vertretung des erkrankten Kriminalrats Otto als Bearbeiter des Sachgebiets »Vorbeugungsmaßnahmen gegen Asoziale, Prostituierte und Zigeuner«. Später vertrat Maly außerdem zeitweise geschäftsführend den Kriminaloberrat Böhlhoff, Leiter des Referats A 2, dem die »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« unterstand.27
Die Reichszentrale war ab 1942 Teil der Abteilung V A 2 b des RKPA. Leiter war Kriminalkommissar Karl Wilhelm Supp, danach Kriminalobersekretär Josef Eichberger. Neben Auskünften und Anordnungen war die »Reichszentrale« auch bei der Organisation von Massendeportationen beteiligt.
Die noch erhaltenen »Zigeuner«-Personenakten der Kriminalpolizei belegen die enge Zusammenarbeit der Kriminalpolizei mit Standes- und Arbeitsämtern, Jugend- und Wohlfahrtsämtern, Wehrmachtsdienststellen und Arbeitgebern. Zudem war die Kriminalpolizei zuständig für Fahndungen nach Geflüchteten, Einweisungen in Gefängnisse und in Konzentrationslager.
Am 17. Oktober 1939 erfolgte Himmlers »Festsetzungserlass«, dem zufolge Sinti und Roma unter Androhung von KZ-Haft verboten wurde, ihre Wohnorte zu verlassen. Am 20. November 1939 erging eine Anordnung Himmlers, im Verdacht der Wahrsagerei stehende »Zigeunerinnen« in ein Konzentrationslager einzuweisen. Der generelle Verweis aus dem Schulunterricht für »Zigeunerkinder« erfolgte am 22. März 1941.
Seit Beginn des Krieges wurden in den baltischen Staaten, Ost- und Südosteuropa zehntausende Sinti und Roma von Einsatzgruppen und Wehrmachtseinheiten ermordet. Die Dokumente beweisen die aktive Rolle der Wehrmacht, die das seit dem15. Jahrhundert tradierte Stereotyp der »Zigeuner« als »Spione« wieder aufgriff und ihre Ermordung forderte. Obwohl das Oberkommando der Wehrmacht am 11. Februar 1941 aus »rassenpolitischen Gründen« die Entlassung von »Zigeunern« und »Zigeunermischlingen« aus dem aktiven Wehrdienst verfügt hatte, kämpften dennoch einige weiterhin in Truppenverbänden.28
Schon 1939 plante Polizeichef Nebe eine Massendeportation der Berliner »Zigeuner«. SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann (1906-1962)29, Leiter der Dienststelle IV B 4 des RSHA, und damit Organisator der Verfolgung und Deportation der Juden, schlug vor, »dem 1. Judentransport von Wien am 20. Oktober 1939 3-4 Waggon „Zigeuner“ anzuhängen«.30 Dieser Plan wurde jedoch nicht umgesetzt.
Im Frühjahr 1940 wurden 2.500 »Zigeuner« aus dem Rhein- und Ruhrgebiet, aus Baden, Württemberg, Hessen, der Saarpfalz, Schleswig-Holstein, aus dem Raum Hannover, Hamburg und Bremen ins Generalgouvernement verschleppt.31 Dort kamen sie in Lager wie Belzec, Radom, Kielce. Weitere Deportationen waren geplant, scheiterten jedoch an der ablehnenden Haltung der Verwaltung des Generalgouvernements.
Nach der Deportation im November 1941 von 5.000 Sinti und Roma aus dem österreichischen Burgenland nach Litzmannstadt (Łódź) und der ostpreußischen Sinti 1942 nach Bialystock folgten auf Grundlage des von Himmler erlassenen sogenannten Auschwitz-Erlasses vom 16. Dezember 1942 umfangreiche Deportationen ins »Zigeunerlager« von Auschwitz-Birkenau. Nach den Ausführungsbestimmungen diesesErlasses hätten mit »Deutschblütigen« Verheiratete, »sozial angepasst« Lebende, in der Rüstungsindustrie Beschäftigte, Wehrmachtsangehörige, Kriegsversehrte und im Krieg Ausgezeichnete nicht interniert werden dürfen.32 »Reinrassige Zigeuner« und »im zigeunerischen Sinne gute Mischlinge« sollten auf Wunsch Himmlers als eine Art »Menschenzoo« in einem Reservat untergebracht werden. Entgegen der Anweisung wurden auch diese Personen im Zuge der Verhaftungen deportiert. Selbst Kinder, die bei Pflegeeltern oder in Kinderheimen untergebracht waren, wurden abgeholt.33
Am15. Januar 1943 fand im RKPA eine Konferenz über die Durchführung des Auschwitz-Erlasses statt.34 Im Frühjahr 1943 begannen die Deportationen von 23.000 Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die Zusammenstellung der Deportationslisten war den Polizeibehörden überlassen.35 Nach der 12. Verordnung zum »Reichsbürgergesetz« vom 25. April 1943 wurde »Zigeunern« die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Nachdem die noch Arbeitsfähigen für die Zwangsarbeit und medizinischen Experimente in deutsche Konzentrationslager verbracht worden waren, wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 alle Insassen des »Zigeunerlagers« in Auschwitz in den Gaskammern ermordet.
Die nicht in ein KZ Überstellten mussten bei der Kriminalpolizei ein Schriftstück unterzeichnen, dass sie sich »freiwillig« mit ihrer Sterilisation einverstanden erklärten.36 Dies war allerdings nicht unbedingt ein Schutz vor einer späteren Deportation. Geplant war ein »Reichszigeunergesetz« bzw. ein »Gemeinschaftsfremdengesetz«, das aber aufgrund des Kriegsverlaufs nicht mehr in Kraft trat.
3.2 Die »Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle« am Reichsgesundheitsamt
3.2.1 Der Leiter der Forschungsstelle Dr. Dr. Robert Ritter
Neben dem Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) war die »Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle« (RHF) die bedeutendste reichsweite Behörde der nationalsozialistischen »Zigeunerverfolgung«. 1936 erhielt der Oberarzt und Jugendpsychiater an der Tübinger Universitätsnervenklinik Dr. Dr. Robert Ritter37 vom Reichsministerium des Innern den Auftrag, eine »erbwissenschaftliche Forschungsstelle« zu gründen. Angegliedert war sie als L3 an die Abteilung L (Erbmedizin) des Reichsgesundheitsamts.38 Das Institut nannte sich zunächst »Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle«, nach dem Zusammenschluss mit der »Kriminalbiologischen Forschungsstelle« des Reichsgesundheitsamtes firmierte auf dem Briefkopf auch »Kriminalbiologische Forschungsstelle«. Die RHF bezog eine Villa in der Thielallee 74 in Dahlem auf dem Gelände des Reichsgesundheitsamt, dessen Sitz Unter den Eichen 82-84 lag. Die Finanzierung war über »Drittmittel« gesichert. Die »Deutsche Forschungsgemeinschaft« (DFG) war jahrelang der Hauptgeldgeber, zudem das Reichsministerium des Innern und der »Reichsausschuss für Volksgesundheitsdienst«. In Tübingen war zeitweilig eine Zweigstelle der RHF eingerichtet, die von Dr. Manfred Betz geleitet wurde.39 Die von Ritter in seinen Berichten an die DFG angegebenen Daten, Methoden, Arbeitstätigkeiten und Forschungsergebnisse entsprachen allerdings nicht unbedingt der Realität und sollten nicht ohne kritische Hinterfragung als Fakten übernommen werden.
Der am 14. Mai 1901 in Aachen geborene Robert Ritter war einer der zentralen Entscheidungsträger bei der rassistischen Verfolgung der Sinti und Roma, denn er lieferte das pseudowissenschaftliche Grundgerüst für den Genozid an der Minderheit. Nach dem Besuch der Kadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde studierte er Pädagogik, Psychologie, Philosophie und Psychiatrie in Bonn, Tübingen, Marburg, München, Berlin, Heidelberg und Oslo. 1927 promovierte er über »Das geschlechtliche Problem in der Erziehung. Versuch einer Sexualpädagogik auf psychologischer Grundlage«40 und 1930 in Medizin mit dem Titel »Zur Frage der Vererbung der allergischen Diathese«.41 1931 und 1932 war Ritter an der kinderpsychiatrischen Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich tätig. Von 1932 bis 1935 hatte er die Stelle eines Oberarztes in der Jugendabteilung der Psychiatrie der Universität Tübingen inne und war Mitglied des Erbgesundheitsgerichts.
Ritter war ein Anhänger von Cesare Lombroso, der im 19. Jahrhundert die These der Vererbbarkeit von Kriminalität aufgestellte, und seit seiner Arbeit in der psychiatrischen Klinik in Zürich Befürworter der Rassenhygiene und Eugenik. Durch wissenschaftliche Vorträge u.a. auf dem »Internationalen Bevölkerungskongress« 1935 in Berlin profilierte er sich als Rassenhygieniker.
Entscheidend für Ritters wissenschaftliche Karriere war seine Habilitationsschrift »Ein Menschenschlag« von 1937.42 Hierzu unternahm er »erbärztliche und erbgeschichtliche« Untersuchungen an sogenannten »Gauner- und Räubersippen« angeblich über Generationen hinweg, um seine These von der Erblichkeit von Kriminalität und Asozialität zu untermauern. Dieser »Menschenschlag«, in dem »Asoziale« und »Verbrecher« eine biologische Einheit bilden würden, würde sich als ein krimineller »Erbstrom« über die Jahrhunderte durchziehen, so seine Hauptthese. In akribischer Arbeit forschte er über die Abstammung von ihm auffällig erscheinenden Jugendlichen. Diesen unterstellt er eine bestimmte »Verschlagenheit«, die er als »sozialen Schwachsinn« definierte.43 Unter diesem Terminus konnte jeder Mensch willkürlich als schwachsinnig, aus der »Volksgemeinschaft« ausgesondert, sterilisiert und - die Ideologie der »Rassenhygieniker« letztendlich konsequent umgesetzt – ermordet werden.
Ritter war sehr geschickt im Knüpfen und Nutzen von Beziehungen. So hatte er Förderer und Befürworter im Innenministerium, in Gesundheitsämtern, Polizeibehörden sowie in »erbbiologischen« Instituten, auch an höherer Stelle. Und dies obwohl er kein Angehöriger der NSDAP oder der SS44 war. Seine Mitgliedschaft in der HJ stand im Zusammenhang mit seiner Funktion in den »Jugendschutzlagern« Moringen und Uckermark, wo er ebenfalls eine maßgebliche Rolle bei der Verfolgung »asozialer« Jugendlicher spielte.45
Ritters Aufsätze zu »Zigeunern« und »Asozialen« sind als programmatische Schriften zu verstehen, in denen er nicht nur seine wissenschaftlichen Thesen niederlegte, sondern auch bestimmte politische Maßnahmen empfahl und einforderte. Er hielt zahlreiche Vorträge, um diese publik zu machen, sich als »Erbwissenschaftler« und »Asozialenforscher« zu profilieren, Förderer und Sponsoren zu finden.46 Während seiner Recherche zum Familienhintergrund »asozialer« Jugendlicher war Ritter auf »Zigeuner« gestoßen, zu denen er nicht nur Sinti und Roma zählte, sondern auch die Jenischen47, bzw. die nach »Zigeunerart Umherziehenden«. Für die »Zigeuner« interessierten sich zwar auch andere Wissenschaftler, wie etwa der Mitarbeiter am »Institut für Erb- und Rassenpflege« der Universität Gießen, Otto Finger48, der Professor für »Erb- und Rassenpflege« an der Universität Gießen und Direktor des »Instituts für Erb- und Rassenpflege«, Heinrich Wilhelm Kranz (1897-1945)49, der spätere Gutachter der »Aktion T4«, und ab 1943 wissenschaftlicher Leiter der »Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung«, Carl-Heinz Rodenberg (1904-1995)50, doch gelang es Ritter durch Befürworter in einflussreichen Positionen die »Konkurrenz« zu verdrängen und das Forschungsgebiet weitestgehend zu besetzen.
Ritter vertrat die These, dass die »Zigeunermischlinge« auf eine Vermischung von »rassereinen Zigeunern« mit »Asozialen« und »Minderwertigen« zurückgingen. Die »Zigeunermischlinge«, zu denen er 90% aller in Deutschland lebenden »Zigeuner« zählte, seien daher »rassisch minderwertig« und »Erbträger« von Kriminalität und Asozialität.51 Ritter war somit der Urheber der »erbbiologisch« begründeten »Zigeunerverfolgung« und lieferte den Machthabern die wissenschaftliche Legitimation für ihre Internierung, Zwangssterilisation und Ermordung. Auch Menschen, die längst assimiliert und »sozial angepasst« lebten, gerieten in die Verfolgungsmaschinerie. Im Gegensatz zu den jüdischen Verfolgten waren besonders die »Zigeunermischlinge« im Fokus der Verfolger, selbst »Achtel-Zigeuner«. Ritter schlug vor, sie in Lagern zu internieren und zu sterilisieren.52 Den »Wanderzigeunern« sollte zunächst erlaubt werden, in einem begrenzten Gebiet umherzuziehen und nach ihren »Sitten« zu leben.53 Letztendlich wurden aber auch die »stammesechten Zigeuner« nicht von der Deportation verschont. Auch für andere Gruppen wie Jenische, Schausteller, Zirkusleute, Kriminelle, Landstreicher, »asoziale« Jugendliche, Juden, Deutschbalten und Zeugen Jehovas54 interessierten sich die Mitarbeiter der RHF.
Mit dem »Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik«, untergebracht in der Ihnestraße 22/24 in Dahlem - heute Otto-Suhr-Institut, Fachbereich Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin -, entwickelte sich eine Kooperation, die sich in der Betreuung von Doktoranden, gemeinsamen Auftritten auf internationalen Kongressen und dem Austausch von Wissenschaftlern manifestierte.55 So gab es eine Verbindung zwischen Ritter – über Dr. Karin Magnussen vom KWI – und Dr. Josef Mengele, Assistent von Prof. Dr. von Verschuer und SS-Lagerarzt im KZ Auschwitz, hinsichtlich »Zigeunern« mit heterochromen Augen.56 Prof. Dr. Eugen Fischer (1927-1942), Leiter des »KWI für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik«, und sein Assistent und Nachfolger als Institutsleiter Prof. Dr. Otmar von Verschuer (1942-45) befürworteten ausdrücklich die Einrichtung eines Lehrstuhls für Kriminalbiologie an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, den Ritter erhalten sollte. In den Gutachten wird ein persönliches, fast familiäres Verhältnis erkennbar. Ritter war seit März 1940 Lehrbeauftragter für kriminalbiologische Forschung an der Juristischen Fakultät der Berliner Universität, 1944 auch an der Universität Tübingen. 1943 stieg er zum Direktor beim Reichsgesundheitsamt, 1944 zum Regierungsrat auf. Auch mit dem Robert-Koch-Institut bestand eine enge Zusammenarbeit hinsichtlich der abgenommenen Blutproben.57
Ritters Einfluss beschränkte sich nicht nur auf die Rolle des »Spiritus Rector«, sondern er war auch politischer Mentor. So unterhielt er engen Kontakt zur Kriminalpolizei. Die Zusammenarbeit manifestierte sich in der Umbenennung seines Instituts in »Kriminalbiologischen Instituts« am Reichsgesundheitsamt Anfang 1941 und der Leitung eines »Kriminalbiologischen Instituts« der Sicherheitspolizei (KBI) Ende 1941, angegliedert ans Reichssicherheitshauptamt (RSHA) mit der Aufgabe, ein Archiv »asozialer und krimineller Sippschaften« aufzubauen.58 Zudem war das Institut zuständig für die Begutachtung von Häftlingen in Konzentrationslagern, vor allem der Jugendkonzentrationslager Moringen und Uckermark. Im Januar 1942 war Ritter Mitglied einer Gutachterkommission im »Städtischen Arbeits- und Verwahrhaus« Berlin-Rummelsburg. Die Insassen wurden dort im Auftrag der »Aktion T4« begutachtet.59
Oberkriminalrat Paul Werner war als Leiter der Amtsgruppe V A (Kriminalpolitik und Vorbeugung) im RSHA maßgeblich beteiligt an der Einrichtung des »Kriminalbiologischen Instituts«. Er kannte Ritter noch aus seiner Zeit als Leiter des Kriminalpolizeiamts in Karlsruhe. Ritter und Reichskriminaldirektor Arthur Nebe, Leiter des Reichskriminalpolizeiamt (RKPA), sollen sogar befreundet gewesen sein.60 Überliefert sind Gesetzesentwürfe für ein reichsweites »Zigeunergesetz« und für ein »Gemeinschaftsfremdengesetz« 1943, an dessen Formulierung Ritter mitarbeitete, deren Verabschiedung jedoch nicht mehr zustande kam.61 Seine These, die Roma hätten sich die deutsche Staatsbürgerschaft mit gefälschten Papieren erschlichen, führte zu einem Massenverfahren zur Staatenloserklärung.62
Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler, der sich für die »arische« Abstammung der »Zigeuner« interessierte63, hatte zeitweilig die Intention, am Neusiedler See ein Reservat für »rassereine Sinti und Lalleri« und die »im zigeunerischen Sinne guten Mischlinge« einzurichten. Dort sollten sie als »Rohmaterial« für weitere Forschungen durch »Rassenforscher« zur Verfügung stehen. Nebe und Ritter unterliefen jedoch die Anweisungen Himmlers. Dies beschrieb jedenfalls die Mitarbeiterin Ritters, Eva Justin, in einem Erinnerungsprotokoll:
»Im Herbst 1942 hörten wir, daß sich auf einmal wieder der Reichsführer SS Himmler persönlich für die Zigeuner interessierte. [...]. Trotzdem kritisierte man im Reichskriminalpolizeiamt untereinander offen die unsinnige Anordnung – musste aber doch beflissen sein, dem Befehl nachzukommen. General Nebe versuchte Dr. Ritter unter vier Augen damit zu besänftigen, daß er sagte, er könne es sich zwar nicht leisten, irgendeinen Widerspruch zu erheben, er müsse gehorchen; das sei aber nicht so wichtig, auf die Dauer ließe man die ganze Aktion einfach im Sande verlaufen. So wurde es dann auch gemacht.«64
Die zur Krankenschwester ausgebildete Eva Justin (1909-1966) war seine engste und wichtigste Mitarbeiterin.65 Eva Hedwig Justin wurde am 23. August 1909 in Dresden geboren. Nach ihrem Abitur 1933 besuchte sie 1934 einen Lehrgang für Krankenschwestern. Sie wurde die Assistentin des Oberarztes Robert Ritter, dem sie 1936 an die RHF folgte. Sie erwarb sich Kenntnisse in Romanes und erschlich sich so den Kontakt zu manchen Roma und Sinti.
In ihrer Dissertation »Lebensschicksale artfremd erzogener Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen«, die sie 1943 an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin eingereichte, vertrat Justin die These, dass »Zigeuner« sich durch Erziehung nicht bessern. Auch sie glaubte an die Vererbung von Kriminalität und forderte wie ihr Vorgesetzter vehement die Sterilisation der »Zigeuner« und »Zigeunermischlinge«. Als Probanden für ihre Dissertation hatte sie Sinti- und Jenische-Kinder aus dem katholischen Waisenhaus Mulfingen in Württemberg missbraucht. Nach Abschluss des Promotionsverfahren wurden die 39 Kinder am 9. Mai 1944 ins Zigeunerlager Auschwitz deportiert. Bis auf vier wurden sie in den Gaskammern ermordet.
Wegen der Luftangriffe auf die Reichshauptstadt zogen Ritter und seine Assistentin Eva Justin 1944 in die evangelische Heil- und Pflegeanstalt in Mariaberg in Baden-Württemberg.
3.2.2 Die Arbeitsmethoden der Forschungsstelle
3.2.2.1 Erfassung
Mehrere Anthropologen wie Dr. Sophie Ehrhardt (1902-1990)66, Dr. Adolf Würth (1905-1997)67 und Dr. Karl Moravek (1911-1943)68 waren bei der RHF angestellt. Dr. Ruth Hesse (1913-1999), seit 1939 verehelichte Kellermann, zunächst wissenschaftliche Angestellte am Institut, arbeitete nach ihrer Heirat und ihrem Umzug nach Hamburg weiterhin als freie Mitarbeiterin für die RHF.69 Kurzfristig war auch der Mediziner Dr. Gerhart Stein (1910-1971) angestellt.70 Der Soziologe Dr. Manfred Betz (1904-1989) leitete die Zweigstelle in Tübingen. Für die RHF arbeiteten zudem eine Reihe ehemaliger Fürsorgerinnen als technische Assistentinnen und genealogische Zeichnerinnen, sowie Fotografinnen, Schreibkräfte und ein Verwaltungsleiter.
1938 wurde im Erlass zur »Bekämpfung der Zigeunerplage« vom Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei Himmler, festgelegt, dass die Kriminalpolizei für die Erfassung der »Zigeuner« zuständig sei. Laut der Ausführungsbestimmung vom 1. März 1939 bekam die RHF den Auftrag für die »rassenbiologische« Untersuchung und Einstufung. Denn anders als bei Juden konnte nicht an der Religionszugehörigkeit festgemacht werden, wer als »Zigeuner« zu gelten hatte. Von der RHF sollte daher ein »Zigeunersippenarchiv« angelegt werden.
In enger Zusammenarbeit mit der Polizei sollte die rassenkundliche Begutachtung und Erfassung von 35.000-40.000 in Deutschland und Österreich lebenden »Zigeunern« und »Zigeunermischlingen« erfolgen.71 Ab dem Winter 1937/38 waren sogenannte »Fliegende Arbeitsgruppen« im Einsatz, um »Zigeuner« und »Zigeunermischlinge« auf Rastplätzen, in »Armenquartieren«, in städtischen Zwangslagern oder Konzentrationslagern zu erfassen und zu vermessen. Aber auch in Gefängnissen und Konzentrationslagern führten die »Rassenforscher« skrupellos ihre Befragungen und Untersuchungen durch. So äußerte sich Justin über ihren dortigen Einsatz:
»Besonders eindrucksvoll ließ sich die Verschiedenartigkeit der einzelnen Zigeunerschläge und –stämme dort erkennen, wo Hunderte von Zigeunern in den polizeilichen Arbeitslagern zusammengefaßt lebten. Da ein beträchtlicher Teil der männlichen Zigeuner in Konzentrationslagern untergebracht worden war, hatten wir den Antrag stellen müssen, auch diese Zigeuner nach ihrer Sippen- und Stammeszugehörigkeit befragen zu dürfen. Wenn wir auch nicht die Erlaubnis erhielten, die Konzentrationslager zu betreten, so wurden uns doch die als Zigeuner eingelieferten Häftlinge außerhalb des Lagers zum Zwecke der Untersuchung vorgeführt.«72
Ein wichtiger Teil der Untersuchung war die Befragung zu den persönlichen und familienbezogenen Daten. Die »Rassenforscher« erschlichen sich das Vertrauen durch Kenntnisse von Kultur, Sprache73