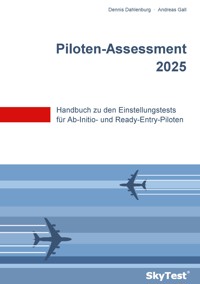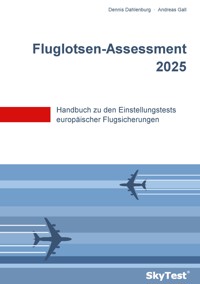
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Fluglotsen kontrollieren das Verkehrsgeschehen am Boden und in der Luft in Echtzeit. Der erforderliche Überblick setzt kognitive und operationelle Belastbarkeit und sichere Kommunikation voraus - Fähigkeiten, die bereits im Vorfeld der Ausbildung in Eignungstests geprüft werden. Die Standards sind hoch, die Arbeitsplätze in der Flugsicherung dafür attraktiv und krisenfest. SkyTest® Fluglotsen-Assessment 2025 zeichnet Zielsetzungen, Aufbau und Inhalte der wichtigsten Auswahlverfahren in Europa nach - vom DLR-Test für die Deutsche Flugsicherung (DFS) über den First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST®) bis hin zu den Tests von Austro Control, Skyguide und der Bundeswehr. Vorgestellte Auswahlverfahren und Berufsbilder: - DLR-Test für die DFS Deutsche Flugsicherung - FEAST® - Austro Control - Skyguide - Militärische Flugsicherung - Vorfeldkontrolle und Fluginformationsdienst Extras: - Wissenwertes zu Bewerbung und Testvorbereitung - Mathematische und physikalische Grundlagen als Formelsammlung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
SkyTest®Fluglotsen-Assessment 2025 ist Ihr Handbuch zur Vorbereitung auf die Einstellungstests europäischer Flugsicherungen. Neben einer Karriere als Verkehrspilot gilt die Laufbahn am Boden, als Fluglotse, als der häufigste Wunschberuf innerhalb der Luftfahrt – zu Recht: die Arbeit im Tower, bei der An- und Abflugkontrolle (Approach, APP) oder bei der Sektorenaufsicht (Area Control, ACC) ist verantwortungsvoll, abwechslungsreich und angesehen. Ein hohes Vergütungsniveau bereits in der Ausbildung gepaart mit hervorragenden Sozialleistungen machen Flugsicherungen zu begehrten Arbeitgebern. Zudem zeigt sich der Arbeitsmarkt für Fluglotsen weit weniger anfällig für konjunkturelle Einflüsse als jener für Piloten. Die verbreitet staatlichen Träger oder Gesellschafter der Flugsicherungen garantieren krisenfeste Arbeitsplätze.
Bereits die Ausbildung zum Fluglotsen verläuft mit einem ausgeprägten Anteil von Training-on-the-Job, der nach rund 1,5 Jahren Theorieunterricht einsetzt, sehr praxisnah. Entsprechend viele Bewerbungen gehen bei den Flugsicherungen ein. Dennoch werden die Organisationen von Nachwuchssorgen geplagt – geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Fluglotsenausbildung sind ein knappes Gut. Der Personaldauermangel in der Flugsicherung ist zum Teil selbst verschuldet: in den zehn Jahren nach dem 11. September 2001 planten viele Flugsicherungen erheblich zu konservativ und bildeten viel zu wenig Nachwuchs aus. Diese Unterdeckung wirkt bis heute nach, zeitgleich ziehen die Pensionierungsraten an.
Bei der DFS Deutsche Flugsicherung routen 2.000 Fluglotsen Flüge sicher und effizient durch den Luftraum. Auf Nachwuchssorgen reagiert die DFS mit einer Ausbildungsoffensive – die DFS reizte mit 136 Ausbildungsplätzen für Fluglotsen ihre Kapazitäten zuletzt voll aus. Hinzu kommen zehn Studienplätze im dualen DFS-Studiengang Air Traffic Management. Auf die Plätze gingen in den letzten Jahren bis zu 4.000 Bewerbungen ein. Aber nur ein kleiner Teil der Bewerber nimmt die Hürde des Auswahlverfahrens und erhält einen der begehrten Ausbildungsplätze bei der Deutschen Flugsicherung: von 1982 bis 2022 hat die DFS zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) über 60.000 Bewerberinnen und Bewerber auf ihre Eignung getestet – aber nur 4.000 zur Ausbildung zugelassen, eine Erfolgsquote von rund 7 Prozent. Daher lohnt es sich, auch bei anderen Flugsicherungen anzuklopfen und einen Eignungstest zu machen – oder flugsicherungsnahe Berufsbilder wie die Vorfeldkontrolle und den Fluginformationsdienst ebenfalls in Betracht zu ziehen.
Ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen, Stress- aber auch Monotonieresistenz, Teamfähigkeit, Kommunikationsvermögen, eine hohe Gedächtnisleistung, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit und überdurchschnittliche Leistungen in Englisch, Mathematik und Physik bilden die Eckpunkte des klassischen Anforderungsprofils für den Beruf des Fluglotsen. Entsprechend stellen die Auswahlverfahren vor allem auf diese für den Beruf unerlässlichen Kompetenzen ab.
SkyTest®Fluglotsen-Assessment 2025 stellt Ihnen die Abläufe, Tests und Methodiken der Eignungsuntersuchungen europäischer Flugsicherungen vor. Im Buch werden die Verfahren der DFS, der Schweizer Flugsicherung Skyguide, der österreichischen Austro Control und des länderübergreifend verwendeten First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) im Detail beleuchtet. Ebenso wirft das Buch einen Blick auf das Auswahlverfahren für militärische Fluglotsen im Offiziersdienst der Bundeswehr. Der Schwerpunkt liegt auf den softwarebasierten Eignungstests der frühen Verfahrensstufen. Die Ausführungen sollen Ihnen dabei helfen, die mit den Tests verbundenen Ziele einzuordnen. Mit diesem Vorwissen können Sie nicht nur Ihre Vorbereitung besser strukturieren, sondern werden sich auch im Auswahlverfahren sicherer fühlen. In einem ergänzenden Kapitel gibt Ihnen SkyTest®Fluglotsen-Assessment 2025 einen Überblick über grundlegende mathematische und physikalische Formeln und Zusammenhänge, die Sie in jedem fliegerischen Auswahlverfahren beherrschen müssen.
Die Autoren dieses Buchs verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ausbildung und Recruitment innerhalb der Verkehrsluftfahrt. Als Bewerber finden Sie in SkyTest®Fluglotsen-Assessment 2025 eine verlässlich recherchierte und aktuelle Informationsquelle für Fragen zu Ihrem Auswahlverfahren.
Inhalt
1 Fluglotse – Der Traumberuf
2 Grundanforderungen an Bewerber
3 DFS Deutsche Flugsicherung
3.1 Die Online-Stufe
3.2 Die Vorauswahl
3.2.1 Allgemeine Leistungstests
3.2.2 Spezifische Leistungstests
3.2.2.1 Flugstreifentest
3.2.2.2 Radarsimulator
3.3 Die Block8-Tests
3.3.1 Manueller Flugstreifentest
3.3.2 Der Dyadic Cooperation Test (DCT)
3.3.3 Das Interview
4 Der FEAST
4.1 Stufe I
4.2 Stufe II
4.2.1 Radar-Control-Test
4.2.2 Dynamischer Radartest
4.2.3 Multi Control Test
4.3 Stufe III und IV
4.4 FEAST Plus
5 Austro Control
5.1 Kognitive Leistungstests
5.2 Worksample Tests und Interview
6 Skyguide
6.1 Eignungsabklärung I
6.2 Eignungsabklärung II
6.3 Eignungsabklärung III
7 Militärische Flugsicherung
7.1 Allgemeine Leistungstests
7.1.1 Leistungstests der FEAST Stufe I
7.1.2 Ergänzende Leistungstests
7.2 Spezifische Leistungstests
7.2.1 Flugzeugpositionierungstest
7.2.2 Radarsimulator
7.3 Psychologische und medizinische Eignungsabklärung
8 Vorfeldkontrolle und Fluginformationsdienst
8.1 Vorfeldkontrolle
8.2 Fluginformationsdienst
9 Assessment-Center übergreifende Tests
9.1 Mathematik
9.1.1 Kopfrechnen
9.1.2 Schätzaufgaben
9.1.3 Textaufgaben
9.1.4 Zahlenreihen
9.1.5 Algebraische Grundlagen
9.1.6 Geometrische Grundlagen
9.2 Physik
9.2.1 Mechanik
9.2.2 Elektrizitätslehre
9.2.3 Optik
9.2.4 Wellenlehre
9.2.5 Wärmelehre
9.2.6 Radioaktivität
1 Fluglotse – Der Traumberuf
In Spitzenzeiten tummeln sich weltweit bis zu 20.000 Verkehrsflugzeuge gleichzeitig am Himmel. Die Sicherheit der Insassen hängt nicht allein von der Arbeit der Piloten ab – die Fluglotsen am Boden nehmen eine ebenso wichtige Rolle ein. Die unmittelbare Verantwortung für andere ist in wenigen Berufen so ausgeprägt wie in der Flugsicherung.
Europas Verkehrsluftfahrt befindet sich (wieder) auf einem stabilen Wachstumskurs. In den Sommermonaten Juni, Juli und August 2024 registrierte Eurocontrol im Schnitt 34.042 Flüge pro Tag im europäischen Luftraum. Zum Vergleich: Auf dem absoluten Tiefpunkt der Covid-19-Phase, am 12. April 2020, zählte Eurocontrol nur 2.099 kommerzielle Flüge über Europa. Das Kontrollaufkommen lag 2024 rund fünf Prozent über Vorjahreswerten. Die Branche hat damit wieder zu Vorkrisenwerten aufgeschlossen, für 2025 rechnet Eurocontrol mit einer weiteren Verkehrszunahme um 3,7 Prozent. Im Jahr 2030 – so eine aktuelle Prognose – werden die IFR-Flugbewegungen in Europa 12,2 Prozent über dem Referenzwert von 2019 liegen.
Was fehlt, sind Lotsinnen und Lotsen. Eurocontrol erkannte 2024 für alle Flugsicherungen in Europa einen „klaren, dringenden und wachsenden Bedarf, mehr Fluglotsen einzustellen und auszubilden“. Anders ist das Verkehrswachstum nicht zu stemmen. Eine Zahl: Unterbesetzte Kontrollzentren brummten Airlines im Juni 2024 im Schnitt 0,6 Minuten Verspätung pro Flug auf – was nach wenig klingt, kann sich über einen Flugtag zu markanten Verzögerungen im gesamten System hochschaukeln.
Als Fluglotse koordinieren Sie entweder den ein- und ausgehenden Verkehr an einem Flughafen oder überwachen von einem Center aus die Flugbewegungen in einem Ihnen zugewiesenen Kontrollsektor.
Im Tower eines Flughafens ordnen die Fluglotsen den rollenden Verkehr am Boden, erteilen Startfreigaben, überwachen den Luftraum um den Airport und weisen ankommende Flugzeuge ein. Die eigentliche Luftraumkontrolle erfolgt demgegenüber in einem Sektorensystem. Europaweit gibt es etwa 50 Luftverkehrskontrollzentren und rund 650 einzelne Kontrollsektoren. Während je Sektor ein Radarlotse die Flugbewegungen am Schirm überwacht und den Kontakt zu den Flugzeugen hält, plant ein Koordinationslotse die Übergabe des Verkehrs an den Sektorengrenzen. Der Koordinationslotse entwickelt zudem ein Gesamtverkehrsbild und gleicht dieses mit den Freigaben der Radarlotsen ab (4-Augen-Prinzip). Die wichtigste Aufgabe der Lotsen im Center besteht darin, den nach Instrumentenflugregeln durchgeführten Flugverkehr in sicheren vertikalen und horizontalen Abständen zu separieren.
Das zunehmende Verkehrsaufkommen am Himmel über Europa stellte die Flugsicherungen schon in den 1990er Jahren vor große Herausforderungen. Die Fluglotsen mussten nicht nur mehr Flugbewegungen an den Flughäfen, sondern auch erheblich mehr Enroute-Verkehr – Überflüge – betreuen, was die bestehenden ATC-Systeme an ihre Kapazitätsgrenzen brachte. Dies bereitete den Boden für einen Paradigmenwechsel in der Organisation der Luftverkehrskontrolle, innerhalb dessen sich ein Übergang ausschließlich verbaler Air-Ground-Kommunikation hin zu einem vermehrten Einsatz von Daten-übertragungssystemen vollzog. Die klassische Rollenverteilung zwischen Piloten und Fluglotsen blieb dabei aber erhalten. Die Piloten haben weiterhin primär die Verantwortung für ihr Flugzeug und die Sicherheit der Menschen an Bord. Ihnen obliegt die praktische Durchführung des Flugs, insbesondere das korrekte Abfliegen des zugewiesenen Luftkorridors und der Umgang mit ungeplanten Ereignissen (sog. Non-Standards, z.B. im Falle eines technischen Defekts am Fluggerät). Die Fluglotsen übernehmen Planung und Kontrolle des Luftverkehrs.
In der Kommunikation zwischen Piloten und Fluglotsen setzen Airlines und Flugsicherung heute aber vermehrt auf neue Mensch-Maschine-Schnittstellen wie Datalink. Wesentliche Teile standardisierter Kommunikation werden inzwischen über diese Systeme abgewickelt und haben den klassischen Sprechfunkverkehr dort abgelöst oder ergänzt. Der Trend zeigt klar in Richtung einer weiter voranschreitenden Automatisierung der Luftraumkontrolle und ihre Verknüpfung mit weiteren Assistenzsystemen. So können Standards wie ein request-startup oder ein request-taxi bereits heute ohne Sprechfunk über Datalink abgewickelt werden. Verfügen Flugzeug und Flughafen über die entsprechende Technik, erhalten Piloten mit dem Datenaustausch weitere Informationen – beispielsweise in Form einer Visualisierung ihres per Datalink zugewiesenen Rollwegs zum Start. Ebenso können die Piloten über die Schnittstelle ein direkteres Routing oder eine Höhenänderung anfragen und die entsprechende Freigabe erhalten.
Satellitenbasierte Systeme – etwa ADS-B über dem Nordatlantik – geben Fluglotsen Echtzeit-Daten. Die klassische Funkkommunikation zwischen Fluglotsen und Piloten wird aber auch mit fortschreitender Digitalisierung der Luftraumkontrolle erhalten bleiben. In kritischen Flugphasen, wie Start und Landung, ist es wichtig, dass die Piloten auf offenen Frequenzen alle Anweisungen an den Verkehr mithören, um gegebenenfalls selbst auf Fehler der Flugsicherung aufmerksam zu werden. Die Technologien und Verfahren der Luftraumkontrolle steuern auf eine internationale Harmonisierung zu. In Europa wird im Programm Single European Sky ATM Research (SESAR) von Politik und Industrie eine Standardisierung der Systeme intensiv vorangetrieben. Eine enge Abstimmung mit dem vergleichbaren NextGen - Programm der Vereinigten Staaten soll transatlantische Kompatibilität herstellen. Das Ziel für Europa ist die Verdreifachung der Luftraumkapazität bei einer Reduzierung der Emissionen um zehn Prozent. Die Kosten der Luftraumüberwachung sollen pro Flug von derzeit etwa 800 Euro auf 400 Euro sinken. Neue ATM-Technologien werden auf dem Weg dahin ihren Teil beitragen.
Von größerer Bedeutung ist aber die Aufhebung hoheitsrechtlicher Vorbehalte, die lange eine effektivere Nutzung des Himmels behinderten. Die Sektoren des Luftraums über Europa spiegelten bislang im Wesentlichen die Landesgrenzen wider. Das im Jahr 1999 angestoßene Programm Single European Sky (SES) sieht eine Neuordnung der Kontrollbereiche vor: Im SES ist die historisch gewachsene Aufteilung des Luftraums vollständig aufgehoben und durch neun sogenannte Funktionale Luftraumblöcke (Functional Airspace Blocks, FAB) ersetzt. Die FABs werden dabei an den Hauptverkehrsströmen durch Europa ausgerichtet:
■ BALTIC FAB: Polen, Litauen
■ BLUE MED: Griechenland, Italien Zypern, Malta (später ggf. Nordafrika)
■ DANUBE: Bulgarien, Rumänien
■ FABCE / FAB Central Europe: Österreich, Ungarn, Tschechien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowakei, Slowenien
■ FABEC / FAB Europe Central: Deutschland, Frankreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Belgien
■ NEFAB / North European FAB: Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Island, Estland, Lettland
■ NUAC / Nordic Upper Airspace Centre: Dänemark, Schweden
■ SW FAB / South-West FAB: Portugal, Spanien
■ UK- IRELAND FAB: Großbritannien, Irland
Schrittweise wird die Defragmentierung des europäischen Himmels Realität. Der Funktionale Luftraumblock Europa Zentral (FABEC), einer der komplexesten und intensivsten genutzten Lufträume der Welt, wurde Jahr 2013 nach einer vierjährigen Vorbereitungsphase eingerichtet. Gegenwärtig werden im 1,7 Millionen Quadratkilometer großen FABEC jährlich etwa 5,7 Millionen Flüge gezählt – 55 Prozent des europäischen Aufkommens. Da zusätzliches Verkehrsaufkommen von den alten Strukturen kaum mehr unterstützt werden kann, ist die Umsetzung des SES inzwischen überfällig.
Allerdings bremst oft nicht politischer Unwille Kooperationen und Innovationen aus – im Gegenteil: die Einführung des ADS-B ist beispielsweise ein länderübergreifender Erfolg: die britische Luftfahrtaufsicht NATS, NAV Portugal und NAV Canada lösen mit der Anwendung des satellitenbasierten Kontrollsystems starre Korridore im Nordatlantik-Verkehrs gemeinsam auf. Das ADS-B ging 2020 nahtlos von einer Testphase in die dauerhafte Anwendung über: Flüge können jetzt effizienter gestaffelt und dennoch sicherer über den Atlantik fliegen, weil die beteiligten Flugsicherungen jederzeit das Verkehrsgeschehen in Echtzeit „auf dem Schirm“ haben.
Problematisch ist aber nach wie vor eine Tendenz zur Besitzstandswahrung unter den Flugsicherungen. Dabei verspricht der SES Fluglotsen auch neue Karriereperspektiven. War ein Arbeitsplatzwechsel zwischen zwei europäischen Flugsicherungen früher mit vielen Hindernissen verbunden, soll er in Zukunft einfacher werden. Denn schon auf Ebene der Ausbildung und sogar der Auswahlverfahren, dem Thema dieses Buchs, wird es weiter zu einer Harmonisierung der Standards innerhalb Europas kommen.
Aus nachvollziehbaren Gründen arbeiten Flugsicherungen in ihren Kontrollbereichen in der Regel in einer staatlich garantierten Monopolstellung – schließlich wäre es wenig praktikabel, wenn mehrere Flugsicherungen zeitgleich die Aufsicht über einen Sektor hätten. In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die Anforderungen und Auswahlverfahren der großen europäischen Flugsicherungsorganisationen vor. Viele dieser Unternehmen setzen inzwischen den von EUROCONTROL entwickelten First Air Traffic Controller Selection Test (FEAST)für ihre Bewerberauswahl ein oder haben ihn zumindest in ihre Eignungstestverfahren integriert. Auch dies unterstreicht, wie sich Europa in Richtung einheitlicher Strukturen für die Kontrolle seiner Lufträume bewegt.
Die meisten Fluglotsenanwärter streben eine Laufbahn bei der großen Flugsicherung ihres Landes an, die auch die Kontrollbefugnis an den jeweiligen internationalen Flughäfen innehat. Allerdings gibt es auch die alternative Möglichkeit, sich als Regionalfluglotse für den Einsatz an kleineren und mittleren Flughäfen ausbilden zu lassen. In Deutschland ist man in diesem Fall nicht bei der DFS Deutsche Flugsicherung angestellt, sondern direkt bei einem Flughafen oder einem privaten Anbieter für regionale Flugsicherheitsdienste.
Die Aufgaben eines Lotsen an einem kleineren Flughafen sind nicht minder anspruchsvoll und daher gelten für sie im Wesentlichen die gleichen Grundvoraussetzungen wie für DFS-Fluglotsen. Allerdings haben kleinere Airports etwas flexiblere Auswahlstandards und legen im Gegensatz zur DFS in den meisten Fällen keine Altershöchstgrenze für den Beginn einer Ausbildung fest. Eine einmal erworbene Regionallotsenlizenz ist später überregional gültig. Sie können Ihren Arbeitsflughafen also auch einmal wechseln. Bewerber für eine Ausbildung zum Regionalfluglotsen müssen in einem fliegerischen Auswahlverfahren den FEAST bestehen. Die in diesem Buch vorgestellten Tests beziehen sich zur besseren Veranschaulichung auf Trainingsmodule der SkyTest®-Trainingssoftware.
2 Grundanforderungen an Bewerber
Für die Zulassung zu einer Fluglotsenausbildung müssen Sie Grundqualifikationen aber auch medizinische und fähigkeits- beziehungsweise leistungsbezogene Anforderungen erfüllen.
In Hinblick auf qualifikatorische Grundanforderungen sind vor allem die Hochschulreife und sehr gute Englischkenntnisse zu nennen. Ihre Schulzeit sollte zudem noch nicht allzu lange zurückliegen – die meisten Flugsicherungen haben in ihren Ausbildungsprogrammen Altersgrenzen. So lässt die DFS Deutsche Flugsicherung beispielsweise nur Bewerber bis 24 Jahre zur Ausbildung zu.
Die medizinischen Grundanforderungen spiegeln sich in einer fliegerärztlichen Untersuchung wider, die Teil jedes Auswahlverfahrens für Fluglotsen ist. Der flugmedizinische Check, auch Medical genannt, ist sehr umfangreich. Fluglotsenanwärter benötigen das europäische flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis nach EMCR(ATC). Dieses Medical beinhaltet unter anderem eine Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems, die Feststellung der Sehkraft und des Hörvermögens sowie eine Überprüfung auf psychiatrische Tauglichkeitskriterien (beispielsweise der Ausschluss von Suchtkrankheiten).
Der größte Anteil der Auswahlverfahren für Fluglotsen entfällt aber auf die Abklärung der berufsspezifischen fähigkeits- und leistungsbezogenen Grundanforderungen. Kognitive und operationelle Fähigkeitsprofile werden inzwischen bei allen europäischen Flugsicherungen über computer- beziehungsweise apparategestützte Tests erstellt. Dieses Vorgehen verspricht eine objektive und aussagekräftige Beurteilung der Bewerber. Der Einsatz standardisierter, leistungspsychologisch valider Testverfahren garantiert zudem, dass nur ein Bruchteil der positiv beschiedenen Teilnehmer in der anschließenden Ausbildung oder im Beruf scheitert. In den Auswahluntersuchungen werden die folgenden fähigkeits- und leistungsbezogenen Grundanforderungen festgestellt:
Entscheidungs- und Kommunikationskompetenz
Egal ob Sie später im Tower, der Anflugkontrolle oder Sektoraufsicht arbeiten – Entscheidungs- und Kommunikationskompetenz sind das Handwerkszeug jedes Fluglotsen. Zögerliches Entscheidungsverhalten und fehlerhafte Air-Ground-Kommunikation sind häufige Ursachen für Zwischenfälle im Luftraum und an Flughäfen. Standardisierte Abläufe und eine ebenso standardisierte Kommunikation sollen Missverständnisse zwischen Piloten und Fluglotsen vorbeugen. In kritischen Situationen, den bereits erwähnten Non-Standards, liegt es hingegen vor allem am Lotsen, Handlungsalternativen schnell und sicher abzuwägen und seine Entscheidung an die Piloten zu kommunizieren.
An verkehrsintensiven Flughäfen müssen Lotsen zeitgleich mit vielen Flugzeugen kommunizieren und für jede Maschine Entscheidungen treffen. Solange alle Flüge die vorgeplanten Abläufe am Boden und in der Luft einhalten, können die Fluglotsen im Tower und Approach auch Traffic Peaks problemlos abwickeln. Schon die kleinste Störung wird diesen orchestrierten Hubverkehr aber gehörig aus dem Takt bringen. Sich unvermittelt ändernde Windverhältnisse, ein Schwarm Vögel oder die Crew einer Boeing 747, die sich aufgrund mangelnder Orts- und Englischkenntnisse ihren eigenen Anflug sucht – jeden dieser und viele anderer Fälle muss ein Fluglotse mit seinen Entscheidungen und seiner Kommunikation zu entschärfen wissen.
Teamfähigkeit
Auch Teamfähigkeit ist für Fluglotsen kein Soft Skill, sondern eine Schlüsselqualifikation. Sie bilden schließlich nicht nur ein Team mit ihren unmittelbaren Kollegen – auch mit den Piloten gehen Sie jeden Tag aufs Neue einen intensiven Arbeitsverbund ein. Selbst kleinste Teams – beispielsweise ein Radar- und ein Koordinationslotse – tragen im System der Flugsicherung eine derart hohe Verantwortung, dass jedes Problem in ihrer Zusammenarbeit schnell zu einem Sicherheitsproblem wird.
Die Piloten erhalten von den Fluglotsen Freigaben, Anweisungen und Informationen. Die hohe, persönliche Verantwortung der Fluglotsen für die Sicherheit des Luftverkehrs verleiht ihnen Weisungsbefugnisse gegenüber Piloten. Dennoch werden Entscheidungen, soweit sinnvoll und möglich, zwischen Boden und Luft in gegenseitiger Abstimmung getroffen. Auch dies geht leichter, wenn sich alle Beteiligten als zusammenwirkendes Team verstehen.
Ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen
Fluglotsen müssen sich sowohl in der Fläche als auch im dreidimensionalen Raum jederzeit sicher orientieren. Die gedankliche Umrechnung abstrakter Informationen vom Radarschirm in ein konkretes Situationsbild darf auch Berufsanfängern keine Schwierigkeiten bereiten. Sie müssen sich stets in die aktuelle Verkehrssituation versetzen können, um richtige Entscheidungen und Priorisierungen zu treffen. Ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen ist eine wesentliche Dimension Situativer Aufmerksamkeit, also dem für Fluglotsen (und Piloten) unerlässlichen Verständnis aktueller räumlicher und zeitlicher Gegebenheiten.
Konzentrationsvermögen und Mehrfacharbeit