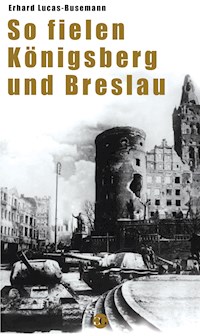
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cupitora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Flucht und Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten war und ist für viele Menschen eine der schrecklichsten Folgen des Zweiten Weltkrieges. Trotz der seit 1944 unabwendbaren Niederlage verteidigten die deutschen Generäle den »Bestand des Reiches« bis zum Äußersten. Der Sozialhistoriker Erhard Lucas-Busemann teilt die Trauer um die zerstörten Städte, um den Verlust der Heimat und die unzähligen Toten und Vermißten. Am Beispiel von Königsberg und Breslau weist er nach, wie der »Kampf bis zum letzten Mann« Tausende sinnlose Opfer kostete und einen einzigartigen Kulturraum zerstörte. Seine Analyse der grauenvollen Ereignisse und seine fundierte Replik auf Thesen des Historikerstreits basieren auf langjährigen Forschungen und bewegenden persönlichen Erinnerungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SONDERAUSGABEExklusiv für unsere Leser
Zum Autor
ERHARD LUCAS-BUSEMANN (1937–1993), geboren in Arnswalde (Pommern), Studium der evangelischen Theologie, Philosophie, Wirtschaftswissenschaften und Neueren Geschichte, Mitglied im Freiburger Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Seit 1975 Professor für die Geschichte der sozialen Bewegungen an der Universität Oldenburg.
Erhard Lucas-Busemann
So fielen Königsbergund Breslau
Nachdenken über eine Katastrophe
eISBN 978-3-86789-751-8
1. Auflage dieser Sonderausgabe
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
© 2013 by BEBUG mbH / Gemini Verlag, Berlin
© 1994 Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Jana Krumbholz, ACDM
Inhalt
Vorwort
Erinnerungen an unsere Flucht aus Pommern
Umgang mit einem lebensgeschichtlichen Bruch
Die Neuentdeckung eines Textes aus dem Historikerstreit
Erste Kritik an Hillgruber; die Wahrheit einer wissenschaftlichen Fehlleistung
Fortsetzung der Kritik des Hillgruber-Textes
Selbstzerstörung und Untergang Königsbergs
Selbstzerstörung und Untergang Breslaus
Rechtfertigungsversuche
Die Unfähigkeit zu kapitulieren
Die Grausamkeit der Russen
Trauer worüber? Abschluss der Kritik des Hillgruber-Textes
Deutsche, Juden und Polen
Terrorjustiz, »Nacht und Nebel«; das Sondergericht in Breslau
Verantwortung
Nachbemerkung
Dokumente
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Vorwort
Der politisch engagierte Historiker Erhard Lucas-Busemann, der an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg eine Professur für die Geschichte der sozialen Bewegungen innehatte, stand für eine Geschichtswissenschaft, die die weitgehend unterschlagene Historie einer langen Tradition demokratischen Aufbegehrens in Deutschland aufzuhellen versucht – von den Bauernkriegen bis zur Revolution von 1918/19 und dem nicht bloß auf den 20. Juli reduzierten Widerstand gegen das Dritte Reich. Ihm ging es in allen seinen Veröffentlichungen zur neueren Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vor allem darum, durch den historischen Rückbezug unser Bewusstsein für den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft zu schärfen. Seine Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Revolution von 1918/19, zum Aufbruch in der Rätebewegung, deren Zielsetzungen und politisches Scheitern er am Beispiel von Frankfurt/Main1 und Bremen2 dargestellt hat und deren endgültige Niederlage im Ruhrgebiet im März 1920 den Gegenstand seines Hauptwerkes bildet,3 verfolgen dieses Erkenntnisinteresse. Für seine Arbeitsweise bestimmend waren minutiöse Recherchen und detaillierte Darstellung des Materials. Er hat dadurch diesseits abstrakter Theoriedebatten über den Gehalt sozialistischer Zielsetzungen einen wichtigen Beitrag zur Erforschung und Vergegenwärtigung der neueren Geschichte der Arbeiterbewegung und ihres Scheiterns4 geleistet.
Die Frage liegt deshalb nahe, was den Sozialhistoriker Erhard Lucas-Busemann veranlasst hat, sich mit der in diesem Buch behandelten Thematik der Kriegsereignisse im Osten 1944/45 eingehender zu beschäftigen, die quer zu seinem eigentlichen Forschungsschwerpunkt stand. Auch hier geht es ihm bei der Ermittlung der historischen Wahrheit zentral um die Gegenwartsbedeutung von Vergangenheit. Den Anstoß dazu hatte er, der 1937 in Arnswalde/Pommern geboren worden war, 1988 durch eine Fahrt in den Ort seiner frühen Kindheit erhalten. In diesem Zusammenhang entdeckte er für sich einen Text von Andreas Hillgruber5 neu, der im 1986 einsetzenden Historikerstreit6 eine besondere Rolle gespielt hatte. Es ging Lucas-Busemann mithin um zweierlei. Zum einen wollte er sich mit seiner letzten historischen Arbeit ein eigenes Urteil über die Verstrickungen der eigenen Familie in den NS-Staat und über die Ereignisse bilden können, die zum Verlust seiner Heimat geführt hatten. Zum anderen wollte er, wie der Arbeitstitel seiner historischen Studie »Selbstzerstörung und Untergang Ostdeutschlands 1944/55. Nachdenken über eine Katastrophe ein halbes Jahrhundert danach«7 deutlich macht, einen Gegenakzent zur nationalkonservativen Deutung der Endphase des von Hitlerdeutschland angezettelten Krieges setzen.
Lucas-Busemann wendet sich nachdrücklich gegen die von Hillgruber vertretene Auffassung, dass das deutsche Ostheer im Interesse des Schutzes der Zivilbevölkerung »vor den Racheorgien der Roten Armee, den Massenvergewaltigungen, den willkürlichen Morden und den wahllosen Deportationen« keine andere Wahl hatte, als bis zum bitteren Ende durchzuhalten. Für Lucas-Busemann ist dies nach genauerer Sichtung der zugänglichen Quellen und in Anbetracht der unbestreitbaren historischen Fakten eine Legendenbildung.
Hillgruber stilisiert die an den »Führer« gebundene bedingungslose Gefolgschaftstreue der Befehlshaber des Ostheeres zum von verantwortungsethischem Handeln geprägten Heldentum, das er dem an abstrakt moralischen Maßstäben orientierten gesinnungsethischen – und folglich als verantwortungslos abgewerteten – Handeln der Verschwörer des 20. Juli 1944 gegenüberstellt. Für Lucas-Busemann ist dies eine wissenschaftliche Fehlleistung ersten Ranges. Er sieht sie darin begründet, dass es dem Kriegsveteranen und gebürtigen Ostpreußen Hillgruber nicht gelingt, den Rollenkonflikt als unmittelbar Betroffener und Historiker zu lösen. Hillgruber geht es primär um die Rechtfertigung seiner Handlungen und die seiner Kameraden beim Kampfeinsatz an der Ostfront. Demgegenüber weist Lucas-Busemann darauf hin, dass in Anbetracht des bereits 1944 verlorenen Krieges die Verteidigung der Städte Königsberg und Breslau objektiv sinnlos war und die dabei gebrachten Opfer der Unfähigkeit der Generalität geschuldet sind, die Kapitulation im Alleingang zu wagen oder gegen Hitler durchzusetzen. Deshalb erscheint es ihm geradezu als historische Fälschung, den blinden Durchhaltewillen der militärischen Führung zu einem verantwortungsethisch geleiteten Handeln in einer Art tragischem Heldenepos umzuinterpretieren. Lucas-Busemann räumt überzeugend Unklarheiten über historisch bedeutsame Geschehensabläufe aus und ergründet die Motive der für die Verteidigung der beiden ostdeutschen Festungsstädte verantwortlichen Generalität sowie weiterer Akteure; so wird deren Verhalten und trügerische Selbsteinschätzung für den Leser nachvollziehbar.
Die von Erhard Lucas-Busemann eingeforderte Erinnerung an das verbrecherische Treiben des NS-Regimes bis zur Befreiung Deutschlands durch den Sieg der Alliierten war für ihn ein Akt der Solidarität mit den Opfern, wobei er im Unterschied zu Hillgruber sehr wohl zwischen der Opferrolle der KZ-Häftlinge, der Flüchtlinge und der Soldaten beiderseits der Fronten zu unterscheiden weiß. Dies schloss für ihn ein, sich selbst und allen Betroffenen die biographisch vermittelten Eigenanteile am Geschehen bewusst zu machen, wobei diese für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich aussehen können. Erst durch den Mut zur Wahrheit bei der Beschäftigung mit den grauenvollen Ereignissen ist ihm ihre Verarbeitung überhaupt möglich.
Durch eine collageartige Verknüpfung von biographischen Momenten und dem Ablauf des Geschehens 1944/45 im Osten, insbesondere beim Kampf um Königsberg und Breslau, erschließt Lucas-Busemann die geschichtlichen Vorgänge in der Perspektive eigener, rückerinnerter Zeiterfahrung und derjenigen von Zeitgenossen, die diese in Lebensberichten festgehalten haben. Hillgruber geht es zentral um das »Problem der Identifizierung« mit der Erlebnisperspektive der kämpfenden Truppe, was für Lucas-Busemann »vom Standpunkt der Geschichtsschreibung eine methodische Entgleisung« darstellt. Er fordert eine Art der Geschichtsbetrachtung, die »Distanz zwischen dem Betrachter und dem Geschehen voraussetzt – Distanz im zeitlichen Sinne, und sei die Zeitspanne noch so klein, oder – was dasselbe ist, nur anders ausgedrückt – Distanz des Blicks. Diese Distanz ermöglicht, dass wir uns probeweise in alle am betrachteten Geschehen Beteiligten hineinversetzen können.« Hans Mommsen hatte bei seiner Kritik an den Plänen der Bundesregierung für ein Haus der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn und das in Berlin vorgesehene Deutsche Historische Museum gleichfalls geltend gemacht, dass gerade wegen der der Geschichte »eigentümlichen Kraft der Identitätsstiftung« dem allgemeinen Selbstverständnis der internationalen Historiographie entsprechend »Geschichte nur aus einer kritischen Distanz heraus und gerade nicht als Gegenstand emotionaler Identifizierung dargestellt werden kann«.8
Weil es Lucas-Busemann gelingt, den von Hans Mommsen entwickelten Anspruch auch bei der Darstellung der eigenen biographischen Anteile am Geschehen weitgehend einzulösen, wird die Leserin und der Leser nicht durch ein emotional vorgefertigtes, historisch ummänteltes Werturteil vereinnahmt bzw. fremdbestimmt. Wir, die Leser, werden dadurch in die Lage versetzt, uns selbst ein annähernd wirklichkeitsgetreues Gesamtbild vom Untergang Ostdeutschlands in den Jahren 1944/45 zu erarbeiten. Die erzählerisch vermittelte Distanz ermöglicht es, sich im schwierigen Prozess der historischen Wahrheitsfindung ein eigenes und, wie zu hoffen ist, gerechtes Urteil zu bilden bei der Bewertung der Ereignisse wie der Personen, die für »Selbstzerstörung und Untergang Ostdeutschlands 1944/45« verantwortlich zu machen sind.
Das Motiv für die Beschäftigung des Historikers der Arbeiterbewegung Erhard Lucas-Busemann mit der Katastrophe von 1945 findet sich übrigens schon in seinem in vielerlei Hinsicht unbequemen Buch »Vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung«, in dem er Fälle aus deren Geschichte untersucht, die verdrängt wurden und damit auf folgenreiche Weise ungelöst blieben. Nichts erscheint ihm nämlich für den politischen Zustand der Bundesrepublik verhängnisvoller zu sein als die Verdrängung der dunklen Seite der Geschichte Deutschlands und des darin enthaltenen Anteils an der Lebensgeschichte der Kriegsgeneration und der Kriegskinder. Der kollektiven Gedächtnisanstrengung gegen den »Geschichtsverlust«, den er in Deutschland für »so besonders markant« hielt,9 maß er eine Schlüsselbedeutung für die demokratische Konstitution der deutschen Nachkriegsgesellschaft nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur zu. Lange vor dem Historikerstreit mit Hillgrubers, Noltes, Stürmers u. a. Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus (Broszat),10 dem auf der politischen Ebene der gemeinsame Auftritt von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem amerikanischen Präsidenten Reagan auf dem Soldatenfriedhof Bitburg mit seinen SS-Gräbern und unmittelbar daran anschließend im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen im Jahre 1985 in besonders markanter Weise entsprach, warnte Lucas-Busemann vor der Gefahr einer »Normalisierung der Vergangenheit« (Habermas) Er wies auf die öffentliche Aufgabe der Geschichtswissenschaft und die Notwendigkeit aufklärender individueller und kollektiver Erinnerungsarbeit hin. Zur Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Geschehenen als Bestandteil eines gesamtgesellschaftlichen Lernprozesses schreibt er:
»Der Wiederaufbau autonomer Arbeiterorganisationen, die Entmachtung der Nazieliten und der Profiteure des verbrecherischen Systems, der Kampf um demokratische Verfassungen, die Überführung von Schlüsselindustrien in Gemeineigentum usw. – das alles war wichtig. Aber das Wichtigste wäre die Utopie einer Gesellschaft gewesen, in der dauerhaft öffentlich über das Geschehene geredet wird. Nicht über das Geschehene als abscheuliches System, mit dem man selbst nichts zu tun hat, … sondern über die persönliche Teilhabe am Verbrechen, über das, was nie mehr gutzumachen ist und nie mehr vergessen werden kann, und auch über die Albträume. … Die große Gefahr – die dann auch eintrat – bestand darin, dass die Menschen das Geschehene in sich einschlossen, sei es aus Angst vor den Reaktionen auf die Mitteilungen, die sie hätten machen müssen, sei es, weil sie nicht hartnäckig genug gefragt wurden, sei es in dem stillschweigenden Übereinkommen, es sei besser zu schweigen. … Das Gespräch zwischen den Generationen ist noch tiefer abgerissen, als es ohnehin schon geschieht …« (Hervorhebung D. St.)11
Wie wichtig das Gespräch über die Schreckenserlebnisse des Krieges für die damaligen Kriegskinder und heute Erwachsenen für die Verarbeitung der damals erlittenen traumatischen Erfahrungen ist, zeigt ein Erhard Lucas-Busemann gewidmetes Gedicht, das ein Freund »Zur Erinnerung an Erhard« im April 1993 geschrieben hat:
Aus dem Füllhorn der Lebenslust
purzeln die Frühlingsblumen
wie aus der Flüstertüte
die Utopien für eine bessere Zukunft.
Der Tod hat Dich geholt
und mich gerufen.
Kein Gespräch mehr mit Dir
über die 68er Flüstertütenzeit.
Unsere Worte sprangen leicht wie Insekten
über das Wasser
und spiegelten unsere Sehnsüchte.
Kein Disput mehr über den Historikerstreit.
Unsere Blicke streiften mit Kinderaugen
durch die völlig zerbombten Städte unserer Geburt.
Wollt ihr den totalen Krieg? Der Schwall des »Ja« lief uns
noch 40 Jahre danach schaudernd den Rücken hinunter.12
In seinem Buch »Vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung« findet sich an der oben zitierten Stelle eine Anmerkung des Autors, die Aufschluss darüber gibt, worin der moralische und erzieherische Sinn begründet liegt, Geschichte nicht zu vergessen, sondern lebendig zu halten. Erhard Lucas-Busemann rechtfertigt den Anspruch auf Auskunft, den er mit dem Unterton einer Anklage stellvertretend für seine Generation gegen die Elterngeneration richtet, mit deren »Tatbeitrag« für den jähen Verlust der eigenen Kindheit im Jahre 1945. Diese Fußnote lautet:
»Eltern lassen ihre Kinder im Unklaren, was sie mit ihnen in der Kindheit gemacht haben. So müssen die Kinder selbst entdecken, dass sie seit dem ersten Atemzug Opfer waren, und zwar nicht Opfer irgendwelcher böser Mächte, des Krieges, der Nazis oder was immer, sondern Opfer der geliebten Personen, die sie ins Leben gezogen haben. Aber eben diese Entdeckung und die Trauer darüber gilt als verächtliche Form des Selbstmitleids. Dabei wäre die Trauer über sich selbst die Voraussetzung dafür, auch über andere trauern zu können, und die Voraussetzung dafür, wieder lachen zu können. Andererseits ist ein gewisser Bruch zwischen den Generationen notwendig. Man könnte ja kaum aufwachsen, wenn der ganze Haufen von Erwachsenen die Masse der Menschheitsprobleme auf einen wälzen würde. Das Ideal wäre, ganz allgemein formuliert, dass die Erwachsenen mit der ›Geschichte‹ und den ›Geschichten‹ herauskommen, wenn die Kinder danach fragen, und dabei doch den Kindern ihre eigene Welt lassen.«13
Dieses Frageinteresse will der Geschichtswissenschaftler Erhard Lucas-Busemann in dem hier veröffentlichten Beitrag durch eigene Recherchen befriedigen. Zu diesem Zweck betreibt er die Ermittlung der historischen Wahrheit ohne jede Bitterkeit und durchdrungen von einem tiefen Gerechtigkeitsbedürfnis. Es scheint, dass er sich der Gefahr durchaus bewusst war, durch die persönliche Nähe zum Gegenstand und den nicht ausgetragenen Konflikt mit Andreas Hillgruber in seinem Urteil befangen zu sein. Daraus erklärt sich die Eigenart der historischen Erzählweise in diesem Geschichtsessay, in dem der Autor sich selbst als Subjekt einbringt und die eigene Biographie zum Schnittpunkt der militärischen Geschehnisse des Kriegsendes im deutschen Osten macht. Zugleich legt er dabei aber auch offen, welche Probleme sich ihm aus seiner subjektiven Sichtweise in Anbetracht der Last der Vergangenheit stellen. Der Text wird so in gewisser Weise selbst zu einem Dokument, wie eine Person die Zeit bewusst wahrzunehmen und mit Zukunftsgewinn für sich selbst zu verarbeiten versucht.
Erhard Lucas-Busemann ist im März 1993 gestorben. Auch wenn er das Manuskript nicht mehr abschließend bearbeiten konnte und insbesondere die Schlusskapitel teils skizzenartig ausgeführt sind,14 so öffnet uns gleichwohl seine Untersuchung die Augen für wichtige Aspekte in einem dunklen Kapitel deutscher Geschichte. Nicht zuletzt der sogenannte Historikerstreit, bei dem es zentral um das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zur NS-Vergangenheit Deutschlands ging, und die vielfältigen Aktivitäten der politischen Führung »zur Entsorgung der Vergangenheit«15 bis in die jüngste Zeit16 haben deutlich gemacht, wie wichtig das Bewussthalten der deutschen Geschichte der Jahre 1933–1945 ist. Nur wenn wir uns Rechenschaft ablegen über die durch die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen begründeten existenziellen Verknüpfungen des eigenen Daseins mit der Lebensweise unserer Eltern und Großeltern, die den NS-Staat mit seinen unsäglichen Verbrechen miterlebt und womöglich mitgetragen haben, erkennen wir die Notwendigkeit, die vergangene Zeit nicht zu vergessen oder zu verleugnen; dann können wir Verantwortung für die gemeinsame Geschichte übernehmen und demokratische Perspektiven für die deutsche Gesellschaft entwickeln. Vollzieht sich die Beschäftigung mit Geschichte im Geist sinnstiftender Erinnerungsarbeit, können wir uns den hinterlassenen Erfahrungsgewinn von Erhard Lucas-Busemann zu eigen machen, dass »ein Verlust zwar zu betrauern, aber nicht zu beklagen ist«.
Dieter Sterzel,
1994
Erinnerungen an unsere Flucht aus Pommern
Freitag, der 2. Februar 1945. Seit Einbruch der Dämmerung liegt das Dorf Nantikow im Kreis Arnswalde/Pommern im Dunklen. Die Überlandzentrale in Landsberg an der Warthe ist vor Tagen bei einem Luftangriff getroffen worden und liefert seitdem keinen Strom mehr. Auch die Kerzen beginnen schon knapp zu werden, man muss sparsam mit ihnen umgehen.
Die Menschen in den Häusern sind unruhig. Die deutsche Ostfront, so viel ist bekannt, ist Mitte Januar zusammengebrochen. Konnte sie wieder stabilisiert werden? Wie weit sind die angreifenden Russen schon vorgedrungen? Auf dem Gutshof stehen abfahrbereite Planwagen, auf die die Dorfbevölkerung aufsteigen soll, wenn die Parole zur Evakuierung kommt.
Dieselbe Unruhe im evangelischen Pfarrhaus. Es ist leer geworden darin; bis vor kurzem hatte es Einquartierung gehabt, die Knechte des berühmten Trakehnergestüts aus Ostpreußen, Männer, Frauen und Kinder (die Besitzer und die Pferde selbst waren auf dem Gutshof untergebracht gewesen), aber sie sind bereits weitergezogen. Auch die Lehrerin der Dorfschule, 1943 mit zahlreichen Kindern aus Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet nach Pommern evakuiert, ständiger Gast im Pfarrhaus, ist vor Tagen auf Anweisung in einen überfüllten Sonderbus nach Stettin gestiegen. Nun sind wir nur noch fünf Personen im Haus: meine Großmutter, 61 Jahre alt, eine Witwe, die seit Beginn des Krieges bei uns lebt, meine Mutter, 35 Jahre alt, und drei Kinder – meine beiden jüngeren Brüder und ich im Alter von 7, 6 und 3 Jahren.
Plötzlich, gegen 19 Uhr, fährt ein Militärlastwagen vor dem Haus vor, Wagentüren schlagen, im Hausflur steht mein Vater – seit Beginn des Krieges Soldat, 1939 Einsatz in Polen, 1940 in Frankreich, seit 1941 in Russland, zuerst bei den Pionieren, dann bei der Nachrichtentruppe, bei den »Strippenziehern«, wie es im Militärjargon heißt, Mitglied der Bekennenden Kirche, dennoch 1944 zum Leutnant befördert. Die Offiziere werden knapp, und die Wehrmacht kann es nicht mehr so genau nehmen. Sein Erscheinen kommt für meine Mutter nicht so ganz überraschend; seit der russischen Großoffensive hat er mehrmals über das Dorftelefon angerufen und mit ihr gesprochen. Seine Worte sind es, die sie in helle Aufregung versetzen: ob wir mitkommen wollen, viel Zeit hat er nicht, er müsse heute Nacht noch nach Falkenberg (rund 50 Kilometer in nordöstlicher Richtung), um bei einem SS-Regiment Nachrichtenpapiere zu übergeben. Am nächsten Tag könne er uns dann weiter nach Stettin mitnehmen.
Meine Mutter geht mit ihm zum Gutshof; der Gutsbesitzer ist allein für die Evakuierung des Dorfes zuständig, seitdem vom Kreisleiter der Partei keine Direktiven mehr kommen. Derweil brät meine Großmutter schnell etwas in der Küche. Ich habe das Bild noch vor Augen: Die Soldaten sitzen um den großen Tisch in der Stube, auf dem die Pfanne mit Bratkartoffeln und Blutwurst steht. Fleisch war reichlich im Haus, vor kurzem war geschlachtet worden, die Würste hingen an Stangen in einem nicht benutzten Zimmer. Während sie mit gutem Appetit essen, zieht Großmutter uns drei Kindern die wärmsten Sachen an und hilft uns in die Wintermäntel.
Unterdessen hat der Gutsbesitzer meiner Mutter dringend zugeredet, wir sollten mitfahren, er sei dann die Verantwortung für uns los. Er gibt meinen Eltern ein paar Leinensäcke mit. Doch es herrscht klirrender Frost, das Thermometer steht unter minus 20 Grad, und es fegt ein eisiger Ostwind. Das kommt meiner Mutter voll zu Bewusstsein, als sie mit meinem Vater wieder das Haus betritt. Nein, sagt sie, sie könne mit den Kindern nicht auf die Landstraße. Sie denkt besonders an den Jüngsten, der eben erst mit knapper Not eine doppelseitige Lungenentzündung überstanden hat. Der kleine Körper ist noch völlig entkräftet, und ein Rückfall muss befürchtet werden (der dann auch eintrat). »Gut«, sagt mein Vater, »das kann ich verstehen, dann will ich mich nur noch von den Kindern verabschieden.«
So kommt es zu einer für uns alle entscheidenden Konfrontation zwischen den beiden Frauen. »Du kannst ja meinetwegen hierbleiben«, sagt meine Großmutter zu ihrer Tochter, während wir drei Kinder fertig angezogen dastehen, »aber wir fahren mit!« Ich nehme an, dass sie hier rigoros ihren Erfahrungsvorsprung ausgespielt hat. Sie war 1914 schon erwachsen, sie hatte also das Eindringen der Russen in Ostpreußen im Gedächtnis. Jedenfalls gibt meine Mutter vor so viel Resolutheit nach. Sie sucht noch schnell ein paar Sachen zusammen, wir Kinder bekommen jeder ein Federbett um den Leib gewickelt, aus dem Nachbarhaus kommt noch eine Frau mit ihrem kleinen Kind dazu, dann klettern alle auf den Lastwagen, und ab geht die Fahrt auf dunkler, vereister Straße.
Damit begann eine wochenlange Flucht, die Anfang Mai in Schleswig-Holstein endete. Was für uns im ersten Moment wie ein Abenteuer aussah, entpuppte sich schnell als Absturz vom Frieden in den Krieg. Auf dem Dorf waren wir weitab von jedem Kriegsgeschehen aufgewachsen. Jetzt lernten wir die Tiefflieger kennen, mal auf freiem Feld, mal auf verstopften Straßen, die endlosen Trecks, hungernde und erfrierende Kinder, verzweifelte Frauen.
Männer, die auf zusammenbrechende Pferde vor den überladenen Wagen einschlugen. Ich habe das brennende und zu einer einzigen Ruine zerfallende Prenzlau vor Augen, aus dem wir gerade noch herauskamen; ich erinnere mich noch an Fliegeralarm und Bunkernächte in einem Vorort von Berlin. Aus meinem Gedächtnis getilgt sind die wegen »Fahnenflucht« und »Feigheit vor dem Feind« aufgehängten deutschen Soldaten, aber meine Mutter erinnert sich mit Grauen daran, wie mein Bruder und ich mit den Köpfen an die herabhängenden Beine stießen und die Leichen zum Schaukeln gebracht haben. Zugleich aber weiß ich nach dem, was ich inzwischen gehört und gelesen habe, wie viel Glück wir noch gehabt haben. Wir sind nicht von der Front überrollt, wir sind nicht bedroht, gedemütigt und ausgeplündert worden, ich habe nicht mit ansehen müssen, wie eine Frau vergewaltigt wurde.17
Umgang mit einem lebensgeschichtlichen Bruch
Das Dasein einer Flüchtlingsfamilie, das wir zuerst in Schleswig-Holstein, dann, ab August 1945, in Westfalen führten, rief immer wieder Erinnerungen an Pommern und an die Flucht wach. Einige Jahre später lernte ich ein neues Wort kennen – »Wiedervereinigung«. Die Gespräche der Erwachsenen, die sich darum drehten, waren in der Regel von Resignation getragen. Skeptisch wurde insbesondere die von Adenauer betriebene Westintegration beurteilt. In der Erinnerung an die allmähliche Bildung einer eigenen Meinung heben sich zunächst nur Fetzen heraus, z. B. ein Disput mit einem Klassenkameraden, Anhänger der CDU, in dem ich die westdeutsche Politik gegenüber den Amerikanern als zu wenig selbständig bezeichnete. Im ersten Semester meines Theologiestudiums – im Herbst 1955 an der Kirchlichen Hochschule in Bethel – sehe ich mich in einem Gemeinschaftsraum mit zahlreichen Kommilitonen; wir hören Radionachrichten und Kommentare über die Genfer Konferenz der Außenminister der USA, Englands, Frankreichs und der Sowjetunion und ihre gegensätzlichen Positionen in der Deutschlandpolitik: westliche Sicherheitsgarantien gegenüber der UdSSR für den Fall der Wiedervereinigung – oder ein System kollektiver Sicherheit und Abrüstung in Europa. Sollten die Deutschen nicht dem Beispiel Österreichs nachstreben, das im Sommer den aufsehenerregenden Staatsvertrag mit Moskau abgeschlossen, sich zur Neutralität gegenüber den beiden Machtblöcken verpflichtet und dafür die Unabhängigkeit und den Abzug der Besatzungstruppen erreicht hat? Ich abonniere die damals von Hans Zehrer geleitete »Welt«, in der die Wiedervereinigung das zentrale Thema war.
Eine weitere Situation, ein oder zwei Jahre später: Auf der Fahrt in die Semesterferien eine Begegnung auf der Bahn mit einem ehemaligen Studienrat aus dem Gymnasium, inzwischen Bundestagsabgeordneter der CDU; er pries die »Politik der Stärke« – ich sehe noch, wie er den Ellenbogen auf die Ablage am Fenster stieß, den Unterarm hochreckte und die Faust ballte – und stellte es als so gut wie sicher hin, dass »der Russe« demnächst »die Zone herausrücken« müsse.
Klare Konturen gewinnen erst die sechziger Jahre. 1961 begann ich in Freiburg ein zweites Studium (Wirtschaftswissenschaften und Geschichte), und gleichzeitig trat ich in den Sozialistischen Studentenbund ein. In zahlreichen Diskussionen habe ich die Position vertreten: Die Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches ist Resultat des von Hitler angezettelten Zweiten Weltkrieges, die Ansiedlung der Polen dort ist nicht mehr rückgängig zu machen, die Oder-Neiße-Grenze muss vorbehaltlos anerkannt werden, alles andere bedeutet neues Unrecht und beschwört die Gefahr eines neuen Krieges herauf. Im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit Vertriebenen fand ich kein persönliches Wort, das sich auf unser gemeinsames Schicksal bezogen hätte. Hinter jedem Vertriebenen sah ich die Vertriebenenverbände mit ihrem Gefasel vom Weiterbestehen des Deutschen Reiches und von Rechtspositionen, die nicht aufgegeben werden dürften.
Unterdes fuhren meine Eltern zum ersten Mal nach Polen und besuchten auch Nantikow, das jetzt Nętkowo heißt. Durch ihre weitläufigen Beziehungen zu anderen Vertriebenen hatten sie bereits Informationen über die Region, die sie jetzt durch Augenschein teils bestätigt fanden, teils korrigierten und ergänzten. Das Dorf war 1945 kurz nach unserem nächtlichen Aufbruch von den Russen besetzt worden, doch die Wehrmacht hatte es bald darauf zurückerobert, bis es dann Anfang März in erbittertem Kampf endgültig von der Roten Armee genommen wurde. Zahlreiche Gebäude waren in Flammen aufgegangen, in der Schule ein Munitionslager explodiert, die Kirche war eine Ruine, der Gutshof dem Erdboden gleichgemacht. Doch das ehemalige Pfarrhaus stand noch, und die Polen hatten darin eine Grundschule eingerichtet. Nur der schöne Hecken- und Baumbestand ringsherum fehlte. Dafür fand sich noch die Pumpe hinter dem Haus, aus dem unzählige Eimer Wasser geschöpft und ins Haus getragen worden waren. Nicht lange danach fuhren meine Eltern ein zweites Mal hin.
1970 schickte mir mein Vater ein paar Fotos und schlug mir eine Reise zu dritt nach Nętkowo vor: er, mein nächstältester Bruder und ich. Ich entwarf einen scharfen Absagebrief (die endgültige Fassung war dann knapper und insofern milder), in dem es unter anderem hieß:
»Bei den Fotos empfand ich Freude über dreierlei: darüber, dass das frühere Pfarrhaus jetzt eine Schule ist, dass es den Gutsbetrieb nicht mehr gibt und dass die Kirche zerstört ist. Da das Letztere dich besonders schmerzen wird, eine kurze Erklärung: Seit einiger Zeit stelle ich mir nach allen möglichen Seiten vor, welche Stellung der Pfarrer im Verhältnis zum Gutsbesitzer einerseits, zu den Bauern und den übrigen Dorfbewohnern andererseits hatte, und komme zu dem Ergebnis, dass die Kirche vollkommen kompromittiert gewesen sein muss durch die ökonomische und gesellschaftliche Abhängigkeit vom Gutsbesitzer. Wenn also die Kirche noch heute eine Ruine ist, scheint mir da etwas auf richtige Weise zum Ausdruck zu kommen Alle drei Momente zusammengenommen: ich freue mich darüber, dass das Dorf seit 1945 zum sozialistischen Polen gehört. Sicherlich würde eine Reise mir diese Freude bestätigen, aber ich würde gleichzeitig sehen müssen, wie meine Freude für dich Anlass zur Trauer wäre. Das möchte ich nicht.«
Damit war das Thema für mich erst einmal abgeschlossen. Auffällig blieb, dass Gedanken an das Dorf und die Jahre der Kindheit immer wieder auftauchten, oft bei ganz seltsamen Gelegenheiten. Das kreuzte sich mit der Differenzierung meines bis dahin ganz dogmatischen Polenbildes. Es war ja auch merkwürdig genug: Im Sozialistischen Deutschen Studentenbund sahen wir sehr scharf die Differenzen, die wir mit den deutschen Parteikommunisten (KPD/DKP und SED) hatten, und in diesem Briefentwurf sprach ich ganz naiv vom »sozialistischen« Polen. Im Jahr 1970, in dem ich das zu Papier brachte, stürzte Gomulka über Arbeiterunruhen, die er nicht mehr meistern konnte; bei Trikont erschien das Tonbandprotokoll der Auseinandersetzung zwischen den streikenden Werftarbeitern von Szczecin (Stettin) und dem neuen Parteichef Gierek vom 24. Januar 197118





























