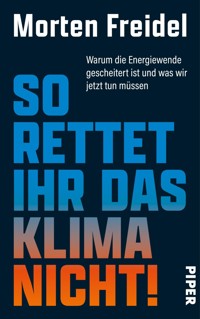
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klimapolitik auf Abwegen Viele sind überzeugt, dass echter Klimaschutz nur möglich ist, wenn wir auf wirtschaftliches Wachstum verzichten. Morten Freidel hat die Energiekrise seit dem Ukrainekrieg begleitet. Er hat mit zahlreichen Entscheidern gesprochen und ist überzeugt: Klimaschutz funktioniert nur mit Wachstum. Ein erzwungener Verzicht bedroht die Demokratie. Freidel wirbt leidenschaftlich für einen Klimaschutz, der Brückentechnologien als Chance sieht. Er verfällt dabei weder einem naiven Fortschrittsglauben noch Untergangsprophezeiungen. Sein Buch zeigt mit persönlichen Einblicken die Widersprüchlichkeit einer Moderne auf, die durch den Klimawandel in ihren Grundfesten erschüttert wird. Und es erklärt, was wir ändern müssen, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024Covergestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Erstes Kapitel –Wie ich lernte, die Energiepolitik zu lieben
Zweites Kapitel –Die Schlange am Flughafen Kos-Hippokrates
Drittes Kapitel –Mit Panzern nach Peking
Viertes Kapitel –Der alte Porsche und das Klima
Fünftes Kapitel –Eine Maschine, die den Einstler vertreibt
Sechstes Kapitel –E-Mail von der Behörde
Siebtes Kapitel –Schluckimpfung ist süß
Achtes Kapitel –Eine Winternacht im Jahr 2053
Neuntes KapitelAuf der Suche nach dem Schnee
Anhang
Erstes Kapitel, »Wie ich lernte, die Energiepolitik zu lieben«
Zweites Kapitel, »Die Schlange am Flughafen Kos-Hippokrates«
Drittes Kapitel, »Mit Panzern nach Peking«
Viertes Kapitel, »Der alte Porsche und das Klima«
Fünftes Kapitel, »Eine Maschine, die den Einstler vertreibt«
Sechstes Kapitel, »E-Mail von der Behörde«
Siebtes Kapitel, »Schluckimpfung ist süß«
Achtes Kapitel, »Eine Winternacht im Jahr 2053«
Neuntes Kapitel, »Auf der Suche nach dem Schnee«
– Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Gewidmet Antonia und Theodor
Erstes KapitelWie ich lernte, die Energiepolitik zu lieben
Warum Energiepolitik das wichtigste Thema der Gegenwart ist
Energiepolitik hat mich nie interessiert. Für mich waren Artikel über Energiepolitik immer die mit den Fotos von Strommasten und wirr durcheinanderhängenden Kabeln. Schon die Fotos sahen so anstrengend aus, dass ich die meisten Texte gar nicht erst las. Wofür brauchte es bei Energie überhaupt Politik? RWE sollte seinen Strom verkaufen, die Politik die Regeln festlegen, so sah ich das.
Ein paar Monate nach Russlands Überfall auf die Ukraine bat mich ein früherer Kollege aus der Redaktion, eine Titelgeschichte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über die Atomkraft zu schreiben. Ich hatte wenig Lust. Es war Krieg, im Donbass starben ukrainische Soldaten. In einer solchen Situation über Atomenergie zu schreiben, kam mir vor, als würde ich während einer Notlandung über Briefmarken diskutieren. Es gab drängendere Themen. Ich hatte kein Problem mit den alten Meilern, aber Deutschland hatte sich nach Fukushima für einen anderen Weg entschieden, es setzt auf die Kraft von Wind und Sonne. Ich fand, das Thema gab nichts her.
Doch der Kollege insistierte. Also ging ich der Frage nach, ob es sinnvoll sein könnte, die letzten drei Reaktoren wegen der Energiekrise ein paar Monate länger laufen zu lassen. Es war die Zeit, in der die Deutschen darüber diskutierten, ob sie ihr Frühstücksei mit oder ohne Deckel kochen sollten, und in der Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihnen empfahl, sich mit dem Lappen zu waschen, statt zu duschen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, dass »jede Kilowattstunde« zähle. Das galt allerdings nicht für Strom aus Atomkraftwerken. Den wollte die Bundesregierung auf keinen Fall länger haben als nötig. Für sie war das vor allem eine Frage der Sicherheit. Ich ging zu Beginn meiner Recherche davon aus, dass sie gute Argumente hatte, die der Krieg zum Teil entkräften würde. Zu meiner Überraschung stellte ich fest: Sie hatte kein einziges gutes Argument. Deutschland konnte den Strom der Kraftwerke sehr wohl gebrauchen, anders als die Bundesregierung behauptete. Es gab sehr wohl genug Personal, um die Meiler weiterlaufen zu lassen. Es war sehr wohl möglich, die Brennstäbe neu anzuordnen und mehr Saft aus ihnen rauszuholen, und es drohte auch keine Kernschmelze, nur weil die Reaktoren für kurze Zeit weiterliefen. Ein leitender Techniker, der im damals schon vom Netz gegangenen Kernkraftwerk Brokdorf arbeitete, sprach am Telefon von »Scheinargumenten«. Wenn die Regierung denn wolle, könne sie alle Probleme lösen, sagte er. Das bestätigte sich Monate später, als die Bundesregierung nun doch beschloss, die Reaktoren über den Winter laufen zu lassen. Sie tat also genau das, was sie in diesem Moment noch als unmöglich darstellte.
Mich machte diese Hartnäckigkeit nervös. Wer sich in die entgegengesetzte Richtung zu allen anderen bewegt, der kann auf der richtigen Spur sein, meistens aber ist er ein Geisterfahrer. Noch dazu wirkte Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen aufgeschlossen gegenüber der Kernkraft. Einmal sagte er in einem Video, die Frage nach der Atomenergie sei »ja total virulent«. Ideologen klingen anders. Sie sind nicht offen für die Argumente der anderen. Habeck aber schien es zu sein. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass solche Leute meistens selbst die besten Argumente haben. Was, wenn ich derjenige war, der falschlag?
Einige Wochen nach dem Artikel kam der Kollege wieder zu mir. »Wir müssen was über Fracking machen!«, sagte er. Er fand, dass sich die Regierung für ein Übel entscheiden müsse: entweder für die Atomkraft oder dafür, Schiefergas in Deutschland zu fördern. Sonst könnte es eng werden mit der Energie, wenn das russische Gas ausblieb. Wieder war ich skeptisch. Mir kam Fracking noch abwegiger vor als Kernkraft. Ich hatte mich damit nie eingehend beschäftigt, aber Bilder im Kopf von verschlammten Bohrmaschinen und Arbeitern in der amerikanischen Prärie. Von Wasserhähnen, die man anzünden konnte, weil aus ihnen Gas entwich. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Fracking Erdbeben auslösen kann. Im großen, weiten Amerika fand ich das vertretbar. Im dicht besiedelten Deutschland kam es mir riskant vor. Ich fand es außerdem verdächtig, dass in der Öffentlichkeit kaum einer über Fracking diskutierte. Vielleicht war die Sache einfach zu aufwendig, dachte ich. Jemand musste erst einmal Genehmigungen einholen, Probebohrungen machen, dann das Gas aus der Tiefe holen. Die Atomkraftwerke waren wenigstens gebaut, die konnten einfach weiterlaufen.
Doch die Dinge lagen anders. Unsere Titelgeschichte stützte sich vor allem auf den Bericht einer Expertenkommission, die die Große Koalition eingesetzt hatte, als sie 2016 das Fracking in Deutschland verbot. Die Kommission bestand aus lauter Umweltschützern und sollte nach dem Verbot in aller Ruhe prüfen, wie gefährlich es ist, Schiefergas zu fördern. Sie nahm sich dafür fünf Jahre Zeit, bis 2021. Man kann also sagen, sie arbeitete gründlich. Die Experten schätzten das Risiko für Erdbeben in ihrem Bericht als »äußerst gering« ein. Die Gefahr, dass Grundwasser verseucht werden könnte, hielten sie für »gering«. Seit die Amerikaner mit dem Fracking anfingen, sind sie besser darin geworden, sie haben ihre Methoden verfeinert. Die Kommission kam deshalb zu dem Schluss, dass Fracking auch in Deutschland vertretbar sei. Das Problem war nur: Es hatte kaum einer ihren Bericht gelesen. Eigentlich sollte der Bundestag auf seiner Grundlage noch einmal neu über das Fracking diskutieren. Die Umweltschützer erzählten uns, dass sie sogar ihre Urlaubspläne aufeinander abgestimmt hatten, falls jemand anrufen sollte, um sie einzuladen. Es rief aber niemand an.
Wir fragten in Habecks Ministerium nach, ob es wegen dieses Berichts und des Krieges nicht geboten sei, noch einmal über Fracking zu diskutieren. Eine Sprecherin hielt es nicht für geboten. Sie antwortete uns, Fracking sei verboten, weil es das Grundwasser verschmutze und der Umwelt schade. Das klang, als hätte es die Kommission nie gegeben. Die Sprecherin nannte Argumente, die seit mehr als einem Jahr widerlegt waren.
Was hier passierte, hatte für mich eine andere Qualität als die Diskussion über die Kernkraft einige Wochen davor. Ich habe schon oft erlebt, dass Politiker von unlösbaren Problemen redeten, die Experten für lösbar hielten. Beim Streit über Waffenlieferungen an die Ukraine passierte das ständig. Ich hatte aber noch nie erlebt, dass Fachleute für die Regierung einen Bericht verfassen, den die Regierung ignoriert. Noch dazu in einer solchen Notlage. Das ganze Land diskutierte damals darüber, wie man russisches Gas ersetzen könnte. Milliarden Kubikmeter Schiefergas liegen in Deutschland unter der Erde, es könnte das Land für Jahrzehnte versorgen. Und hier bot sich nun eine Möglichkeit, es rauszuholen, beglaubigt von Umweltschützern, die uns versicherten, dass sie sich vor allem von der Vorsicht leiten ließen, und trotzdem wollte die Bundesregierung nichts davon wissen. In der Kommission saßen auch nicht irgendwelche Leute. Ein Mitglied aus dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung war beteiligt, ebenso jemand aus dem Umweltbundesamt. Das ist eine Behörde, die dem Bundesumweltministerium unterstellt ist und die manche dafür kritisieren, dass ihr Naturschutz wichtiger ist als Ausgewogenheit. Ich weiß nicht, ob das berechtigt ist, ich bin mir aber sicher, dass im Umweltbundesamt keine Wirtschaftslobbyisten sitzen. Diese Leute hielten Fracking für vertretbar. Die Regierung handelte also gegen die eigenen Experten. Von nun an hatte die Energiepolitik meine Aufmerksamkeit.
Bis dahin hatte ich bei meinen Recherchen nur wenig über Klimaschutz nachgedacht. Es ging um die Versorgungssicherheit, um die Frage, wie Deutschland durch den nächsten Winter kommt. Ich wollte wissen, wie die Regierung vermeiden konnte, dass im Land die Lichter ausgingen. Was das für das Klima bedeutete, war erst einmal egal. Die Bundesregierung war der Meinung, dass sie das ohne Atomkraftwerke und heimisches Schiefergas schaffen würde. Sie baute lieber LNG-Terminals an der Küste, um Flüssiggas zu importieren, und holte alte Kohlekraftwerke wieder ans Netz. Das konnte man riskant finden oder nicht, es war jedenfalls keine Frage der planetaren Gesundheit. Die Ironie war aber, dass die Maßnahmen der Regierung auch noch klimaschädlich waren. Atomkraftwerke stoßen keine Treibhausgase aus, und sie laufen auch dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. An manchen solcher Tage lieferten die letzten drei verbliebenen Meiler in Deutschland fast so viel Strom wie Wind und Sonne zusammen. Man kann darauf verzichten, klar. Aber dann müssen andere Kraftwerke die Arbeit übernehmen, vor allem Kohlekraftwerke. Wie deren Klimabilanz aussieht, weiß jeder.
Ähnlich sah es beim Fracking aus. Es ist für das Klima immer noch besser, Schiefergas aus der niedersächsischen Heide zu holen und zu einer Chemiefabrik in der Nähe zu bringen als mit Tankern über den Atlantik. Um das Gas auf die Schiffe zu laden, muss es abgekühlt und verflüssigt werden, dabei geht viel Energie verloren. Dann fahren die Schiffe über das Meer, stoßen Treibhausgase aus, und im deutschen Hafen wird das Gas dann wieder aufgetaut. Das alles ist eine dreckige Angelegenheit, viel dreckiger, als wenn sich Deutschland selbst die Hände schmutzig machen würde.
Mir kam das nicht sonderlich grün vor. Grün wäre es für mich gewesen, alle Kernkraftwerke ans Netz zu holen, die noch betriebsbereit sind, statt Kohlekraftwerke anzuwerfen. Grün wäre es für mich gewesen, Schiefergas in Deutschland zu fördern, statt auf Einkaufstour in Katar zu gehen. Noch dazu hätte das die Energieversorgung langfristig stabilisiert. Die Ampel verzichtete also darauf, zwei Probleme gleichzeitig zu lösen. Sie wollte ausgerechnet auf diejenigen Schritte beim Klimaschutz verzichten, die den Bürgern nicht einmal etwas abverlangt, sondern sie sogar in der Krise entlastet hätten. Von allen Dingen, die ich bisher über Energiepolitik gelernt hatte, konnte ich das am wenigsten begreifen. Eine solche Chance haben Politiker beim Klimaschutz selten genug. Normalerweise ist er mit Härten verbunden, Strom muss gespart, Häuser müssen gedämmt werden. Und nun stemmte sich die Ampel gerade gegen die Maßnahmen, bei denen das anders war? Mich ließ das an den Grünen zweifeln.
Dabei bin ich selbst ein Grüner, zumindest von der Grundidee her. Klimaschutz ist mir wichtig, ich habe zwei Kinder, denen ich einen lebenswerten Planeten hinterlassen will. Es kann für mich auch keine Lösung sein, dass Mitteleuropäer zukünftig in klimagekühlten Häusern und Bürotürmen den Sommer verbringen und halb Afrika versteppt. Deshalb bin ich überzeugt, dass Europa und Deutschland beim Klimaschutz besonders engagiert sein müssen. Ich glaube, das wird schwer genug. Es ist aber nahezu unmöglich, wenn Politiker auch noch wählerisch werden, anstatt mutige Entscheidungen zu treffen.
Die Lage war in jenem Sommer angespannt. Unternehmen mussten aufgeben, weil ihnen der Strom zu teuer geworden war. Habeck wand sich im Fernsehen, weil er den Unterschied nicht erklären konnte zwischen einem Bäcker, der die Produktion einstellt, und einem, der insolvent ist. Vielleicht wollte er ihn auch nicht erklären. Videos von diesem Auftritt liefen in den sozialen Netzwerken rauf und runter. All das kostete Habeck Sympathien. Vom beliebtesten Politiker Deutschlands konnte keine Rede mehr sein. Das war nicht allein seine Schuld, in Krisenzeiten geraten Politiker unter Druck. Aber wenn er bei der Energiepolitik mutiger gewesen wäre, so wie die Bundesregierung bei der Verteidigungspolitik, dann hätte er ein Signal ausgesandt: Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um die Krise abzuwenden und Klimaschutz zu ermöglichen. Die alten ideologischen Gräben haben für mich keine Bedeutung mehr.
Es kam mir so offensichtlich vor, was er tun musste, dass ich mich fragte, ob ich etwas übersah. Wer so naheliegende Vorteile ausschlägt, der macht entweder einen Fehler, oder er hat einen besseren Plan. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Habeck sich unüberlegt ins Feuer stellte. Ich hatte ihn bei seinen Auftritten als reflektierten Politiker wahrgenommen. Er musste eine andere Vorstellung davon haben, wie sich Klimaschutz und Energieversorgung in Deutschland zusammenbringen ließen, dachte ich.
Die hatte er auch. Er kündigte an, noch mehr Windräder aufzustellen und Solarzellen zu bauen. Immer wieder wiesen mich Leser in den sozialen Medien auf Studien hin. Die zeigten doch, dass Deutschland allein mit der Kraft von Wind und Sonne klimaneutral werden könne, schrieben sie. Experten hätten das alles schon durchgerechnet, ich sollte ihnen gefälligst mal zuhören.
Das tat ich jetzt. Für die nächste Titelgeschichte sprach ich mit Naturwissenschaftlern über die Energiewende, unter anderem vom Karlsruher Institut für Technologie. Sie sollten mir erklären, wie der Plan aussieht und wie sehr der Ukrainekrieg ihn gefährden könnte. Dieses Mal war ich auf einiges gefasst, schlechte Nachrichten war ich jetzt ja gewohnt. Ich rechnete damit, dass die Forscher die Ziele der Bundesregierung für schwer erreichbar hielten. Womit ich nicht rechnete, war, dass die meisten die Energiewende schon vor dem Krieg für utopisch hielten. Es ging schon mit den Ausbauzielen los. Wussten Sie zum Beispiel, dass Deutschland ab dem Jahr 2025 jeden Tag für zehn Jahre lang mindestens vier große Windräder bauen muss, um seine Ziele zu erreichen? Tag für Tag, zehn Jahre lang. Haben Sie so ein Windrad mal von der Autobahn aus in den Himmel ragen sehen? Wir reden über Anlagen, die mehr als zweihundert Meter hoch sind. Für ein einziges solches Windrad brauchen Sie bis zu hundert Schwerlasttransporte. Dann müssen Sie noch die Teile zusammenbauen. Wussten Sie, dass Deutschland bald jeden Tag für neun Jahre lang Solaranlagen installieren muss in der Größe von mindestens 40 Fußballfeldern? Tag für Tag, neun Jahre lang. Wie, fragten mich die Wissenschaftler, soll das gehen? Woher sollen die Handwerker kommen, woher die Rohstoffe, woher das Geld?
Und das war erst der Anfang, es gab noch viel gravierendere Probleme. Ich dachte bei der Energiewende bisher immer an Windräder und Solarzellen. Die sollen den Strom liefern, der Deutschland klimaneutral macht. In Wahrheit gehörte dazu aber auch Gas, Milliarden Kubikmeter jedes Jahr. Im Winter weht manchmal tagelang kein Wind, und es scheint keine Sonne. An diesen Tagen hilft es auch nichts, wenn in jedem Winkel des Landes ein Windrad steht. Auch die können die Gesetze der Physik nicht außer Kraft setzen. Deshalb sollen in solchen Momenten Gaskraftwerke einspringen, das ist die Idee. Sie haben den Vorteil, dass man sie schnell hoch- und auch wieder runterfahren kann. Sie sind gute Lückenfüller. Es gab dafür auch lange Brennstoff, Gas aus dem fernen Sibirien, das durch die Nordstream-Pipeline direkt ins Land floss. Solange deutsche Politiker Russland behandelten wie einen großen Bruder, der manchmal ein bisschen ruppig war, aber sonst in Ordnung, konnten sie auf dieses Gas setzen. Das ging erstaunlich lange gut, obwohl Russland schon vor Jahren in Georgien einmarschierte und 2014 die Krim besetzte. Doch in dem Moment, in dem russische Soldaten von allen Seiten in die Ukraine einfielen, konnten selbst deutsche Politiker nicht mehr die Augen vor der Realität verschließen. Mittlerweile bekommen wir kein russisches Gas mehr durch die Nordstream-Pipeline. Es ist also die Frage, wo es jetzt herkommen und was es kosten soll.
Doch das ist nicht einmal das größte Problem. Es fehlen schon die Kraftwerke. Monate bevor Russland die Ukraine überfiel, forderten Fachleute, dass Deutschland zehnmal so viele Gaskraftwerke baut wie bisher. Sonst könnte der ambitionierte Zeitplan scheitern. Die Bundesnetzagentur schätzt, dass Deutschland in sechs Jahren mindestens 34 große Gaskraftwerke bauen muss. Das klingt nicht dramatisch, aber haben Sie einmal ein solches Kraftwerk gesehen? Ich hatte dazu kürzlich die Gelegenheit.
Es war das Gaskraftwerk Staudinger 4 in der Nähe von Frankfurt. Der Turm ist knapp 130 Meter hoch, man kann ihn noch von der Stadt aus sehen. Fast alles in den umliegenden Ortschaften ist auf dieses Kraftwerk ausgerichtet. Bahnschienen führen direkt in die Anlage, es gibt mehrere Tiefgaragen, eine Bushaltestelle, Fernwärmeleitungen in die Stadt Hanau, sogar Tennisplätze für die Mitarbeiter. Wer um die Anlage herumlaufen will, der hat einen ziemlichen Marsch vor sich. Den Tennisplatz kann man sicher weglassen. Aber das ist die Größenordnung, über die wir reden. Von solchen Kraftwerken müssten wir in wenigen Jahren 34 Stück bauen, wenn es denn reicht. Wer aber soll das tun, wenn keiner weiß, mit welchem Gas sie betrieben werden sollen? Auch die Betreiber müssen Geld verdienen können. Ihre Investition muss sich lohnen. Was ist, wenn sie es nicht tut? Soll dann die Bundesregierung einspringen, bei den ganzen Sondervermögen, die sie schon jetzt aufgesetzt und die das oberste Gericht zum Teil für verfassungswidrig erklärt hat?
Deutschland kann auf diese Gaskraftwerke nicht verzichten, auf ihnen ruht die Energiewende. Sie sollen in Zukunft mit Wasserstoff laufen statt mit klimaschädlichem Erdgas. Die Frage ist nur, wie weit diese Zukunft von der Gegenwart entfernt ist. Von den Wissenschaftlern, mit denen ich sprach, wusste es keiner. Dabei waren darunter welche, die selbst an Wasserstoff für die Industrie forschten. Aber es ist eben das eine, ob durch einige Leitungen in Deutschland schon Wasserstoff strömt, oder ob man eine ganze Nation an dunklen Tagen damit versorgen will. Selbst der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen von der CDU war skeptisch. Röttgen ist ein überzeugter Anhänger der Energiewende, nach Fukushima trieb er zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel den Atomausstieg voran. Nun aber sagte er mir, Wasserstoff sei »weit entfernt von einem Business Case«. Noch dazu ist er ungeheuer aufwendig herzustellen. Um einen Speicher damit zu füllen, muss man viel mehr Energie aufwenden, als dort am Ende drinsteckt. Woher sollte diese Energie kommen, wenn sie doch jetzt schon knapp war?
In allen Studien, die ich las, ist von Wasserstoff die Rede. Ganz Europa soll es in Zukunft nutzen und sich damit beliefern, falls es mal knapp wird. Das wird in diesen Texten vorausgesetzt. Überhaupt fiel mir bei der Lektüre auf, wie kühn viele Annahmen sind. Was die Fakten anging, war für mich alles klar. Aber politisch war ich jetzt in einer blöden Lage. Wer kann schon etwas gegen ein Energiesystem haben, das einzig und allein angetrieben wird von der unerschöpflichen Kraft des Windes und der Sonne? Die Alternative ist eines, das für Jahrzehnte weiter Kohle und Gas benötigt, oder die Atomkraft. Für Kernenergie sind vor allem Politiker der AfD, viele von ihnen halten den Klimawandel für eine Lüge. Ich fand, das sprach nicht gerade für Atomkraftwerke. Es gibt Politiker der Union und FDP, die Kernkraft ebenfalls für unentbehrlich halten, allerdings sagen das die meisten von ihnen nicht offen, sondern nur im privaten Gespräch. Sie fürchten, dass sie sich damit unbeliebt machen. Sollte ich so eine Position vertreten?
Ich hoffte, dass die Naturwissenschaftler die Studien verteidigen und mir mein Störgefühl ausreden würden. Sie taten allerdings das Gegenteil. Sie erzählten mir, dass die meisten Studien zur Energiewende kein wissenschaftliches Verfahren durchlaufen. Von Studien zu reden, ist also schon irreführend. Es sind eher Berechnungen. Sie rechnen aber nicht aus, ob die Energiewende funktionieren kann. Dieses Ziel steht fest, es ist unverrückbar. Sie rechnen aus, wie man es mit den vorgegebenen Mitteln erreichen kann. Die Parameter werden so lange angepasst, bis die Rechnung aufgeht. Wir können die Wende schaffen, lautet die Botschaft, wir müssen dafür nur massenhaft Windräder und Solarpaneele errichten, unseren Energieverbrauch halbieren und 15-mal so viele Häuser mit Wärmepumpe ausstatten wie bisher. Wir müssen alle Autos mit Verbrennermotor durch Elektroautos ersetzen, den Verkehr auf den Straßen um ein Drittel senken, den Verbrauch der Industrie auch und viel weniger Fleisch essen. Und weil wir all das tun werden, können wir die Kernkraftwerke jetzt schon abschalten und auf das Fracking verzichten. Mir kam es vor, als würde man sagen: Wir können den Mars bis 2030 besiedeln, dafür müssen wir nur in einem Jahr den ersten bemannten Flug auf den Weg bringen, in zwei Jahren acht weitere bemannte Flüge und in vier Jahren mit dem Bau einer Bodenstation auf dem Planeten beginnen, die sich in fünf Jahren selbst versorgen kann. Und weil wir all das tun werden, können wir jetzt schon darauf verzichten, zusätzliche Sauerstofftanks in den Raumschiffen mitzunehmen. Das nimmt nur Platz weg, den wir für andere Dinge brauchen. So kann man es machen. Es gibt dann aber keinen Weg zurück mehr, wenn der Plan scheitert.
Ich weiß natürlich nicht, wie die Sache ausgeht. Vielleicht gelingt die Energiewende genau so, wie sie einmal vorgesehen war. Ich hätte dagegen nichts einzuwenden. Aber es gehört zu meiner Jobbeschreibung, auf Risiken hinzuweisen, und mir kommt es so vor, als würde die Regierung auf diesem Feld besonders hohe eingehen. Deswegen ist Energiepolitik für mich heute das spannendste Thema der Gegenwart. Innerhalb von drei Monaten hatte ich mich um 180 Grad gedreht. Mich interessierte jetzt jedes Detail daran, Umspannwerke, Leitstände und die Einstellwinkel von Windrädern. Wenn ich heute ein Foto von einem Strommast sehe, schreckt mich das nicht mehr ab. Ich frage mich, mit welcher Spannung er betrieben wird.
Vieles in der Politik ist interessant, über manches wird in diesem Land erbittert gestritten, zum Beispiel über die Migration oder den Umgang mit Russland und China. Aber von der Energie hängt alles ab. Ohne sie kann ein Land wie Deutschland nicht funktionieren. Sie hält unsere Zivilisation am Laufen, bis hin zur Toilettenspülung, die wir jeden Tag mehrmals drücken, ohne daran einen Gedanken zu verschwenden. Käme es in Deutschland zu einem Blackout, würden diese Spülungen ausfallen. Wir könnten auch nicht mehr tanken, denn die Pumpen an den Tankstellen würden ebenfalls ausfallen. Ampeln würden erlöschen, der Verkehr erlahmen, Züge blieben stehen, Flugzeuge am Boden. Es wäre so, als würde man einem Menschen die Hauptschlagader abklemmen. Alles bricht zusammen.
Ohne die Energie, die uns heute zur Verfügung steht, hätte die Moderne keine Chance gehabt. Bei der Industrialisierung denken viele zuerst an die Dampfmaschine von James Watt, aber diese Erfindung wäre ohne die Kohle bedeutungslos gewesen. Mithilfe der Kohle schufen die Menschen das Eisen für ihre Maschinen, und mit der Kohle trieben sie sie an. So kam eine ungeheure Dynamik in Gang. Die Menschen holten Kohle aus der Erde, um Maschinen zu bauen und anzutreiben, und mit den Maschinen konnten sie noch mehr Kohle abbauen. Richtig interessant wird all das in meinen Augen aber durch den Klimawandel. Er zwingt die Menschheit dazu, sich in kürzester Zeit von einer Energiequelle zu lösen, die ihr Leben auf dem Planeten seit 250 Jahren radikal geändert hat. Kohle, Öl und Gas haben Millionen Menschen aus der Armut befreit und von den Fesseln der irdischen Mühsal. Seit Europa fossile Rohstoffe verbrennt, hat sich die Lebenserwartung der Menschen mehr als verdoppelt. Krankheiten wurden ausgerottet, Mangelernährung gestoppt, Reisen um die Welt für viele möglich. Doch indem wir diese Rohstoffe verbrennen, zerstören wir zugleich unsere Lebensgrundlagen. Wir heizen das Klima mit einer Geschwindigkeit auf, die es aus dem Gleichgewicht bringt. Also müssen wir uns umstellen. Wir müssen so Energie verbrauchen, dass wir unsere Umwelt schonen. Zugleich sollte es aber genug sein, um das moderne Leben zu erhalten, das wir dieser Umwelt abgetrotzt haben. All das hängt entscheidend vom Energiesystem ab. Sicher, Häuser müssen gedämmt und effizienter beheizt werden, Autos mit Verbrennermotor müssen ersetzt werden durch Elektroautos, oder sie müssen klimaverträgliche Treibstoffe tanken. Sicher, die Industrie muss ihre Prozesse verbessern, unnötige Verschwendung muss enden. Das ist alles wichtig, damit die Transformation gelingen kann. Aber ohne ein klimaneutrales Energiesystem ist es wertlos. Es bringt nichts, den Akku eines Elektroautos mit Kohlestrom zu laden oder eine Wärmepumpe in ein Haus einzubauen, die dann mit Strom aus Gasturbinen angetrieben wird.
Gibt es einen Mangel an klimaschonender Energie, bleiben der Menschheit nur zwei Wege. Sie kann weiter Kohle, Öl und Gas verbrennen und damit die Erde zu einem unwirtlichen Ort für sich selbst machen. Oder sie kann auf Energie verzichten. Die große Frage ist deshalb: Wie sähe Klimaschutz durch Verzicht aus? Kann das funktionieren?
Zweites KapitelDie Schlange am Flughafen Kos-Hippokrates
Warum Verzicht für das Klima scheitern wird
Wir haben lange über einem 1-Euro-Shop gewohnt. Man kann dort alles kriegen, Nagelscheren, Tupperdosen, Sekundenkleber, Haribos, Shampoo und Spielzeugautos, der Preis ist immer gleich. Jedes Mal, wenn wir mit unserem Sohn an dem Laden vorbeigehen wollten, blieb er stehen. Manchmal kauften wir ihm etwas, manchmal nicht, aber was wir auch taten, es endete im Streit. Meine Frau fand, wir könnten ja mal eine Ausnahme machen, ich fand, den Krempel brauchten wir nicht. Die meisten Spielzeuge waren nach einer halben Stunde kaputt, ich hielt das für Verschwendung. Eines Abends schickte meine Frau mich noch mal runter mit dem Auftrag, ihr etwas zu besorgen. Ich war gerade fertig mit dem Einkauf und trat durch die Tür wieder auf die Straße, da begegnete ich einer Kollegin, die Tüte vom Laden in der Hand. Sie schaute mich mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung an. Wir sind dann zum Glück bald umgezogen.
In unserem Freundeskreis gibt es viele, denen ein sparsamer Umgang mit Ressourcen wichtig ist. Einer fliegt nur noch alle zwei Jahre in den Urlaub, ansonsten verreist er mit dem Camper. Ein anderer schreibt alle Gegenstände, die er sich im Jahr gönnt, auf eine Liste, Hosen, Sneaker, den neuen Milchschäumer. Wenn er bei Nummer 20 angelangt ist, kauft er nichts Größeres mehr, nur noch Sachen, die er wirklich braucht. Wer in unserem Viertel einen Termin beim Schneider machen will, sollte damit rechnen, dass es länger dauert. Viele haben kein Auto mehr, und wenn doch, fahren sie damit höchstens zum Einkauf oder zu den Großeltern auf dem Land. Was früher der VW Golf war, ist jetzt das Lastenrad: Wer eines hat, ist Teil einer Avantgarde. Nur dass an erster Stelle nicht mehr die Freiheit steht, loszufahren, wohin man will, sondern die Entscheidung, sich im Einklang mit dem Planeten fortzubewegen.
Die meisten sprechen gar nicht groß über ihr Verhalten. Es ist für sie selbstverständlich, es entspricht ihrem Lebensgefühl. Verzicht ist für die Leute in meinem Freundeskreis mehr als eine Notwendigkeit, um die Erde zu retten, er ist edel, ja sexy. Dieses Gefühl wirkt auch umgekehrt. Verschwendung ist mehr als nur moralisch falsch, sie ist abstoßend. Wer sinnlos Ressourcen verbraucht oder auch nur in den Verdacht gerät, sie zu verschwenden, ist uncool. Was für ein Unterschied zu den Rockstars früherer Jahre, die nicht nur ihr Leben vergeudeten, sondern alles, was sie in die Finger bekamen, und die trotzdem oder gerade deshalb Idole waren. Die Vorbilder von heute sind Instagrammer, die ihre Körper schonen und ihre Yogamatten selbst nähen. Dass sie für ihre Inszenierungen oft mehr in der Welt herumreisen als frühere Rockstars, spielt keine Rolle. Entscheidend ist die Wirkung der Bilder. Deshalb war es so unangenehm, der Kollegin vor dem 1-Euro-Shop zu begegnen.
Eines Abends schaute ich mit meiner Frau einen Vortrag der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann vor dem Schauspiel Stuttgart vom Januar 2022 an, auf den ich zufällig bei Twitter gestoßen war. Er zog uns sofort in den Bann. Herrmann sprach über den Klimaschutz, aber so, wie wir es noch nie gehört hatten. Sie legte ihre Armbanduhr vor sich auf das Pult, strahlte die Zuschauer an, bedankte sich dafür, vor einem Theaterpublikum sprechen zu dürfen, und dann erklärte sie den Besuchern in aller Ruhe, warum ihre Art zu leben keine Zukunft mehr hat. Herrmann redete nicht darüber, was passieren muss. Es war kein flammender Appell, keine Rede ins Gewissen. Die Moral blieb außen vor. Sie erzählte einfach, was passieren wird, ganz von allein.
Ihr Gedankengang war schnörkellos: Deutschland muss schnellstens umstellen auf Ökostrom, um klimaneutral zu werden, dazu gibt es keine Alternative. Wie gewaltig diese Herausforderung ist, verdeutlichte sie mit einer Zahl. Die Windkraft machte damals gerade einmal 5,4 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland aus. Bei der Solarenergie war es ähnlich. Das war alles, trotz der Hunderten von Milliarden von Euros, mit denen Deutschland die Erneuerbaren seit zwei Jahrzehnten fördert. Das Land musste also in wenigen Jahren noch ungefähr 90 Prozent seines gesamten Verbrauchs ersetzen. So ging es weiter. Weil der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint, muss man ihre Energie speichern. Das geht nur mit Batterien und Wasserstoff, und das ist aufwendig. »Daraus folgt etwas«, sagte Herrmann, »das man sich in aller Härte klarmachen muss: Ökoenergie wird immer knapp und immer teuer sein. Das ist nicht etwas, das im Überfluss zur Verfügung steht.«
Nun kam ihre eigentliche schlechte Nachricht. Wenn Energie knapp bleibt, kann die Wirtschaft nicht mehr wachsen, wie es in den 250 Jahren seit der Industrialisierung der Fall war. Sie muss also schrumpfen. Herrmann sprach im Plauderton über das Ende des Kapitalismus, ihre Armbanduhr immer im Blick. Nicht, dass sie noch überzog, die Leute wollten ja noch ein Theaterstück sehen.





























