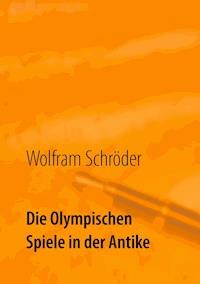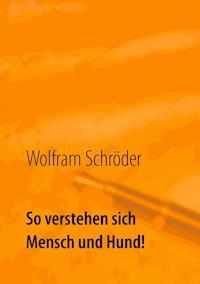
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Es sind die typischen Missverständnisse zwischen Mensch und Hund, die eine artgerechte Erziehung und Haltung Ihres"Familienraubtiers" beeinträchtigen. - Als sein "Rudelchef", können Sie Ihrem Partner Gewohnheiten, Erfahrungen und Gehorsamsleistungen vermitteln, die ihn zu einem wohlerzogenen Hund machen.- Von Ihnen Gewolltes "positiv verstärken" bzw. Nichtgewolltes "negativ verleiden", das entspricht seinem Naturell und ist der Schlüssel zum Erfolg. - Aus der Sicht Ihres Hundes erfahren Sie das "Wie" und "Warum", dass ist das Anliegen dieses Ratgebers für künftige oder ratsuchende Hundehalter. - Die vornehmlich aus Sicht eines Familienhundes geschriebenen Hinweise sind auch für Kinder lesenswert, sie ermöglichen es ihnen, tatkräftig bei der Erziehung und Haltung ihres Lieblings mitzuwirken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Uns Hunde verstehen sowie mit Liebe erziehen, anstatt zu unterdrücken, sei der Menschen Maxime«
Einen ersten Denkanstoß zum vorliegenden Thema erhielt der Autor durch das Buch des Wiener Verhaltensforschers Prof. Dr. Brunner: »Der unverstandene Hund“
Erfahrungen in der „humanen Tierdressur“, bei in Menschenhand aufgezogenen Raubtieren, ermunterten mich zur weiteren Beschäftigung mit diesem Thema.
Speziell das typische Verhaltensmuster des Wolfes, das sich mehr oder weniger bei allen Haushunden wiederfindet, gab Anlass, die Erziehung und Haltung unseres domestizierten Wolfsabkömmlings unter dem Aspekt, „Eines verstandenen Hundes“, zu überdenken.
Der vornehmlich aus der Sicht eines Familienhundes geschriebene Ratgeber ist auch für Kinder lesenswert, er ermöglicht ihnen, tatkräftig bei der Erziehung und Haltung ihres Lieblings mitzuwirken.
Alle Hinweise in diesem Buch sind sorgfältig überprüft und an Familien- und Begleithunden erprobt, erheben aber nicht den Anspruch, der Weisheit letzter Schluss zu sein.
Inhalt
VORBEMERKUNG
M
ISSVERSTÄNDNISSE ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN
P
ARTNERN
S
TATEMENT
MEINE WELPEN-ZEIT
B
EGINN DER KÖRPERLICHEN UND GEISTIGEN
E
NTWICKLUNG
E
RSTE
L
AUTÄUßERUNGEN
P
RÄGUNG UND
S
OZIALISIERUNG
D
IE
B
EIßHEMMUNG
M
EISTERN VON
S
CHRECKSITUATIONEN
P
RÄGUNG DER
F
RESSGEWOHNHEITEN
B
EGINN DER
H
UND
-M
ENSCH
-B
EZIEHUNG
WIE ICH IN MEINE FAMILIE KAM
S
ITUATIONSLERNEN
,
POSITIVE
V
ERSTÄRKUNG
, K
ÖRPERSPRACHE
M
EIN
„
GEMISCHTES
“ R
UDEL
S
OZIALE
R
EGELN
- R
ANGORDNUNG
K
AMPF UM DIE
R
ANGORDNUNG
E
RZIEHUNG ZUM FAMILIENFREUNDLICHEN
S
CHLAFRITUAL
GRUNDERZIEHUNG
M
ISSVERSTANDENE
F
OLGSAMKEIT
„K
OMM
!“ - S
ITUATIONSLERNEN
,
POSITIVE
V
ERSTÄRKUNG
U
NBEDINGTES
K
OMMEN
G
EBRÄUCHLICHE
K
OMMANDOS
LEHRMETHODEN
P
OSITIV VERSTÄRKEN ODER NEGATIV VERLEIDEN
?
K
EINE
Ü
BERFORDERUNG BEIM
L
ERNEN
!
E
RFOLGSERLEBNIS SCHAFFEN UND NUTZEN
!
L
ERNSITUATIONEN
S
PIELERISCH LERNEN
!
I
NKONSEQUENZ
B
ESTRAFEN UND
E
RSCHRECKEN ALS
G
EHORSAMSMOTIVATION
E
RZIEHUNG ZUR
S
TUBENREINHEIT
B
EGRÜßUNGS
-
ODER
A
NGST
-U
RINIEREN
S
TUBENREINHEIT UNTER BESONDEREN
U
MSTÄNDEN
K
AUZWANG UND
M
ETHODEN DES
V
ERLEIDENS
G
EWÖHNEN AN DAS
A
LLEINSEIN
A
BGEWÖHNEN DES
A
NSPRINGENS
F
OLGSAMKEIT
Leinenführigkeit
„Warte!“, „Warte!“ - „Sitz!“
„Lauf!“
„Warte!“ - mit und ohne Leine
Überall folgsam ohne Leine
„Fuß!“ - mit und ohne Leine
„S
ITZ
!“ - „D
OWN
!“
„Sitz!“
„Bleib!“
„Down!“
„Down!“ - „Bleib!“
FLEGELALTER, FREIRÄUME, ZWANG
F
LEGELALTER
V
ERMENSCHLICHUNG
F
REIRÄUME
L
ERNEN UNTER
Z
WANG
E
RZIEHUNGSFLOP
GEHÖR, GERÄUSCHTOLERANZ
W
ACHSAMKEIT
G
ERÄUSCHEMPFINDLICHKEIT
V
ORBILD ALS
M
ETHODE
A
BLENKUNG ALS
M
ETHODE
K
RACH ALS POSITIVE
R
ESONANZ
JAGDVERHALTEN
V
ERHINDERN ODER
A
BGEWÖHNEN DES
N
ACHSETZENS
A
BGEWÖHNEN DES
J
AGENS
LAUT- UND KÖRPERSPRACHE
V
ERSTÄNDIGUNG ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN
P
ARTNERN
L
AUTÄUßERUNGEN
W
ACHSAMKEITSMOTIVATION
K
ÖRPERSPRACHE
Körpersignale und ihre Bedeutung
Neutrale Haltung
Ängstliche Haltung
Freundliche Unterwürfigkeit
Freundliche Haltung
Aggressive Haltung
Imponierhaltung
„Ich bin Dir gut gesinnt!“ – „Tu mir bitte nichts!“
„Tu mir bitte nichts, sonst muss ich mich wehren!“
GRUNDBEDÜRFNISSE
V
OLLWERTIGES
F
RESSEN UND
F
RESSGEWOHNHEITEN
Proteine
Gesunde Zähne durch angepasste Ernährung
Kohlenhydrate
Fette
Vitamine
Mineralstoffe
Fertigfutter
Wie ich das Betteln lernte
Fressgewohnheiten, Fresskultur, anerzogenes Fressverhalten
Futterauswahl
Gefährliche Magendrehung
K
ÖRPERPFLEGE
Fellpflege
Wasserscheu, Temperaturregulation, Baden
WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN!
Z
WEITHUND
– „L
UZI
“
H
UND UND
K
ATZE
W
ELPENSCHUTZ
?
B
EIßHEMMUNG GEGENÜBER
M
ENSCHEN
H
UND UND
K
INDER
M
IT DEM
H
UND IN DEN
U
RLAUB
Ü
BERNAHME EINES
H
UNDES MIT
V
ERGANGENHEIT
A
LTERNDER
H
UND
QUELLENNACHWEIS
WEITERE BUCHTITEL DES AUTORS
„G
ESUND
&
FIT IM BESTEN
A
LTER
“
D
IE
O
LYMPISCHEN
S
PIELE IN DER
A
NTIKE
»A
LS
G
EHEIMNISTRÄGER IM
V
ISIER DER
S
TASI
«
Vorbemerkung
Missverständnisse zwischen unterschiedlichen Partnern
Angesichts meines teuflischen Aussehens erhielt ich den Namen „Düwel“, wie im Niederdeutschen der Teufel genannt wird. Und zum Teufel könnt ich werden, wenn ich mit ansehen muss, wie schlecht sich Mensch und Hund bisweilen verstehen:
Da ruft Herr Meier seinen Hund. Er pfeift, benutzt dessen Namen, wütend schreit er sogar: Sein Hund kommt nicht, jedenfalls nicht jetzt, wenn Herr Meier es will.
Nach einer Weile kommt er doch. Er schleicht, Schwanz eingeklemmt, Ohren angelegt, fast auf dem Bauche kriechend, reumütig zu seinem Herrchen. Dessen Reaktion kennt er bereits: Es sind dies harte Worte, oft sogar Schläge.
Die reumütigen Gebärden seines endlich näherkommenden Hundes missversteht Herr Meier als schlechtes Gewissen. „Ja, Herr Meier, wissen Sie denn nicht, dass wir Hunde gar kein Gewissen haben, jedenfalls keins in Ihrem, dem menschlichen Sinne?
Wir handeln nicht im Sinne von ‚Gut’ oder ‚Böse’, sondern sind um des lieben Friedens willen bemüht, alles richtig zu machen. Es entspricht vielmehr unserer Überlebensstrategie, das Wohlgefallen unseres Partners zu bewahren.
Der Hund unserer Nachbarin, Frau Krause, ist sehr wachsam. Er bellt, sobald jemand an der Haustür klingelt. So weit, so gut. Bittet Frau Krause den Gast herein, bellt er beharrlich weiter, lässt sich keinesfalls durch ihr lautes, verärgertes „Aus!“, „Bist du still!“ o.a. beruhigen.
„Frau Krause, der Ton macht die Musik! – Je lauter und drohender Sie in dieser Situation selbst die nettesten Dinge zu Ihrem Hund sagen, desto mehr empfindet er den Besuch als Gefahr.
Wie soll mein Artgenosse wissen, dass Ihr aggressives Getue ihm und nicht dem Gast gilt. Im Gegenteil, Ihr Hund bellt umso mehr, weil er Sie beschützen will.“
Herr Wilhelm möchte seinen Hund apportieren lassen. Deutlich sichtbar wirft er einen Stock, freut sich, weil Nero den Stock holt, sogar damit in seine Nähe kommt. Doch mehr passiert nicht. Nero kommt zwar näher, aber sobald Herr Wilhelm den Stock ergreifen will, läuft sein Hund wieder davon.
Beide missverstehen sich: Herr Wilhelm denkt, sein junger Hund kann bereits von Geburt an apportieren. – Stattdessen hat Nero das für uns Hunde typische Spiel: „Fang mich, ich hab’ eine Beute!“, im Sinn.
Frau Lehmann kaufte sich einen großen, kräftigen Hund, der Haus und Hof bewachen soll. Um alles richtig zu machen, betraut sie einen Hundetrainer mit dessen Erziehung. Der Hund pariert bestens, jedenfalls bei seinem Trainer – nicht aber bei Frau Lehmann.
Sofort erkennt der Hund in ihr die schwache Frau. Eingestellt auf das konsequente, energische Einwirken seines Trainers, entwickelt er bei ihr eine Dominanz, deren sie nicht Herr wird.
Herr Müller ist fest davon überzeugt, sein Hund könne genauso denken wie er. Äußert sich dieser doch mit anhaltendem Winseln, Trampeln oder Bellen, bis ihm sein jeweiliger Wunsch erfüllt wird. Das kann die Aufforderung zum Spaziergang, das Erbetteln von Futter oder anderes von ihm Gewolltes sein.
„Dieser Hund weiß genau, wann er mit seinen Allüren Erfolg hat. Einmal ausprobiert: Herrchen reagiert in seinem Sinne! – So etwas lernen wir am schnellsten.“
Herr Jähzorn ist stolz auf seinen „disziplinierten“ Hund. Auf Pfiff kommt dieser sofort, folgt auf „Sitz!“, „Platz!“ u.a. Unterwerfung fordernde Kommandos. Allerdings spürt sogar jemand, der wenig mit unserer Wesensart vertraut ist, die totale Unterwürfigkeit dieses Hundes, der alle Zwangsmaßnahmen der „Hundeerziehung“ kennen lernen musste. Er kommt und sitzt wie ein „Jammerlappen“, bei „Platz!“ liegt er in Demutshaltung auf dem Rücken.
„Dieser Hund wurde zum absoluten Untertan, wünschen Sie einen solchen, dann habe ich Ihnen nichts zu sagen!“
Statement
Mögen Sie es mir vorlautem Hund verübeln, trotzdem mache ich die Herrschaften Meier, Krause, Wilhelm, Lehmann und Müller darauf aufmerksam, selbst an den geschilderten Missverständnissen schuld zu sein. Schließlich zählen sie zu den vernunftbegabten Wesen dieser Erde und sollten wissen, dass wir nicht von ihrer, sondern von anderer Art sind und gemäß diesem Unterschied, möchten wir behandelt werden.
Andererseits können Sie nicht von uns verlangen, dass wir Sie als von anderer Art wahrnehmen, bleibt uns doch die vom Menschen benutzte Unterteilung nach Arten fremd. Wir betrachten die Menschen eher als Gleichartige, bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit, sich als ranghöher zu etablieren, uns in Ihrem Sinne zu beeinflussen. Dies umso müheloser, je mehr Sie unser Naturell beachten oder versuchen, unser Handeln aus der Perspektive unserer Wesensart zu verstehen. – Nur so wird es Ihnen möglich sein, uns artgerecht zu behandeln!
Das Zusammenleben von Mensch und menschenfreundlichen Wölfen mag vor vielen tausend Jahren weniger Probleme bereitet haben. Beide Arten besaßen in dieser Zeit offensichtlichere Gemeinsamkeiten: Als Fleischfresser verbanden Wolf und Mensch gleiche Interessen, nämlich erfolgreich zu jagen sowie sich und ihre Beute zu verteidigen.
Inzwischen veränderten sich die Menschen, machten große Teile der Natur inklusive des einstigen Partners Wolf für sich nutzbar. Das Ergebnis sind unter anderem wir, die Hunde, denen sie jedoch grundsätzliche Verhaltensweisen des Wolfes nicht restlos wegzüchten konnten.
Vergessen Sie deshalb nie, Ihr heutiger Partner ist keineswegs nur Kuscheltier, sondern ein mehr oder weniger soziales Raubtier. In uns wirken vom Wolf überkommene Anlagen: „Ein ausgeprägtes Sozialverhalten sowie die Tendenz zum Jagen.“
Das für uns charakteristische Sozialverhalten ist Ihnen sicher ohne Abstriche willkommen. Relativ komplikationslos können Sie uns in Ihre Familie einbeziehen sowie mit Sachverstand einen Großteil der uns überkommenen Fähigkeiten nutzen.
Problematischer sind die uns verbliebenen Raubtiereigenschaften, wie beispielsweise einzelne Abfolgen wölfischen Jagdverhaltens, die Ihnen in der heutigen Zeit Ärger bereiten könnten. Je nach Rasse und Temperament neigen wir dazu, Beutetiere zu suchen, uns an sie heranzupirschen, sie aufzuscheuchen, ihnen nachzusetzen. Damit geben wir uns für gewöhnlich zufrieden. Schlimmer wird es, sollten wir wirklich Beute machen, indem wir ein Tier töten, es sogar fressen. Eigentlich Handlungen, die gar nicht nötig sind, weil wir unser Fressen von Ihnen bekommen.
Was ich hier so eindringlich nenne, soll Sie keineswegs von einer Partnerschaft mit unseresgleichen abhalten. Vielmehr weist es darauf hin, worauf Sie sich mit uns einlassen, wann Sie erzieherisch eingreifen müssen. – Ihren Familienhund seine Raubtiereigenschaften nicht ausleben zu lassen, ist durchaus möglich, jedoch auf das „Wie“ der Einflussnahme kommt es an!
Kraft Ihrer Überlegenheit könnten Sie uns mittels unzeitgemäßer Methoden alles verleiden: Endergebnis, ein völlig unterdrücktes und frustriertes Wesen, aber kein richtiger Hund.
Gehen Sie stattdessen davon aus, dass wir im Sinne des Wohlbefindens die uns angeborenen Fähigkeiten ebenso ausleben möchten, wie Sie die Ihren, dann könnten wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen:
Wie auch Sie, erwachen wir morgens tatendurstig. Ausgeruht möchten wir unser aufgestautes Aktivitätsquantum abreagieren was ursprünglich bedeuten konnte, zur Nahrungsbeschaffung auf die Jagd zu gehen. Denn eben das taten Ihre prähistorischen Vorfahren mit uns. Anstelle dessen bestreiten Sie heute Ihren Lebensunterhalt mit ganz anderen Tätigkeiten. Ebenso erlernten wir, die domestizierten Wölfe, uns mit vergleichbaren Ersatzhandlungen zufrieden zu geben.
Beim Spaziergang befinden wir uns mit Ihnen auf der Pirsch, so will es die uns eigene Erfahrungswelt. Dabei muss das Ziel nicht unbedingt ein Elch, Reh, Häschen oder Fasan sein. Handeln Sie als unser „Rudelführer“, dann hetzen wir mit gleichem Eifer einen geworfenen Stock, erbeuten ihn und falls Sie uns dazu erzogen haben, bringen wir Ihnen diesen zurück. In der Endphase des Spiels lassen Sie uns den Stock als Beute nach Hause tragen; dort verzehren wir nicht den erbeuteten Stock, dafür aber das Futter, das Sie für uns bereitstellten.
Solche und ähnliche Bräuche, spielerische Hundebegegnungen, Joggen, Laufen am Rad usw. können unser tägliches Aktivitätsquantum ausreichend beanspruchen, worauf Sie ein friedliches, weil glückliches „Raubtier“ besitzen, dem Sie so nebenbei Verhaltensweisen anerziehen, die Ihren modernen Lebensumständen entsprechen.
Verstehen Sie unsere Fähigkeit zu lernen als eine artspezifische „Intelligenzleistung“ Ihres Hundes, dem seine ererbten Instinkte oder Verhaltensweisen keinesfalls genügen, um in allen Situationen des heutigen Alltags überlebensfähig zu sein. Nach Hundeart sind die Alttiere des Rudels unsere Lehrmeister; weil wir aber bereits im Alter von acht Wochen in Ihre Hände gelangen, sind Sie und Ihre Familie für unsere Erziehung verantwortlich.
Bemühen Sie sich deshalb, unser „Alpha-Tier“, unser Vorbild zu sein, das uns zu jeweils „richtigem“ Handeln motiviert. „Richtig“ ist dabei überwiegend menschlich geprägt, da Sie von ihrem Hund erwarten, dass er komplikationslos inmitten der Menschen lebt.
Fazit : Erziehung und Haltung nach unserer, also Hundeart, beinhaltet ein möglichst geregeltes Ausleben angeborenen Fähigkeiten und Verhaltensweisen in Formen, die ein konfliktfreies Zusammenleben mit Menschen in einer von ihnen beeinflussten Umwelt ermöglichen.
Wie bereits bemerkt, auf das „Wie?“ kommt es an. In meiner teils autobiografischen Darstellung will ich auf eine uns gemäße Erziehung sowie die für beide Seiten befriedigende Haltung als Familien- und Begleithund aufmerksam machen.
Meine Welpen-Zeit
Bevor Sie einen Welpen in Ihre Familie aufnehmen, sollten Sie unbedingt wissen, was dieser bisher erlebte, ehe er in Ihre Hände gelangt. Es sind ausgerechnet die ersten Lebenswochen, die einen Hund für das ganze Leben prägen. Entwicklungen, für die ein Menschenkind Jahre braucht, durchläuft er in Wochen und Monaten. In seinem ersten Lebensjahr absolviert er immerhin den Reifeprozess eines 14jährigen Kindes.
Einen beachtlichen Teil dieser entscheidenden Zeit, nämlich die ersten acht Wochen seines Lebens, verbringt der Welpe im Zwinger, den Sie sich vor dem Kauf sorgfältig ansehen sollten. Dabei erfahren Sie, ob Ihr Welpe unter bestmöglichsten Bedingungen aufwächst und was Sie noch durch Erziehung und Haltung vervollkommnen können.
Beginn der körperlichen und geistigen Entwicklung
„Er erblickte das Licht der Welt!“ – Diese menschliche Floskel trifft für die Geburt eines Hundes nicht zu. Vielmehr kommen wir blind, taub und nur zu unbeholfenen Bewegungen fähig, als hilfsbedürftige Wesen zur Welt. Ursächlich dafür ist das vom Wolf übernommene Trächtigkeitsverhalten unserer Mutter.
Ein solches Trächtigkeitsverhalten der Raubtiere steht ganz im Gegensatz zu dem der Fluchttiere, wie etwa Pferde, Schafe, Ziegen, Antilopen oder Zebras. Jene werden in der Regel als Einzelkinder geboren, wodurch sie im Körper der Mutter eine Reife erlangen, die es ihnen ermöglicht, nach der Geburt schnellstmöglich fluchtfähig zu sein.
Stattdessen kann es sich eine Raubtiermutter leisten, ihren Nachwuchs an einem verborgenen Ort auf die Welt zu bringen und dort relativ gefahrlos aufzuziehen. Das erlaubt beispielsweise einer Wölfin den zur Arterhaltung notwendigen Vorteil, mehrere Welpen in die Welt zu setzen und trotzdem bis kurz vor der Geburt noch ausreichend beweglich, daher zum Beutemachen fähig zu sein.
Als weitere im Laufe der Evolution entstandene Zweckmäßigkeit kommt ihr jetzt die Unbeholfenheit der Welpen zur Hilfe. Diese bleiben in ihrer Abwesenheit an das Wurfnest gebunden. Mehr noch, eng aneinander gekuschelt schlafen sie zumeist in aller Ruhe und selbst ein auffallender Körpergeruch, der sie an eventuelle Feinde verraten könnte, fehlt in diesem Lebensabschnitt.
Bisweilen wundern sich die Besitzer einer Hündin, die nicht zur Geburt weggesperrt wurde, über deren Verschwinden. Diese folgt einzig dem von ihrem Urahn übernommenen Verhalten, sich zur Geburt an einem ruhigen Ort zu verbergen. Erst von Hunger und Durst getrieben, verlässt sie nach Stunden bis Tagen völlig geschwächt ihren Unterschlupf.
Bei einem Züchter oder anderen mit der Zucht Vertrauten sollte das nicht passieren. Diese unterstützen die werdende Mutter, indem ihr ein Wurfnest in ruhiger Umgebung angeboten sowie Wasser und Futter bereitgestellt wird.
In den ersten zwei Lebenswochen hat es den Anschein, als seien wir die reinsten Faulpelze. Außer schlafen, saugen, ausscheiden und wachsen passiert offensichtlich gar nichts. Unser Verhalten scheint ausschließlich vom Instinkt gesteuert; wir hören und sehen nichts, sondern erspüren nur das zurzeit für uns Notwendige.
Doch der äußere Schein trügt, bereits von Geburt an lernen wir. Erblich bedingt steckt in uns eine Vielzahl art- und rassespezifischer Veranlagungen. Es sind dies genetische Vorgaben unserer Vorfahren, die trotz Jahrtausende dauernde Domestikation sowie Züchtung der unterschiedlichsten Rassen zu einem großen Teil auf den Wolf zurückgehen. Erst durch die Anforderungen des Lebens geweckt, offenbaren sich diese Veranlagungen als Verhaltensweisen und charakterliche Merkmale.
Unmittelbar nach der Geburt verfügen wir bereits über einen einigermaßen funktionstüchtigen Geruchssinn. Er hilft uns eine der Milchzitzen zu finden, die unsere Mutter uns anbietet, indem sie sich zum Säugen auf die Seite legt. Instinktiv, nämlich durch pendelnde Suchbewegungen mit dem Kopf, erspüren wir eine Milchzitze. Dieses angeborene Kopfpendeln gehört zu den genetischen Veranlagungen, die uns schneller oder überhaupt an eine Zitze gelangen lassen. Völlig unsinnig wäre dagegen der Versuch, „zielgerichtet“ geradewegs ins Leere zu stoßen.
Das durch den Hunger ausgelöste Erfolgserlebnis führte zu einer ersten wohltuenden Erfahrung: „Knurrt Dein Magen, musst Du aktiv werden!“ Bald lernten wir, dass es von Vorteil ist, rasch an eine prall gefüllte Zitze zu gelangen, wobei wir im Wettstreit mit unseren Geschwistern stehen.
Uns fügend, reagieren wir auf das erzieherische Einwirken unserer Mutter, der ein allzu heftiges Saugen und Strampeln lästig ist. Diese ersten Erfahrungen setzten den Lernprozess in Gang, der uns dereinst zu einem lebenserfahrenen Hund macht. Besonders in den ersten Lebenswochen führen artspezifische Erfahrungen zu unauslöschlichen Lernergebnissen, die lebenslang unser Wesen, wie unsere Handlungsweise prägen.
Als ersten sozialen Kontakt nehmen wir wahr, wie unsere Mutter uns mit ihrer Zunge säubert und streichelt, wie wir gemeinsam mit unseren Geschwistern im Welpennest kuscheln und uns gegenseitig wärmen. Letzteres ist für unser Wohlbefinden sehr wichtig, weil unser Körper sich in diesem Lebensabschnitt erst darauf einstellen muss, seine Temperatur selbständig zu regulieren. Es wäre aber falsch, Welpen aus übertriebener Vorsicht vollklimatisiert aufwachsen zu lassen. Vielmehr sollten wir gezwungen sein, uns aktiv einen wärmenden Platz in der Menge zu sichern. Denn jeder Stress, der anpassungsfördernde Aktivitäten auslöst, ist in diesem Alter ein nachhaltiger Entwicklungsreiz.
Auf der Suche nach Wärme robben wir instinktiv in halbkreisförmigen Bewegungen. Stur geradeaus, bei falscher Richtung, wäre hier ebenso unsinnig, wie bereits bei der Suche nach einer Milchzitze beschrieben. Dabei lernen wir, nachdem wir bereits den Kopf heben und pendeln können, unsere Vorderbeine zu gebrauchen. Dieses motorische Lernen koordiniert weitere Muskelfunktionen. Es folgt die Rumpfmuskulatur und erst danach die der hinteren Extremitäten. Aus einem unbeholfenen Robben entwickelt sich allmählich ein gekonntes Krabbeln.
Übrigens : Durch motorische und geistige Lernprozesse verknüpfen sich im Zentralnervensystem die Nervenzellen. Dies umso mannigfaltiger, je mehr wir in der weiteren Entwicklung geistig wie körperlich gefordert werden. Je zahlreicher diese Verknüpfungen, umso besser können wir uns der Umwelt anpassen sowie neue Situationen erfolgreich meistern.
Erste Lautäußerungen
Geraten wir aus dem Kreis der Nestwärme, lassen wir in dieser Notsituation erste Lautäußerung vernehmen: Normalerweise ist Ruhe im Welpennest. Alle liegen aneinander gekuschelt und wärmen sich gegenseitig oder werden von ihrer Mutter gewärmt. Werden wir durch eines unsere Geschwister oder einer Bewegung unserer Mutter im Schlaf gestört, dann lassen wir einen leisen Muck-Laut hören. Dieser wird jedoch von keinem ernst genommen. Unsere Mutter erkennt an diesem Laut lediglich eine harmlose Unzufriedenheit.
Geben wir Murr-Laute von uns, die sich wie mehrere vibrierende „M“ anhören, dann ist bereits ein größeres Unbehagen im Spiel. Jetzt reagiert unsere Mutter, indem sie sich um den murrenden Welpen kümmert. Er könnte unbequem liegen oder ein Geschäftchen machen wollen. Letzteres vermag er im Interesse der Nestsauberkeit noch nicht alleine; deshalb massiert die Mutter mit der Zunge sein Bäuchlein, worauf er sich entleert. Sogleich beseitigt seine Mutter die Verunreinigung.
Fiep-Laute geben wir als Schreckenslaute von uns oder, wenn wir in großer Not sind. In dem jetzigen Entwicklungsstadium ist es meistens die ernst zu nehmende Gefahr des Unterkühlens. Unsere Mutter reagiert augenblicklich darauf. Hat ein Welpe sich aus dem Nest entfernt oder ist herausgefallen, dann bringt sie ihn schnell wieder zurück. Fiepen alle Welpen in ihrer Abwesenheit, ist Hunger oder Kälte die Ursache. Je stärker das Unbehagen, desto intensiver das Fiepen; sogar Menschen erkennen es als bedrohliche Situation. Die Hundemutter unterstützend, greift jetzt ein guter Züchter ein. Dies ist für unsere Prägung auf den Menschen sehr wichtig, erfahren wir doch: „Aha, da ist noch jemand, der sich um uns kümmert!“ Riechend und tastend erleben wir den ersten Kontakt zu einem artfremden Wesen.
Übrigens : Die hier noch nach ihrer Wahrnehmung benannte Nestwärme vervollständigt sich im übertragenen Sinne zu einem Moment des außergewöhnlichen Sozialverhaltens, das Sie erkennen und für die Einflussnahme auf Ihren Hund nutzen sollten. Sie werden feststellen, wie sehr dieser Ihre Nähe, Streicheleinheiten, Lobe, Leckerli und weitere Freundschaftsbeweise als Ersatz für die Nestwärme in der Hundemeute benötigt. Alles zur rechten Zeit gewährt, dankt er es Ihnen durch seine besondere Anhänglichkeit sowie durch die Chance, die in ihm schlummernden Fähigkeiten müheloser entwickeln zu können.
Obwohl unsere Ohrkanäle noch verschlossen sind, nehmen wir bereits erste Laute war. Kommen diese geräuschvoll und unvermittelt, können sie sogar Schrecken auslösen. Mit diesem fertig zu werden, ist ebenso wichtig, wie auf Schmerzen, Temperatur und sonstige Empfindungen zu reagieren. Für uns sind dies weitere Stresssituationen, die wir möglichst erfolgreich meistern sollten, damit sie unserer Vorbereitung auf das Leben in einer Welt voller Gefahren förderlich sind. – Wohlbehütet, ohne stressige Umwelteinflüsse aufzuwachsen, wäre nur hemmend für unsere weitere Entwicklung. Im Gegenteil, jede noch so kleine Auseinandersetzung mit der Umwelt, sei es eine Aktivität zum Stillen des Hungers, zur Wärmeregulation oder des Kompensierens von Schmerzen und Schrecken, bereitet uns auf das spätere Leben vor. Aufzuchtbedingungen, die wohldosierten, also entwicklungsfördernden Stress beinhalten, garantieren Ihnen einen Welpen, den Sie später zu einem der Umwelt angepassten, wohlerzogenen Hund weiterentwickeln können.
Mit jedem Tag nehmen wir an Gewicht zu, werden kräftiger und geistig reger. Der Hunger treibt uns zu einem Gerangel an Mutters Zitzen. Bei diesem Gedränge um den besten Platz an der Quelle köstlicher Muttermilch beginnt sich zu entscheiden, wer von dem Wurf einmal zu den Stärkeren, Dominanteren gehört oder wer ein zurückhaltendes, aber dennoch liebenswertes Nesthäkchen bleibt.
Nach etwa zwei Wochen öffnen sich unsere Augen, zudem hören wir Geräusche jetzt deutlicher. In der folgenden Woche entwickelt sich unsere Seh- und Hörfähigkeit soweit, dass unser Leben jetzt interessanter wird. Die Umgebung nehmen wir inzwischen bewusster wahr und lassen uns von ihr beeinflussen. Unser Schlafbedürfnis verringert sich, so dass eine verstärkte Aufmerksamkeit nunmehr vor allem unserer Mutter, den Geschwistern aber auch in zunehmendem Maße der weiteren Umgebung gilt. Dies leitet die Präge- und Sozialisierungsphase ein, in der wir uns an den Menschen, andere Lebewesen sowie weitere Umwelteinflüsse gewöhnen.
Prägung und Sozialisierung
Alles was uns möglich ist, probieren wir in der dritten bis achten Lebenswoche aus. Jetzt sind wir keine hilflosen Babys mehr, unsere Sinnesorgane entwickelten sich vollends. Bewusst nehmen wir riechend, hörend und sehend die Umgebung wahr. In dieser Lebensphase verhalten wir uns allen Umweltreizen gegenüber besonders aufgeschlossen, erlernen sämtliche für unsere Art typische Gangarten und vergrößern dadurch unseren Aktionsradius. Unser Horizont weitet sich jetzt über den Nestrand hinaus, wir erkunden neugierig die weitere Umgebung. In unseren Geschwistern entdecken wir die Spielkameraden. Sie und unsere Mutter wandeln sich von der einst willkommenen Wärmequelle, zur Begegnung mit der eigenen Art.
In der 4. Lebenswoche stellen wir verwundert fest, dass es außer uns noch andere Lebewesen gibt. Es ist dies zuerst unser Züchter, der jetzt öfter nach dem Rechten sieht. Der uns – und das macht ihn zu einem Vertrauten – ähnlich wie die Mutter streichelt, uns mit einschmeichelnden, ruhigen Worten bedenkt sowie für die Reinhaltung des Welpennestes sorgt. Dies ist ein erster bewusster Kontakt mit einem Menschen, den ein guter Züchter so oft wie möglich gewährt, wodurch er unsere Prägung im Sinne einer freundschaftlichen Einstellung zum Menschen einleitet.
Betrachten Sie die Prägung wie die Sozialisierung als einen intensiven sowie für das ganze Leben entscheidenden Lernprozess, der uns besonders in der Zeit bis zur zwölften, maximal vierzehnten Lebenswoche mit Artgenossen, anderen Tieren, Menschen, Situationen und Gegenständen so vertraut macht, dass diese uns im späteren Leben weder fremd noch bedrohlich vorkommen. Je eindrucksvoller und umfangreicher dieser Lernprozess verläuft, umso günstiger ist dies für unser späteres Verhalten in einer mit Reizen überfluteten Umwelt.
Mich treibt die Neugierde, die durch eine interessante Umgebung befriedigt wird und meinen Lernprozess beschleunigt. Vorsichtig zwar, noch unter Obhut des Rudels, versuchte ich alles Neue zu ergründen und festzustellen, ob es Gefahr in sich birgt oder nicht. Es kommt meiner Entwicklung zugute, wenn ich in der Präge- und Sozialisierungsphase so viel wie möglich kennen lerne. Mein so erworbener Erfahrungsschatz ermöglicht es mir später, Unbekanntem toleranter zu begegnen, auf Erstmaliges weniger schreckhaft zu reagieren! Eben deshalb sollte ein Welpe mit einer Vielfalt abwechslungsreicher Umwelteinflüsse konfrontiert werden.
Auf Unbekanntes, das ein Welpe in diesem Lebensabschnitt nicht kennen lernt, reagiert er später womöglich mit Flucht oder Aggression, ein für wildlebende Tiere durchaus zweckmäßiges Verhalten, das sie vor Gefahr bewahrt. Bei Hunden ist dieses Verhalten zumeist unangebracht, da sie in der Obhut des Menschen weniger Gefahren ausgesetzt sind, aber durch Schreckhaftigkeit und Panikreaktionen selbst zur Gefahr werden können.
Die Beißhemmung
In der 4. bis 5. Lebenswoche beherrscht uns eine für diese Entwicklungsphase typische Aggressivität. Es ist dies eine mehr spielerische Angriffslust, die sich vor allem gegen die eigenen Geschwister richtet und unsere Mobilität steigert. Wir balgen miteinander, lernen unsere Bewegungen besser zu koordinieren. Dieses evolutionär begründete Verhalten bereitet uns spielerisch auf Auseinandersetzungen mit widrigen Lebensumständen vor.
Beim Streit mit den Geschwistern erlernen wir die Beißhemmung. Diese ist erforderlich, um bei Kämpfen nicht zu verletzen, denn bald bekommen unsere Auseinandersetzungen einen sozialen Charakter; es geht ums Fressen, um ein Spielzeug oder um den „Platz an der Sonne“. Dabei hält sich unsere Aggressivität in Grenzen; wie jedes normale Tier gehen auch wir nicht bis zum Äußersten, eine Beschädigung des eigenen und des anderen Körpers vermeidend. Dementsprechend ritualisiert sich das Beißen zu einer gefühlvollen, nicht verletzenden Handlung, solange es um deren spielerische Variante geht. Wir beißen in diesem Fall mit „weichem“ Fang.
Das Ritual der Beißhemmung ist also keineswegs angeboren, sondern wird erst im Spiel mit Artgenossen als soziale Regel erlernt! Aus gutem Grund rüstete die Natur uns zuerst mit einem Arsenal nadelspitzer Zähne im weichen Zahnbett aus. Beißt ein Übereifriger zu heftig, lässt sein Gegner ihn dies durch klägliche Laute sowie durch seine Körpersprache wissen. Wir erlernen so das Maß des ungefährlichen Zubeißens, eben die Beißhemmung.
Überdies zwingt uns das noch weiche Zahnbett ohnehin zur Beißhemmung; darum sollten auch Sie Ihrem Welpen in dieser Entwicklungsphase keine Zerrspiele aufzwingen, die sein Zahnbett verletzen oder deformieren könnten!
Meistern von Schrecksituationen
Ab der 5. bis 6. Lebenswoche lernen wir Angst zu empfinden. Dies hat die Natur so „eingerichtet“, weil wir jetzt nach mehr Bewegungsfreiheit streben und damit größeren Gefahren ausgesetzt sind. Jede neue Wahrnehmung verarbeiten wir in dieser Zeit besonders intensiv und erhalten demzufolge bleibende Eindrücke positiver oder negativer Art; wir sammeln weitere Erfahrungen.
Sind wir in dieser Zeit negativen Wahrnehmungen ausgesetzt, wie z.B. lauten Geräuschen oder Schrecksituationen, dann verarbeiten wir diese in der Gemeinschaft des Welpenrudels sowie unter Obhut unserer Mutter ohne bleibende Angstgefühle. Ein Gewitter, ein Feuerwerk, ein umfallender Besen oder anderes erscheint uns nicht so schrecklich, solange die Geschwister sowie unsere Mutter sich davon unbeeindruckt zeigen. Solche typischen Schrecksituationen verarbeitet ein Welpe unter diesen Umständen positiv, die Erfahrung: „Nicht beängstigend!“ prägt sich ihm ein.
Was den Kontakt zum Menschen anbelangt, kann es sich im täglichen Leben verheerend auswirken, wenn Hunde in einem „mehrbeinigen“ Menschen eine Gefahr sehen, weil sie in der Präge- und Sozialisierungsphase niemand kennen lernten, der auf einem Stock oder Krücken laufen muss. Ähnlich kann es ihnen bei Menschen mit anderer Hautfarbe oder auffälligen Gebrechen gehen, sie weichen ihnen aus oder reagieren ängstlich bis aggressiv.
Überraschend für diesbezüglich schlecht vorbereitete Hunde kann es ebenfalls sein, kommt plötzlich jemand um eine Mauerecke oder aus einer Haustür gerannt, taucht aus einem Gully-Schacht auf oder springt von einem Baum herunter.
In solchen Situationen ist ein unzureichend vorbereiteter Hund naturgemäß von Angst beherrscht, dagegen reagiert ein gut sozialisierter lediglich mit einer Vorsicht, die ihn im Überraschungsmoment zurückweichen, dann aber gelassen reagieren lässt, falls er bereits in ähnlichen Situationen positive Erfahrungen sammeln konnte oder seine Bezugsperson sich entsprechend verhält. – Denn wie von unserer Mutter gewohnt, erwarten wir dereinst von unserer Bezugsperson eine der Situation angepasste Reaktion. Strömt diese Person Ruhe aus, überträgt sich das auf uns, es prägt sich ein: „Kein Grund zur Aufregung, der Chef hat ebenfalls keine Angst!“
Reagiert jedoch unsere Bezugsperson aus gutem Grund mit Angst oder Schrecken, dann weckt dies bei einem gut sozialisierten Hund das Abwehrverhalten, unsere Veranlagung zur Rudelverteidigung. Ein erwachsener Hund wird Ihnen in solchen Situationen mutig zur Seite stehen; erwarten Sie das aber bitte noch nicht von ihrem Welpen!
Wenn der Welpe bei Ihnen aufwächst, orientiert er sich an Ihrem Vorbild. Lässt eine Schrecksituation Sie offensichtlich unbeeindruckt, dann empfindet er diese ebenfalls als nicht beängstigend. Ihn aber in Schrecksituationen durch Worte und Gesten beruhigen zu wollen, wäre absolut falsch – sich ungerührt zeigen weit besser. Letzteres entspricht dem Verhalten der Hundemutter in ungefährlichen Schrecksituationen.
Um es noch einmal zu bekräftigen : Die beste Zeit für die Gewöhnung an alle möglichen Lebenssituationen ist die Präge- und Sozialisierungsphase. Je mehr gewöhnliche wie ungewöhnliche Erlebnisse Sie ihrem Welpen in dieser Zeit vermitteln, desto unbeeindruckter wird er beim Verarbeiten immer neuer Ereignisse sein. Deshalb sollten Sie Ihrem Welpen, nachdem Sie ihn aus dem Zwinger holten, weitere umfangreiche Menschen-, Hunde-, Tier- und Umweltkontakte vermitteln. Diese weiterführende Prägung und Sozialisierung ermöglicht es ihm, nicht nur Menschen als „Artgenossen“ zu akzeptieren, sondern auch andere Lebewesen.
Beherrscht und offensichtlich ohne Angst sollten Sie Situationen begegnen, die Ihr Hund nicht als Gefahr ansehen muss. Als Ihr „Gefolgsmann“ sieht er zu Ihnen auf, orientiert sich an Ihrem Verhalten!
Bedenken Sie : Von Haus aus sind wir vorerst mit den Lebensvoraussetzungen eines Welpen, ja eines Wildtieres ausgestattet. Trotz der über Jahrtausende währenden Domestikation müssen wir lernen, uns an die Bedingungen der Umwelt anzupassen. Wobei die heutige Umwelt schon lange nicht mehr die ist, die die Zähmung vom Wolf zum Hund begleitete. Besonders im vorigen Jahrhundert haben sich die Umweltbedingungen so weitgehend von allem Ursprünglichen entfernt, dass selbst der verstandesmäßig orientierte Mensch damit Probleme bekommt. Immerhin ist sein Habitus ebenfalls noch der eines Jägers und Sammlers, so wie er es war, als Mensch und Wolf Freunde wurden.
Als Mensch sind Sie vom Verstand her in der Lage, sich den veränderten Umweltbedingungen anzupassen; Ihrem Hund sollten Sie bei dieser Anpassung hilfreich zur Seite stehen: „Wo gab es zum Beispiel früher diese gefährliche Verkehrsdichte?“
Damals mussten meine Vorfahren sich vor stärkeren Tieren genauso in Acht nehmen, wie ich es heute im Verhalten zu den Verkehrsmitteln lerne. – Heutzutage servieren Sie Ihrem Hund das Futter. Als Äquivalent für das dadurch entfallende Beutemachen bleibt ihm ein ausgiebiger Spaziergang mit vielen spielerischen oder erzieherischen Aktivitäten. Bei solchen Spaziergängen lernt er die unterschiedlichsten Hunde kennen, mit denen er Kontakte knüpft und pflegt, anstatt wie ein Wolf sein Revier zu verteidigen. Dabei lernt er seine Ausdrucksmöglichkeiten zu vervollkommnen und die der anderen Hunde zu verstehen – nur so ist ein friedliches Miteinander möglich.
Ihr Hund wird in seinem ereignisreichen Hundeleben eine Vielfalt an Freiheiten genießen können, wenn er ausreichend lernt, sich bereits im Welpenalter erfolgreich mit Alltagssituationen auseinander zu setzen. Dies als Ergebnis einer artgerechten Entwicklungsmöglichkeit im Zwinger, die durch eine weiterführende Erziehung und Haltung in Ihrer Familie fortgesetzt wird.
Prägung der Fressgewohnheiten
Die Milch unsere Mutter enthält nicht nur Energie- und Aufbaustoffe, sondern zugleich Vitamine und Antikörper, die uns wochen- bis monatelang vor Krankheiten schützen. Sobald wir unsere ersten Zähne bekommen, können wir breiiges, später festeres Futter fressen.
Was wir in dieser Zeit zu fressen bekommen, bevorzugen wir auch später, es prägen sich unsere Fressgewohnheiten. Zweckmäßig ist es, uns bereits im Zwinger an Trockenfutter zu gewöhnen, das speziell für die Welpenaufzucht hergestellt wird. Um den wachstumsfördernden Proteinanteil zu erhöhen, erhalten wir zusätzlich etwas Schabefleisch oder andere Echtfleischgaben. Wie Sie später erfahren, ist es überaus sinnvoll, diese Fütterung mit Trockenfutter beizubehalten, Echtfleischgaben können später durch getrockneten Pansen, Fisch u.a. ersetzt werden.
Lassen Sie sich vom Züchter über die Fressgewohnheiten Ihres Welpen informieren, sie vermeiden dadurch Wachstums- und Verdauungsstörungen. Naturgemäß sind wir eigentlich keine Feinschmecker, wenn doch, dann haben Sie uns zu einem solchen erzogen!
Beginn der Hund-Mensch-Beziehung
Als erster Mensch ließ uns die Züchterin ihre lenkende Hand spüren. Ebenso wie im Wolfsrudel Halbwüchsige und Erwachsene eingreifen, falls sich ein neugieriger Welpe zu weit vom Lagerplatz entfernt, übernahm sie jetzt diese Rolle, stoppte unsere ausgedehnten Spaziergänge, indem sie uns ins Welpennest zurücklegte. Zudem tränkte und fütterte sie unsere Mutter, gewährte ihr gemeinsam mit uns Auslauf und unterstützte so die Reinhaltung des Welpennestes sowie dessen Umgebung.
Wir empfinden ein sauberes Milieu als wohltuend. Es unterstützt uns in dem angeborenen Streben, das Nest und die nähere Umgebung nicht durch unsere Losung zu beschmutzen. Sicher geht es uns da ähnlich den Menschen, die sich in einer sauberen, gepflegten Umgebung reinlicher verhalten, als in einem „Dreckloch“.
Je größer wir wurden, umso weitläufiger gestaltete sich der Auslauf. So bewirkten regelmäßige Spaziergänge bald ein Lösen außerhalb des Zwingers, zuerst im Garten, später auf Wiesen- oder Waldesgrund. Ganz so, wie es unsere Hundemutter vormachte. Dadurch lernten wir zum Lösen saugfähige und vom Menschen wenig begangene Untergründe für unser Geschäft vorzuziehen. Gehsteige oder andere gepflasterte Untergründe zu beschmutzen, sollte zu keiner Gewohnheit werden.
Gemeinsam mit unserer Mutter durften wir das Haus der Züchterin besuchen, im Garten tollen und sogar Auto fahren. Dies und manches mehr unternimmt ein guter Züchter mit jedem neuen Wurf, um ihn auf das spätere Leben vorzubereiten.
Die Gewöhnung an das Autofahren ist in der heutigen Zeit besonders wichtig, weil die meisten Hundehalter ein solches besitzen und uns damit vom Zwinger abholen. Zu spät an dieses Verkehrsmittel gewöhnt, können wir zeitlebens zum Ärgernis beim Autofahren werden, indem wir uns darin erbrechen, lösen oder unseren Widerwillen durch beharrliches Bellen kundtun.
Deshalb gewöhnt ein guter Züchter seine Welpenmeute rechtzeitig an dieses Gefährt: Ohne Scheu sprang unsere Mutter in die für uns neue Umgebung. Als wagemutigster Welpe folgte ich ihr prompt. Dies veranlasste meine Geschwister, desgleichen zu tun. Geduldig ließ die Züchterin uns das Autoinnere beschnuppern, erst später gab sie das Geräusch des startenden Motors hinzu und setzte nach geraumer Zeit das Gefährt gemächlich in Bewegung. So fuhr sie mit uns langsam ein kurzes Stück; das ließ keine Angst in unserer Solidargemeinschaft aufkommen. Später gewöhnten wir uns an ausgedehntere Fahrten. Autofahren wurde für uns eine Selbstverständlichkeit. Uns an weitere individuell genutzte Verkehrsmittel zu gewöhnen, blieb unseren späteren Besitzern vorbehalten. Als lernfähiger „Gefolgsmann“ folgen wir ihm ohne Angst, wenn er alle möglichen Verkehrsmittel wie selbstverständlich benutzt.
Aus dem Welpenrudel kommend, sollten wir uns komplikationslos in eine menschliche Familie einfügen. Dafür ist ein möglichst früher Kontakt mit Ihnen wünschenswert. Besuchen Sie uns mehrmals im Zwinger, freunden Sie sich mit Ihrem Welpen an, spielen Sie mit ihm. Aus unserer Perspektive ist Ihre Familie vorerst ein neues, aber noch fremdes Rudel. Erst wenn Sie uns die nötige Zuwendung und ein ausreichendes Verständnis entgegenbringen, betrachten wir Ihre Familie als unser vertrautes Rudel.
Als solches haben Sie die große Chance, uns an Ihre persönlichen „Zumutungen“ zu gewöhnen. Je mehr Sie über unsere ersten Schritte ins Leben erfahren, umso gezielter können Sie uns dereinst erziehen. Denn erziehen müssen Sie Ihren neuen Partner. Nur von Ihnen kann er lernen, sich in einer für uns fremden Umwelt schadlos und zur beiderseitigen Freude zu bewegen.
„Das darfst Du nicht!“, „Das sollst Du nicht!“, „Wenn Du das machst...!“ usw. sind Ermahnungen, die wohl jedem Menschen beim Begriff „Erziehung“ einfallen.
Viele Worte, eventuell noch umfangreiche Sätze, bewirken bei uns gar nichts. Erziehen Sie, indem Sie uns Erfahrungen vermitteln! Dies entspricht unserer Lernweise. Wir verknüpfen Handlungen und Ereignisse mit deren Wirken auf uns, also dem Empfinden gut oder schlecht, gefährlich oder ungefährlich. Je nach Intensität oder Häufigkeit mit der wir solche Erfahrung sammeln, prägt sich uns ein: „Das ist wohltuend oder das ist zu meiden.“
Was wir Hunde unter Erziehung „verstehen“, ist eigentlich Ihre Hilfe beim Sammeln solcher Erfahrungen. Das kennen wir bereits aus dem Zwinger; unseresgleichen gewährte uns eine Erziehung nach Hundeart. Buchstäblich um eine solche sollten Sie sich bemühen, wenn Sie uns Ihre Vorstellungen vom problemlosen Zusammenleben in der Menschengemeinschaft vermitteln möchten!
Erziehung nach Hundeart ist für einen Familienhund keineswegs etwas Negatives. Im Gegenteil, um sich in der Gemeinschaft ihres Rudels komplikationslos einzufügen, machen z.B. junge Wölfe einen umfangreichen Erziehungsprozess durch. In diesem Prozess wird von den Alttieren nicht nur „lobend“, sondern auch „tadelnd“ auf die Möglichkeiten und Zwänge des Rudellebens hingewiesen. Für Wolfswelpen, wie für uns ist dies ein ganz normales Vorgehen.
Ähnlich den jungen Wölfen, die sich komplikationslos in die Gemeinschaft ihres Rudels einfügen, geht es uns. Nur dass es bei uns nicht die Alttiere sind, die uns „lobend“ oder „tadelnd“ auf die für das Rudelleben notwendigen Verhaltensweisen vorbereiten, sondern Menschen, denen wir den Status von Alttieren zubilligen, wenn sie unsere artspezifischen Handlungsweisen beachten. Es kommt jedoch zu Missverständnissen, wenn die Menschen mit unseren Verhaltensweisen wenig vertraut sind und es an ihrem Bemühen mangelt, diese Verhaltensweisen in für beide Seiten ausreichendem Spielraum zu beachten.
Ich erinnere dabei an das eingangs erwähnte Beispiel von Herrn Wilhelm. Dieser erwartete von seinem Hund das Apportieren eines weggeworfenen Stockes, ohne ihm diese Übung jemals beigebracht zu haben. Kein Wunder, wenn sein Hund lieber das Spiel „Mein Stock!“ vorzieht, das als Beutemachen vielmehr seinem Naturell entspricht.
Wie ich in meine Familie kam
Der freundliche Mann, der uns so oft im Zwinger besuchte und sich vornehmlich um mich kümmerte, mit mir spielte, mich streichelte und mit ruhiger Stimme auf mich einsprach, hatte diesmal einen größeren Einkaufskorb dabei, in den mich meine Züchterin legte. Zu meiner Überraschung roch der Korb sehr vertraut, in ihm befand sich die Decke, die meine Züchterin vor einigen Tagen zu uns legte; ihr Duft sollte mir wohl den Abschied vom Zwinger erleichtern. Inzwischen acht Wochen alt, war es an der Zeit, mich in eine Menschenfamilie einzuordnen.
Eben dieser Mann, den ich später als mein „Herrchen“ akzeptierte, sprach mich, wie von seinen Besuchen im Zwinger gewohnt, mit „Düwel“ an; ein Name, der stets meine Aufmerksamkeit weckte und den ich als den meinen zu akzeptieren lernte, nachdem ich mir meiner Persönlichkeit bewusst wurde. Im Augenblick berührte mich besonders sein Bemühen, mir den Wechsel vom Zwinger in eine mir unbekannte Welt erträglich zu gestalten.
Ähnlich dem uns eigenen Zusammengehörigkeitsritual, das bei uns als liebevolle Fellpflege und Kontaktlecken abläuft, kraulte und streichelte er mich, lobte mit „Braver Hund“. – Diese Worte, in beruhigendem Ton gesprochen, bekamen in Verbindung mit dem Streicheln einen für meine Erziehung besonderen Sinn. Vorerst weckten sie in mir ein Gefühl der Geborgenheit, das ich auf der belebten, mir doch etwas unheimlichen Straße als sehr angenehm empfand. Alleine und ohne Auto war der Mann gekommen, ungestört wolle er mir nach der Trennung von meinem Welpenrudel zur Seite stehen. Zudem dämpfte der vom Zwingergeruch erfüllte Korb meine Ängste in der mir sonst unbekannten Umgebung.
Hungrig geworden, zog es mein „Herrchen“ zum Metzger. Aber, wie einkaufen in Begleitung eines kleinen Hundes? An der Tür hing als übliches Symbol, das Abbild eines Hundes mit der Aufschrift: „Hier darf ich nicht rein!“ Ich durfte aber – dank der Fürsprache des Mannes. Er hatte die Metzgerfrau höflich auf unser Problem hingewiesen; auf der Straße, vor der Ladentür konnte er mich in dieser heiklen Situation unmöglich alleine lassen.
Also durfte ich, in Eingangsnähe abgesetzt, vom Korb aus die herrlichen Gerüche der Fleisch- und Wurstwaren genießen. „Hoffentlich nimmt dieser mir langsam sympathisch werdende Mann auch für mich etwas Leckeres“, ging es mir durch den Kopf. Leider konnte er meinen Geschmack nicht ahnen, der nach Kalbfleisch verlangte, das mir als leckere Beigabe aus dem Zwinger bekannt war. Spontan wäre es ihm möglich, mit so einem Leckerbissen meine Zuneigung zu gewinnen: „Wie die Liebe, geht wohl auch die Sympathie durch den Magen.“