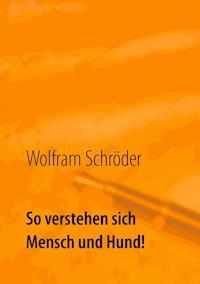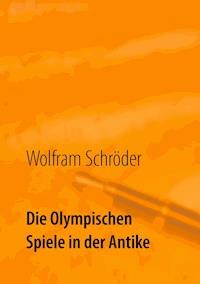
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was wir über die Olympischen Spiele der Antike wissen und wie die Griechen damals lebten, erfahren wir durch Milon von Kroton, dem erfolgreichsten Olympioniken seiner Zeit. Begleiten wir ihn in seiner 30jährigen Karriere, in der er 7mal bei Olympia sowie 26mal bei weiteren panhellenischen Spielen siegte und uns Einblicke in die Höhen und Tiefen der Spiele gewährt. Bereits nach dem ersten Sieg bei Olympia, so war es damals üblich, zählte er zu den privilegierten Bürgern seines Stadtstaates: Siegte als Heerführer in der Schlacht gegen Sybaris, war freundschaftlich verbunden mit Pythagoras und verkörperte in seiner Lebensführung das altgriechische Ideal, der Harmonie von Körper und Geist. Als Buchautor hiterließ er Hinweise zum Training der Athleten und äußerte sich zu Problemen seiner Zeit. - Allein die Tatsache, dass es den alten Griechen über 750 Jahre gelang, die Spiele trotz aller Streitigkeiten und Kriege durchzuführen, sollte uns heute zu denken geben!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Milon von Kroton
Erfolgreichster Olympionike
Der Antike
Inhalt
LEGENDEN UM MILON
KROTON (CROTONE)
K
NABENZEIT
Die Götter der Griechen
Gymnastík
D
IE
G
ESCHICHTE DES
R
INGKAMPFES
W
ARUM FÖRDERTE
K
ROTON
M
ILONS
´ T
ALENT
?
M
ILONS
´ R
INGKAMPFTRAINING
E
RNÄHRUNG UND
T
RAINING
M
ILONS
´
ERSTE
L
IEBE
DIE OLYMPISCHEN SPIELE
M
YTHISCHER
U
RSPRUNG
Z
EUS BEGRÜNDET
O
LYMPIA IM
T
AL DES
A
LPHEIOS
IPHITOS UND LYKURGOS ERNEUERN DIE SPIELE
G
OTTESFRIEDEN DURCH
L
YKURG
K
RIEGSRAT IM
S
CHUTZ DES
G
OTTESFRIEDENS
B
ETEILIGUNG
V
OM
B
ARBAREN ZUM
G
RIECHEN
NACH OLYMPIA
G
EOGRAFISCHE
W
ELT DER ALTEN
G
RIECHEN
D
IE
S
PIELE DER
H
ERA
(H
ERAIA
)
OLYMPIA
V
ORBEREITUNG
- T
RAININGSVARIANTEN
W
ETTKAMPFVORBEREITUNG
K
NABE ODER
M
ANN
D
IE
H
ELLANODIKAI
R
EGELVERSTÖßE BEIM SPORTLICHEN
W
ETTKAMPF
V
ON
E
LIS ZUR
A
LTIS
H
ADUBALT
, S
KLAVEREI
PROGRAMM
E
RSTER
T
AG
Zuschauer sein
Vereidigungszeremonie
Wettbewerbe der Jugendlichen
Ruhm, Geschäfte, Politik
Selbstdarstellung durch die Spiele
Z
WEITER
T
AG
Wagenrennen und Reiterwettkämpfe
Fünfkampf (Pentathlon)
Diskuswurf
Weitsprung
Speerwurf
Lauf
D
RITTER
T
AG
Laufdisziplinen
Nacktheit
Fitness und Körperkult
Bankette
V
IERTER
T
AG
Faustkampf
Training der Faustkämpfer
Allkampf (Pankration)
Training der Pankratiasten
Waffenlauf (Hoplitodromos)
Ärzte und Trainer
Doping, Drogen und Gefahren
LEGENDEN, SENSATIONEN, SKANDALE
F
RAUEN BEI
O
LYMPIA
F
ÜNFTER
T
AG
M
ARATHONLAUF
S
KANDALE
PROFISPORT, EHRUNGEN, EINKÜNFTE
E
RSTE
S
IEGER
K
ROTONS
H
OCHZEIT
PANHELLENISCHE SPIELE
V
ORBEREITUNG AUF DIE
P
YTHISCHEN
S
PIELE
P
YTHISCHE
S
PIELE
I
STHMISCHE
S
PIELE
N
EMEISCHE
S
PIELE
MILON UND ATLANTE
ATLANTES HAUSSKLAVIN
ALLEIN ZU DEN SPIELEN
MILANTE
DEMOKEDES
PYTHAGORAS
K
RIEG GEGEN
S
YBARIS
DEMOKRATIE
D
IE
R
EFORMEN
D
RAKONS UND
S
OLONS
U
NTERGANG DER
P
YTHAGORÄER
T
OD DES
D
EMOKEDES
MILONS´ ERFOLGE NEBST ANFEINDUNGEN
HALBGÖTTER UND HEROEN STERBEN MYTHISCH
D
ER
T
OD DES
A
CHILLEUS
D
ER
T
OD DES
P
ARIS
I
RRFAHRTEN UND
T
OD DES
O
DYSSEUS
H
ERAKLES
T
OD
M
ILONS
´ T
OD
MILONS´ MYTHISCHE UNSTERBLICHKEIT
AUTOR
QUELLEN
»GESUND & FIT IM BESTEN ALTER«
V
ORWORT ZUR
2. A
UFLAGE
R
EZENSION
:
»ALS GEHEIMNISTRÄGER IN VISIER DER STASI«
P
ROLOG
»SO VERSTEHEN SICH MENSCH UND HUND«
M
ISSVERSTÄNDNISSE ZWISCHEN ANDERSARTIGEN
P
ARTNERN
S
TATEMENT
LEGENDEN UM MILON
Bereits lange vor unserer Zeit wurde in allen Kulturen von starken Menschen berichtet; ihre Kraftleistungen erregten Aufsehen, wurden niedergeschrieben und so der Nachwelt überliefert. In der körperbetonten wie sportorientierten Antike zählten Kraft und Gewandtheit zu den Eigenschaften der Götter und der irdischen Helden. In der »Ilias« und der »Odyssee« berichtet Homer immer wieder von kriegerischen Erfolgen aber auch von sportlichen Höchstleistungen im Steinstoßen, Ringen oder Diskus- und Speerwerfen, welche von Männern erzielt wurden, die einen athletischen Körper und einen scharfen Verstand besaßen. Sagenhafte »Kraft« bedeutete in der Antike die Harmonie von Körper- und Geistesstärke, denken wir nur an den listenreichen und starken Odysseus, den unverwundbaren Herakles sowie Prometheus, den mythischen Rebellen gegen die Götter und Wohltäter der Menschheit.
Nicht vergessen sei Milon von Kroton, mehrmaliger Olympiasieger seiner Heimatstadt und sechsfacher Periodonike, ein Ehrentitel, der in der Antike dem Athleten verliehen wurde, dem es gelang, innerhalb einer Periode1 bei allen vier panhellenischen Spielen zu gewinnen. Seine Entwicklung vom schwächlichen Knaben zum bedeutendsten Athleten der Antike führte zu zahlreichen Legenden:
Pausanias, vielgereister griechischer Schriftsteller, Geograf und Historiker der Antike schrieb: »Legendär sind die Höchstleistungen des 555 bis 510 v. Chr. im pythagoreischen Kroton lebenden Milon. Nach der Sage sprengte er eine um die Stirn gespannte Darmsaite mit der Kraft seiner Schläfenmuskeln, trug einen vierjährigen Ochsen durch das Stadion von Olympia und verspeiste ihn hinterher. Die einsturzgefährdete Decke des Hauses von Pythagoras hielt er so lange, bis sich dieser mit seinen Schülern in Sicherheit gebracht hatte. Außerdem war keiner in der Lage, ihm einen Granatapfel zu entreißen, den er trotz aller Anfechtungen emporhielt, ohne ihn bei dem Gerangel zu zerdrücken. Auf einem mit Öl eingefetteten Diskus stehend, war keiner in der Lage, ihn hinunter zu stoßen. Als Athlet soll Milon täglich 17 Pfund Fleisch und die gleiche Menge Weizenbrot nebst zehn Liter Wein verzehrt haben. Er trug eigenhändig seine ihm gewidmete Siegerstatue in die Altis, dem heiligen Hain von Olympia.
Im Kriege gegen den Stadtstaat Sybaris trat er auf wie Herkules, bewaffnet mit Keule und bekleidet mit einem Löwenfell. Wir dürfen uns Milon von Kroton trotzdem nicht wie einen geistlosen Muskelprotz vorstellen. Er war Sänger, Dichter und Buchautor, zudem ein enger Freund von Pythagoras, dem großen griechischen Philosophen und verstand sich in seiner Lebensführung als Verkörperung des pythagoreischen Ideals, nämlich der Harmonie von Körper und Geist.«
Hervorgegangen wäre Milon aus dem antiken Leistungszentrum von Kroton in Süditalien. Es wurde berichtet, dass dort der berühmte Philosoph und Mathematiker Pythagoras einer der Lehrmeister von Milon war. Doch Milon hätte seine große Intuition bereits gehabt, bevor er Pythagoras begegnete: »Es wird nämlich erzählt, dass der kleine Milon ein recht schwächliches Kind gewesen sei, das häufig von den rohen Nachbarskindern verprügelt wurde. Eines Tages aber fasste er den eisernen Entschluss, diesem Treiben ein Ende zu setzten. Er wollte unbedingt stärker werden und packte das bemerkenswert systematisch an.«
An dieser Stelle wird die Geschichte auch trainingsmethodisch interessant: »Er nahm ein gerade zur Welt gekommenes Kalb auf den Arm und trug es mehrmals um den elterlichen Hof. Obwohl ihm das anfangs sehr viel Mühe bereitete, hielt er durch und machte diese ‚Rundläufe‘ täglich. Im Laufe der Zeit wuchs nicht nur das Kalb, sondern auch die Kraft des Milon und nach einem Jahr sehr natürlicher Belastungssteigerung war er stark genug, ein ausgewachsenes Rind rund um das Anwesen seiner Eltern zu tragen, um nun – darum ging es ja schließlich – die Nachbarskinder zu verprügeln.«
»Mit seinen 600 bis 1200 Kilogramm wäre ein Stier wohl selbst für den derzeit amtierenden Weltrekordhalter im Kniebeugen zu schwer: Dieser schafft eine 90-Grad-Kniebeuge mit einer 475 Kilogramm schweren Hantelstange auf den Schultern.
Aus trainingswissenschaftlicher Sicht interessant ist die Tatsache, dass ein Kalb täglich um 0,4 bis 1,2 Kilogramm zunimmt und sich die Trainingslast somit der zunehmenden Leistungsfähigkeit des jungen Milons´ anpasste. Dies wäre im weitesten Sinne eine frühe Strategie der Belastungssteuerung, wie sie im heutigen Training von Spitzen-Athleten Anwendung findet.«2
Eine weitere Legende zur Herkunft Milons´ hält ihn für den Sohn eines Schäfers. Immerhin könnte dies glaubhafter seinen Kraftzuwachs durch die »natürliche Belastungssteigerung« im Training des knabenhaften Milons´ erklären: Denn ein eben geborenes Lamm auf den Armen um das elterliche Anwesen getragen zu haben, mag für unser heutiges Verständnis möglich sein. Im Laufe der Zeit wird er das heranwachsende Schaf geschultert haben, sodass die Kraft seiner Schulter-, Rumpf-, Bein- und Armmuskulatur sich soweit entwickelte, dass er bei Raufereien mit den Nachbarskindern siegen konnte.
Doch vorerst genug der Legenden, denen Aristoteles3 nur die Möglichkeit einer Annäherung an die Wahrheit zubilligte. Die Wahrheit im Falle Milons´ könnte sein, dass er tatsächlich ein heranwachsendes Tier täglich auf die Weide trug, um übereinstimmend mit dessen Gewichtszunahme seine körperliche Leistungsfähigkeit zu entwickeln.
1 Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen, er zählte von den augenblicklichen Spielen bis zu den nächsten.
2 Christian Thiel und Winfried Banzer in »Forschung-Frankfurt«; 2/2011
3 Aristoteles gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte.
KROTON (CROTONE)
Milon stammte, wie sein Beiname verrät, aus Kroton. Wer heute Kroton sucht, der wird an der östlichen Küste Süditaliens fündig. Am »Großzehenballen«, des durch die italienischen Landmassen markierten »Stiefels« lag sie, Milons´ Heimatstadt, heute Crotone genannt. Kroton war bekannt für seinen Reichtum, der sich aus dem blühenden Handel über einen gut ausgebauten Hafen ergab. Die in großer Zahl ein- und auslaufenden Schiffe schlugen Waren, mit denen auch Milons´ Vater handelte, aus aller Welt um. Überdies waren es die Heilstätten, die man in Kroton gern besuchte, in ihnen praktizierten Ärzte, die ihrer Zeit weit voraus waren; genannt sei der bedeutende Arzt Demokedes von Kroton, ihn lernen wir später kennen.
Beispielhaft für seine Zeit die Sorge Krotons um ein geregeltes Staatswesen, das bis zu den Unruhen 510 v. Chr., in die auch Pythagoras, Milon und Demokedes verwickelt waren, von der Mehrheit der Bürger4 Krotons gebilligt wurde. Beachtlich die Aufwendungen für körperliche und geistige Bildung; demgemäß trainierte und lernte die männliche Jugend der Stadt im Gymnasion5. Aus diesem ersten Sportleistungszentrum der Antike gingen einige Olympiasieger hervor, die zu Ruhm und Ehre der Stadt beitrugen.
Deren bekannteste Olympioniken im 6. und frühen 5. Jahrhundert v. Chr. waren außer Milon von Kroton: Astylos von Kroton, Timasitheos von Kroton und Phayllos von Kroton:
Astylos von Kroton ist bekannt als achtfacher Olympiasieger in den Laufdisziplinen zur Zeit der Perserkriege. An einem Tag feierte er Siege im Stadion- sowie im Doppellauf (diaulos), diese Glanzleistung steigerte er, als er auch noch den Waffenlauf absolvierte, den er erneut vier Jahre später gewann. Damit war er der zweite Triastes (Dreifachsieger), der aus der Antike überliefert ist. Im Kapitel »Skandale« begegnen wir ihm als ersten bekannten Athleten der Antike, der seiner Stadt den Rücken kehrte und sich von einer anderen Stadt abwerben ließ.
Timasitheos von Kroton soll unter Anleitung von Milon trainiert haben. Er war der Ringer, den wir als letzten Gegner Milons ´ kennenlernen. Wie wir später erfahren, endete dieser Kampf unentschieden, doch mit »Vorteil« für den kämpferischen Milon.
Gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. hat der attische Vasenmaler Euthymides zwei Athletenbildern den Namen Phayllos beigeschrieben. Phayllos gehörte zu den sagenumwobenen Gestalten seiner Zeit, er nahm 480 v. Chr. an der Schlacht bei Salamis teil und darüber hinaus war er ein berühmter Athlet. Mehr darüber unter »Training bei den Laufwettbewerben!«
Seinen Ruhm mehrte Phayllos 20 Jahre später, als er auf eigene Kosten ein Kriegsschiff ausrüstete, um an der Seeschlacht bei Salamis gegen die Perser teilzunehmen. Eine auf der Akropolis von Athen gefundene Inschrift verewigte seine sportlichen und militärischen Erfolge.
Aber auch Künste und Architektur gediehen im wirtschaftlich aufblühenden Kroton. Der berühmte Zeuxis6 schuf für den Tempel der Hera Lakinia das Bildnis der schönen Helena, wofür ihm »fünf« der hübschesten Mädchen Krotons Modell stehen mussten, weil er der Meinung war, vollendete Schönheit könne sich in der Natur nicht in einer »einzigen« Person ausdrücken.
Kroton steht - wie andere Stadtstaaten - für die Kolonisierung Süditaliens durch sich ausbreitende griechische Stämme längst der Küsten des Mare Tirreno7 und dem Mare Ionio8 sowie in der Nähe von Flüssen oder Quellen. Dies führte durch die Gründung voneinander unabhängiger Stadtstaaten zur Magna Graecia (Großgriechenland), das neben Ionien zu den kulturell und wirtschaftlich führenden Gebieten des antiken Griechenlands zählte.
Übervölkerung, sich daraus ergebende Nahrungsmittelknappheit sowie der sich entwickelnde Fernhandel bestärkten das Motiv für den griechischen Kolonisationsdrang im 8. bis 6. Jahrhundert v. Chr. Die Siedlungsexpansion dieser Ära, auch »Große Kolonisation« benannt, führte zur Verbreitung von Poleis (Stadtstaaten) im Mittelmeer sowie am Schwarzen Meer.
Selbst die Lebensläufe namhafter Griechen sind beredtes Zeugnis für deren Ungebundenheit: »Behagte es ihnen nicht mehr in ihrer Heimatstadt, dann wichen sie in einen anderen der autonom regierten Stadtstaaten aus oder gründeten mit Gleichgesinnten in der Ferne ein neues Gemeinwesen.«
In der Regel geschah die Abreise der Kolonisten aus ihrer Heimatstadt in friedlicher Weise; entweder konnte der Stadtstaat nicht mehr alle Einwohner ernähren oder eine der im Stadtstaat miteinander verfeindete Gruppe musste das Feld räumen, wurde verbannt. Oft stellten die jeweiligen Stadtverwaltungen die für die Ausreise notwendigen Mittel zur Verfügung: Schiffe, Waffen, Ackergeräte, Lebensmittelvorräte sowie Saatgut. – Zudem bestimmten sie einen Oikistes (Stadtgründer), dem es oblag, alles zu organisieren. Im besten Falle erkundete der Oikistes den Zielort, um auf alle zu erwartenden Schwierigkeiten vorbereitet zu sein. Ebenfalls war es möglich, vorher das Orakel von Delphi zu befragen.
Kaum einer der alten Griechen gab gerne zu, dass sein Aussiedeln in ein neues Umfeld als »aus der Not geboren« geschah; eine geschönte Sage, die sich auch noch auf den göttlichen Herakles bezog, hörte sich trotz allem viel besser an und ist sogar im heutigen Crotone als wohlgehütetes Mysterium bekannt.
Als mythischen Stadtgründer Krotons lernen wir Myskelos kennen: »Laut Ovids Metamorphosen lebte Myskelos, eine Gestalt der griechischen Mythologie und Sohn von Alemon, in Argos, einer griechischen Stadt im Nordosten des Peloponnes. Eines nachts erschien ihm im Traum der zum Gott gewordene Herakles und befahl ihm, seine Heimat zu verlassen und sich zum fernen Aisar zu begeben und drohte ihm Strafe an, wenn er dem Befehl nicht Folge leisten würde. Dem gegenüber stand jedoch das Gesetz der Ortsgebundenheit, das jedem bei Todesstrafe verbot, sich eine neue Heimat zu suchen.
So wurde das altertümliche Kroton um 710 v. Chr. von achäischen6 Griechen nahe des heutigen Standorts gegründet und entwickelte sich zu einer wohlhabenden Polis. Zu deren Umland gehörte alsbald der südlich von Kroton gelegene Küstenstreifen mit dem Akron (Kap) Lakinion, auf dem sich das Heiligtum der Göttin Hera Lakinia befand. Die in Süditalien beheimateten Stämme sowie die Etrusker widersetzten sich den einwandernden Griechen nicht, sie waren an dem durch die Griechen geförderten Handel interessiert.
Die Vorfahren Milons ´ planten nach ihrer Ankunft in Süditalien ihre Polis nach den Erfahrungen der Achäer. Das zu organisieren oblag der Kaste der Adligen, allen voran Myskelos, der ja als Oikistes die Zuwanderung geleitet hatte. Wie wir wissen, befragte Myskelos vor der Abreise das Orakel in Delphi, zu seiner Zeit war dies so üblich, wenn man in die Fremde zog. Unabhängig vom Orakelspruch sollten die dortigen Priester bereit gewesen sein, für reichliche Opfergaben weitere Ratschläge zu erteilen. Ihr Wissen über die Welt der Griechen und darüber hinaus schöpften sie aus dem Informationsfluss, der ihnen durch die zahlreichen Besucher des Orakels zugetragen wurde. Ging es um die Suche nach einer für Kolonisten günstigen Gegend, konnten sie sich auf Informationen stützen, die Ihnen von Seefahrern zugetragen wurden. Die Gegend um das zukünftige Kroton war so ein Gebiet: Kaum besiedelt, wartete es mit fruchtbringenden Böden auf und bot eine günstige Lage für die Stadtgründung unmittelbar am Meer an der Mündung des Flusses Aisar.
Dort angekommen, organisierte Myskelos die Verteilung des Landes, legte den Standort der Stadt, deren Straßenraster, den Platz für die »Agora«7 und den künftigen Hafen fest. Myskelos und seine Getreuen hatten sich bemüht, Fehler bei der Stadtgründung zu vermeiden, die in älteren Städten durch zu enge Bebauung zu Bränden, Seuchen, Lärm und Gestank führten. Ihre Stadt sollten breite Straßen queren, auf denen zwei Fuhrwerke aneinander vorbeifahren konnten, eine Kanalisation sowie der Bau von tiefen Brunnen waren ebenfalls vorgesehen. All das und noch viel mehr, setzte eine gut geleitete Mitarbeit aller Bürger voraus.
Nach dem damaligen Verständnis galt als adlig, wer zu den Besten gehörte, sei es durch Ideenreichtum zum Wohle aller, Tatkraft bei der Verwirklichung dieser Ideen, Bereitschaft zur Verteidigung der Stadt, die Herkunft aus gutem Hause sowie ehrlich erworbenes Vermögen. Zu Beginn der Zeit Milons´ sollte dies noch Voraussetzung für das Vertrauen der Bürger Krotons in die Führungsqualitäten der sie regierenden Adligen sein, solange diese durch kluge Entscheidungen in ihrem Sinne handelten. Nach Aristoteles wäre diese Regierungsform die Aristokratie! Wie es in Kroton damit weiterging, erfahren wir später im Zusammenhang mit den Pythagoreern.
KNABENZEIT
Milon stammte aus einer vornehmen Familie. Wollte eine Mutter aus diesen Kreisen ihr Kind nicht selbst stillen und erziehen, dann übernahm eine Amme diese Aufgabe. Mütter oder Ammen sangen den Kindern vor, machten sie mit den Sitten und Gebräuchen des täglichen Lebens vertraut und erzählten Geschichten. Dafür verwandten sie auch Erzählungen von unheimlichen Geschöpfen, die den Kindern einen heilsamen Schrecken einjagen sollten. Sagen, Legenden oder Mythen, die das Leben anschaulich erläutern, erfreuten sich großer Beliebtheit und dienten zur Belehrung der Kinder.
Wie uns bekannt, benutzten die Kinder Klappern, Rasseln, Pfeifen sowie Figuren aus Terrakotta als Spielzeug; die Mädchen hatten sogar Puppen mit z. T. beweglichen Gliedmaßen. Außerdem bezogen sie Tiere wie Hunde, Schafe und Ziegen in ihr Spiel mit ein.
Als Vorschulkind wuchs Milon unter der Obhut seiner Mutter und einer Sklavenamme auf, beide erzogen ihn nach den gesellschaftlichen Normen und Werten der Griechen. Als Junge fühlte er sich besonders zu dem Haussklaven Hadubalt hingezogen, weil dieser, als gebildeter Grieche, der nach einem verlorenen Krieg seiner Polis in Gefangenschaft geriet und als Sklave verkauft wurde, ihm so manches Interessante über die Götter und die Welt erzählte und auch in praktischen Dingen sehr erfahren war. Mit einem von Hadubalt aus Leder genähten und mit Wolle gefüllten Ball übte Milon Zielwürfe in einen mannshoch aufgehängten Korb; bald fanden sich die Nachbarskinder ein, wodurch sich unter Hadubalt´s Anleitung ein dem Basketball ähnliches Spiel entwickelte. Auch bei weiteren Ballspielvarianten wie Weitwürfen, Zielwürfen und Fangübungen, die zu kindgemäßen Wettkämpfen ausarteten, blieb Hadubalt stets ein fairer Schiedsrichter. Wenn auch »nur« Sklave, für die rangelnden und raufenden Kinder, war Hadubalt eine Autorität. Kam es in der Hitze des Spiels zu wütenden Streitigkeiten der Knaben, so gab es nie ernsthaft Verletzte, weil Hadubalt immer rechtzeitig einen der Streitenden zum Sieger erklärte.
Im Jahre 548 v. Chr. lernen wir Milon als wissbegierigen, jetzt schulfähigen Knaben kennen. Manches über die Ereignisse in Kroton sowie in der für die Griechen bekannten Welt erfuhr Milon, wenn er den Gesprächen der Männer lauschte, die bei Speis und Trank im Hause seines Vaters debattierten. Noch interessanter wurde es, wenn er seinen Vater, einen umtriebigen Händler, zum Hafen begleitete. Schiffe aus der großen weiten Welt, die für die alten Griechen das Mittelmeer, das Ägäische Meer, das Schwarze Meer, das Ionische Meer, das Adriatische Meer, das Tyrrhenische Meer und deren Küsten bedeutete, und die Kunde von anderen Völkern hatten seine kindliche Neugierde geweckt. Immerhin handelte sein welterfahrener Vater mit Silber aus den Silberminen von Laurion nahe Athen, Purpurmuscheln und Eisen aus Lakonien, Eisenerz, Blei, Kupfer und Bronze von den Etruskern; in Amphoren abgefüllten Wein, Olivenöl und Getreide; sowie mit Gewürzen, Vasen und Keramikartikeln, die ebenfalls als gefragte Exportartikel galten.
Für den nunmehr siebenjährigen Milon begann jetzt »der Ernst des Lebens«, das systematische Lernen. Die »Schule«, im alten Griechenland, das Gymnasion nebst Palästra, war eine Einrichtung, über die jede griechische Stadt verfügte. Sie diente nicht nur dem Training der Athleten, sondern war zugleich die Schule der Knaben zu ihrer körperlichen Ertüchtigung und für die Unterweisung in Musik, Arithmetik, Grammatik sowie im Schreiben und Lesen. Vorerst besuchte Milon vom 7. bis zum 14. Lebensjahr diese Bildungseinrichtung. Galt doch die Ausbildung des Körpers mittels Gymnastik, die Entwicklung des Gefühls durch Musik und die Pflege des Geistes durch das Kennenlernen überkommener Dichtungen in Gestalt von Legenden, Mythen und Sagen sowie das Schreiben, Lesen und das Beherrschen der Arithmetik als höchstes Ziel eines Knaben wie Milon.
Dem Haussklaven Hadubalt kam die für einen gebildeten Sklaven übliche Aufgabe zu, die körperliche und geistige Bildung Milons´ zu fördern, ihn nach dem Brauchtum der alten Griechen zu erziehen; wobei ihm auch das Recht des Bestrafens zukam. Außerdem sollte er Milon vor möglichen Fährnissen beschützen.
Bei einem Privatlehrer lernten die Schüler zuerst das Schreiben. Sie mussten die von diesem an die Tafel geschriebenen Buchstaben und später Wörter, fein säuberlich auf ihre mit Wachs beschichtete Tafel schreiben. Verschrieben sich die Schüler, dann löschten sie das falsch geschriebene Wort, indem sie das Wachs mit dem stumpfen Ende ihres Stylus glätteten und den Buchstaben oder das Wort erneut schrieben.
Eine Eigenart des damaligen Griechisch war, dass alle Wörter eines Satzes zusammengeschrieben wurden, es zu all dem auch noch keine Interpunktion gab. Manchmal könnte es viel Einfallsreichtum gebraucht haben, einen fremden Text zu verstehen. Überliefert ist aber auch, dass sowohl Wörter als auch Texte immer laut zu lesen waren, möglich, dass die vom Lehrer vorgegebene Betonung, die Logik des Satzgefüges verständlicher machte!
Für die Erfindung der Vokalisierung des Alphabets lobpreisten die Griechen den legendären Palamedes, der ihnen als Klügster aller Sterblichen galt: Palamedes, sagenhafter Held bei den Kämpfen vor Troja, soll nicht nur die Alphabetschrift erweitert, sondern auch noch den Würfel und das Brettspiel erfunden sowie außerdem noch Maße und Gewichte vereinheitlicht haben. Seine Klugheit trug ihm den Neid des wegen seiner List berühmten Odysseus ein.
Die Legende besagt, dass der listige Odysseus den frühen Tod von Palamedes herbeigeführt habe: »Odysseus wollte sich der Teilnahme am Trojanischen Krieg entziehen, obwohl er per Eid dazu verpflichtet war. Um seine Kampfgenossen zu täuschen, markierte er den geistig Verwirrten, indem er mit einem Ochsen und einem Esel vor dem Pflug die Furchen zog und darein als Saatgut Salz streute. Palamedes entlarvte die List des Odysseus, indem er dessen Sohn vor den Pflug legte. Als Odysseus vorsichtig den Pflug über den Säugling hinweghob, bekundete er ungewollt seine Zurechnungsfähigkeit. Um sich wegen dieser Schmach zu rächen, ersann Odysseus während der Belagerung vor Troja eine heimtückische List, mit der er Palamedes zu verderben trachtete. Er verbarg im Zelt des Palamedes Gold und fälschte einen Brief des Priamos, des in Bedrängnis geratenen Königs von Troja, an Palamedes. Diesen Brief spielte er einem gefangenen Trojaner in die Hand, tötete den vermeintlichen Boten auf der Stelle, nachdem er den Brief ‚entdeckt‘ hatte. Eine Untersuchung der Unterkunft von Palamedes förderte das versteckte Gold zutage. Der Rat der griechischen Fürsten verurteilte Palamedes aufgrund der Indizien, die einen Verrat an der Sache der Griechen belegen sollten, zum Tode durch Steinigung. ‚Freue dich, Wahrheit, du bist vor mir gestorben‘, rief der Verurteilte. Nachdem er diese Worte gesprochen, wurde ihm von Odysseus ein Stein an die Schläfen geworfen und er verstarb.«
Weil eben die griechische Schrift für einen aufgeweckten Burschen so leicht erlernbar war, konnte Milon bald auch lesend seinen Wissensdurst stillen. Geistig lebte er in den überlieferten Götter- und Heldensagen, mit denen er im Unterricht vertraut gemacht wurde.
Die Götter der Griechen
Die Götter lebten das vor, was sie auch von den Menschen verlangten, sie hüten sich vor der Hybris, »dem Übermut«, »die Anmaßung«; einer Selbstüberhebung, die unter Berufung auf einen gerechten göttlichen Zorn, die Nemesis, gerächt wird. Die Nemesis ist die Tochter der »Nyx« (Nacht), sie bestraft vor allem die menschliche Selbstüberschätzung und die Missachtung von Themis, der Göttin des Rechts und der Sittlichkeit. »Zeus paarte sich mit Nemesis in Gestalt eines Schwans, nachdem sie aus Scham und gerechten Zorn geflüchtet war. Auf ihrer Flucht über das Meer verwandelte sie sich in einen Fisch, am Rande der Erde angelangt in eine Gans, mit der Zeus als Schwan die Helena zeugte, um derentwegen schließlich der Trojanische Krieg geführt wurde«, der eine bedeutende Rolle bei dem spielte, was Milon über die Götter und Heroen erfuhr. Zu nennen wären hier Homers Epen der Ilias und der Odyssee, die etwa um 700 v. Chr. nach den »Dunklen Jahrhunderten«8 entstanden und die als solche, die Griechen mit ihrer Geschichte vertraut machten sowie sie, wenn schon nicht als friedlich zusammenlebendes Volk, so doch im Geiste vereinte. Milon lebte also in einer Welt, die uns noch heute fasziniert und so manches zu sagen hat.
In ihren überlieferten Mythen schreiben die alten Griechen ihren Göttern menschliche Eigenschaften zu: So ist Hera eifersüchtig auf die zahllosen Liebschaften ihres Gatten, dem Göttervater Zeus; Demeter trauert wie eine menschliche Mutter, als sie ihre Tochter Persephone an Hades, den Herrscher der Unterwelt, verloren hat; Hephaistos stellt seiner Gemahlin Aphrodite und ihrem Liebhaber Ares eine Falle.
Vom vielfältigen Eingreifen der Götter in das Leben und Handeln der Menschen wird ebenfalls berichtet: Das berühmteste Beispiel ist der eben genannte »Trojanische Krieg«, der auf göttlichen Streit zurückgeht. Es beginnt mit dem Urteil des Paris: »Die Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite waren zusammen mit den übrigen olympischen Göttern zur Hochzeit des sterblichen Helden Peleus mit der Göttin Thetis eingeladen. Eris, die Göttin der Zwietracht, war als einzige Göttin nicht geladen. Sie warf einen goldenen Apfel in die Runde, mit der Aufschrift ‚kallisti‘ (für die Schönste), und lösten damit einen Streit zwischen Hera, Athene und Aphrodite aus, weil jede der Göttinnen den Apfel für sich beanspruchte.
Die drei Göttinnen baten Zeus, zu entscheiden, welche von ihnen die Schönste sei. Dieser wollte es aber klugerweise vermeiden, sich diese Wahl aufzubürden, da Aphrodite und Athene seine Töchter, und Hera seine Ehefrau und Schwester waren. Also ließ er Hermes kommen und trug ihm auf, die Göttinnen zu Paris, dem schönen, wenngleich verstoßenen Königssohn Trojas zu bringen, damit dieser entscheide.
Alle drei Göttinnen versuchten Paris` Gunst durch Bestechung zu erlangen: Hera versprach politische Macht und Dominanz in Asien, Athene Weisheit und Kriegskunst, Aphrodite jedoch las Paris` Wünsche am klarsten, indem sie ihm die schönste Frau auf Erden versprach, nämlich Helena. Diese war allerdings schon die Frau des Königs Menelaos von Sparta. Jedenfalls sprach Paris den Erisapfel der Aphrodite zu, womit er sich den Zorn der anderen beiden Göttinnen zuzog. Diese versuchten nun, ihm zu schaden, wo sie konnten.«
Das gelang ihnen, weil Paris die schöne Helena begehrte und damit den »Trojanischen Krieg« entfachte: »Helena war die Gattin des Menelaos. Bevor sie Menelaos heiratete, hatten viele Griechenkönige, die alle untereinander verfeindet waren, um sie geworben. Um nach der Wahl den Frieden in Griechenland zu erhalten, hatte Odysseus dazu geraten, dass alle Bewerber einen Eid ablegen sollten, Helenas Wahl anzuerkennen und die Ehe Helenas zu verteidigen. Als Paris nun Helena traf, da erfüllte Aphrodite ihr Versprechen und sorgte dafür, dass sich Helena in Paris verliebte. Beide flohen gemeinsam nach Troja. Die unter den Griechen von Menelaos aufgerufenen Eidpflichtigen zogen nun unter dem Heerführer Agamemnon, dem Bruder von Menelaos und König von Mykene, gegen Troja, sehr zur Freude von Hera und Athene.«
Wie die Troer und Griechen stehen sich die Götter in diesem Kampf feindlich gegenüber und helfen der jeweils von ihnen begünstigten Partei; Aphrodite, Ares, Apollon und Artemis auf Seiten der Troer – Hera, Athene. Poseidon und Hephaistos auf Seiten der Griechen. Nur Zeus steht über den Kämpfenden und entscheidet den Krieg - auf den wir in einzelnen Episoden zurückkommen - nach der Waage des Schicksals. Auf Beleidigung durch die Menschen, ob bewusst oder unbewusst, reagieren die Götter mit unnachsichtiger Rache: Poseidon verfolgt Odysseus unbarmherzig auf seinen Irrfahrten durch die Meere, weil der Held einen Sohn des Gottes, den Kyklopen Polyphem, geblendet hatte.
Hera ist die unversöhnliche Feindin des Herakles, Sohn der Alkmene und ihres untreuen Gemahls Zeus, bis der Held nach seinem Tode endlich in den Olymp aufgenommen wird.
Der zurückgewiesene Liebhaber Apollon bestraft die troische Königstochter Kassandra damit, dass ihre Weissagung bei niemandem Glaube findet: »So warnte Kassandra vergebens gegen Ende des Trojanischen Krieges die Trojaner vor dem ‚Trojanischen Pferd‘ und der Hinterlist der Griechen, sodass Troja unterging.«
Besonders grausam bestraft wird Tantalos für seine Freveltaten; nicht nur er selbst muss qualvolle Leiden ertragen, auch seine Kinder und Kindeskinder erwarten schreckliche Schicksale.
Andererseits stehen die menschlichen Nachkommen der Götter unter deren Schutz: Die Meeresgöttin Thetis, Mutter des Achilleus, macht ihren Sohn durch ein Bad im Unterweltfluss Stix unverwundbar – nur die Achillesferse, an der sie ihn festhielt, ist davon ausgenommen; Perseus, Sohn des Zeus und der Danae, erhält bei seinem Abenteuer Hilfe durch Athene und Hermes; dem Aineias, einem Sohn der Aphrodite, helfen die Götter bei der Flucht aus dem brennenden Troja.
Es gab also Götter, die menschliche Züge trugen, die wie diese denken und handeln sowie Begebenheiten, die für Milon belehrend und für uns noch immer als historische Ereignisse nachvollziehbar und mit dem heutigen Hier9 vergleichbar sind. Es blieb dem aufgeweckten Knaben vorbehalten, dass insbesondere der reiche Schatz der griechischen Sagen, Legenden und Mythen ihm die Welt der Götter, Halbgötter, Unsterblichen und Titanen erschloss und dies seinen Lebensweg nachhaltig beeinflusste.
Die folgende Mythe, die sich aus einem der legendären Seitensprünge des Göttervaters Zeus ergab, hatte es Milon besonders angetan; ihn beeindruckte das Heldenepos des »Herakles«. Dieser, Sohn des mächtigsten olympischen Gottes Zeus, galt als ein mit wundersamem Schutz ausgestatteter Halbgott und Begründer der Olympischen Spiele:
»Zeus verliebte sich einst in die schöne Alkmene, diesmal getarnt als deren Ehemann. Als ihr Ehemann Amphitryon von einer Reise zurückkehrte, flog der Schwindel auf. Er verzieh seiner unwissenden Frau und zeugte mit ihr Iphikles, den Zwillingsbruder von Herakles, wobei es hier um Letzteren geht.
Aus Eifersucht wurde Hera, die Gemahlin des Zeus, zur lebenslangen Verfolgerin des Herakles. Aus Angst vor Heras Zorn hatte Alkmene ihren Sohn, den kleinen Herakles, ausgesetzt. Seine Halbschwester Athene, die auch später als Schutzgöttin des Herakles eine wichtige Rolle spielte, nahm ihn und brachte ihn zu Hera. Diese erkannte Herakles nicht und säugte den Findling aus Mitleid. Dabei sog Herakles jedoch so stark, dass er Hera Schmerzen zufügte und diese ihn von sich stieß. Doch mit der wenigen, aber göttlichen Milch, erhielt Herakles seine übernatürlichen Kräfte. Athene brachte darauf Herakles zu seiner Mutter zurück, nun konnte er bei seinen Eltern aufwachsen. Als er gerade acht Monate alt war, schickte Hera zwei riesige Schlangen in das Gemach der Kinder. Iphikles, sein Zwillingsbruder, weinte vor Angst, doch Herakles ergriff die beiden Schlangen und erwürgte sie.
Der Seher Teiresias, den der erstaunte Vater kommen ließ, prophezeite Herakles eine ungewöhnliche Zukunft, er werde zahlreiche Ungetüme besiegen. – ‚Der mythische Teiresias war ein Priester des Zeus, der, als er auf dem Berg Kyllini auf ein Paar sich begattende Schlangen stieß, die weibliche tötete, worauf er in eine Frau verwandelt wurde. Als solche heiratete er, erlebte als Frau deren Gefühle und wurde Mutter eines Sohnes. Sieben Jahre später traf Teiresias erneut ein Paar kopulierender Schlangen, diesmal tötete er die männliche und wurde wieder zum Mann. – Aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Leben, sowohl als Mann oder Frau, wurde er von Zeus und Hera gebeten, die Frage zu klären, welches Geschlecht, Mann oder Frau, in der geschlechtlichen Lust mehr empfinde – Zeus hatte sich für die Frauen, Hera sich für die Männer entschieden. Als Teiresias die Meinung des Zeus unterstützte und offenbarte, als Frau neunmal so viel Lust wie als Mann empfunden zu haben, ließ die wütende Hera Teiresias erblinden, weil er den Männern das Geheimnis der Frauen preisgegeben hatte. Da Zeus dies nicht rückgängig machen konnte, verlieh er Teiresias zum Ausgleich die Gabe des Sehers und eine siebenfache Lebensdauer.‘
Entsprechend der Voraussage von Teiresias wurde Herakles in den sportlichen Disziplinen des Wagenlenkens, Bogenschießens, Fechtens, im Faustkampf und im Ringen unterrichtet. Auch brachte ihm sein Musiklehrer Linos Gesang und das Spiel auf der Leier bei. Herakles war zwar sehr gelehrig, doch lebenslang bis zum Wahnsinn jähzornig. So erschlug er Linos mit der Leier, als dieser ihn zu Unrecht tadelte. Sein Pflegevater König Amphitryon schickte ihn daraufhin - wohl aus Furcht vor seiner ungebändigten Kraft - auf den Kithairon zu seinen Rinderherden. Hier wuchs Herakles unter den Hirten zu einem stattlichen Jüngling heran.«
Aus jener Zeit des Hirtenlebens wird folgendes Abenteuer des Herakles berichtet: »Auf dem Kithairon, an welchem die Herden des Amphitryon und des Thespios weideten, hauste ein Löwe, den Herakles zu bekämpfen unternahm. Thespios gab dem Helden hierfür 50 Tage hindurch jede Nacht eine seiner 50 Töchter zur Umarmung, von denen darauf 50 Söhne10 geboren wurden. Nach langem Kampf erlegte Herakles den Löwen und trug seitdem dessen Haut statt seines gewöhnlichen Gewandes, wozu später noch die aus einem Ölbaum gefertigte Keule kam.«
Bei seiner Rückkehr nach Theben begegnet Herakles den Gesandten des orchomenischen Königs Erginos, welche einen den Thebanern abgerungenen Tribut von 100 Ochsen einholen wollten: »Er schnitt ihnen Nasen und Ohren ab, schickte sie gefesselt nach Hause und zwang in dem darauffolgenden Krieg die Orchomenier, den empfangenen Tribut doppelt rückzuerstatten.
Schnell verbreitete sich der Ruhm seiner Taten. Kreon, der König von Theben, gab ihm zum Lohn seine Tochter Megara zur Frau, mit der er drei Söhne zeugte. Darauf rief ihn Eurystheus in seine Dienste, welchem er aber anfangs seine Dienstbarkeit verweigerte. Doch die rachsüchtige Hera schlug ihn mit Wahnsinn. Darin verfangen erschlug Herakles seine Frau Megara und die mit ihr gezeugten Kinder.«
Als der Anfall von ihm gewichen und er seine schreckliche Tat vor Augen sah, ergriff Herakles eine tiefe Bekümmernis. Schließlich fragte er das Orakel von Delphi um Rat. Darauf antwortete die Pythia: »Entsühnung für deine schreckliche Mordtat erlangst du nur, wenn du dich zwölf Jahre in den Dienst des Eurystheus stellst und die von ihm geforderten Taten erfüllst.« Herakles tat, wie ihn das Orakel geheißen. Bewaffnet mit einer Keule, die er selbst geschnitzt hatte, einem von Hermes geschenkten Schwert sowie Pfeil und Bogen, die er von Apollon erhalten hatte, ging er nach Argos zu König Eurystheus11. Dieser gab ihm insgesamt zwölf Aufgaben, die »Arbeiten des Herakles«, die er allesamt bewältigte.
»Eine dieser Aufgaben bestand darin, den von Poseidon mit Raserei geschlagenen »Kretischen Stier«, der auf Kreta große Verwüstung anrichtete, zu bändigen und ihn Eurystheus zu bringen. Herakles landete also auf Kreta und bat Minos, der die Schuld an der Raserei des Stieres trug, den Stier einfangen und mitnehmen zu dürfen. Herakles bändigte den Stier, schulterte ihn und brachte ihn zu Eurystheus, zeigte ihm den Stier und ließ ihn wieder frei.«
Wie schon bei Milons´ Schulbesuchen erwähnt, hatte der Haussklave Hadubalt die Aufgabe, Milon vor möglichen Fährnissen zu schützen. Eine Fährnis könnte sich bald herausgestellt haben: Milons´ unstillbare Wissbegier brachte ihm den Ruf eines Strebers ein, was, wie auch heute üblich, nicht nur die Missgunst seiner Mitschüler, sondern auch körperliche Auseinandersetzungen mit diesen zur Folge gehabt haben könnte, denen Milon nicht gewachsen war. Hadubalt, der ihm beigestellte Beschützer, hatte in seiner Jugendzeit Ähnliches erlebt. Genoss er doch vor seinem Dasein als Sklave, die gleiche für Milon beginnende Bildung. Er könnte es gewesen sein, der Milon, soweit es ihm möglich war, vor dessen Mitschülern beschützte, es aber für klüger hielt, wenn Milon dieser Raufereien von sich aus Herr wird.
Möglich, dass Milon selbst des lahmenden Lämmchens gewahr wurde, es ihm anzusehen war, wie leid ihm das hilfsbedürftige Wesen tat, das auf drei Beinchen versuchte, seiner Herde zu folgen. Hadubalt dies sehend, nahm das Lämmchen auf den Arm, um mit ihm der Herde zu folgen. Das mochte für den noch schwächlichen Milon der Anlass gewesen sein, selbst dem Lämmchen in seiner Not beizustehen. Er ließ sich von Hadubalt das Lämmchen über die Schultern legen. Es könnte zu dieser Zeit nur etwa 8 kg gewogen haben, dennoch kostete der steile Anstieg zur Weide unserem schwächlichen Milon einige Mühe!
Voller Stolz ob seiner guten Tat entschloss sich Milon, das Lämmchen zukünftig des Morgens auf die Weide zu tragen und des Abends wieder zurückzuholen. - Das Schaf könnte dem »Skudde« entsprochen haben. Man nennt es auch »Wikingerschaf«, weil in ihm der Nachfahr jungsteinzeitlicher Wildschafe vermutet wird. Das Skudde ist eine der ältesten Schafrassen, sehr genügsam, wetterunempfindlich, und muss nicht geschoren werden, weil es zweimal jährlich selbstständig sein Vließ abwirft; es könnte das antike Schaf gewesen sein.
Bald spürte Milon, wie er immer kräftiger und ausdauernder wurde, kein Wunder, denn das Lämmchen wuchs rasch zu einem ausgewachsenen Schafbock von etwa 45 kg und mit ihm die Kraft Milons´. Für Milon ergab sich daraus sein erstes »Heureka«12 (Ich hab´s gefunden!), nämlich eine Erkenntnis, die wir heute als »kontinuierliche Belastungssteigerung« bezeichnen und die Milons´ weitere athletische Laufbahn bestimmen sollte. Mir scheint, die Legende vom Schäfer, dessen Lämmchen Milon getragen haben soll, ist aus heutiger Sicht für einen Knaben seines Alters realistischer!
Heute sprechen wir von Überkompensation, wenn wir uns in der Ruhephase nach einer sportlichen Anstrengung nicht nur erholen, sondern aus dieser Belastung gestärkt hervorgehen.
Denn das ungewohnte Bergauftragen ermüdete Milon nicht nur, sondern er erholte sich in der anschließenden Ruhephase über das übliche Maß hinaus; vorsichtshalber bereitete sich sein Körper auf weitere derartige Anstrengungen vor, lagerte eine vergrößerte Energiereserve in der Muskulatur ein. Dies ermöglichte die »Überkompensation«, nämlich eine erhöhte Leistungsfähigkeit, die Milon benötigte, um das sich täglich etwa um 250 Gramm zunehmende Gewicht des Lämmchens erneut tragen zu können.
Also: Während der Erholung wurde das verbrauchte Energiereservoir - über sein normales Niveau hinaus - wieder aufgefüllt, denn dies ist die Voraussetzung für eine erhöhte Leistungsfähigkeit. Im vorliegenden Falle passte sich nach weiterem kontinuierlichen Training Milons´ Muskulatur weiter an, indem sie hypertrophiert.13 Zudem wurde sein Energiestoffwechsel innerhalb der Muskulatur leistungsfähiger und dem angepasst, vervollkommneten sich weitere Stoffwechselprozesse seines Körpers.
Das hier nach heutigen Erkenntnissen interpretierte Geschehen konnte Milon wahrscheinlich nur gefühlsmäßig erfassen, es weckte aber, und das scheint umso wichtiger, seine Beobachtungsgabe, sein »Körpergefühl«. Selbst bei der heute weitgehend ausgeklügelten Trainingsmethodik mit ihren technikbasierenden Testvarianten ist das »Hineinhorchen« der Athleten in ihren Körper noch lange nicht vergessen! – Für Milon scheint dieses Körpergefühl, wie wir es im Laufe seiner Entwicklung immer wieder nachempfinden können, eine wesentliche Voraussetzung für seine überragende Leistungsfähigkeit gewesen zu sein!
Besonders motiviert für sein kontinuierliches, leistungsbetontes Training – als solches könnten wir das Tragen des Lämmchens und seine weiteren sportlichen Aktivitäten bezeichnen – dürfte Milon wegen seiner anfänglichen Unterlegenheit bei Raufereien, die ihm seine Mitschüler aufzwangen, gewesen sein. Hinzu kam das unverhoffte Erfolgserlebnis der kontinuierlich zunehmenden Leistungsfähigkeit. Wobei ihn die Überlieferung ermutigte - nach der Herakles den »Stier von Kreta« auf die Schultern nahm - sein mit dem Lämmchen begonnenes Training fortzusetzen. Es ist anzunehmen, dass er beseelt von den Heldentaten des Halbgottes Herakles, der auch ein Sieger bei Olympia war, in seiner zunächst kindlichen Naivität nach Gleichem strebte.
Das Tragen des Lämmchens, einschließlich des noch zu schildernden Trainings im Gymnasion, sollten wir als einen ganzheitlichen Prozess verstehen: Milon wurde nicht nur kräftiger, sondern sein Körper wurde insgesamt leistungsfähiger. Stellt doch jedwedes Training der Muskulatur gleichzeitig höhere Anforderungen an unseren Organismus, die vergleichbar mit dem Prinzip der Überkompensation die Leistungsfähigkeit des Knochen/Gelenk-Apparates, des Herz-Kreislauf-Systems, des Atemsystems, des motorischen Nervensystems und darüber hinaus des gesamten Nervensystems sowie die Funktion des Stoffwechsels und des Immunsystems ver bessern! Außerdem bietet die Art und Weise wie das »Nerv-Muskel-System« belastet wird, die Möglichkeit, spezielle Varianten sportlicher (aber auch alltagstauglicher) Leistungsvoraussetzungen zu entwickeln. – Wir sprechen vom »Nerv-Muskel-System«, weil jede Muskelaktivität gemäß dem jeweiligen Bewegungsablauf sowie ihrer Eigenschaft (z. B. kräftig, schnellkräftig oder ausdauernd) vom Nervensystem nach einem bestimmten Muster gesteuert wird.
Was hier so »superschlau« nach heutigen Erkenntnissen formuliert ist, sollte uns nicht glauben lassen, dass die alten Griechen keine Ahnung vom sportlichen Training hatten! Immerhin müsste es vor Milons´ erstmaliger Teilnahme an den 60. »Olympischen Spielen der Antike« im alten Griechenland bereits umfangreiche Erfahrungen über das sportliche Training, fußend auf den bereits 59 vorangegangenen »Spielen«, gegeben haben! Wir dürfen demzufolge annehmen, dass langjährige Erfahrungen sowie Intuitionen den Trainern, Ärzten und Beratern ein »gutes Händchen« gaben, um die Planung und Gestaltung des Trainings für unseren »Wunderknaben« bestmöglich zu gestalten, was letztendlich zu Milons´ Erfolgen bei Olympia beitrug!
Gymnastík
Schon zu Zeiten Milons´ benutzte man die Gymnastik, um den ganzen Körper zur höchsten Vollkommenheit zu bilden, dies sowohl körperlich, geistig und moralisch. Schließlich sahen bereits Milons´ Vorfahren in der Vereinigung einer edlen Seele (hier als Gesamtheit aller geistigen Vorgänge und Gefühlsregungen) mit einem schönen Körper das Ideal des Menschen und hielten es schon zu Homers Zeiten für beschimpfend, in der Gymnastik nicht erfahren zu sein. Sogar Milons´ Vater leistete es sich, als freier und finanziell unabhängiger Grieche, bis ins hohe Alter im Gymnasion zu üben und so die Rüstigkeit seines Körpers zu erhalten! Nicht zuletzt, das galt auch für Milon, war die Gymnastik eine notwendige Vorbereitung für den Kriegsdienst, zu welchem jeder freie Bürger verpflichtet war. – In Sparta, das sollte Milon bald erfahren, musste sogar jedes Mädchen im vorgenannten Sinne Gymnastik treiben.
Von öffentlichen Lehrern der Gymnastik in Griechenland ist eigentlich wenig bekannt, vielmehr übten die Knaben in der Palästra14 oder dem Dromos15 vor einstigen Aktiven und interessierten Zuschauern, von denen sie mehr oder weniger hilfreiche Tipps und Belehrungen erhielten; dabei führten vom Staat angestellte Gymnasiarchen die Oberaufsicht.
In Kroton war die speziell den Ringern, Faust- und Allkämpfern (Pankration) vorbehaltene Palästra eine Säulenhalle mit einem Ausbildungsraum (conisterium) für die Athleten. Diese konnten sich im Umkleideraum (ephebeum) für das Training vorbereiten (einölen, mit Sand bestäuben) und nach dem Training stand ihnen ein Bad zur Reinigung und ein Massage- und Salbraum (elaeothesium) zur Verfügung, in denen die auch heute bei uns im Leistungssport gepflegten Maßnahmen zur Regeneration begannen.
Ein dafür bezahlter Gymnast16 (Gymnotribai) lehrte die Kinder gut betuchter Eltern, das vor den gaffenden Zuschauern im Gymnasion nur planlos Geübte, nun in methodischer Folge. Schwerpunkt dabei, der antike Fünfkampf (Pentathlon), also der Diskuswurf, der Weitsprung, der Speerwurf, der Lauf über kurze (im Training aber auch längere) Distanz und Milons´ spätere Lieblingsdisziplin, der Ringkampf. Außerdem konnte Milon im Bad seine Fertigkeiten im Schwimmen üben oder sich am Ballspiel beteiligen. Ballspiele in unterschiedlichen Wettkampf-Varianten waren sehr beliebt; hierbei dominierte Milon dank seiner Übungen im Vorschulalter. Zum Erstaunen des Gymnasten glänzte er nicht nur dank seines Spielwitzes durch immer neue Kombinationen beim Ziel-, Weit- oder Korbball, sondern brillierte auch mit Ideen für neue Spielvarianten. Eine Variante war beispielsweise der »Abwurfball«, bei dem sich zwei gleichstarke Mannschaften in zwei markierten Feldern gegenüberstanden. Im Spiel waren 2 bis 4 größere Bälle, mit denen die Knaben ihre Gegner treffen (abwerfen) konnten. Abgeworfen und damit ausgeschieden war, wen ein Ball traf. Konnte er diesen Ball jedoch fangen, so blieb er im Spiel und versuchte seinerseits, einen Spieler der Gegenmannschaft abzuwerfen. – Ein Kampfspiel, das die Wurfkraft, schnelle Reaktionen, das Orientierungsvermögen, den Gleichgewichtssinn und eine spezielle Schnellkraft verbunden mit der nötigen Kraftausdauer trainierte, wie es im Falle Milons´ ein zukünftiger Ringer braucht!
Alles Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen, mit denen Milon sich körperlich, geistig und moralisch vervollkommnete. Die Übungen in der Gymnastik blieben kein Selbstzweck; wie schon angedeutet, verstand sich der im Kontext der Gymnastik betriebene Fünfkampf,17 dessen Einzeldisziplinen eindeutig auf kriegerischen Handlungen beruhten, als »militärische Grundausbildung«. Letztere ergab sich aus der kriegerischen Landnahme der Griechen, die, hier als Beispiel genannt, in dem durch Sparta vereinnahmten Lakonien dauerhaft zu sichern war, aber auch Folge der partikularistischen Haltung der Stadtstaaten zueinander blieb, die oft zu kriegerischen Auseinandersetzungen führten.
Das systematische Training im Gymnasion zeigte Wirkung. Vor allem der Fünfkampf bewirkte eine vielseitige athletische Ausbildung. Beim Ringen, Weitsprung und Laufen spürte Milon zudem fast täglich den Kraftzuwachs, den ihm das Tragen des jeweils um nahezu 250 Gramm schwerer werdenden Lamms einbrachte, beim