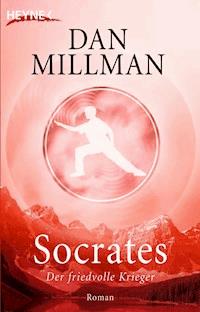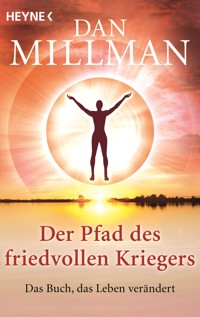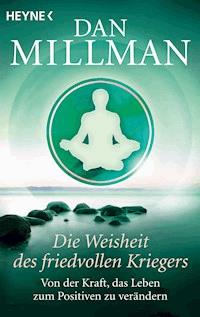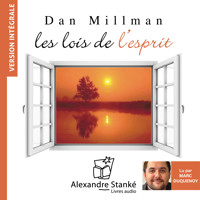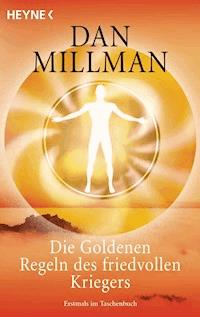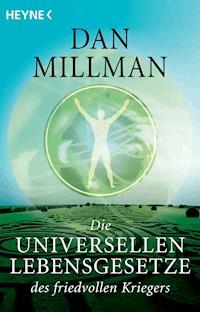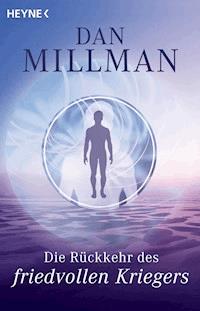DAS BUCH
Jeder, der den »Pfad des friedvollen Kriegers« gelesen hat, fragt sich: Wer eigentlich war Socrates, der friedvolle Krieger? Ein Schamane, ein Erleuchteter? Oder einfach nur ein wunderlicher alter Mann, der Dan Millman ein paar Zaubertricks beibrachte?
In diesem hoch spannenden Roman wird das Geheimnis gelüftet: Dan Millman erzählt die Lebensgeschichte seines einstigen Lehrers Socrates. Die Entwicklung vom brutalen Elitekämpfer der Zarenzeit über den Deserteur, der sich nach Frieden sehnt, hin zum friedvollen Krieger, der sich noch einem letzten Kampf stellen muss – gegen den Mann, der seine Familie ermordet hat.
DER AUTOR
Dan Millman
Socrates
Der friedvolle Krieger
Roman
Aus dem Amerikanischen von Manfred Miethe
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Journeys of Socrates« im Verlag HarperSanFrancisco, USA.
Copyright © by Dan Millman
Published by arrangement with HarperCollins Publishers, Inc.
Copyright © 2004 der deutschen Ausgabe by Ansata Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlagmotiv: © digital stock
Herstellung: Helga Schörnig
ISBN 978-3-641-01283-0V003
http://www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Teil 1 – Bitter und süß: Die zwei Seiten des Lebens
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil 2 – Überleben der Tüchtigsten
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Teil 3 – Wie gewonnen, so zerronnen
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil 4 – Der Weg des Kriegers
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil 5 – Die Mönchsinsel
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Teil 6 – Der Sturm zieht herauf
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Teil 7 – Die Suche nach Frieden
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Lob
NACHWORT
Danksagung
WIDMUNG
Im Laufe der Jahre haben mir zahlreiche Leser von Der Pfad des friedvollen Kriegers unzählige Fragen über den Tankstellenheiligen gestellt, den ich Socrates genannt habe. »Woher kam er?« – »War er jemals verheiratet?« – »Hatte er Kinder?« – »Wer waren seine Lehrer?« – »Welche Erfahrungen haben sein Leben geprägt?«
Heute, Jahrzehnte nach unserer ersten Begegnung, kann ich – ausgehend von den Einträgen in seinem Tagebuch – endlich von den Erfahrungen berichten, die den Charakter des friedvollen Kriegers geformt haben, der mein Mentor werden sollte.
Prolog
Jede Reise hat eine geheime Bestimmung, von welcher der Reisende selbst nichts weiß.
MARTIN BUBER
Ich habe Dimitri Sakoljew getötet.
Dieser düstere Gedanke tauchte wieder und wieder in Sergejs Kopf auf, während er bäuchlings auf einem moosbewachsenen Baumstamm lag und so schnell und leise wie möglich über den Kruglojesee paddelte, der fünfundzwanzig Kilometer nördlich von Moskau liegt. Sergej war aus der Newski-Kadettenanstalt und vor seiner Vergangenheit geflohen, aber der Tatsache, dass er Dimitri Sakoljew getötet hatte, konnte er nicht so leicht entfliehen.
Sergej versuchte, sich parallel zum Ufer zu halten. Ab und zu spähte er durch die Finsternis zu den bewaldeten Hügeln hinüber, die nur auftauchten, um gleich darauf wieder im dichten Nebel zu verschwinden. Die schwarze Oberfläche des Sees, die vom bleichen Licht des Mondes schwach erhellt wurde, wenn er durch die Wolken brach, glänzte bei jedem Eintauchen seiner Arme silbern auf. Die Wasserspritzer und die bittere Kälte lenkten Sergej einen Augenblick lang ab, bevor er wieder an Sakoljews Körper im Schlamm denken musste.
Sergej konnte seine Hände und Beine kaum noch fühlen. Er wusste, er würde bald an Land gehen müssen, weil der vollgesogene Baumstamm ihn nicht ewig tragen würde. Nur noch ein bisschen weiter, dachte er, nur noch einen Kilometer, dann werde ich an Land gehen. Die Flucht über das Wasser war sicher nicht die schnellste oder die sicherste Methode, aber sie besaß einen eindeutigen Vorteil: Auf dem Wasser hinterließ man keine Spuren.
Schließlich hielt er auf das Ufer zu, rollte vom Baumstamm herunter, stand einen Moment lang hüfttief im Wasser, bevor er durch den Schlamm und das Schilf zum Strand hinauf watete, um gleich darauf im dunklen Wald zu verschwinden.
Er war fünfzehn Jahre alt und er war ein Flüchtling.
Sergej liefen nicht nur wegen der Kälte eisige Schauer den Rücken hinunter, sondern auch, weil er ein Gefühl von Bestimmung hatte – als ob jedes Ereignis seines bisherigen Lebens ihn zu diesem Punkt geführt hätte. Während er sich seinen Weg durch das Unterholz zwischen den Kiefern und Birken bahnte, dachte er daran, was ihm sein Großvater erzählt hatte – und wie alles angefangen hatte.
Im Herbst des Jahres 1872 wehte ein eisiger Wind von der moosbewachsenen sibirischen Tundra über die Ural-Berge und die Taiga zu den riesigen Kiefern- und Birkenwäldern, die Sankt Petersburg umgaben – das Kronjuwel von Mütterchen Russland.
Vor dem Winterpalast patrouillierte die Leibgarde von Alexander II. in ihren Wollmützen und schweren Wollmänteln. Die nahe gelegene Newa war nur eine der neunzig Wasserstraßen, die unter achthundert Brücken hindurchflossen, vorbei an Häuserreihen und Kirchen, auf deren Turmspitzen Kreuze funkelten. Nicht weit vom Fluss befanden sich die Parkanlagen, in denen – beleuchtet von den Straßenlaternen, die in der beginnenden Abenddämmerung gerade angezündet worden waren – die Statuen von Peter dem Großen, Katharina der Großen und von Puschkin standen – Zar, Zarin und literarisches Genie.
Der beißende Wind riss die letzten gelben Blätter von den dürren Ästen, spielte mit den Wollröcken der Schulmädchen und zerwühlte das Haar zweier Jungen, die im Hof eines zweistöckigen Hauses miteinander rangen. Eine plötzliche Böe blies die Gardinen im Fenster des zweiten Stockes in ein Schlafzimmer hinein, in dem Natalja Iwanowa, die Frau des Sergej Iwanow stand. Sie zog ihren Schal enger um die Schultern und lächelte in sich hinein, als sie auf den Hof hinuntersah, auf dem ihr kleiner Sohn Sascha mit seinem Freund Anatoli spielte.
Anatoli rannte auf Sascha zu und versuchte, ihn zu Fall zu bringen. Im letzten Moment machte Sascha einen Schritt zur Seite und warf Anatoli über die Hüfte, so wie es ihn sein Vater gelehrt hatte. Vor lauter Stolz krähte er dabei wie ein Hahn. Was für ein starker Junge er doch ist, dachte Natalja. Er kommt ganz nach seinem Vater. Sie bewunderte seine Energie umso mehr, als es ihr im Moment völlig daran fehlte. Seit in ihrem Bauch ihr zweites Kind wuchs, war sie ständig erschöpft, was allerdings auch keine Überraschung war. Ihre Nachbarin Jana Waslakowa, die zugleich auch ihre Hebamme war, hatte sie gewarnt: »Eine so zerbrechliche Frau wie du sollte nicht noch ein Kind haben.« Und doch trug sie wieder ein neues Leben unter dem Herzen und betete täglich, dass ihr die Kraft gegeben werden möge, das Kind auszutragen. Und das trotz der immer häufiger auftretenden Ohnmachtsanfälle und der bleiernen Erschöpfung, die sich in ihren Knochen ausgebreitet hatte.
Natalja zog den Schal fester um die Schultern, weil ihr kalt war. Sie fragte sich, wie kleine Jungen es fertig bringen, an einem so kalten Abend wie diesem draußen zu spielen. Sie lehnte sich aus dem Fenster und rief: »Sascha! Anatoli! Es wird bald regnen. Kommt jetzt rein!« Ihre müde Stimme war gegen den Wind kaum zu hören. Außerdem hörten die Ohren sechsjähriger Jungen sowieso nur das, was sie hören wollten.
Mit einem Seufzer setzte sich Natalja wieder auf das Sofa, auf dem sie sich mit Jana unterhalten hatte, und machte sich daran, ihr langes schwarzes Haar zu bürsten. Schon bald würde Sergej heimkommen. Für ihn wollte sie so schön wie möglich aussehen.
In diesem Moment sagte Jana: »Ruh du dich aus, Natalja. Ich gehe nach unten und hole die Jungen rein.« Während ihre Freundin nach unten ging, hörte Natalja das Geräusch der Regentropfen auf dem Dach und dann direkt über ihr etwas noch anderes: das Trippeln kleiner Füße und verschwörerisches Kichern. Sie sind wieder mal am Spalier hochgeklettert, dachte sie. In einer Mischung aus Zorn und Angst, die alle Mütter von kleinen Jungen kennen, die sich für unverwundbar halten, rief sie nach oben: »Ihr kommt auf der Stelle vom Dach herunter! Und seid vorsichtig!«
Als Antwort hörte sie nur Gelächter und andere Geräusche, die darauf schließen ließen, dass die Jungen oben miteinander rangen.
»Sascha, wenn du nicht sofort runterkommst, sag ich es deinem Vater!«
»Ja, Mamutschka«, rief Sascha mit zuckersüßer Stimme. »Bitte sag Vater nichts.« Darauf folgte weiteres Lachen.
Als Natalja sich umdrehte, um die Bürste wegzulegen, verwandelte sich das Gelächter der Jungen plötzlich in angsterfülltes Kreischen. Einen Augenblick später war es totenstill.
Als Natalja zum Fenster rannte und hinaussah, sah sie zu ihrem Entsetzen dort unten zwei kleine Körper liegen. Sie war wie gelähmt und konnte nur starren und starren. Dann begann Anatoli, sich zu bewegen und zu weinen. Aber Sascha lag mit verdrehten Gliedmaßen weiterhin still da. Jana, die gerade aus der Haustür trat, rannte zu den Jungen hinüber.
Nur einen Wimpernschlag später war Natalja ebenfalls draußen und kniete im Schlamm. Sie spürte weder den Regen noch ihren schweren Bauch. Sie hielt den leblosen Körper ihres Sohnes in den Armen und während ihr Tränen und Regentropfen übers Gesicht strömten, schaukelte sie im ewigen Rhythmus mütterlichen Schmerzes vor und zurück.
Plötzlich riss sie ein stechender Schmerz im Unterleib zurück in die Gegenwart und sie wurde sich bewusst, dass Jana und ein Mann neben ihr standen und zu ihr sprachen. Während Jana ihr auf die Beine half, versuchte der Mann, ihr die Last des toten Sohnes abzunehmen. Natalja wehrte sich zuerst, aber als der schrille Schrei eines Jungen ertönte, erstarrte sie. Voller Hoffnung schaute sie ihren Sascha an, aber es war Anatoli, der geschrien hatte, weil sein Bein gebrochen war und er nach dem ersten Schock nun den Schmerz zu spüren begann.
Jana Waslakowa half Natalja gerade ins Haus, als der Schmerz sie wieder überkam. Sie krümmte sich und brach noch im Hausflur zusammen. »Wo ist mein Sascha?«, fragte sie mit müder Stimme. »Er soll hereinkommen, es ist doch so kalt, so furchtbar kalt.«
Als sie wieder zu sich kam, lag sie umsorgt von der Hebamme im Bett. Und plötzlich kam ihr der Gedanke: Das Baby kommt … Es ist viel zu früh … Zwei Monate zu früh. Oder sind inzwischen Wochen vergangen? Wo bin ich nur? Wo ist Sergej? Er wird mir sagen, dass dies alles nur ein böser Traum ist. Sergej wird mich anlächeln, über mein Haar streichen und mir sagen, dass es Sascha gut geht … dass alles gut ist. Aber der Schmerz! Irgendetwas stimmt nicht. Wo ist Sascha? Wo ist Sergej?
Als Sergej Iwanow nach Hause kam, standen die Nachbarn mit bedrückten Mienen im Regen im Hof. Als er in ihre Gesichter sah, stürmte er voller böser Vorahnungen ins Haus. Jana erzählte ihm, was geschehen war: Sascha war tot, vom Dach gefallen. Bei Natalja hatten die Wehen eingesetzt, die Blutung konnte nicht gestillt werden, man konnte nichts tun. Beide waren verloren.
Aber das Baby lebte. Es war ein Sohn. Aber klein und zerbrechlich, wie ein Frühgeborenes nun einmal ist, würde er wohl kaum überleben. Jana Waslakowa hatte in ihrem Leben viel gesehen und war mit dem Tod vertraut. Der Tod ist leicht, dachte sie, aber nicht für die, die zurückbleiben. Schon bald würde der Priester kommen und Natalja und Sascha die letzten Sakramente geben – und wahrscheinlich auch dem Neugeborenen. Sie legte Sergej seinen Sohn in die Arme und trug ihm auf, dem Baby etwas Ziegenmilch einzuflößen, was ihn möglicherweise durch die Nacht bringen würde.
Sergej sah in das zerknitterte kleine Gesicht und auf den winzigen Körper, der in die Decke eingewickelt war, die Natalja selbst gewebt hatte. Als ihn die Trauer übermannte, setzte er sich auf einen Stuhl und starrte mit blinden Augen zu Boden. Nur vage und wie von fern hörte er die Stimme von Jana Waslakowa: »Bevor sie starb, sagte Natalja, dass sie Sie von ganzem Herzen liebe. Dann bat sie noch darum, dass Sie ihren Sohn in die Obhut ihrer Eltern geben mögen.«
Noch im Tod hatte Natalja nur das Wohl ihres Sohnes im Auge gehabt – und das ihres Mannes. Sie wusste, dass Sergej, ein Angehöriger der Leibgarde des Zaren, sich nicht um ihren kleinen Sohn würde kümmern können. Hatte sie auch geahnt, dass ihn sein Anblick auf ewig an diesen tragischen Tag und an den Verlust seiner geliebten Frau erinnern würde?
Der Priester kam und taufte das Baby, damit es nicht – sollte es tatsächlich sterben – der ewigen Verdammnis anheim fallen würde. Als der Priester nach dem Namen fragte, erwiderte Sergej, der nicht richtig zugehört hatte, zerstreut: »Sergej«, weil er dachte, der Priester habe ihn nach seinem Namen gefragt. Und so erhielt der Sohn den Namen des Vaters.
Jana, die Hebamme, bot sich an, die Nacht über auf den Kleinen aufzupassen. Sergej nickte langsam und sagte: »Sollte er bis zum Morgen überleben, bringen Sie ihn bitte zu seinen Großeltern.« Er gab ihr Namen und Adresse: Heschel und Esther Rabinowitz. Es behagte ihm überhaupt nicht, dies zu tun, denn Nataljas Eltern waren Juden, aber er spürte, dass sie das Kind lieben und liebevoll aufziehen würden. Also erfüllte er Natalja ihren letzten Wunsch. Sergej hatte ihr im Leben niemals etwas abschlagen können, wie konnte er es da im Tod tun?
Und während der Sohn sich an sein kleines Leben klammerte, begann für Sergej Iwanow eine lange Reise in die Finsternis, die schließlich zu seinem Tod führen sollte.
Acht Jahre später saß Heschel Rabinowitz in einer dunklen Oktobernacht allein in einem Abteil dritter Klasse in einem Zug nach Moskau. Nachdenklich sah er aus dem Fenster, wobei ihm – wie bei alten Männern üblich – von Zeit zu Zeit die Augen zufielen, sodass er die Wälder und kleinen Dörfer nicht sah, die im ersten Licht des Tages sichtbar wurden. Heschel döste und träumte. Ab und zu erwachte er und starrte vor sich hin, aber alles, was er sah, waren Erinnerungen, die durch seinen Kopf geisterten. Seine Tochter Natalja in ihrem roten Kleid und ihrem strahlenden Lächeln; Sascha, der Enkel, den er nie gesehen hatte; das wunderschöne faltige Gesicht seiner geliebten Esther. Sie alle waren von ihm gegangen.
Einen Augenblick lang kniff er die Augen zu, als könne er dadurch die Vergangenheit vertreiben. Doch dann entspannten sich seine Gesichtszüge, als vor seinem geistigen Auge eine neue Vision auftauchte: das Gesicht eines dreijährigen Jungen, der mit Augen, die viel zu groß für sein kleines Gesicht waren, vertrauensvoll zu seinem Großvater emporblickte.
Durch die Stimme des Schaffners, der die Ankunft des Zuges ankündigte, wurde Heschel aus seinen Träumen gerissen. Gähnend stand er auf, streckte die schmerzenden Glieder und zog seinen alten Mantel enger um sich. Er strich über seinen schneeweißen Bart und rückte die Brille auf seiner riesigen Nase gerade. Er nahm kaum wahr, dass ihn die anderen Passagiere stießen und schubsten. Er drückte seine Tasche gegen die Brust, so als ob er ein Baby darin tragen würde, stieg auf den Bahnsteig hinunter und begann mühsam vorwärts zu gehen. Als er nach oben in den Himmel blickte, sah er, dass es bald anfangen würde zu schneien.
Heschel rückte seine Mütze gerade und versuchte sich auf sein Ziel im Norden zu konzentrieren. Er würde eine Mitfahrgelegenheit im Karren oder Wagen eines mitleidigen Bauern finden müssen, denn sein Ziel lag eine halbe Tagesreise weit entfernt in den Hügeln nördlich von Moskau. Die Reise würde ihn über schlammige Wege hin zu einer Kadettenanstalt am Ufer des Kruglojesees führen.
Er wusste, es würde keine leichte Reise werden. Sein Rücken, gebeugt durch zahllose Stunden an der Werkbank, war gekrümmt wie die Geigen, die er aus Ahorn-, Fichten- und Ebenholz herstellte. Außerdem baute er auch Präzisionsuhren. Er hatte schon als Junge beide Handwerke erlernt – eines von seinem Vater und das andere von seinem Großvater. Da er sich nicht entscheiden konnte, was er lieber tat, baute er immer erst eine Geige, dann eine Uhr, immer abwechselnd. Selbst heute und trotz der Schmerzen in den Gelenken arbeitete er noch unermüdlich und ging an die Herstellung jeder neuen Geige heran, als ob es seine erste wäre, und an jede Uhr, als ob es seine letzte wäre.
Schon bald nachdem er seine beiden Ausbildungen abgeschlossen hatte, hatte ihm der Vater die Leitung der Werkstatt übertragen und war nach Osten gereist, um mit Edelsteinen zu handeln. Später hatten es der Reichtum und die Großzügigkeit seines Vaters dem Juden Heschel ermöglicht, weiterhin in Sankt Petersburg zu leben, wo er und seine Frau Esther eine Wohnung hatten.
Heschel gab sich einen Moment lang diesen Erinnerungen hin, während er den Bahnhof verließ und sich langsam auf den Weg zur großen Ausfallstraße aus der Stadt machte.
Ein paar Stunden später saß er auf einem Bauernkarren, der auf der engen, schlecht unterhaltenen Straße nach Norden rumpelte, und lehnte sich dankbar gegen einen Kartoffelsack. Als der Karren schließlich quietschend zum Halten kam, stieg er ab, nickte dem Bauern dankend zu und machte sich zu Fuß auf, den Rest des Weges hinter sich zu bringen.
Während er in das Tal hineinwanderte, dachte er an die vielen Bittbriefe, die er in den letzten fünf Jahren geschrieben hatte, und an die ebenso zahlreichen Ablehnungsbescheide. Vor ein paar Wochen hatte er dann einen letzten Versuch gemacht: Er hatte Wladimir Iwanow, dem Leiter der Kadettenanstalt, einen Brief geschrieben, in dem es hieß: Ich habe Sergej nicht gesehen, seit er in die Anstalt gebracht wurde. Inzwischen ist meine Frau gestorben. Keiner meiner Verwandten ist mehr am Leben. Dies ist meine letzte Gelegenheit, meinen Enkel zu sehen.
Und vor zwei Tagen war die Antwort gekommen und mit ihr die Genehmigung, Sergej zu besuchen. Heschel hatte sich sofort auf den Weg gemacht.
Im beißenden Wind zitternd, der ihm in den Nacken blies, schlug er den Kragen seines Wollmantels höher. Ich habe zwei Tage, dachte er, nur zwei kurze Tage, um den Geist eines achtjährigen Jungen mit den Erfahrungen meines Lebens zu füllen.
Dann fiel ihm ein, was Rabbi Hillel einmal gesagt hatte: »Kinder sind keine Gefäße, die gefüllt, sondern Kerzen, die angezündet werden müssen.«
»Ich habe nicht mehr viel Feuer«, murmelte Heschel, als er einen schneebedeckten Abhang vorbei an Birken und Kiefern hinunterstolperte. Seine schmerzenden Gelenke erinnerten ihn an seine Sterblichkeit und an diese letzte Aufgabe, die er sich selbst gestellt hatte. Das Heulen des Windes trat in den Hintergrund, während er sich an einen Tag vor fünf Jahren erinnerte, an dem ein Soldat mit einem Brief von Sergejs Vater zu ihm gekommen war, in dem stand, dass der Sohn zur Newski-Kadettenanstalt gebracht werden sollte.
Ein Stunde später näherte sich Heschel dem Haupttor eben dieser Kadettenanstalt. Staunend betrachtete er den Gebäudekomplex, der wie eine Burg von einer vier Meter hohen Mauer umgeben war. Direkt vor sich konnte er eine Reihe spartanisch anmutender Blockhäuser sehen. Weder Pflanzen noch Verzierungen milderten die Strenge der Mauern, hinter denen – so nahm er an – das Leben der jungen Soldaten von Strenge und Disziplin bestimmt war.
Teil 1
Bitter und süß: Die zwei Seiten des Lebens
Ich erzähle eine traurige Geschichte und eine frohe.Am Schluss wirst du erkennen, dass es sich um ein- unddieselbe Geschichte handelt, denn bitter und süßhaben jeweils ihre eigene Zeit. Sie wechseln sich ab wieder Tag und die Nacht – selbst jetzt in den Stundender Dämmerung meines Lebens.
1
Als Sergej an jenem Oktobertag zu seinem Onkel befohlen wurde, schwante ihm nichts Gutes.
Es war ihm verboten, Wladimir Iwanow als seinen Onkel zu betrachten, für ihn war er Kommandant Iwanow. Es war ihm auch verboten, dem Kommandanten persönliche Fragen zu stellen, obwohl er viele hatte – zum Beispiel Fragen in Bezug auf seine Eltern und seine Vergangenheit. Der Kommandant hatte Sergej weder über das eine noch das andere viel erzählt. Er hatte ihm lediglich vor vier Jahren bekannt gegeben, dass sein Vater gestorben war.
Zum Kommandanten befohlen zu werden – was äußerst selten vorkam – bedeutete entweder, dass es schlechte Nachrichten gab oder dass man bestraft werden sollte. Da er verständlicherweise keine Eile hatte, vor dem Kommandanten mit seiner strengen Miene und seiner ständig gerunzelten Stirn zu erscheinen, schlenderte Sergej in einem völlig unmilitärischen Tempo über den Platz.
Jeder Fleck, an dem Sergej vorbeikam, rief Erinnerungen wach: Der Pferch zum Beispiel erinnerte ihn an das erste Mal, als er auf einem wild um sich tretenden Pferd gesessen hatte. Er hatte sich verzweifelt an die Zügel geklammert und versucht, sich seine Todesangst nicht anmerken zu lassen. Ein freier Platz erinnerte ihn an die vielen Kämpfe, in die er aufgrund seines Jähzornes schon verwickelt worden war.
Er ging erst am Lazarett vorbei und dann an der kleinen Wohnung von Galina, der ältlichen Krankenschwester, die sich seiner zuerst angenommen hatte. Sie hatte ihm über die Wange gestrichen, als er krank war, und ihn zum Essen gebracht, bis er sich selbst zurechtgefunden hatte. Da er zu jung war, um in den regulären Stuben der Kadetten zu bleiben, hatte er in den ersten zwei Jahren auf einer Pritsche im Lazarettflügel schlafen müssen. Es war eine einsame Zeit gewesen, da er seinen Platz noch nicht gefunden hatte. Die anderen Kadetten hatten ihn wie ein Maskottchen oder ein Haustier behandelt: An einem Tag hatten sie ihn gestreichelt, am nächsten Tag getreten.
Die meisten anderen Jungen hatten ein Zuhause, einen Vater und eine Mutter, aber Sergej hatte nur seinen Onkel, deshalb strengte er sich nach Kräften an, um seinem Onkel zu gefallen. Seine Bemühungen brachten ihm allerdings nur den Zorn der älteren Kadetten ein, die ihn höhnisch als »Onkel Wladis Junge« betitelten. Sie quälten ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit, sie schubsten und schlugen ihn oder stellten ihm ein Bein. Jeder Moment der Unaufmerksamkeit bedeutete einen neuen blauen Fleck oder etwas Schlimmeres. Es war allgemein üblich, dass die älteren Kadetten auf den jüngeren herumtrampelten, und Prügeleien waren an der Tagesordnung. Die Instruktoren wussten davon, aber sie sahen einfach weg, solange niemand ernsthaft verletzt wurde. Sie tolerierten die Prügeleien, weil die jüngeren Kadetten dadurch wachsamer und härter wurden. Schließlich befanden sie sich in einer Kadettenanstalt.
Als Sergej zum ersten Mal von einem älteren Kadetten angegriffen wurde, hatte er wie wild um sich geschlagen, weil er ahnte, dass die Übergriffe nie aufhören würden, wenn er jetzt klein beigab. Der ältere Junge verprügelte ihn nach Strich und Faden, aber immerhin gelang es Sergej, ein oder zwei Treffer zu landen. Danach belästigte ihn der Junge nie wieder. Einmal war Sergej dazugekommen, als zwei Kadetten einen Neuankömmling verprügelten. Er hatte die beiden wie ein wütender Bulle angegriffen, woraufhin sich diese zurückzogen und so taten, als wäre das Ganze nur ein Witz gewesen. Aber für den Neuen, dessen Name Andrej war, war es kein Witz gewesen. An diesem Tag wurde er der einzige wirkliche Freund, den Sergej jemals gehabt hat.
Als Jüngster der ganzen Anstalt schlief Sergej in einem Gebäude mit den Sieben- bis Zehnjährigen. Die älteren Jungen schliefen im ersten Stock und alle über sechzehn waren in einem anderen Gebäude untergebracht. Die Älteren waren die Herrscher der Stuben. Alle Kadetten hatten Angst davor umzuziehen, da sie dann wieder die Jüngeren und damit die Opfer sein würden. Sergej und Andrej beschlossen, gut aufeinander aufzupassen.
Vom Leben vor seiner Ankunft hatte Sergej nur verschwommene Erinnerungen. Es schien ihm, als wäre er in einer gänzlich anderen Welt gewesen. Manchmal tauchten in seiner Erinnerung Bilder von einer dicken Frau mit weichen Armen und einem Mann mit einem Kranz aus weißem Haar auf. Sergej fragte sich oft, wer sie wohl gewesen waren. Er fragte sich überhaupt viele Dinge.
An der Wand des Klassenzimmers hingen Karten von Mütterchen Russland und anderen Ländern. Mit den Fingern war Sergej auf den Karten und auf dem Globus auf dem Pult des Klassenlehrers herumgewandert und hatte die Umrisse blauer Ozeane und gelber, grüner und roter Länder nachgezeichnet. Es wäre ihm im Traum nicht eingefallen, dass er diese Länder einmal besuchen könnte.
Seine Welt war bis zu jenem Oktobertag im Jahr 1880 auf die hohen Mauern, die Blockhäuser, die Schlafgebäude, Klassenzimmer und Exerzierplätze der Newski-Kadettenanstalt beschränkt gewesen. Sergej hatte sich diesen Ort nicht ausgesucht, aber er akzeptierte ihn so, wie Kinder es nun einmal tun müssen. Seine frühen Jahre waren durch den geregelten Tagesablauf aus Unterricht, Körperertüchtigung und Disziplin geprägt, durch das Studium von Militärgeschichte, Strategie und Geographie, durch Reiten, Laufen, Schwimmen und Gymnastik.
Wenn die Kadetten nicht im Unterricht waren oder arbeiteten, dann übten sie sich in den militärischen Künsten. Im Sommer lernte Sergej im kalten Kruglojesee unter Wasser zu schwimmen und durch ein Schilfrohr zu atmen. Er übte den Kampf mit dem Säbel und schoss Pfeile mit einem Bogen ab, den er kaum zu spannen vermochte. Später würde er auch mit der Pistole und dem Karabiner schießen lernen.
Es war weder ein gutes noch ein schlechtes Leben: Er kannte einfach kein anderes.
Als Sergej sich dem Hauptgebäude näherte, steckte er seine dunkelblaue Bluse ordentlich in seine dunkelblauen Hosen und überprüfte, ob seine Stiefel blank genug waren. Einen Augenblick lang überlegte er, ob es nicht angebracht gewesen wäre, die Ausgehuniform mit Handschuhen anzuziehen, aber dann verwarf er den Gedanken wieder. Die meisten älteren Jungen sahen fesch darin aus, aber er versackte immer noch fast in der viel zu großen Uniform. Wenn er zu groß für eine alte Uniform geworden war, gab man ihm stets eine gebrauchte neue, die wiederum viel zu groß für ihn war.
Immer noch in Gedanken versunken, schlurfte Sergej über die Steinfliesen des langen Korridors zur Amtsstube seines Onkels. Er dachte daran, wie er vor vier Jahren zum letzten Mal dorthin befohlen worden war. Er konnte sich noch gut an das hagere, strenge Gesicht des Kommandanten erinnern, der ihm befohlen hatte, sich zu setzen. Sergej war auf einen Stuhl geklettert, seine Füße hatten in der Luft gebaumelt und er hatte kaum über den Rand des Pultes schauen können, als sein Onkel die Worte sagte, die sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingebrannt hatten. »Dein Vater ist gestorben. Sein Name war Sergej Borisowitsch Iwanow. Er gehörte der Leibgarde unseres Zaren Alexander an. Er war ein guter Mann und ein Kosak. Du musst dich nach Kräften anstrengen, um so zu werden wie er.«
Sergej hatte nicht gewusst, was er fühlen oder wie er reagieren sollte, deshalb hatte er einfach nur genickt.
»Hast du irgendwelche Fragen?«, hatte der Kommandant ihn gefragt.
»Wie … Wie ist er gestorben?«
Erst Stille, dann ein Seufzer. »Dein Vater hat sich zu Tode gesoffen. Was für eine Verschwendung!«
Damit war Sergej entlassen worden. Er erinnerte sich noch, wie leichenblass das Gesicht seines Onkels an jenem Tag gewesen war.
Er hatte die Amtsstube mit so vielen widerstreitenden Gefühlen verlassen, dass es schwer für ihn war, herauszufinden, was er eigentlich fühlte. Es machte ihn traurig, dass sein Vater gestorben war. Andererseits hieß das, dass sein Vater einmal gelebt, ihn aber nie besucht hatte. Er war stolz, dass auch in seinen Adern Kosakenblut floss und dass er eines Tages so stark wie der Vater sein würde, den er nie gekannt hatte.
Sergej kam zurück in die Gegenwart, als er vor der Tür seines Onkels ankam. Er wollte gerade klopfen, als er von drinnen gedämpfte Stimmen hörte.
»Dieser Besuch, um den Sie mich bitten«, hörte er die Stimme seines Onkels sagen, »ich werde ihn gestatten, obwohl andere nicht der Meinung sind, das ich es tun sollte. Viele Leute schätzen die Juden, die Mörder unseres Herrn, nicht besonders.«
»Und ich schätze Soldaten, die Mörder der Juden, nicht besonders«, erwiderte eine ältere Stimme, die Sergej nicht kannte.
»Nicht alle Soldaten hassen die Juden«, antwortete sein Onkel.
»Und Sie?«, fragte die andere Stimme.
»Ich hasse nur Schwäche.«
»So wie ich Dummheit hasse.«
»Ich bin nicht so dumm, dass ich mich von Ihrem jüdischen Intellekt austricksen lassen würde«, sagte der Kommandant.
»Und ich bin nicht so schwach, dass ich mich von Ihrem Kosakengehabe einschüchtern lassen würde«, erwiderte der andere Mann und fügte dann etwas freundlicher hinzu: »Wissen Sie, mit Ihrem Mut und meinem Verstand hätten wir viel erreichen können.«
In der eintretenden Stille fand Sergej den Mut, dreimal an die Tür zu klopfen.
Als sie sich öffnete, erblickte er seinen Onkel und einen alten Mann. Sein Onkel sagte knapp: »Kadett Iwanow, das hier ist dein Großvater.«
2
Heschel breitete instinktiv die Arme aus, um seinen Enkel zu umarmen. Aber als ihm klar wurde, dass der Junge keine Ahnung hatte, wer er war, senkte er die Arme wieder und streckte stattdessen seine große Hand aus, um Sergejs kleine Hand zu schütteln.
»Hallo Sergej, ich freue mich, dich zu sehen. Ich wäre schon viel eher gekommen, aber … Nun ja, jetzt bin ich da.«
Kommandant Iwanow unterbrach ihn. »Hol deine Sachen, Kadett Iwanow. Du hast zwei Tage Urlaub.«
Und zu Heschel gewandt, sagte er: »Sorgen Sie dafür, dass der Junge spätestens Sonntagmittag zurück ist. Ich erwarte, dass er dann seine Ausbildung wieder aufnimmt. Er hat noch viel zu lernen.«
»Das hat er tatsächlich«, antwortete Heschel und nahm Sergej bei der Hand.
Als der Kommandant sie mit einer Handbewegung entließ, gingen Sergej und sein Großvater aus der Tür, den langen Korridor hinunter, durch das eiserne Tor und auf einem schneebedeckten Pfad zu den bewaldeten Hügeln hinauf.
Heschel, der etwa Mitte achtzig war – er hatte seine Geburtstage nicht mehr gezählt, seit Esther gestorben war -, ging langsam und mit Mühe, aber Sergej, der von der plötzlichen Freiheit wie berauscht war, hüpfte fröhlich voran. Der Junge hatte keine Worte, mit denen er sein Glück hätte ausdrücken können. Es schien ihm, als sei er plötzlich nicht mehr nur irgendein Kadett, sondern ein richtiger Junge mit einem richtigen Großvater und damit einer richtigen Familie.
Sie bahnten sich ihren Weg durch den Wald, bis sie zu einem großen Felsen kamen. Heschel nahm eine Landkarte heraus und zeigte sie dem Jungen. »Siehst du hier den See und dort die Anstalt? Hier ist der Felsen, vor dem wir jetzt stehen.« Er zeigte auf einen Punkt auf der Karte. »Und das hier ist unser Ziel.« Dabei zeigte er erst auf ein Kreuz auf der Karte und wies dann mit der Hand den Hügel hinauf. Sergej hatte nur rudimentäre Kenntnisse im Kartenlesen, aber sie reichten aus, um zu verstehen, was ihm sein Großvater zeigte, und es sich einzuprägen.
Nachdem er die Karte wieder eingesteckt hatte, starrte Heschel den schmalen Pfad hinauf, der im Schnee kaum noch zu erkennen war. Dann sah er auf seine Taschenuhr und runzelte die Stirn. »Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit dort sein«, sagte er.
Sergej, der gewohnt war zu gehorchen, stellte keine Fragen, obwohl sein Kopf vor lauter Neugier schmerzte. Da er spürte, dass es ihm erlaubt war, Fragen zu stellen, wagte er es und fragte: »Gehen wir zu deinem Haus?«
»Mein Haus ist zu weit weg«, antwortete Heschel. »Wir werden die nächsten beiden Tage bei Benjamin und Sara Abramowitsch verbringen. Ich kenne Benjamin seit vielen Jahren, aber das ist eine andere Geschichte.«
»Haben sie Kinder?«
Heschel lächelte, weil er die Frage erwartet hatte. »Ja, zwei. Awrom ist zwölf und die kleine Leja ist fünf.«
»Die Namen hören sich komisch an.«
»Es sind jüdische Namen. Heute Abend feiern wir den Sabbat.«
»Was ist Sabbat?«, fragte Sergej.
»Sabbat ist der heilige Tag, an dem wir ruhen und Gottes gedenken sollen.«
»So wie am Sonntag?«
»Ja, aber der Sabbat beginnt am Freitagabend, wenn die ersten drei Sterne hervorkommen. Deshalb müssen wir uns beeilen.«
Damit konzentrierte sich der alte Mann wieder auf den Weg und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Der übermütige Achtjährige aber hüpfte von einem Stein zum anderen wie eine Gämse, bis er hinter sich die Stimme seines Großvaters hörte. »Sei vorsichtig, Socrates, die Steine sind schlüpfrig.«
Da war er wieder, dieser Name, den er schon in der Amtsstube seines Onkels gehört hatte. Sergej nahm all seinen Mut zusammen und fragte: »Warum sagst du Socrates zu mir?«
»Deine Großmutter und ich haben dich, seit du ein Baby warst, immer unseren kleinen Socrates genannt. Es war unser Kosename für dich.«
»Aber warum?«
Heschels Augen nahmen einen verträumten Ausdruck an, als sein Geist sich der Vergangenheit zuwandte. »Als Natalja, deine Mutter, ein kleines Mädchen war, las ich ihr aus dem Talmud und der Thora und anderen Weisheitsbüchern vor, unter anderem auch aus den Büchern der großen Philosophen. Am liebsten hatte sie einen Griechen namens Socrates, der vor vielen, vielen Jahren lebte. Er war einer der weisesten und besten Menschen, die je gelebt haben.«
Heschel blickte in die Ferne und in den Himmel hinauf. Dann fuhr er fort: »Wir nannten dich ›kleiner Socrates‹, weil wir uns so an deine Mutter, unsere Tochter, erinnern konnten.«
»Gefiel Socrates meiner Mutter wegen seiner Weisheit so sehr?«
»Ja, das auch, aber vor allem wegen seiner Tugendhaftigkeit und seiner Charakterstärke.«
»Was hat er denn gemacht?«
»Socrates lehrte die jungen Männer Athens die höheren Werte wie Tugendhaftigkeit und Friedfertigkeit. Er behauptete, der unwissendste aller Menschen zu sein, aber er stellte kluge Fragen, die Wahrheit oder Lüge ans Tageslicht brachten. Er war nicht nur ein Denker, er war auch ein Mann der Tat. In seiner Jugend war er ein Ringer und ein tapferer Soldat, bis er den Krieg endgültig hinter sich ließ. Ich denke, man könnte ihn wohl zu Recht als einen friedvollen Krieger bezeichnen.«
Zufrieden wandte Sergej seine Aufmerksamkeit wieder der verschneiten Landschaft zu. Die späte Nachmittagssonne ließ die weißen Hügel glitzern und schien auf die Bäume, Moose und Flechten. Durch die frische klare Luft und das Abenteuer belebt, rannte Sergej voraus, zwang sich dann aber, auf seinen Großvater zu warten. Während er wartete, dachte er über das Wort »Jude« nach. Er hatte es schon ein paar Mal in der Anstalt gehört.
»Großvater«, rief er, »bist du ein Jude?«
»Ja«, erwiderte Heschel keuchend und kam langsam näher. »Und du auch, denn deine Mutter war Jüdin und dein Vater … Na ja, dein Vater war kein Jude, aber trotzdem hast du jüdisches Blut.«
Sergej sah auf seine Hände, die von der Kälte gerötet waren. Kosakenblut und Judenblut. »Großvater …«
»Du kannst gern Opa zu mir sagen, wenn du möchtest«, unterbrach ihn Heschel und setzte sich auf einen schneebedeckten Stein, um sich einen Moment auszuruhen.
»Opa.« Sergej stockte einen Augenblick, denn das neue Wort war für ihn noch ungewohnt. »Kannst du mir etwas über meine Mutter und meinen Vater erzählen?«
Heschel fegte mit der Hand den Schnee von einem anderen Stein und bedeutete Sergej, sich ebenfalls zu setzen. Nachdem er eine Weile darüber nachgedacht hatte, was er dem Jungen erzählen sollte, begann er mit der Geschichte seiner Geburt. Er erzählte ihm alles, was er von Jana Waslakowa, der Hebamme, über diesen schicksalsschweren Tag erfahren hatte.
Als er fertig war, standen die beiden auf und setzten schweigend ihren Weg fort. Es ist gut, dem Jungen Zeit zu lassen, alles, was er gehört hat, beim Gehen zu verdauen, dachte Heschel. Nach einer Weile fügte er der Geschichte noch etwas hinzu. »Du warst dieser kleine Junge, Socrates, ein kleiner Lichtstrahl an einem dunklen Tag. Du hattest eine Mutter und einen Vater, die dich lieb hatten.«
Sergej sah, dass sich sein Großvater ein paar Tränen aus den Augen wischte. »Bist du traurig, Opa?«
»Lass mich einen Moment, mein kleiner Socrates. Gleich geht es mir besser. Ich musste nur an deine Mutter denken, an meine Tochter Natalja.«
»Wie war sie denn, meine Mutter?«
Heschels Miene nahm wieder einen geistesabwesenden Ausdruck an, als er traurig antwortete: »Natürlich ist jede Tochter in den Augen des Vaters das wunderbarste Geschöpf auf der ganzen Welt, aber nicht alle Töchter waren so weise und so mitfühlend wie deine Mutter. Sie hätte jeden anständigen jüdischen Mann glücklich gemacht … Wenn er sich an ihren scharfen Intellekt gewöhnt hätte«, fügte er nach einer Pause lächelnd hinzu.
Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht, als er fortfuhr: »Ich weiß nicht genau, wo sie deinen Vater kennen gelernt hat, vielleicht auf dem Markt, aber als er uns das erste Mal besuchte, erfuhren wir, dass er kein Jude war. Schlimmer noch, er war ein Kosak und gehörte der Leibgarde des Zaren an, der wahrlich kein Freund unseres Volkes ist.«
»Aber er hat meine Mutter geheiratet und du hast gesagt, er wäre gut zu ihr gewesen.«
»Ja, aber weißt du, deine Mutter konnte ihn nicht heiraten, ohne ihren jüdischen Glauben aufzugeben und zum Christentum überzutreten.« Heschel brach ab, damit Sergej die ganze Tragweite dieser furchtbaren Tragödie erfassen konnte.
»Hat sie dich denn nicht mehr besucht?«
»Nein, nein, so war es nicht.« Heschels Gesicht verzog sich zu einer Grimasse des Schmerzes.
»Opa, geht es dir gut?«
Heschel beschwichtigte den Jungen mit einer Handbewegung. »Ich war es, der den Kontakt abbrach. Ich behandelte meine eigene Tochter, als ob sie gestorben wäre.«
Er fing an, offen zu weinen, während die Worte nur so aus ihm hervorbrachen. »Ich erwarte nicht, dass du verstehen kannst, wie ich etwas so Schreckliches tun konnte, mein kleiner Socrates. Ich verstehe es selbst nicht. Aber aus meinem Mund kamen furchtbare Worte. Ich kehrte ihr den Rücken zu, weil ich glaubte, sie habe ihrem Volk den Rücken gekehrt. Ich konnte nicht anders. Deine Großmutter Esther hatte keine andere Wahl, als sich ebenso zu verhalten wie ich, obwohl es ihr das Herz brach.«
Heschel zwang sich weiter zu erzählen. »Deine Großmutter wollte unbedingt mit ihrer Tochter sprechen und sie noch einmal in die Arme schließen. Konnte sie denn wirklich glauben, ich hätte etwas anderes gewollt?«, sagte Heschel mehr zu sich selbst als zu Sergej. Seine Gedanken schweiften wieder in die Vergangenheit zurück. Er hatte völlig vergessen, dass er auf einem eiskalten Felsen mitten im Wald saß.
Als er wieder zu sprechen anfing, klang seine Stimme müde. »Als wir erfuhren, dass unser erstes Enkelkind geboren worden war – dein Bruder Sascha -, hatten Esther und ich einen furchtbaren Streit. Sie flehte mich an, sie zu ihrer Tochter gehen zu lassen, sie um Vergebung bitten zu dürfen und ihren Enkel zu sehen. Aber ich ließ sie nicht. Ich erlaubte meiner geliebten Esther nicht einmal, die Briefe unserer Tochter zu beantworten.«
»Wir haben den kleinen Sascha niemals gesehen«, fuhr er mit erschöpfter Stimme fort. »Wir erfuhren nur aus den Briefen deiner Mutter etwas über ihn. Die Briefe waren wie ein Schatz für uns, aber wir haben sie nie beantwortet. Ich brachte es nicht über mich, sie zu lesen, aber deine Großmutter erzählte mir alles, was darin stand. Wir sprachen nie wieder mit deiner Mutter, noch sahen wir sie jemals wieder. Nicht solange sie lebte.«
Heschel schnäuzte sich die Nase und wischte seine nassen Wangen mit dem Ärmel ab. Sergej hätte am liebsten auch geweint.
Als sie weitergingen, fielen die ersten Schneeflocken. Heschel nahm Sergejs Hand und sagte leise: »Es gibt da noch etwas, das du wissen solltest, mein kleiner Socrates. Du Hebamme, die dich zu uns brachte, erzählte uns, dass deine Mutter dich noch eine Weile im Arm hatte, bevor sie starb.«
»Warum musste sie denn sterben, Opa?«
»Warum muss überhaupt irgendjemand sterben? Es ist nicht für uns bestimmt, dies zu wissen.« Er hielt einen Augenblick an, bückte sich und pflückte eine rote Blume aus dem Schnee.
»Deine Mutter war zerbrechlich und doch stark. So wie diese Blume, die im Winter blüht. Die Blume ist ganz und gar rein und unschuldig und doch habe ich sie gepflückt. Gott hat Natalja gepflückt, ihre Zeit war gekommen. Ich wünschte nur …«
Wieder zog sich Heschel in seine eigene Welt zurück und nach einer Weile nahm sein Gesicht einen friedlicheren Ausdruck an.
»Ja, Esther«, sagte er zu jemand, den Sergej nicht sehen konnte. »Ich weiß, alles wird gut.«
Dann legte er dem Jungen die Hand auf die Schulter und sie gingen schweigend weiter. Sergej dachte darüber nach, was ihm sein Großvater erzählt hatte: dass seine Mutter ihn vor ihrem Tod an ihr Herz gedrückt hatte. Und plötzlich war ihm nicht mehr gar so kalt.
Nun kannte er die Geschichte seiner Geburt und der Todesfälle, die sie begleitet hatten. Er spürte instinktiv, dass die Trauer seinen Großvater bis zu seinem Tod begleiten würde, wenn alle Sorgen endlich von ihm genommen werden würden. Jetzt freute er sich vor allem darüber, dass sich die Miene seines Großvaters aufgehellt hatte.
3
Die bleiche Sonne – ohnehin kaum sichtbar hinter einem dichten Wolkenschleier – verschwand nun endgültig hinter den Bäumen. Irgendwo in den dunklen Wäldern markierte das Heulen eines Wolfs die hereinbrechende Finsternis.
Schon ein paar Minuten später sahen die beiden Wanderer vor sich auf einer kleinen Lichtung eine Hütte, aus deren Fenstern ein schwaches Licht schien, das Wärme und Trost versprach. Die fallenden Schneeflocken erschienen grau in der Dämmerung. Nur dort, wo sie vor den erleuchteten Fenstern niederfielen, leuchteten sie noch einmal hell auf, bevor sie zu Boden sanken.
Die Hütte schien solide gebaut zu sein und war größer, als Sergej sie sich im ersten Moment vorgestellt hatte. Das Dach war mit Schindeln gedeckt und aus dem gemauerten Kamin stieg Rauch auf. Heschel trat auf die Veranda, nahm seine Mütze ab und schüttelte den Schnee von seinen Stiefeln. Sergej machte es ihm nach. Dann klopfte Heschel fest gegen die eichene Tür, die kurz drauf geöffnet wurde.
Nach einer herzlichen Begrüßung und nachdem sich die beiden gewaschen hatten, setzte sich Sergej zu der ersten richtigen Familie, an die er sich erinnern konnte, an den Tisch. Sara, die Mutter, eine zarte braunhaarige Frau, deren Haar fast völlig von einem weißen Kopftuch bedeckt wurde, das sie unter dem Kinn fest verknotet hatte, stellte das Essen auf den Tisch. Die beiden Kinder warfen Sergej neugierige Blicke zu, die er ebenso neugierig erwiderte. Awrom, ein hoch aufgeschossener Zwölfjähriger, schien zurückhaltend, aber ansonsten freundlich zu sein. Leja, eine hübsche Fünfjährige mit einem Schopf kupferroten Haares sah ihn schüchtern an.
Sergejs Augen konnten sich nicht an dem wohlgeordneten Haushalt sattsehen. Seine eigenen Kleider schienen ihm schlicht – um nicht zu sagen, schäbig – verglichen mit den glänzenden Hosen Awroms und dem schwarzen Kleid und dem weißen Kopftuch von Leja.
Der Vater, Benjamin Abramowitsch, erklärte ihm: »Am Sabbat werfen wir alle Sorgen des Alltags ab und widmen uns ausschließlich der Literatur, der Poesie und der Musik. Dieser Tag soll uns daran erinnern, dass wir keine Sklaven der Arbeit sind. Am Sabbat sind wir frei von weltlichen Dingen.«
Sara zündete zwei Kerzen an und sprach den Tischsegen. Nachdem Benjamin den Wein mit einem Gebet gesegnet hatte, bat er Heschel das geflochtene Brot, das sie Challa nannten, ebenfalls mit einem Gebet zu segnen. Sara erklärte Sergej, was alles an Essbarem auf dem Tisch stand. Da waren eine dicke Gerstensuppe, klein geschnittene Eier, Rote-Bete-Salat, Kräcker, verschiedene Gemüse aus dem eigenen Garten, Kartoffelpfannkuchen, Apfelreis und zum Nachtisch ein mit Äpfeln gefüllter Honigkuchen.
Während sie aßen, erklärte Sara mit einem Schulterzucken: »Ich wollte bei diesem Wetter eigentlich noch eine Hühnersuppe machen, aber das Huhn wollte nicht.«
Das ist also eine Mutter, dachte Sergej, während er Sara verstohlen ansah. Er beneidete die beiden Kinder, dass sie ihre Mutter jeden Tag um sich hatten.
Es war das beste Essen, an das er sich erinnern konnte. Es wurde viel gelacht und über alles Mögliche geplaudert. Der Abend war von einer ganz besonderen Atmosphäre erfüllt, was nicht nur an den vielen Kerzen und dem Glühen des Herdfeuers lag. Zum ersten Mal war Sergej Mitglied einer richtigen Familie. Diesen Abend würde er nicht so schnell vergessen.
Der nächste Tag verging wie im Flug. Awrom brachte Sergej bei, wie man Dame spielt. Während sie spielten, fiel Sergej eine Narbe auf, die direkt über dem rechten Auge auf Awroms Stirn zu sehen war. Awrom bemerkte, dass Sergej die Narbe anstarrte und erklärte: »Ich bin auf einen Baum geklettert und heruntergefallen. Ich glaube, das da habe ich einem Ast zu verdanken.« Mit diesen Worten zeigte er auf den roten Strich auf seiner Stirn. »Mutter hat gesagt, ich hätte beinahe mein Auge verloren. Und jetzt darf ich nicht mehr so hoch klettern«, fügte er bedauernd hinzu.
Da es am Nachmittag aufklarte, machte die ganze Familie einen Spaziergang durch den Wald. Benjamin zeigte auf die Bäume, deren Holz er für Heschels Geigen und Uhren verwendete.
Nachdem sie ins Haus zurückgekehrt waren, schlief Heschel mitten im Satz ein. Als er später erwachte, war er mürrisch, weil er nicht wusste, wo er war. Sara brachte ihm eine Tasse dampfenden Tee und überließ ihn sich selbst. Er würde schon zurechtkommen.
Am Abend, nachdem die ersten drei Sterne aufgegangen waren, endete der Sabbat mit weiteren Gebeten, die über dem Wein und den Kerzen gesprochen wurden. Nachdem Benjamin das neue Feuer im Herd entzündet hatte, nahm Heschel seinen Rucksack hervor und holte seine Geschenke heraus: Gewürze und Kerzen für die Erwachsenen und Süßigkeiten für die Kinder. Anschließend drückte Benjamin Heschel eine Geige in die Hand, die dieser selbst gebaut hatte und Heschel begann zu spielen.
Sergej starrte seinen Großvater mit offenem Mund an. Es kam ihm vor, als wäre sein Großvater jetzt erst richtig zum Leben erwacht. Er war nicht länger ein einfacher Sterblicher, sondern der Schöpfer großer Musik, der sein Instrument zum Leben erweckte. Einen Augenblick lang erzählte die Geige von menschlicher Trauer, im nächsten Moment aber sang sie von himmlischen Freuden. Leja tanzte und drehte sich, während Awrom und Sergej sie mit Händeklatschen anfeuerten.
Als sein Großvater das Instrument schließlich niederlegte, war die ganze Hütte von Musik und Licht erfüllt. Dann entschuldigte sich Heschel mit einem Gähnen und zog sich zurück. Sergej legte sich mit den beiden anderen Kindern vor dem Herd zum Schlafen nieder. Zum zweiten Mal schlief er im Schoß einer Familie und träumte von Musik.
Am Sonntagmorgen verabschiedeten sie sich von ihren Gastgebern. Sergej nahm noch einmal alles in sich auf, um es sich unauslöschlich einzuprägen, damit ihn die Erinnerung später in der Schule am Leben erhalten würde. Er prägte sich Saras Gesicht und Stimme genau ein und Benjamins Lachen, Awroms Gesicht, das in einem Buch vergraben war, Leja, die am Feuer saß und ihrer Mutter dabei half, einen kleinen Strauß Winterblumen zu binden. Ob er wohl auch eines Tages ein Ehemann wie Benjamin Abramowitsch sein und eine Frau wie Sara und zwei eigene Kinder haben würde?
Bevor sie gingen, kniete Sara nieder und umarmte Sergej. Auch die kleine Leja umarmte ihn. Awrom und sein Vater schüttelten ihm die Hand. »Du bist hier jederzeit willkommen«, sagte Benjamin. »Ich sehe dich hoffentlich bald wieder«, sagte sein Sohn.
Heschel zog seinen dicken Wollmantel an und warf sich den Rucksack über die Schulter. Sergej tat es ihm gleich. Als er in das Gesicht seines Großvaters sah, wurde ihm auf einmal bewusst, dass auch dieser nach der langen Zeit in seiner leeren Wohnung Trost bei dieser Familie gefunden hatte. Sie winkten noch einmal, dann wanderten sie den Weg in den Wald entlang.
Das Körperliche vergisst man nur zu leicht. Man kann stunden- oder tagelang frieren, aber schon nach ein paar Minuten an einem warmen Feuer, erscheint die Kälte völlig unwirklich. Wie anders sind doch die Gefühle, die in der Erinnerung unauslöschliche Spuren hinterlassen. In den schweren Jahren, die auf diesen Tag folgen sollten, halfen die Erinnerungen an diese Familie, an das lodernde Feuer im Herd, an den köstlichen Geruch von frisch gebackenem Brot und an Awrom und Leja, Sergej alle Schwierigkeiten zu überstehen.
In den Messen, die Vater Georgi in der Kapelle der Anstalt abgehalten hatte, wurde oft von Himmel und Hölle gesprochen. Sergej hatte sich unter dem Himmel nie etwas vorstellen können, bis er diese zwei Tage mit seinem Großvater in der Hütte im Wald verbracht hatte.
Heschel und Sergej gingen in vollkommener Stille, die nur durch das gelegentliche Brechen eines weiß bedeckten Astes, dem Rauschen des Windes und dem Knirschen des Schnees unter ihren Füßen unterbrochen wurde, den Berg hinunter. Worte würden die Erinnerungen und Gefühle nur stören, die jeder für sich noch einmal durchlebte. Außerdem mussten sie sich auf jeden Schritt konzentrieren, denn der Abstieg war gefährlicher als der Aufstieg. Einmal rutsche Sergej aus und griff hilfesuchend nach der Hand seines Großvaters. Die Berührung spendete beiden Trost: Sie waren zwar allein, aber zumindest hatten sie einander.
Plötzlich sagte Heschel: »Du bist ein guter Junge, Socrates.«
»Und du bist ein guter Opa«, antwortete Sergej und als er den alten Mann lächeln sah, war er froh, dass er es gewagt hatte, dies zu sagen.
Dann kam die Anstalt in Sicht. Sergej sah seinen Großvater an und mit einem Mal wirkte dessen Gesicht erschöpft und müde und älter als je zuvor. Sergej ahnte, dass eine lange Reise vor seinem Großvater lag, an deren Ende eine leere Wohnung auf ihn warten würde, die nur von Erinnerungen bewohnt wurde. Er wollte mit seinem Großvater nach Sankt Petersburg gehen, aber er brachte nicht den Mut auf, dies auch zu sagen. Es war der Wille seines Vaters gewesen, dass er in einer Kadettenanstalt aufwachsen sollte. Und so sehr er es sich auch wünschte, man würde ihm nie erlauben, diese zu verlassen.
Dann waren sie am Haupttor angekommen. Sie standen lange da, während die Herbstsonne ihre Bahn zog. Schließlich ergriff Heschel das Wort: »Mein kleiner Socrates, ganz gleich, was die Jahre auch bringen mögen, denke immer daran, dass du nicht allein bist. Selbst in den schwersten Zeiten wirst du nicht allein sein. Die Seelen deiner Eltern und die deiner Großmutter Esther und deines Großvaters Heschel werden immer bei dir sein.«
Sergej starrte stumm auf seine Füße, während ihm allmählich die volle Bedeutung dieses Abschieds klar wurde. Ihn fror, als er plötzlich begriff, dass er seinen Großvater wahrscheinlich niemals mehr wiedersehen würde. Heschel beugte sich herab und strich Mantel und Bluse seines Enkels glatt. Dann zog er ihn an sich.
Sergej fürchtete schon, dass sich sein Großvater nun umdrehen und ihn verlassen würde, aber stattdessen lächelte der alte Mann und sagte: »Ich habe etwas für dich. Ein Geschenk von deinen Eltern.« Er griff in seine Manteltasche und nahm ein silbernes Kettchen heraus, an dem ein ovales Medaillon hing. Der Junge kniff die Augen zusammen, als ein Sonnenstrahl von der glatt polierten Oberfläche reflektiert wurde.
»Die Hebamme gab es mir, als sie dich zu uns brachte«, erklärte Heschel. »Dieses Medaillon hat deiner Mutter gehört. Es war ein Geschenk von deinem Vater. Die Hebamme sagte, dass du es haben solltest, wenn du alt genug wärst. Und jetzt bist du wohl alt genug.«
Damit drückte er die Kette und das Medaillon in Sergejs Hand. Sergej erschauerte: Dieses Medaillon hatte seine Mutter um den Hals getragen. Und nun gehörte es ihm.
»Mach es auf.«
Sergej starrte seinen Großvater verständnislos an.
»Gib her, ich zeig dir, wie man es macht.« Heschel öffnete den Verschluss und Sergej erblickte eine kleine Fotografie, auf der er zwei Menschen sah: eine Frau mit dunklem, gelocktem Haar und schneeweißer Haut und einen Mann mit hohen Wangenknochen, intensivem Blick und dunklem Bart.
»Sind das … Sind das meine Eltern?«
Sein Großvater nickte. »Ich glaube, es war ihr wertvollster Besitz und nun gehört es dir. Ich weiß, du wirst es immer in Ehren halten.«
»Das werde ich, Opa«, murmelte Sergej, der seinen Blick nicht von den Gesichtern seiner Eltern wenden konnte.
»Und nun hör mir gut zu, Socrates! Da ist noch etwas, das ich aber nicht mitbringen konnte. Es ist auch ein Geschenk für dich und es ist auf einer Wiese in der Nähe von Sankt Petersburg vergraben.«
Er griff wieder in seine Manteltasche und zog ein Blatt Papier hervor. Er strich es glatt, damit der Junge die Zeichnung sehen konnte. Auf dem Blatt war eine Karte, auf der neben einem Baum auf einer Wiese ein Kreuz markiert war. Die Wiese war auf drei Seiten von Wald umgeben und lag in der Nähe eines Flusses. Zudem waren auf der Karte noch andere Markierungen zu sehen.
»Erinnerst du dich an die Geschichte, die ich dir auf dem Weg zur Hütte erzählt habe? Die über meinen Lieblingsplatz im Wald nahe dem Fluss Newa, wo ich das Schwimmen gelernt habe? Hier ist er, etwas nördlich von Sankt Petersburg«, sagte er weiter und zeigte auf die Karte. »Und das ist die Stadt, hier sind die Docks und dort der Winterpalast. Wenn du dem Fluss zehn Kilometer weit nach Norden folgst, am Palast vorbei, aus der Stadt heraus und in den Wald, dann wirst du zu einer Lichtung kommen.«
Er drehte das Blatt um. Auf der Rückseite war eine detailliertere Zeichnung des Ufers und des Waldes. Heschel zeigte auf einen Baum und ein Kreuz. »Hier ist die Kiste vergraben, neben einem Baum direkt gegenüber vom Fluss. Du erkennst den Baum leicht. Es ist eine alleinstehende Zeder mitten auf einer Wiese. Der Baum wurde von meinem Großvater gepflanzt, als er noch ein Junge war. Zwischen zwei Wurzeln wirst du die Kiste finden.«
Heschel faltete das Blatt wieder zusammen und gab es Sergej. »Karten kann man verlieren oder sie können einem gestohlen werden, Socrates. Ich möchte, dass du sie dir genau einprägst. Dann zerstöre sie. Wirst du das tun?«
»Ja, Opa.«
Sie gingen auf das Tor zu. »Denk an das Geschenk, das auf dich wartet. Wenn du es findest, denke daran, wie sehr wir dich lieben.«
»Ich werde daran denken.«
Heschel sah zum Himmel und atmete tief ein, so wie er es tat, wenn er eine Geige oder eine Uhr fertiggestellt hatte und mit seinem Werk zufrieden war. »Es ist gut«, sagte er. »Es ist gut.« Dann senkte er den Blick. »Ich möchte, dass du weißt, mein lieber Socrates, dass es eine der größten Freuden meines ganzen Lebens war, diesen Sabbat mit dir zu feiern.«
4
Nachdem er die Karte weggesteckt hatte, ging Sergej durch das Tor. Der wachhabende Kadett rief ihm zu: »Beeil dich, du kommst zu spät zum Gottesdienst.«
Sergej rannte durch die leeren Flure bis zu seiner Stube und warf den Rucksack in seinen Spind. Als er gerade gehen wollte, bemerkte er auf der Pritsche neben seiner, die vor einigen Wochen frei geworden war, einen Militärsack. Vermutlich gehörte er einem Neuankömmling.
Sergej steckte das Medaillon und die Karte in ein Loch in seiner Matratze, an den sichersten Ort, den er in der Eile finden konnte. Dann rannte er den Flur hinunter zur Kapelle. Als er an seinen Großvater dachte, der mit krummem Rücken langsam die Straße entlangwanderte, verlangsamte sich sein Schritt automatisch.
An der Tür angekommen, schlug er das Kreuz und bat Gott, seinen Großvater zu beschützen und ihm Kraft für seine Reise zu geben. Es war das erste Mal, dass er wirklich mit ganzem Herzen betete – so wie es Vater Georgi ihnen immer gesagt hatte. Vorher hatte er noch nie Grund dafür gehabt. Sergej hoffte, dass Gott sein Gebet erhören würde, obwohl Opa Heschel Jude war.
Als Sergej eilig den Mittelgang der Kapelle zu seinem Platz hinunterging, warfen ihm einige der Jungen Blicke zu: einige freundliche, weil sie sich freuten, ihn zu sehen, andere hämische, weil sie hofften, dass er für sein verspätetes Kommen bestraft werden würde. Sergej sah zu Vater Georgi auf, der in seiner schwarzen Robe vor dem erhöhten Altar mit den Ikonen von Christus, Maria mit dem Kind, dem Heiligen Michael, dem Heiligen Gabriel und dem Heiligen Georg, dem Schutzpatron ihrer Anstalt und Mütterchen Russlands, stand. Die Sonnenstrahlen, die durch die farbigen Butzenglasscheiben fielen, zauberten einen Regenbogen mitten in die Kapelle.
Gerade hatten die Jungen begonnen, eine Hymne zu singen. Sergej fand seinen Platz und begann ebenfalls zu singen, aber seine Gedanken schweiften immer wieder ab. Sowohl Vater Georgi als auch sein Großvater Heschel hatten von einem Gott gesprochen, den er nicht sehen konnte. Für Sergej war Gott eine Hütte im Wald und der Himmel bestand in einer mütterlichen Umarmung.
»Opa«, hatte er auf dem Rückweg zur Anstalt gefragt, »wie kommt man nach Ansicht der Juden in den Himmel?«
Heschel hatte gelächelt und geantwortet: »Ich kann nicht für alle Juden sprechen und ich bin auch nicht weise genug, um die Antwort zu kennen, kleiner Socrates, aber ich bin überzeugt, dass du deinen eigenen Weg finden wirst.«
Als der Gottesdienst vorbei war, schreckte Sergej aus seinen Gedanken auf und gliederte sich in die Reihe ein, in der die Kadetten aus der Kapelle hinausgingen. Dabei begegnete er auch dem Neuankömmling – groß, ernst, drei oder vier Jahre älter – zum ersten Mal. Sie gingen zufällig nebeneinander, als sie dem Ausgang zustrebten. Da immer nur eine Person durch die Tür gehen konnte, wollte Sergej beiseite treten und dem neuen Jungen höflich den Vortritt lassen, als dieser ihn einfach so brutal zur Seite drängte, dass Sergej fast zu Boden gestürzt wäre. Die Art dieser ersten Begegnung sollte bestimmend für ihre ganze kommende Beziehung sein.
Es stellte sich heraus, dass der Militärsack auf der Pritsche zwischen denen von Andrej und Sergej einem gewissen Dimitri Sakoljew gehörte. Von diesem Tag an lernte Sergej diesen Namen fürchten und verachten.
Es ging das Gerücht um, dass ein Mann Sakoljew am Haupttor abgeliefert, dem Wachposten einen Umschlag in die Hand gedrückt und nur gesagt habe: »Dies sollte als Bezahlung ausreichen.« Ohne ein weiteres Wort hatte sich der Mann umgedreht und war gegangen.
Da er bereits zwölf war, hätte Sakoljew eigentlich im oberen Stock bei den Elf- bis Vierzehnjährigen schlafen sollen. Aber dort war es aufgrund von Lausbefall der Matratzen zu einer vorübergehenden Bettenknappheit gekommen. Daher musste der neue Kadett die erste Woche im »Kinderzimmer« verbringen, wie er es nannte. Er ließ seine Wut darüber an allen aus, die ihm über den Weg liefen – besonders an Andrej und Sergej, da deren Pritschen seiner am nächsten waren.
Im Verlauf der nächsten Wochen erkämpfte sich Sakoljew seinen Platz in der Kadettenhierarchie und verdiente sich den – nur widerwillig gewährten – Respekt seiner Altersgenossen. Es war aber die Art von Respekt, die man auch einem wilden Tier entgegenbringen würde.